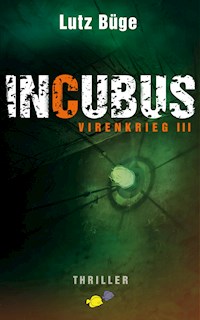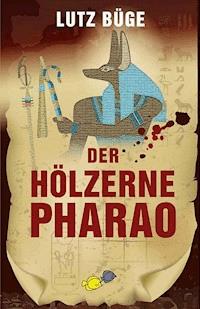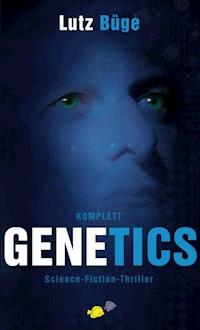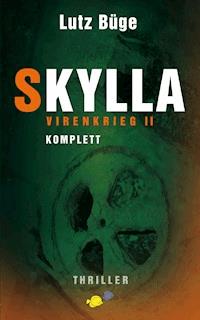
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ybersinn-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"'Gewalt erzeugt Gegengewalt. Wenn Sie diesen Teufelskreis durchbrechen wollen, müssen Sie anfangen zu reden. Wenn Sie nicht reden wollen, dann wollen Sie diesen Teufelskreis nicht durchbrechen. Dann stellt sich die Frage: Was haben Sie davon, dass der Teufelskreis funktioniert?'Justin hatte die Talkshow lange genug verfolgt. Er trank seinen Tee aus und ging wieder nach draußen. Die Queen Mary 2 leuchtete strahlendweiß und unerreichbar im Sonnenlicht. Dort waren seine Söhne. Justin durfte kaum daran denken. Düstere Ahnungen beschlichen ihn. Schlimme Dinge würden geschehen.""Virenkrieg" geht weiter: In "Skylla", dem zweiten Teil des Epos', ringt der Genetiker Jan Metzner in Al-Isrā, dem Stützpunkt der Islamischen Allianz, mit dem Tod. Er hat sich mit der Biowaffe Skylla infiziert. Derweil stellen Terroristen die Geduld der Welt auf die Probe: Sie drohen, Manhattan mit Milzbrand-Bakterien zu verseuchen, und fordern die Versenkung von US-Flugzeugträgern. Die Regierung scheint außerstande, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Und in Seattle sieht sich Detective Hillary Landsdale nach dem mysteriösen Tod des Nobelpreisträgers Samuel McWeir mit dem rätselhaftesten Fall ihrer Karriere konfrontiert, der sie nahe an die Machenschaften einer gefährlichen Geheimorganisation führt, zu nahe ...Wir schreiben das Jahr 2024. Die Welt steht am Scheideweg. Beinahe ein Vierteljahrhundert des "War on Terror" liegt hinter ihr. Die USA haben Al-Qaida und den "Islamischen Staat" niedergerungen und sind darüber zum Überwachungsstaat geworden. Die Sehnsucht nach Frieden hätte eine reale Chance, denn auch die islamische Welt ist kriegsmüde, und erstmals seit Jahrzehnten erhebt in den USA ein Präsidentschaftskandidat seine Stimme für den Frieden. 2024 ist Wahljahr. Doch die Feinde des Friedens sind mächtig, und sie verfügen über furchtbare Waffen, etwa über das tückische Virus Skylla …"Skylla" ist Teil 2 des monumentalen "Virenkrieg"-Epos von Lutz Büge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 794
Ähnliche
Skylla
Virenkrieg II
Thriller
Lutz Büge
www.ybersinn.de/news
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel: Geheimnisträger
2. Kapitel: Free Mind
3. Kapitel: Enduring Freedom
4. Kapitel: Seuchenalarm
5. Kapitel: In der Schwebe
6. Kapitel: Zeitenwende
7. Kapitel: Restalkohol
8. Kapitel: Wer fängt an aufzuhören?
9. Kapitel: Meisterstück
10. Kapitel: Westliche Werte
Epilog
Projekt Free Mind – Phase 1
Ziel:
Verbreitung eines Bedrohungsszenarios und Schüren von Ängsten in der Bevölkerung, um die Impfbereitschaft der Zielgruppe zu fördern
Operationsplan:
Stufe 1: Freisetzung von Pockenviren in Frankreich getarnt als islamistischer Anschlag (Umsetzung durch Spezialisten der External Affairs Division)
Stufe 2: Anstoßen einer Debatte in den USA über Biowaffen mit dem Ziel herauszustellen, dass es keinen Schutz vor Biowaffen gibt; Förderung des Angstszenarios auf den üblichen Wegen, z.B. Blogs, Talkshows, Think Tanks (Steuerung: Kommunikationsabteilung von SCOUT)
Stufe 3: Information an die Zielgruppe: Impfstoff Safe Harbour bietet Schutz vor Biowaffen (Steuerung: Internal Affairs Division; die Kollegen haben eine Liste mit rund 25.000 Namen von Personen erstellt, die geimpft werden sollen)
Übergang zu Projekt Free Mind – Phase 2
Auszug aus den SCOUT-Protokollen, April 2017
Prolog
12. Juni 2024
Amman, Jordanien
Aziz ließ sich mit dem Menschenstrom durch den Basar treiben, obwohl er eigentlich keine Zeit zu verlieren hatte. Er war bereits verspätet, und sein Kontaktmann mochte es nicht, wenn man ihn warten ließ. Doch es trieb Aziz wenig zu diesem Treffen. „Sofort!“, „Jetzt gleich!“, „Am besten gestern!“ Die amerikanische Hast und Wichtigkeit ging Aziz auf die Nerven. Er fühlte sich unter Druck gesetzt. Sogar zu Hause hatte er sich schon dabei erwischt, dass er sich fragte, ob er gerade überwacht wurde. Das ging allmählich zu weit. So hatte er sich das alles nicht vorgestellt. Im Palast gingen Gerüchte um, dass der Sicherheitsdienst verstärkt worden sei. Aziz musste vorsichtig sein. Daher hielt er lieber einmal mehr an Ständen des Basars an, um sich unauffällig nach Verfolgern umzusehen.
Allerdings hatte der Sicherheitsdienst all die Jahre nichts davon gemerkt, dass Aziz CIA-Informant war. Obwohl Aziz einer von drei Leibköchen des Königs war, hatte er nur selten persönlichen Kontakt zu Abdallah, der seit dem Attentatsversuch von 2019 sorgfältig abgeschottet wurde. Entsprechend dürftig waren die Informationen, die Aziz seinem Kontaktmann bisher geliefert hatte. Abdallahs Lieblingsgerichte, Abdallahs Schonkost, die Allüren seiner verzogenen Söhne, hin und wieder auch die eine oder andere Intrige am Hof – Aziz konnte sich nicht vorstellen, dass diese Informationen für die Amerikaner irgendeinen Wert hatten. Trotzdem zahlte die Agency. Geld, das er zu schätzen wusste. Das Leben war hart in Jordanien, wenn man eine kranke Mutter hatte. Mit dem Honorar konnte Aziz die nötige Behandlung bezahlen.
Hier und da schnappte er Gesprächsfetzen auf, während er durch den Basar schlenderte. Im Westen war es üblich, Meinungsumfragen zu machen, wenn Herrscher wissen wollten, was das Volk dachte. Das hatte Aziz zumindest gehört. In Jordanien ging man in den Basar. Hier wanderten nicht nur Waren und Geldscheine über die Tische der Händler, sondern auch Nachrichten und Meinungen. Aziz lauschte aufmerksam. Natürlich redeten die Händler über die Entführung der Queen Mary 2. Das Kreuzfahrtschiff fuhr zurzeit mit 4000 Menschen an Bord Richtung Bermuda. Die Händler befürchteten, dass es Militärschläge der Amerikaner geben könnte. Terrorismus war nie gut für die Geschäfte. Niemand hier war auf der Seite der Terroristen. Zugleich war die Spannung groß: Was hatten die Entführer vor?
Das wichtigste Thema im Basar war jedoch die Konferenz von Amman, der Hohe Rat des Islam, die Schura, die gestern erste Ergebnisse ihrer Beratungen bekanntgegeben hatte – fast zur selben Zeit, als die Queen Mary 2 entführt worden war. Den Kaufleuten schien zu gefallen, was der König und seine geistlichen Berater verkündet hatten. Aziz hatte sich darüber noch kein Urteil gebildet. Einerseits empfand er Unbehagen bei dem Gedanken, dass ihm jemand sagte, wie er den Koran zu verstehen habe. Aziz machte sich lieber selbst ein Bild. Andererseits war der Islam für ihn eine Religion des Friedens. Das manifestierte sich schon in den ersten Worten des Koran, die eine Art Präambel waren:
„Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.“
Seit er lesen konnte, las er jeden Abend im Koran. Da gab es viele Verse, die mit Barmherzigkeit und Gnade wenig zu tun hatten. Aus anderen jedoch floss die reine Liebe. Diese Widersprüchlichkeit beschäftigte ihn. Natürlich ging er zum Freitagsgebet und hörte sich die Predigten an, aber häufig schien ihm zu eindeutig, was unter Berufung auf diesen oder jenen Vers des Koran gefolgert wurde. Manche Imame schienen ihm überdies zu sehr darauf aus, sich selbst zu profilieren. Aziz hätte gern mehr darüber erfahren, wie diese Widersprüche zu erklären waren. Insofern war die Schura vermutlich eine gute Idee. Doch Aziz hielt den Mund. Man musste vorsichtig sein mit der eigenen Meinung in Jordanien.
Nun war Aziz sicher, dass er nicht verfolgt wurde. Er steuerte den Treffpunkt an, eine Viertelstunde zu spät. Der Amerikaner machte sich nicht die Mühe, seine Ungeduld zu verbergen. Er wartete im Laden eines Teppichhändlers, verborgen hinter enormen Ballen von Teppichen, und war von der Frau des Händlers mit Tee versorgt worden. Sie verharrte im Hintergrund in einer Nische, während der Inhaber des Ladens einigen britischen Touristen, wie es schien, Teppiche anzudienen versuchte.
Wie immer, wenn sie sich trafen, konnte Aziz kaum seine Blicke vom blonden Haar des Agenten abwenden. Er selbst war einen Kopf kleiner und hatte die drahtigen, schwarzen Haare der Haschimiten, die sich bei ihm sofort zu kräuseln begannen, wenn sie länger als zwei Millimeter wurden. Aziz hasste sein Haar. Dagegen dieser Fluss heller Haare …
Trotzdem wollte Aziz nicht in der Haut dieses Mannes stecken. Das auffällige Muttermal am Nasenflügel entstellte ihn, fand Aziz.
„Na endlich“, knurrte Scott McGrewgious. „Ist dir jemand gefolgt?“
„Nein.“
„Die Antwort war richtig“, gab Scott grinsend zurück. „Hier ist dein Umschlag.“
Aziz rührte ihn nicht an. Er war dicker als sonst. Mehr Geld bedeutete, dass sie etwas von ihm wollten, was über das Übliche hinausging. Mehr Geld würde Aziz natürlich gefallen – aber was erwartete der Amerikaner dafür von ihm?
„Wann hast du Abdallah gesehen?“, fragte der Agent.
„Du weißt, ich sehe ihn nicht oft“, antwortete Aziz. „Es ist ein halbes Jahr her. Er kam …“
McGrewgious winkte ab.
„Alte Geschichte. Bekannt. Was führt er mit seiner Initiative im Schilde?“
„Welcher Initiative?“
„Mit diesem islamischen Rat, dieser …“
„… Schura“, vollendete Aziz den Satz und musterte McGrewgious offen missbilligend. Er mochte es nicht, wenn sich jemand abfällig über den Islam äußerte. Der Tonfall des Agenten ließ keinen Zweifel daran, dass er die Schura für Unsinn hielt. Wie die meisten Westler, die nichts verstanden.
„Schura.“ McGrewgious nickte. „Danke. Das Wort war mir entfallen. Also, was will er damit?“
„Das ist doch offensichtlich“, murrte Aziz. Er hatte keine Lust, das Offensichtliche zu erklären.
„Also?“
„Er will den Islam reformieren.“
„Ist das alles? Nur das?“
„Nur das?“, echote Aziz. „Das ist ein Mammutwerk! Den Islam kann man nicht einfach updaten wie das Betriebssystem eines Computers, denn er wurde offenbart.“
„Musst nicht gleich beleidigt sein“, sagte McGrewgious und grinste.
„Warum bin ich hier?“, fragte Aziz und versuchte, nicht eingeschnappt zu klingen. Er wollte sich vor diesem arroganten Mistkerl keine Blöße geben.
„Warum macht Abdallah das?“, fragte der Agent, ohne auf die Frage einzugehen. „Warum will er den Islam reformieren?“
„Er will dem Terror ein Ende machen. Du solltest dir vielleicht einfach mal die Rede anhören, die er am Schluss der Pressekonferenz gehalten hat. Es war eine gute Rede. Abdallah ist ein weiser Mann.“
„Du meinst, das ist wirklich sein wahres Ziel?“, fragte McGrewgious.
Aziz zuckte mit den Schultern.
„Ich wüsste kein anderes.“
„Ihr Muslime glaubt offenbar wirklich alles, was man euch erzählt.“ Der Agent schüttelte den Kopf. „Hat tatsächlich keiner von euch eine Idee, was Abdallah wirklich vorhaben könnte?“
Aziz wurde wütend. Das Ressentiment tropfte aus jedem der Worte des Agenten. Muslime waren hinterhältig, das wusste die ganze Welt. Eine edle Initiative wie die Schura konnte daher nur den Zweck haben, eine andere, mit Sicherheit weit weniger edle Initiative zu verschleiern. Was sonst? Aziz hatte größte Lust, das Arrangement zu beenden, aber er musste an seine Mutter denken, der er dann nicht mehr die guten Schmerzmittel würden kaufen können.
McGrewgious klopfte mit der Fingerspitze auf den Umschlag.
„Mich interessiert, was in den letzten Tagen im Palast vorgegangen ist“, sagte er.
Aziz berichtete – und diesmal gab es wirklich etwas zu berichten, denn die Schura hatte im Palast getagt, und so hatte Aziz nicht nur viel Arbeit gehabt, um für alle zu kochen, sondern er hatte auch eine Menge aufgeschnappt. Der Palast hatte geschwirrt wie ein Bienenkorb. Gestern zum Beispiel war ein General namens Bassam al-Faris beim König gewesen.
„Bassam al-Faris?”, wiederholte Scott. „Es gibt in der jordanischen Armee keinen General dieses Namens.“
„Er war von der Islamischen Allianz.“
„Was für ein General war das?“
„Ich habe ihn nicht selbst gesehen.“
„Aber der Name ist sicher?“
„Ja.“
„Weitere Neuigkeiten?“
Aziz konnte kaum glauben, dass der Amerikaner noch nichts vom Besuch des Generals gehört hatte.
„Der König ist nach seiner Ansprache zu einer Reise aufgebrochen. Es hieß, er wolle mit seinen Söhnen zelten, auf die Art der Beduinen, im Wadi Rum, um Ruhe zu finden.“
„Zelten? Bei dieser Hitze?“ McGrewgious schüttelte den Kopf. „Wann ist er abgereist?“
„Gestern Nachmittag. Wir waren schon bei den Vorbereitungen für das Abendessen.“
„Klingt nach einer ziemlich spontanen Aktion. Hat es Alarm gegeben?“
„Nein.“
„Und dieser General Al-Faris – wann genau war der beim König?“
„Davor. Die genaue Uhrzeit weiß ich nicht.“
„Hat jemand den König gesehen, nachdem der General bei ihm war?“
„Vom Küchenpersonal keiner.“
Nun schienen dem Agenten die Fragen auszugehen. Er wirkte besorgt, während er das Gehörte überdachte. Dann nickte er und sagte:
„Okay. Die Sache ist rätselhaft, aber sie ist, wie sie ist. Hier ist dein Auftrag.“
Er griff in die Brusttasche seines Polo-Shirts, holte ein unscheinbares, verschlossenes Plastikröhrchen hervor und legte es auf den Umschlag.
„Das ist für den König“, sagte er. „Du musst dieses Pulver im Palast verteilen, so dass Abdallah damit in Berührung kommt. Ein bisschen auf das Besteck, mit dem er isst, auf die Armlehnen, auf die er sich stützt, oder auf den Rand des Deckels seiner privaten Toilette, auf die Tasten seines Computers … Dir wird schon etwas einfallen. Wichtig ist, dass der König mit den Fingern in Kontakt mit dem Pulver kommt. Das leere Röhrchen verschluckst du. Es wird sich in deinem Darm auflösen.“
„Was ist da drin?“
„Das interessiert dich nicht.“
„Ein Attentat also?“, fragte Aziz ungläubig. „Das mich selbst gleich mit erledigt?“
„Nein, dir geschieht nichts. Mein Wort drauf!“
Aziz gab sich keinen Illusionen darüber hin, was das Wort des Agenten wert war.
„Aber ich soll das Röhrchen runterschlucken“, beharrte er. „Es wird noch Gift darin sein.“
„Es ist kein Gift, und es kann und wird dir nichts anhaben. Es wirkt nur beim König, bei niemandem sonst.“ Scott klopfte wieder mit dem Finger auf den Umschlag. „Diese 5000 Dollar sind eine Vorauszahlung. Wenn du es durchgezogen hast, gibt es noch einmal 50.000 Dollar. Was sagst du dazu? Eine hübsche Summe, oder?“
Aziz zögerte einen Moment.
„Warum ausgerechnet ich?“, fragte er.
„Weil du dicht genug an Abdallah dran bist.“
Aziz nahm den Umschlag und das Röhrchen und steckte alles ein. Was er heute abgeliefert hatte, mochte 5000 Dollar wert sein. 50.000 weitere Dollar – darüber musste er nachdenken.
„Solltest Du in Erwägung ziehen, den Auftrag nicht auszuführen …“, sagte McGrewgious, erhob sich und verließ das Teppichgeschäft, ohne seinen Satz zu beenden.
Aziz verstand die Drohung trotzdem. Es wäre ein Leichtes für McGrewgious, ihn zu erledigen. Eine kurze Information an den Sicherheitsdienst des Königs genügte.
Aziz saß in der Falle.
Skylla
Virenkrieg II
Thriller
Lutz Büge
www.ybersinn.de/news
1. Kapitel
Geheimnisträger
15. Juni 2024
Al-Isrā, Stützpunkt der Islamischen Allianz
Jan erwachte, als er ins Gesicht geschlagen wurde. Er blinzelte ins Licht und erblickte sich selbst, doch durch seine Augen hindurch schien ihn ein weiteres Augenpaar zu beobachten. Es dauerte lange Momente, bis er begriff, dass er das gewölbte, leicht spiegelnde Helmvisier eines Schutzanzuges vor sich hatte.
Sein Blick suchte an dem Helm vorbei die Uhr über der Zimmertür.
Erst zwei Stunden.
Er seufzte. Für einen Moment hatte er gehofft, es schon hinter sich zu haben, aber sein Martyrium hatte erst begonnen. Er fühlte sich sogar ein wenig erfrischt, wie nach erholsamem Schlaf.
„Ich will schlafen“, brummte er und schloss die Augen wieder, doch der Helmträger schlug ihn erneut, und aus den Außenlautsprechern des Schutzanzugs schnarrte eine Stimme:
„Wachgeblieben!“
Maria Francesca.
Sie trug einen der luftdicht schließenden Schutzanzüge für die Arbeit im Kern des Hochsicherheitslabors. Hinter Maria Francesca konnte Jan die von der Decke baumelnden Schläuche sehen, die ihren Anzug mit dem separaten, von der Luft im Labor strikt getrennten Belüftungssystem verbanden.
Jan trug keinen Anzug, sondern lag in T-Shirt und Boxershorts auf der Pritsche, auf der er vor zwei Stunden eingeschlafen war, doch ihm war alles andere als kalt. Maria Francesca wollte mit ihren behandschuhten Händen eine Decke über ihn ziehen, doch Jan sagte:
„Nein, bitte nicht. Mir ist warm.“
Unangenehm warm.
„Du hast es also getan.“ Maria Francesca hielt die Spritze in die Höhe, die neben der Pritsche auf dem Tisch gelegen hatte. „Du hast dich mit Skylla infiziert.“
„Ja“, seufzte Jan und hoffte, dass sie ihm anmerkte, wie erleichtert er war, diese Entscheidung endlich getroffen zu haben. Schluss mit der Debatte! In den sechs Wochen, die ihm allerhöchstens blieben, würde sich kein anderer Ausweg mehr auftun. Er hatte keine andere Wahl, als sein Schicksal anzunehmen. Also Skylla. Die schwächste Variante, die aufzutreiben war. Und zwar jetzt. Lieber ein Ende mit Schrecken.
Und keine Diskussionen mehr.
„Das war unverantwortlich“, schnarrte Maria Francescas Stimme.
„Nein“, entgegnete er matt und lächelte. Undeutlich konnte er durch das Visier ihr Gesicht erkennen. „Das war meine Entscheidung, die ich so getroffen habe, wie ich es für richtig hielt. Meine eigene, freie, kleine, dumme Entscheidung.“
So frei, wie es unter diesen Umständen möglich war.
„Also noch etwas, was Professor Schwartz und dich verbindet“, sagte sie. „Auch er war ein Freund einsamer Entscheidungen.“
Jan seufzte erneut.
Ja, mag sein, dass wir uns so ähnlich waren.
Tränen schossen ihm in die Augen.
Michael Schwartz, einst sein bester Freund, mit dem er in Cincinnati studiert hatte, war durch seine Schuld gestorben. Skylla hatte ihn binnen weniger Minuten umgebracht. Jan wollte nicht daran denken, aber die Erinnerung an diese letzte Begegnung ließ sich nicht beiseiteschieben. Das Entsetzen in Michaels Augen angesichts des rasenden Schmerzes in seiner Brust. Der brechende Blick, als Jan den früheren, nun fremden Freund aufzufangen versucht hatte. Gemeinsam waren sie zu Boden gegangen, Michael über Jan.
Die Skylla-Variante, mit der Jan sich bewusst infiziert hatte, unterschied sich in einem entscheidenden Punkt von jener Skylla, die Michael umgebracht hatte: Sie hatte kein Skyllin-Gen. Nach allem, was Jan über die Biowaffe Skylla wusste, war dieses Skyllin, ein hochgiftiges Protein, ausschlaggebend für den tödlich-rasanten Verlauf der Infektion. Wie die Infektion mit einer Skylla-Variante ablief, die kein Skyllin produzierte, darüber gab es nur Vermutungen. Jan war Patient Zero.
Also Selbstversuch.
„Ist es etwa kein positives Zeichen“, erwiderte er kraftlos, „dass ich zwei Stunden nach der Ansteckung noch lebe? Michael war nach drei Minuten tot.“
„Du hast Fieber“, merkte Maria Francesca an. „Ich messe 38,2 Grad, schon jetzt, so kurz nach der Infektion. Das könnte man als heftige Reaktion bezeichnen. Wie fühlst du dich?“
„Müde“, brummte er.
„Das hier soll ich dir von Dr. Latif geben“, sagte sie und drückte ihm einen Becher mit einer milchigen Flüssigkeit in die Hand. „Er sagte, du weißt schon, wozu es gut ist.“
Das Mittel gegen die Blausäurebakterien in meinem Darm.
Gehorsam stemmte er seinen Oberkörper in die Höhe, stützte sich seitlich auf einen Arm und trank.
„Habe ich dir von meiner Mutter erzählt?“, fragte Maria Francesca.
Ich muss schlafen!
„Wir haben eine Tradition in unserer Familie“, fuhr sie fort, „die in der weiblichen Linie weitergegeben wird. Wir sind Heilerinnen. Meine Mutter war eine kluge Frau. Sie kannte sich mit allen Kräutern, Umschlägen und Tinkturen aus, die man sich denken kann. Ich war als Kind oft krank, ohne Fieber zu bekommen. Das gefiel meiner Mutter nicht. Daher gab sie mir Lindenblütentee und andere Dinge, die Fieber erzeugen. Fieber ist gut, sagte meine Mutter, Fieber ist eine gesunde Reaktion des Körpers auf einen Angriff.“
Jan wusste, worauf Maria Francesca hinaus wollte, tat ihr aber trotzdem den Gefallen und fragte:
„Wo ist das Problem? Ich habe Fieber. Das ist also wohl gut so.“
„Meine Mutter sagte aber auch: Fieber ist gut – wenn es nicht zu hoch steigt.“
„Ich stehe ja nun unter Beobachtung“, versuchte Jan einen schwachen Scherz.
„Hast du sonst noch Beschwerden?“, fragte sie.
Er lächelte müde und ließ sich, nachdem er ausgetrunken hatte, wieder auf sein Lager zurücksinken. Dann fielen ihm wohl die Augen zu, denn er bekam wieder Schläge ins Gesicht.
„Jan, denk mal einen Moment lang mit!“, fuhr sie ihn ungehalten an. „Wenn du schon Unsinn machst und dich unkontrolliert mit diesem Virus infizierst, dann mach diesen Unsinn wenigstens mit dem Verstand eines Wissenschaftlers. Wir müssen alles gründlich dokumentieren! Noch nie konnten wir eine Skylla-Infektion von Anfang an beobachten. Du bist zur Mitarbeit aufgefordert.“
„Kein Problem. Skylla injiziert am 15. Juni 2024 um 6 Uhr morgens Mitteleuropäischer Sommerzeit. Wegen der genauen Bezeichnung des Virenstammes frag den Taliban.“
„Wann hast du die antiviralen Medikamente abgesetzt?“
„Zwölf Stunden vor der Injektion.“
„Wie viel Skylla hast Du Dir gegeben?“
„Zehn Milliliter.“
„Bist du wahnsinnig?“, keuchte Maria Francesca. „Zehn Milliliter?“
„Es musste eine signifikante Dosis sein“, sagte Jan und erinnerte: „Ich habe bereits eine Skylla-Variante im Körper.“
Jene Variante, die Michael getötet hatte und die auch ihn hätte töten sollen. So zumindest hatten es die Hintermänner des Attentats wohl geplant. Niemand wusste, wie knapp Jan dem Tod entkommen war. Dass der Plan nur teilweise funktioniert hatte, lag vermutlich daran, dass Jan zu jenem Zeitpunkt noch nicht markiert gewesen war: Charybdis, die erste Stufe des Biowaffensystems Skylla & Charybdis, hatte ihr Werk noch nicht vollendet.
Nur dank eines entschlossenen Eingriffs war Jan noch am Leben. Mit Grausen erinnerte er sich an die Totaldekontamination. Sie hatte das Virus weitgehend aus seinem Körper entfernt. Gegen Restbestände, die sich vielleicht in seinem Lymphsystem und im Drüsengewebe hielten, nahm er seitdem antivirale Medikamente. In dem Moment, in dem er sie absetzte, würde Skylla – die tödliche Variante! – wieder aktiv werden. Und damit war Jans Herz und sein Leben in Gefahr. Das einzige Mittel dagegen war: Die mutmaßlich ungefährliche Skylla-Variante musste so massiv ins Feld geführt werden, dass sie allein schon wegen ihrer schieren Masse so schnell wie möglich alle freien Andockstellen auf den Oberflächen von Jans Herzzellen besetzte, sobald die Antiviren-Medikamente abgesetzt waren. Dann wäre die gefährliche Variante dazu verurteilt, tatenlos in Jans Blutbahn zu kreisen, bis sein Immunsystem einen Weg gefunden hatte, sie zu beseitigen. Das war Jans Kalkül.
„Es war der einzige Weg“, murmelte er.
Benommen registrierte er, dass er plötzlich ein warmes Gefühl verspürte, als er sich daran erinnerte, wie Maria Francesca ihn einmal geküsst hatte. Es war noch gar nicht lange her. Momentan konnte er sich an den Zusammenhang zwar nicht erinnern, aber er wusste noch, dass es ihm gefallen hatte.
Es hat mich auch erschreckt!
Er hörte Maria Francescas Seufzen.
„Männer!“, sagte sie und ließ ein bekümmertes Kichern hören. „Die Herren einsamer Entscheidungen. Genau diese Art von Entscheidungen wird die Welt noch in den Untergang führen.“ Und sie wiederholte in karikierendem Tonfall: „Der einzige Weg!“
„Natürlich“, gab er matt zurück.
Sinnlose Diskussion …
„Hast du einkalkuliert, dass dein Immunsystem am Boden ist?“, setzte sie vorwurfsvoll nach. „Als Folge der Totaldekontamination? Du hättest ihm mehr Zeit geben müssen. Deine Chancen würden deutlich besser stehen, wenn es wenigstens halbwegs auf den Beinen wäre. Aber nein, der Herr musste unbedingt eine Entscheidung treffen.“
„Es ist, wie es ist“, brummte Jan, doch er wusste, dass sie in diesem Punkt recht hatte. Er hätte noch ein paar Tage warten können. Trotzdem – seine Entscheidung fühlte sich weiterhin richtig an. Es wären qualvolle Tage geworden.
„Hör’ jetzt bitte auf, dich aufzuregen“, sagte Jan. „Es lässt sich nicht mehr rückgängig machen.“
Er fühlte sich plötzlich wie gerädert, als habe er seit unendlichen Zeiten nicht mehr richtig geschlafen.
Maria Francesca seufzte.
„Tut dir irgendwas weh?“, fragte sie. „In der Brust?“
Jan lauschte gehorsam in sich hinein.
„Ich spüre einen Druck in der Brust, aber keinen Schmerz.“
„Wo genau?“
Erschöpft legte Jan die flache Hand auf seine Brust, um zu sagen: Überall.
Maria Francesca horchte ihn ab, nachdem sie den USB-Stecker eines speziellen Stethoskops in eine Buchse an der Seite von Jans Beistelltisch geschoben hatte. Jans Herztöne erklangen über ihre Helmlautsprecher ebenso wie über die des Krankenzimmers.
„Nichts Ungewöhnliches“, lautete der Befund. „Wie hoch ist dein Ruhepuls normalerweise?“
„56 bis 60.“
„Zurzeit 72, trotz Ruhelage“, sagte sie, nachdem sie seinen Puls mittels einer Armmanschette gemessen hatte. Anschließend ermittelte sie seinen Blutdruck.
„Zu hoch“, murmelte sie.
„Es geht mir … nicht schlecht“, murmelte Jan. „Ich bin nur müde.“
„Ich lasse dich gleich schlafen“, sagte sie. „Bleib noch ein paar Momente bei mir! Ich werde dich jetzt verkabeln. Ich vermute, du warst noch nie auf einer Intensivstation? Dr. Latif hat alles von der Krankenstation hierher bringen lassen, einschließlich Beatmungsmaschine, falls du ins Koma fällst. Ich vermute, über derartige Konsequenzen hast du dir keine Gedanken gemacht, oder?“
Jan schüttelte schwach den Kopf. Auch jetzt machte er sich keine Gedanken darüber. Wenn er ins Koma fiel, dann geschah es eben. Er hatte sich das Virus im vollen Bewusstsein gespritzt, dass er eine Art russisches Roulette spielte – die Wahrscheinlichkeit, dass der Versuch schiefging, war womöglich größer als die, dass er gelang.
Ein Gottesurteil.
Jan lächelte matt, als er daran dachte, dass er in diversen Labors Dutzende verschiedener winziger Lebensformen erforscht hatte, vor ihnen und dem Mikroversum immer geschützt durch moderne Technik. Jetzt hatte er den lieben Kleinen erlaubt, den Spieß umzudrehen und seinen Körper zu ihrer Spielwiese zu machen. Normalerweise vermehrte er Viren in mit Bakterien geimpften Petrischalen und nicht im menschlichen Körper. Doch nun befanden sie sich in Jans Blutbahn, und es würde sich zeigen, wer die Oberhand behielt. Wenn alles gut lief, würde Jan Antikörper entwickeln. Und falls es nicht gut lief …
Dann sehen wir weiter.
Vielleicht wäre es sogar besser, wenn er stürbe. So, wie sich der weitere Verlauf seines Lebens darstellte, würde er sich sonst über kurz oder lang vor die Entscheidung gestellt sehen, für die Islamische Allianz Biowaffen zu entwickeln. Wenn er Skylla überlebte, würde er Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen – auch dann, wenn er sich weigerte, für die Allianz zu arbeiten. Denn ohne ihn hatte die Allianz keine Chance, Mittel zu finden, um auf die Biowaffen der Amerikaner zu reagieren. Wenn es hingegen gelänge, ein Gleichgewicht des Schreckens herzustellen, konnten die Amerikaner vielleicht davon abgehalten werden, ihre Biowaffen in großem Maßstab einzusetzen.
Es ging dabei nicht nur um Skylla, sondern auch um den geheimnisvollen Erreger, der zurzeit im pakistanischen Swat-Tal grassierte und der bereits unzählige Menschenleben gefordert hatte. Die Allianz hatte ein gutes Labor und gute Mikrobiologen, aber um diesen Erreger zu verstehen, war mehr nötig. Was nach Michaels Tod fehlte, war ein wissenschaftlicher Kopf. Diese Rolle hatte der Kommandant von Al-Isrā, Sacharija al-Maphrut, Jan zugedacht. Wenn Jan diese Aufgabe annahm, konnte er vielleicht unzählige Menschenleben retten, aber zugleich würde er der Allianz mit seiner Arbeit zwangsläufig eine Biowaffe an die Hand geben. Aus diesem Dilemma gab es keinen Ausweg – es sei denn Flucht durch Tod.
Jetzt.
Erschöpft schloss er die Augen.
„Ich ahne, was in dir vorgeht“, hörte er Maria Francesca sagen. „Du solltest so etwas nicht denken. Denk lieber daran, was geschehen könnte, wenn du es überstehst. Wir könnten ein wenig zusammensein zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst, aber mir würde es gefallen.“
„Das wäre sicher nett“, murmelte Jan, ohne die Augen zu öffnen.
„Kleiner Macho!“, kommentierte Maria Francesca ebenso vorwurfsvoll wie zärtlich. „Nett?“
Doch Jan war nun endgültig eingeschlafen, und Maria Francesca versuchte nicht, ihn erneut zurückzuholen. Sie blickte mit feuchten Augen zur Decke hinauf, und später schrieb sie in ihr Tagebuch:
„Wir tanzen auf Messers Schneide.“
***
„39,1“, hörte er eine Stimme in großer Ferne. „Puls 100. Wir sollten ihm etwas geben.“
„Zu früh“, sagte eine andere Stimme.
Jan verstand den Sinn dieser Worte nicht. Er begriff zwar, dass über ihn geredet wurde, aber er war eigentlich gar nicht da.
Ich bin ein Regenwurm …
Ein Regenwurm, der auf sommerheißen Asphalt geraten war und quälend langsam und immer langsamer den rettenden Straßenrand zu erreichen versuchte, ohne die geringste Ahnung, in welche Richtung er sich wenden musste.
Er hatte einen sonderbaren, bedrückenden Traum gehabt, einen Traum von einem Mann in der Wüste, der in Gefahr schwebte. Eigentlich wollte er von diesem Traum erzählen, aber der Tonfall der beiden Stimmen hielt ihn davon ab.
„Ich kann keine Immunantwort erkennen“, sagte eine der Stimmen, die einer Frau, die Jan bekannt war, deren Namen ihm aber momentan nicht einfiel.
„Zu früh“, wiederholte die andere Stimme, die eines Mannes.
„Sein Immunsystem ist tot, wegen Ihrer Totalscheiße mit Strahlenblitz.“
„Das System braucht Zeit für den Neustart“, sagte die Männerstimme. „Geben Sie ihm das hier.“
„Hochdosierte Vitamine?“
„Alles was sein Immunsystem braucht. Jetzt gleich eine Überdosis und alle drei Stunden Nachschub, um den Spiegel hochzuhalten. Wir verschaffen seinem Immunsystem etwas Zeit.“
„Aber das Fieber …“
„39,1 ist nichts. Die Temperatur wird weiter steigen. Bei 39,5 beginnen Sie mit Infusion von isotonischer Kochsalzlösung, damit er nicht dehydriert. Bei 40 schauen wir ihn uns noch mal genauer an. An fiebersenkende Mittel denken wir nicht vor 40,5, bei 40,8 ziehen wir sie ernsthaft in Erwägung und bei 41 sind wir ganz kurz davor, sie tatsächlich einzusetzen.“
„Das heißt, Sie wollen die Dinge sich selbst überlassen. Das ist eine Tortur für seinen Körper.“
„Nicht die erste“, pflichtete die männliche Stimme bei und widersprach doch zugleich. „Er ist stark genug. Hören Sie, es kommt mir so vor, als ob Sie es an wissenschaftlicher Distanz vermissen lassen …“
„Er ist ein Mensch!“, protestierte die weibliche Stimme.
„Der sich selbst zum Versuchstier gemacht hat“, entgegnete der Mann mit einer Entschiedenheit in der Stimme, die Jan sofort einleuchtete. „Ihre Empathie in allen Ehren, Maria Francesca, aber hier geht es um wissenschaftliches Neuland. Wir müssen diese einzigartige Chance nutzen, um die Infektion bis ins kleinste Detail zu erforschen, und darum müssen wir sie möglichst ohne Eingriff ablaufen lassen. Ich bin entschlossen, diese Chance auszureizen. Wir werden also erst dann etwas tun, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Die Rettung von Dr. Metzners Leben ist selbstverständlich unser Ziel, aber was bis dahin alles passiert, ist so unendlich interessant, dass…“
„Mir wird schlecht, wenn ich Sie reden höre!“
„Haltung, junge Frau!“
„Haben Sie gehört, was mit dem Affen passiert ist? Mit Shiva? Er wurde vorgestern zu Testzwecken mit demselben Skylla-Stamm infiziert. Vor einer Stunde lag er tot in seinem Käfig.“
Was hat das mit mir zu tun?
Ich will schlafen.
Einfach nur schlafen.
Meike ist tot.
Meike ist nicht …
Etwa zwei Jahre zuvor
September 2022
Einfach nur schlafen …
Michael Schwartz hieß nun Zach Sturbinsky. Auf diesen Namen lauteten sein neuer Führerschein und sein Reisepass. Die neue Identität fühlte sich noch fremd an, ebenso wie die Haare in seinem Gesicht – Bart konnte man es noch nicht nennen –, die er seit seiner Flucht aus Phoenix hatte wachsen lassen. So fremd wie die Baseballkappe auf seinem Kopf, die er fast ununterbrochen trug, tief ins Gesicht gezogen, obwohl er Baseballkappen hasste. Wenn er sich selbst im Spiegel sah, erkannte er sich kaum wieder. Es lag nicht allein an Äußerlichkeiten. Er war drahtiger geworden, wirkte entschlossener, männlicher, fand er. Zum ersten Mal in seinem Leben folgte er einer Agenda. Er hatte eine Idee. Sie machte ihn zum Einzelgänger, zum einsamsten Menschen auf diesem Planeten, doch das schreckte ihn sonderbarerweise nicht. Auch dass sie ihn zum Staatsfeind der USA machte, war ihm egal, solange sie ihn nicht entdeckten. Ein Staat, in dem so etwas möglich war wie die Entwicklung jener Waffe, ein solcher Staat verdiente Michaels Loyalität nicht, auch wenn es sich um den Staat handelte, in dem er aufgewachsen war. Ein solcher Staat konnte nicht sein Vaterland sein.
Das einzige, was ihm ernsthaft Sorgen machte, war die Frage, ob er sein Ziel erreichen würde. Vor ihm lag ein umständlicher Weg, auf dem er ständig auf der Hut sein musste. Doch er war erschöpft, mit seiner Wachsamkeit war es nicht weit her. Auf seiner Wanderung durch die Wälder hatte er kaum geschlafen. Die große Ungewissheit, seine ständige Begleiterin, belastete ihn schwer. Er war völlig auf sich allein gestellt. Machte er alles richtig?
In Phoenix war er rund um die Uhr beschattet worden. Er war ihnen offenbar entkommen, aber würden sie nicht nach ihm suchen? Konnte er sicher sein, dass sie die Geschichte vom sonderlichen Professor, die er ihnen vorgespielt hatte, gekauft hatten? Vielleicht hatten sie ihn trotzdem wieder aufgespürt? Überall gab es Videoüberwachung, und moderne Gesichtserkennungssoftware war sicher in der Lage, ihn trotz Bart zu identifizieren.
Michael sah sich oft um und prüfte – unauffällig, wie er hoffte – die Gesichter der Menschen in seiner Nähe, doch er konnte niemanden entdecken, der ihm schon vorher aufgefallen wäre oder der ihm verdächtig erschien. Er kam sich vor, als entwickle er allmählich eine Art Verfolgungswahn, aber auf jeden Fall war es besser, einen Tick zu vorsichtig zu sein als denselben Tick zu nachlässig. Sicherheitshalber achtete er darauf, seine neuen Papiere sparsam einzusetzen – nur dann, wenn es sich absolut nicht vermeiden ließ wie beim Check-In für den Flug nach Iqaluit. Leider war es unmöglich zu reisen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ein Restrisiko blieb immer.
Er wollte, dass sie die Geschichte glaubten, die er inszeniert hatte: dass er in die Wälder gegangen war. Von Montpelier aus, seiner Geburtsstadt, war er zu Fuß in die Green Mountains aufgebrochen. Selbst seiner Mutter hatte er die Wahrheit vorenthalten. Wenn sie bei Amy Schwartz vorfühlten, würden sie nur erfahren, dass Michael die Einsamkeit suchte, um zu sich zu finden.
„Michael wird sicher wieder aufkreuzen, bevor der Winter kommt“, würde Amy vielleicht arglos zu ihnen sagen. „Winter in unseren Bergen ist nichts, was man freiwillig sucht.“
Er versuchte, die Gedanken an sie abzuschütteln. Er hatte eine Reiseroute gewählt, mit der sie gewiss nicht rechneten. Sie hatte unter anderem den Vorteil, dass er seinen Pass vor dem Verlassen des Kontinents nur zwei Mal zeigen musste – am Flughafen in Ottawa und vorher beim Geldwechsler. Bis dahin hatte er genug kanadische Dollar in bar für Essen und Zugfahrten. Er hatte das Geld aus dem Elternhaus mitgenommen, wo sich die kanadischen Dollars im Lauf der Jahre infolge einer Mischung aus Vergesslichkeit und Nachlässigkeit angesammelt hatten. Von jedem Trip ins Nachbarland hatte die Familie Wechselgeld und kleine Scheine mitgebracht. Trotz des Vorsatzes, dieses Geld beim nächsten Ausflug endlich auszugeben, war man jedes Mal mit neuen Devisen zurückgekehrt, weil niemand an die kanadischen Dollar in der Schublade gedacht hatte.
Für den Flug reichten diese Rücklagen natürlich nicht. Doch Zach Sturbinsky hatte genügend amerikanische Dollar bei sich. Einen Teil davon tauschte er in einer konventionellen Wechselstube gegen kanadische und zahlte den Flug in bar. Das barg ein gewisses Risiko, doch der Einsatz der Kreditkarte von Michael Schwartz verbot sich natürlich. Die Blicke, mit denen sein falscher Ausweis geprüft wurde, fielen bestenfalls beiläufig aus. Nein, Zach Sturbinsky erregte keinen Verdacht. Er war ihnen entkommen.
Doch erst als Michael in der Boeing 737 nach Iqaluit saß und tief unter sich Seen, Tümpel und die Tundra von Quebec enteilen sah, begriff er, dass er es tatsächlich geschafft hatte, die USA zu verlassen. Jenes Land, das Präsidentin Lindsay Preston in ihrer unnachahmlichen Art so gern als „Heimat der Freiheit“ bezeichnete. Von wegen! Die USA waren ein Land, in dem unbequeme Politiker mit Biowaffen aus dem Weg geräumt wurden! Ein Land, das insgeheim von einem Netzwerk namens SCOUT gesteuert oder zumindest manipuliert wurde. Wie das genau funktionierte, wusste Michael noch nicht, aber in den USA wollte und konnte er nicht länger leben. Jetzt, in der Luft über Kanada, hatte er erstmals seit langem wieder das Gefühl, durchatmen zu können, und seine Selbstzweifel schwanden.
Durfte er sich anmaßen, Entscheidungen zu treffen, die Auswirkungen auf Millionen Menschen haben würden, Entscheidungen, die sich gegen sein Land richteten? Natürlich! Er folgte allein seinem Gewissen. Die USA hatten sich in die falsche Richtung entwickelt. Zum Beispiel was den Krieg gegen den Terror betraf. Am Anfang hatte es einige hundert Fundamentalisten am Hindukusch gegeben. Durch aggressive Anti-Terror-Politik waren daraus spätestens nach dem Irak-Krieg von 2003 Zehntausende geworden. Die USA hatten einen ganzen Kulturkreis gegen sich aufgebracht. Längst waren sie zu einem Überwachungsstaat geworden, dessen Autorität in der Welt allein auf seiner militärischen Überlegenheit beruhte. Viele, wenn nicht die meisten Amerikaner glaubten, dass sie im Recht waren. Diesem kollektiven Wahn setzte Michael sein eigenes Gerechtigkeitsempfinden entgegen. Er konnte nicht anders. Amerikaner hatten eine Biowaffe gegen seinen Vater eingesetzt, Senator Philipp Schwartz, einen politischen Querkopf. Aus der Sicht solcher Amerikaner mochte Michael ein Staatsfeind sein, ein Landesverräter! In Wirklichkeit war er ein Whistleblower, der im Begriff war, den Feinden der USA das tödlichste Virus zu bringen, das er kannte. In einem kleinen, unauffälligen Hochsicherheitsbehälter in Michaels Reisegepäck befand sich eine Gewebeprobe vom Herzen seines Vaters, die von jenem tödlichen Virus verseucht war.
Es geht nicht um die USA, dachte Michael. Es geht um das, was aus den USA unter dem Einfluss von SCOUT geworden ist.
Dieses Etwas musste aufgehalten werden.
Michael dachte an Evans Worte:
„Auf die interessantesten Dokumente sind Sie noch gar nicht gestoßen.“
Evan, der große Unbekannte, der ihm geholfen hatte, die USA zu verlassen!
In Michaels Hosentasche befand sich ein USB-Stick mit 20 Gigabyte an Daten über die geheime Organisation namens SCOUT. Viel Lesestoff für lange, einsame Abende. Michael würde sich Zeit dafür nehmen, wenn er in Europa war. Falls er Evans Worte richtig deutete, standen ihm die schlimmsten Enthüllungen noch bevor.
Die USA lagen hinter ihm. Michael würde nicht zurückkehren. Das stand fest. Er würde überlaufen, auch das stand fest. Er würde einer Organisation, von der er kaum mehr wusste, als dass sie Islamische Allianz hieß und vom jordanischen König Abdallah gegründet worden war, das Virus bringen, das seinen Vater auf unglaublich brutale Weise getötet hatte. Er hatte immer noch die Bilder vom geöffneten Brustkorb seines Vaters vor Augen, er wusste, was dieses Virus anrichtete, wenn es auf ein menschliches Herz losgelassen wurde: Es verursachte eine Art Mega-Herzinfarkt und ließ die Blutgefäße rund ums Herz explodieren. Der Sportunfall auf dem Winooski River war in Wirklichkeit ein Attentat gewesen, weil der Senator über SCOUT Bescheid wusste. Gegen diese grauenhafte Waffe gab es kein Mittel, keine Medikamente. Michael sah nur einen einzigen Weg, wie sich verhindern ließ, dass diese Waffe eingesetzt wurde: Der Gegner musste sie ebenfalls besitzen.
Michaels Ziel war Tanger in Marokko. Es war die ungewöhnlichste Reise seines Lebens, unter anderem deswegen, weil er drei Wochen Zeit hatte. Am 30. September hatte Evan dort in einem Hotel ein Zimmer für ihn gebucht. In Tanger sollte der Kontakt zur Allianz hergestellt werden.
Manchmal zweifelte Michael an seinem Verstand, weil er einem Menschen rundheraus vertraute, der ihm persönlich unbekannt war und mit dem er lediglich über einen geheimen Nachrichtenchat im Internet schriftlich kommuniziert hatte. Doch er hatte von Anfang an ein grundgutes Gefühl dabei gehabt. Evan hatte den richtigen Ton angeschlagen, hatte Michael beraten, ihn aber nie bedrängt. Als er wissen wollte, auf welchem Weg Michael die USA verlassen würde, hatte Michael ihm diese Information verweigert, und Evan hatte dies akzeptiert, ohne in ihn zu dringen.
Ja, Michael hatte losgelassen, und das erfüllte ihn zunehmend mit Stolz. Er hatte einen radikalen Schnitt gemacht, noch viel radikaler als sein bester Freund Jan, den er immer für die Klarheit seiner Entscheidungen bewundert hatte. Er fühlte sich frei – fast. Die Bedrohung durch sie verschwand langsam hinter ihm am Horizont.
Aber da war noch etwas. In einer der Nächte oben in den Wäldern der Green Mountains hatte jemand neben seinem Lager gesessen. Das glaubte er zumindest zu wissen, doch seine Wahrnehmung war vernebelt wie durch einen Traum.
„Ich gehe, wohin du gehst“, hatte der Unbekannte gesagt. Am Morgen darauf war er verschwunden gewesen.
Er reiste also nach Iqaluit, der Hauptstadt des kanadischen Territoriums Nunavut, die mit ihren rund 8000 Einwohnern so groß war wie Montpelier in Vermont. Iqaluit lag dicht am Polarkreis. Michael nahm ein Gästezimmer und verbrachte zwei Tage mit einer Wanderung zu einigen der letzten noch existierenden Eisbären und mit einer Bootsfahrt zu Walgründen. Dann flog ihn das wöchentlich verkehrende Flugzeug der Greenland Air nach Kangerlussuaq, dem einzigen internationalen Flughafen Grönlands. Hier verbrachte er einen weiteren, diesmal milden, sonnigen Tag an der erstaunlich grünen Küste, ehe es nach Kopenhagen weiterging. Und immer sah er sich die mitreisenden Passagiere unauffällig an.
Sein vorläufiges Ziel lag in Südfrankreich: Sète, eine Hafenstadt, wo zweimal wöchentlich eine Fähre nach Tanger abfuhr. Das europäische Bahnnetz war phänomenal. Es transportierte ihn in nicht einmal einem Tag von Kopenhagen ins südfranzösische Montpellier, über eine Entfernung von insgesamt mehr als 1800 Kilometern, ohne Ausweiskontrollen, obwohl er mehrere Landesgrenzen überquerte.
Michael hatte zwar kaum geschlafen, als er in Montpellier ankam, unternahm aber dennoch einen kleinen Rundgang durch die Universitätsstadt – lang genug, um festzustellen, dass sich die Ähnlichkeit zwischen dieser Stadt und seiner Geburtsstadt in der Namensähnlichkeit erschöpfte. Dann ging er zur Bank, um Geld zu tauschen, und fuhr mit dem Zug weiter nach Sète. Hier sah er sich vor ein Problem gestellt, das er vor sich hergeschoben hatte: Wo sollte er für die restliche Wartezeit unterkommen, ohne aufzufallen? Hotels schieden aus, denn beim Einchecken wäre seine Identität registriert worden – wenn auch die falsche. Die Europäische Union hatte zwar ihre Datenaustauschverträge mit den USA infolge mehrerer großer Ausspähskandale gekündigt, aber das hieß nicht, dass NSA oder CIA nicht mehr an europäische Daten herankamen. Wenn diese nicht auf legalen Wegen zu beschaffen waren, fanden die Geheimdienste andere Wege, davon war Michael überzeugt. Er hatte seinen Reisepass zuletzt beim Geldtausch in Montpellier und davor nach der Landung in Kopenhagen zeigen müssen, allerdings ohne dass seine Daten dabei festgehalten worden wären. Jedenfalls hatte er nichts davon bemerkt. Falls die Daten dennoch aufgezeichnet worden waren und falls sie gezielt nach exotischen Bewegungsmustern suchten, konnte dieses eine Mal, dass Zach Sturbinskys Daten beim Einchecken in einem südfranzösischen Hotel festgehalten wurden, das berühmte Mal zu viel sein.
Oder war Michael auf dem besten Weg, paranoid zu werden?
Ein Taxifahrer brachte ihn auf die Lösung seines Unterbringungsproblems. Der braungebrannte, arabisch-stämmige Mann lehnte in der Nähe des Bahnhofs von Sète am Fonds seines Wagens. Als stünde Michael das Wort „Amerikaner“ auf die Stirn geschrieben, sprach der Mann ihn auf Englisch an.
„Sie sehen aus wie jemand, der eine Unterkunft braucht.“ Er musterte Michaels Rucksack, seine Wanderstiefel, und fügte hinzu: „Kein Hotel, sondern vielleicht ein Gästezimmer? Nein, ein Mobilhome auf einem Campingplatz. Ich wüsste einen schönen Platz und könnte sie hinfahren.“
Michael betrachtete den Taxifahrer misstrauisch. Das fügte sich zu glatt, dachte er im ersten Moment, doch dann drängte er seine Paranoia zurück und sagte:
„Das klingt ziemlich gut.“
Dass der Fahrer keineswegs uneigennützig gehandelt hatte, begriff Michael, als ihm die Rechnung für die Fahrt präsentiert wurde. Sie belief sich auf 60 Euro. Doch Michael zahlte diese Summe gern, denn der Ort, an den es ihn verschlagen hatte, gefiel ihm.
So landete er auf einem Campingplatz in einem Örtchen namens Marseillan-Plage und bezog ein Mobilhome, einen Wohncontainer, der im Schatten hoher Pappeln direkt hinter einer Düne am Meer stand. Er musste lediglich ein altmodisches Anmeldeformular schriftlich ausfüllen. Niemand sah ihn schräg an, niemand stellte unangenehme Fragen. Michael war zufrieden, zumal es im Dorf eine Reihe freundlicher Restaurants gab, die er in den kommenden Tagen ausgiebig besuchte. Und natürlich holte er allen Schlaf nach.
Vielleicht hätten ihn diese letzten Wochen in Europa mit der westlichen Welt versöhnen können, denn der Westen bestand ja nicht nur aus Hardlinern in Washington, auch wenn die leider stilbildend wirkten. Er bestand auch aus Menschen wie Florence und Georges, die eines der kleinen Restaurants im Dorf betrieben, Menschen, die sich nicht viel um Politik kümmerten und ihr Leben zu genießen versuchten.
Manchmal, wenn Michaels Blicke über das Meer hinweg den Horizont im Süden absuchten, wo die Länder des Islam lagen, seinen Blicken durch die Erdkrümmung entzogen, fragte er sich, warum es ihm nicht gegeben war, ebenfalls ein solches Leben zu führen. Es hatte natürlich keinen Sinn, sich darüber zu beklagen, dass sein Leben völlig anders hätte verlaufen können, aber trotzdem war dies ein trauriger Gedanke, gerade jetzt, da er kurz vor dem Sprung in jene andere Welt stand, die noch nicht wusste, wie dringend sie ihn brauchte. Ja, alles hätte auch völlig anders kommen können, wenn er nicht den Job bei Fupro angenommen hätte, wenn er nicht Genetik und Mikrobiologie studiert hätte, wenn er nie Samuel McWeir begegnet wäre, dem Nobelpreisträger, der sein Mentor geworden war.
Doch es war nicht anders gekommen. Der Blick zurück stimmte Michael traurig, der Blick nach vorn erfüllte ihn mit Entschlossenheit, und während er der Zukunft entgegensah, las er im SCOUT-Material und wurde sich bei wachsender Wut schließlich endgültig gewiss, dass es für ihn keinen anderen Weg gab als den, den er eingeschlagen hatte. Er würde diesen Kulturkreis verlassen. Lieber heute als morgen.
14./15. Juni 2024
Bethesda / Maryland
Justin Darkwater durchwachte die schlimmste Nacht seines Lebens.
Erst die Irrsinnsfahrt der Queen Mary 2 mit – unter anderen – seinen beiden Söhnen an Bord und die Kollision mit der Freiheitsstatue. Die Flucht der Touristen von Liberty Island, die in alle Richtungen auseinanderstrebenden Fähren, die Bilder von den Suchtrupps, die im Licht eilig aufgestellter Scheinwerfer zwischen den scharfkantigen Trümmern des geborstenen Kolosses, der einmal das Wahrzeichen der USA gewesen war, nach Überlebenden suchten. CNN meldete, dass sich zum Zeitpunkt der Kollision noch Personen im Innern der Statue aufgehalten haben sollten. Immer wieder zeigten die Bilder den abgerissenen Arm der Statue, der die Fackel des Lichts der Freiheit in die Höhe gereckt hatte. Beides, Arm und Fackel, lagen nun sinnlos und winzig unterhalb des hoch aufragenden Bugs des schweigenden Kreuzfahrtschiffes, und das Licht der Fackel war erloschen.
Schließlich mussten die Helfer abziehen, und CNN zeigte Bilder von den Truppen der Nationalgarde, die am Battery Park gegenüber Liberty Island und am weiter entfernten Ufer von New Jersey aufmarschierten. Justin erwartete, dass sie auch nach Liberty Island übersetzten, aber sie blieben in sicherer Distanz. Offenbar sollten die Terroristen nicht provoziert werden. Es gab Gerüchte, dass die Queen Mary 2 gesprengt werden könnte.
Und dann die Zweifel, die Gedanken. Diese Ereignisse würden die USA verändern. Es hatte schon begonnen. Justin spürte ein Rumoren tief in sich, ein Zittern, ein Beben. Da war etwas, was er als fremd empfand, da baute sich ein empfindlicher Druck auf. Dieser unerhörte Angriff auf die USA, diese beispiellose Frechheit verlangte nach einer Antwort. In einem der am besten gesicherten Seegebiete der Welt, unmittelbar vor der US-Hauptstadt Washington, war die Queen Mary 2 im Handstreich gekapert worden, als handle es sich um eine Kleinigkeit. Mit fast clownesker Chuzpe hatten die Terroristen den USA eine Demütigung nach der anderen zugefügt, ohne dass die Supermacht etwas hätte unternehmen können, bis hin zum Sturz der Freiheitsstatue.
Doch über diese tiefe Kränkung hinaus war es die Wahrheit in den Taten der Terroristen, die Justin zu schaffen machte. Er verstand sehr wohl, was das Attentat auf die Freiheitsstatue bedeuten sollte. Die Sache mit dem Licht der Freiheit war schon lange zur Farce verkommen, the land of the free war nicht mehr frei. Es hatte kein Recht, sich der Welt als Leuchtturm der Freiheit zu präsentieren, denn im Namen der Freiheit hatte es unerhörte Verbrechen begangen. Genau dies war es, was Justin so unruhig machte: Die Terroristen hatten vermutlich recht mit ihren Vorwürfen. Aber es durfte nicht sein, dass Amerika so schlecht war. Wenn Justins Amerika nicht mehr existierte, das Amerika, für das er bisher gearbeitet hatte – wofür sollte das alles dann gut sein? Entwickelte er seine Bakterien, die Sarin, ein tödliches Nervengas, zersetzen konnten, etwa für Verbrecher? Bisher hatte er an das Gegenteil geglaubt.
Justin liebte den Frieden. Er empfand ihn geradezu als seine Natur, sein Wesen. Sonja, seine Frau, sagte gern über Justin, er sei der friedfertigste Mann, den sie kenne. Gelegentlich meinte sie dies anerkennend, doch sie hatte auch schon durchblicken lassen, dass sie ihn sich in manchen Momenten zupackender und aggressiver wünschte. Dann empfand sie seine innere Ruhe offenbar als unmännlich. Er wusste, dass sie ihn manchmal nicht verstand. Umgekehrt war es nicht anders. Er hatte sich damit abgefunden. Doch jetzt musste er um seine Ausgeglichenheit kämpfen. Dieser sonderbare Druck machte ihn zutiefst unruhig, dieser Angriff der Terroristen auf alles, was an Amerika aus ihrer Sicht schlecht war.
Es lag ein Hauch von Zeitenwende in der Luft.
Nur nicht die Nerven verlieren! Sonst spielte man den Terroristen womöglich noch in die Hände.
Aber das war einfacher gesagt als getan, vor allem wenn Justin an Matthew und John dachte, seine Söhne auf der Queen Mary 2.
Auch Norah und Alfred Winter, Justins Schwiegereltern, waren an Bord. Alfred Winter, der Pharma-Manager. Er war einer der drei Männer, denen im Verlauf dreier Tribunale Verstöße gegen das Völkerrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachgewiesen worden waren. Tribunale, abgehalten von den Terroristen! Vor den Augen der Weltöffentlichkeit! Alfred hatte vor 20 Jahren ein unreifes Anthrax-Impfserum an afghanischen Häftlingen in einem Geheimgefängnis der CIA getestet. 120 der 150 Probanden waren qualvoll gestorben. So war es beim Tribunal dargestellt worden – und Norah, Justins Schwiegermutter, hatte es bestätigt. Niemand, weder die Präsidentin noch ein anderer Regierungsvertreter war diesen Vorwürfen bisher öffentlich entgegengetreten, lediglich ein Vertreter des Pharmakonzerns MediGen hatte auf einer Pressekonferenz zu dementieren versucht.
Alfred Winter schien ein Mann zu sein, der über Leichen ging. Justin wunderte es nicht. Ob Alfred noch lebte? Die Terroristen hatten das Urteil, das über ihn gesprochen worden war, gerade vollstrecken wollen, als ein US-Angriff auf die Queen Mary 2 die Sendeanlage zerstört hatte. Wenn sie ihm tatsächlich dasselbe giftige Impfserum injiziert hatten, dann war er jetzt entweder tot oder hatte schwere Hirnschäden davongetragen.
Genau darum wurde jener Teil von Justin, der zutiefst patriotisch war, immer unruhiger und wütender. Justin fühlte sich gedemütigt, weil er in seiner Naivität daran geglaubt hatte, das Gute zu bewirken, während Männer wie Alfred Winter amerikanische Werte verraten hatten und dennoch im selben Atemzug fähig waren zu rufen:
„God bless America.“
Justin wurde immer wütender, tief in sich.
Die Entführer hatten schon angekündigt, dass es noch schlimmer kommen würde. Die Welt sollte über weitere US-Verbrechen aufgeklärt werden. Zwei weitere Tribunale sollten beweisen, dass sowohl der Einsatz des chemischen Kampfstoffes Sarin in Damaskus 2013 als auch das Attentat auf den jordanischen König Abdallah 2019 auf das Konto der USA gingen. Diese Tribunale waren wegen der Zerstörung der Sendeanlage noch nicht ausgestrahlt worden, doch schon die bisherigen Enthüllungen erschütterten die USA bis ins Mark.
Wie gelähmt saß Justin vorm Multikom, Sonja im Arm, und verfolgte die Vorgänge in New York. Rund um die Bucht gingen Panzer in Stellung und richteten ihre Geschütze auf die Queen Mary 2, auf der sich 3000 Menschen befanden. Marine-Hubschrauber umkreisten den gestrandeten Ozeanriesen, und weiter draußen in der Bucht hielten die Kriegsschiffe der US-Marine die Stellung, darunter der Zerstörer Richmond, der nur um Haaresbreite der Kollision mit der Queen Mary 2 entkommen war. Immer wieder zeigte das Multikom die riesige, erleuchtete, schweigende Masse der Queen Mary 2, die in der Nacht lag wie stahlgewordenes Unheil.
Was hatten die Terroristen vor? Würden sie das Schiff wirklich sprengen? Selbst der in unzähligen Nachrichtengewittern gestählte CNN-Moderator Phil Ashby zeigte im stundenlangen Sendemarathon Nerven. Eine Formulierung entglitt ihm, die das Ende seiner Karriere bedeuten konnte:
„Man fragt sich, wann sie es endlich tun.“
CNN zeigte, wie auch die Richmond ihre Geschütze auf die Queen Mary 2 richtete. Justin entfuhr ein böses Lachen angesichts dieser völlig nutzlosen Maßnahme. In diesen Minuten versuchte Sonja ein letztes Mal, Matthew, ihren zehnjährigen Sohn, und ihre Mutter Norah an Bord der Queen Mary 2 zu erreichen. Die beiden meldeten sich auch diesmal nicht. Entweder waren alle Mobilfunkknoten im Einzugsbereich der Queen Mary 2 abgeschaltet, oder die Akkus der Handys waren leer. Doch da auch CNN über das Schweigen im Äther berichtete, lag es wohl am Netz, und das bedeutete vermutlich, dass die Knoten auf Weisung der Regierung abgeschaltet worden waren. Zu diesem Schluss kam man zumindest auf CNN. Eine Bestätigung von Regierungsseite gab es dafür nicht, aber darüber wunderte sich kaum jemand angesichts des zugeknöpften Verhaltens der Regierung während der gesamten bisherigen Krise.
„Es ist ein Albtraum“, seufzte Sonja und legte ihr Handy beiseite.
„Sie werden nicht schießen“, sagte Justin.
„Aber warum lassen sie dann all diese Panzer auffahren, wenn sie nicht vorhaben, sie einzusetzen?“
„Weil sie keine andere Antwort haben. Weil es darauf“ – Justin deutete auf die Queen Mary 2 – „keine Antwort gibt. Matthew und John wird nichts geschehen.“
„Aber wenn die Terroristen das Schiff sprengen?“, wandte Sonja mit zitternder Stimme ein.
Justin bemühte sich, zuversichtlich zu wirken. In diesen Minuten klammerte sie sich emotional enger an ihn als je zuvor. Sie brauchte seine Gewissheit, seine Stärke. Falls sie spürte, wie aufgewühlt er war, ließ sie dies nicht erkennen.
„Sie werden das Schiff nicht sprengen“, bekräftigte er. „Sie wollen nur, dass wir glauben, sie könnten es tun. Sie haben nie damit gedroht.“
Sonja sah ihn mit großen, erstaunten Augen an.
„Sie müssen nicht erst damit drohen, damit wir glauben, dass sie es tun könnten“, wandte sie ein.
„Wären sie Terroristen von der simplen Art, dann hätten sie damit gedroht“, gab Justin zurück. „Sie haben etwas anderes vor.“
Sonja schüttelte den Kopf, widersprach aber nicht, sondern sagte:
„Ich nehme jetzt Valium und gehe schlafen. Ich kann nicht mehr.“
„Das ist das Beste, was du tun kannst.“
Sie fragte nicht, warum er es nicht ebenso machte, wenn es doch angeblich das Beste war, sondern küsste ihn auf die Stirn und wankte zu Bett.
Justin brachte es nicht über sich, das Multikom abzuschalten und damit den Sichtkontakt zur Queen Mary 2 und zu seinen Söhnen zu unterbrechen. Er blieb sitzen und folgte der Übertragung aus New York. Gegen das flaue Gefühl in seinem Magen schenkte er sich Bourbon ein, aber erst, als er daran nippte, fiel ihm ein, dass es sich um Alfreds Lieblingsbourbon handelte und dass sie das Zeug nur wegen ihm im Haus hatten. Justin schob den Bourbon von sich. Ohnehin vertrug er keinen Alkohol.
Immer wieder die Frage:
„Was wollen die Terroristen überhaupt?“
Phil Ashby blickte ebenso smart wie angespannt in die Kameras.
„Ihr Tribunal abhalten, so viel scheint klar zu sein. Aber darüber hinaus? Sie haben die Queen Mary 2 gewiss nicht ohne Grund direkt vor der Nase von Manhattan auf Grund gesetzt und die Freiheitsstatue zerstört.“
Es gab wohl niemanden auf der Welt, der sich nicht diese Fragen stellte, doch selbst die gescheitesten Spezialisten konnten nur spekulieren. Immer wieder fielen die Worte:
„Eine solche Situation hat es noch nie gegeben.“
Doch welche Konsequenzen zog sie nach sich?
„Die USA sind mit einem Schlag erpressbar geworden“, behauptete ein Talk-Gast und wurde von einem anderen darauf hingewiesen, dass die Terroristen bisher keine Forderungen gestellt hatten:
„Was soll das für eine Erpressung sein?“
„Was sind das überhaupt für Kidnapper?“, fragte ein dritter.
„Sie verfolgen ein Ziel, das steht ja wohl fest.“
Tatsächlich, so viel stand wohl fest. Doch welches?
„Natürlich, sie wollen ihr Tribunal übertragen.“
„Das allein ist es nicht. Sie haben die Queen Mary 2 vor Manhattan auf Grund gesetzt und sich selbst ganz persönlich damit in eine Situation gebracht, aus der sie nicht mehr herauskommen. Sobald einer von ihnen versucht, das Schiff zu verlassen, wird er entweder erschossen oder gefangen genommen.“
„Sie haben zweifellos etwas vor!“
Auf diese Erkenntnis konnten sich alle einigen. Sie war alles andere als neu. Schon seit 6/11, six/eleven, seit dem 11. Juni, an dem die Queen Mary 2 entführt worden war, hatte die ganze Welt gewusst, dass die Terroristen etwas vorhatten. Justin ahnte längst, dass etwas Böses passieren würde. Er musste sich nur die Bilder von dem riesigen, schweigenden Schiff ansehen. War es nicht offensichtlich, dass die Terroristen die USA quälen wollten?
Natürlich hatten sie etwas vor! Sie verfolgten irgendeinen knallharten Plan, der vor allem eines nicht leisten würde: Er würde die Erwartungen des Westens nicht erfüllen. Was diese Leute planten, würde unerwartet sein, unkalkulierbar, und es würde dazu dienen, die USA weiter an der Nase herumzuführen. Das war den Terroristen schon bisher in einer Weise gelungen, die Justin sich niemals hätte vorstellen können. Diese Terroristen waren alles andere als plumpe Gewalttäter. Wenn man ihnen ernsthaft etwas entgegensetzen wollte, musste man sich in die Logik ihres irren Spiels hineinversetzen. Doch stattdessen verfuhr die Regierung nach Schema F und ließ Panzer auffahren und Geschütze ausrichten!
Allmählich gingen CNN die Neuigkeiten aus, denn es war Nacht in New York, und auf der Queen Mary 2 schien alles zu schlafen. Phil Ashby wurde durch die energisch und ausgeruht wirkende Catelyn Snow abgelöst, die in den Vormittag hinein moderieren würde. Justin saß noch immer auf der Couch seines Wohnzimmers.
Catelyn Snow versuchte, eigene Akzente in der Berichterstattung zu setzen, indem sie der Frage nachging, warum die US-Navy keine größeren Kriegsschiffe vor Ort hatte. Die USA hatten derzeit elf Flugzeugträger mitsamt ihren aus zahlreichen weiteren Kriegsschiffen und U-Booten bestehenden Kampfverbänden überall in der Welt im Einsatz, um amerikanische Interessen und die nationale Sicherheit zu schützen. Jene militärische Macht hingegen, die sie vor New York entfaltet hatte, konnte nur als kläglich bezeichnet werden oder, wie Snow bissig kommentierte, als Einladung an die ganze Welt, die USA auf eigenem Territorium anzugreifen.
CNN-Reporter hatten reihenweise Straßen-Interviews mit Augenzeugen geführt, in denen immer wieder Fragen wie diese auftauchten:
„Wir sind die größte Militärmacht der Welt, aber wo ist diese Macht jetzt? Warum haben wir nur ein paar Nussschalen vor Ort? Hat denn niemand mit so etwas gerechnet?“
Offenbar hatte das tatsächlich niemand. Ironie der Geschichte: Zurzeit wurde der Flugzeugträger Nimitz, ein stählerner Gigant, der erste und älteste seiner Klasse atomgetriebener Träger, im südlich gelegenen Norfolk abgewrackt, gut 200 Seemeilen von hier. Vor einem Jahr erst war die Nimitz nach mehr als 50 Jahren außer Dienst gestellt worden. Ihre Präsenz vor New York hätte alles verändert, darüber waren sich alle Kommentatoren einig.
Catelyn Snow führte auch ein Interview mit einem „Marinebeobachter“ aus Cape Charles an der Chesapeake Bay. Zwar stellte sich im Verlauf des Gesprächs heraus, dass der Mann sich den Titel „Marinebeobachter“ selbst verliehen hatte, aber es war früh am Morgen, die Nachrichtenlage war dünn, und der „Marinebeobachter“ hatte einen Film gemacht, der zeigte, wie ein offensichtlich schwer beschädigtes, ziemlich großes US-U-Boot aufgetaucht durch die Chesapeake Bay Richtung Norfolk pflügte. Sam Walker, so hieß der „Marinebeobachter“, kommentierte seine Bilder mit den Worten:
„Das Boot zeigt keine Insignien mehr, denn der Turm ist so gut wie abrasiert. Was da zu sehen ist, deutet nach meiner Einschätzung auf die Folgen von schweren Explosionen hin, vielleicht durch Torpedobeschuss. Nach der Größe zu urteilen müsste es sich hier um ein Boot der Los-Angeles-Klasse handeln, also um einen U-Boot-Typ, der zurzeit ausgemustert wird. Diese Boote der Los-Angeles-Klasse bildeten über Jahrzehnte hinweg das Rückgrat unserer U-Boot-Flotte. Wir vermuten, dass es sich um die USS Ticonderoga handelt. Das ist eines von zwei U-Booten, die zur Sicherung des Seegebiets vor der Chesapeake Bay abkommandiert waren.“
„Wir“, schaltete sich Catelyn Snow wieder ein, „damit meinen Sie sich selbst und die Mitglieder Ihres Clubs?“
„Genau. Wir sind alle ehemalige Navy-Leute. Wir verfolgen die Flottenbewegungen in der Chesapeake Bay und lauschen auf den Funk der Boote. Teile davon können wir auffangen. Und dann machen wir uns einen Reim darauf, was draußen vor der Küste vorgeht. Das war zuletzt ziemlich aufregend, weil die Ticonderoga abkommandiert wurde, der Queen Mary 2 zu folgen.“
„Also dasselbe U-Boot, das Sie vor wenigen Stunden in schwer beschädigtem Zustand bei der Rückkehr nach Norfolk beobachtet haben?“, fragte Catelyn Snow.
„Vermuten wir“, antwortete Sam Walker. Seiner Stimme war anzumerken, dass er keinesfalls als Spinner dastehen wollte. Er war sich dessen bewusst, dass er ein ungewöhnliches Hobby hatte und über Expertenwissen verfügte.
Justin wusste dennoch nicht, was er mit diesen Informationen anfangen sollte. Hatte es eine Seeschlacht gegeben? Er wusste nur vom Ende der USS Idaho, denn darüber hatte CNN berichtet, begleitet von dramatischen Bildern vom Untergang des Kriegsschiffs, das offenbar einem angreifenden U-Boot unterlegen gewesen war. Er konnte sich nicht einmal erinnern, ob der Name Ticonderoga in den vergangenen Tagen überhaupt gefallen war.
Dann gab es Nachrichten über die Verlegung von Eliteeinheiten der US-Navy von Georgia nach New York – CNN wollte darin erste Anzeichen dafür erkennen, dass die verantwortlichen Behörden die Erstürmung der Queen Mary 2 vorbereiteten. Das Eintreffen der Elitetruppen wurde für die frühen Morgenstunden angekündigt. Derweil errichteten die Sicherheitsbehörden im Battery Park an der Südspitze Manhattans eine provisorische Einsatzzentrale. Gegen fünf Uhr morgens trat ein Sprecher des Pentagon vor die Kameras und bestätigte, dass die Marines auf dem Weg waren. Dass die Präsidentin selbst keine Stellungnahme abgab, wunderte niemanden. Lindsay Preston hatte sich während der Krise nur ein einziges Mal persönlich an das amerikanische Volk gewandt, mit einer Rede, die noch am gleichen Abend von den Entführern der Queen Mary 2 ad absurdum geführt worden war. Niemand erwartete, dass Preston sich erneut äußerte. Sie stand als Lügnerin da. Ihre Zustimmungswerte, das ergab eine taufrische Umfrage, waren auf acht Prozent gesunken, einen einstelligen Wert – das hatte es bei einer amtierenden Präsidentin, einem amtierenden Präsidenten noch nie gegeben. Preston würde noch mindestens sieben Monate Präsidentin sein, bis ihr Nachfolger, der in rund vier Monaten gewählt werden würde, das Amt im Januar 2025 übernahm. Bis dahin musste sie das Land führen. Doch das Weiße Haus schwieg.
Auch aus anderen Teilen der Welt gab es Nachrichten, vor allem aus dem Nahen Osten, doch für diese Neuigkeiten interessierte sich Justin kaum. Der Nahe Osten war Krisenregion, solange er denken konnte. Er war die schlechten Nachrichten von dort gewohnt. Er glaubte nicht mehr daran, dass es in dieser Weltgegend jemals Frieden geben würde. Meist zappte er sogar weg, sobald etwas über den Nahen Osten gebracht wurde.
Ein Führer der islamistischen Hamas, einer Palästinensergruppe, die mit ihrer israelfeindlichen Haltung seit langem eines der unüberwindlichen Hindernisse für den Friedensprozess im Nahen Osten darstellte, war an plötzlichem Herzversagen gestorben, ein Hardliner und unversöhnlicher Israelfeind. Erst gestern war der saudische Hassprediger Mahmut ben Khalil in Mekka gestorben – ebenfalls an plötzlichem Herzversagen, ebenfalls ein Israelfeind und scharfer Kritiker des Westens. Nun wurde in der Hamas-Führung, so berichtete CNN, offenbar die Obduktion des Toten erwogen, um die genaue Todesursache feststellen zu lassen, doch dagegen regte sich Widerstand aus den eigenen Reihen: Der Respekt vor dem Toten gebot, ihn schnell und unversehrt zu bestatten.
Die halbe islamische Welt war in Aufregung. In Marokko, Mauretanien, Mali, Algerien und Tunesien hatten geistliche Führer die Gläubigen dazu aufgefordert, für Jerusalem als Hauptstadt des Islam zu beten. Diese Idee, die auf eine Verkündung der Schura von Amman zurückging, ließ in Israel alle Alarmglocken läuten. Und dann rief auch noch ein tunesischer Imam zum „Marsch der Millionen“ auf Jerusalem auf. Jerusalem war im Islam eine heilige Stadt, ähnlich bedeutend wie Mekka und Medina. Diese beiden Städte lagen allerdings in Saudi-Arabien, wo ein Steinzeit-Islam propagiert wurde, und damit außerhalb der Reichweite der Reformkräfte, die in der Schura von Amman wirkten. Die saudischen Theologen wirkten angesichts der Geschwindigkeit, die von der Schura von Amman vorgelegt wurde, zwar ein wenig hilflos, aber sie wurden nicht müde zu betonen, dass der Islam nicht reformiert werden müsse, ja, nicht reformiert werden könne, da im Koran das Wort Allahs offenbart worden sei; und wer dürfe sich anmaßen, Gottes Wort zu reformieren? Doch offenbar sahen viele Muslime dies anders. Ahmed Mohammed Zadzouk, der Vorsitzende der Schura und Rektor der angesehenen Al-Azhar-Universität von Kairo, wurde mit den Worten zitiert:
„Der Wille Allahs ist unendlich. Er offenbarte sich dem Propheten und ließ zu, dass der Prophet das Geoffenbarte in die Sprache der Menschen übertrug. Doch schon diese Übertragung ist eine Interpretation des Willens Allahs. Gläubige Muslime müssen sich daher jeden Tag fragen, ob sie den Willen Allahs richtig verstehen, und müssen die Worte des Koran wiegen.“