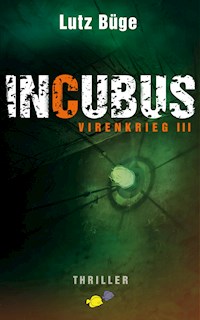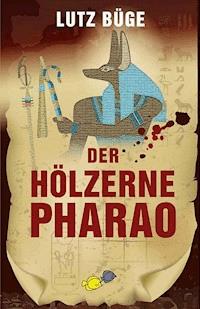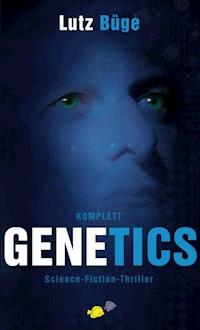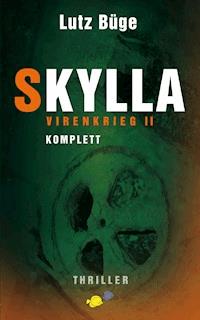9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ybersinn-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Jahr 2025. Raketen unbekannter Herkunft sind im Anflug auf die USA. Der Genetiker Jan Metzner weiß: Der Angriff mit der fürchterlichen Biowaffe SVO hat begonnen! Während der Präsidentenberater Phil Schwartz jr. noch in Washington, einem der Ziele des Angriffs, seine Wunden leckt, und während Jonathan Schwartz, sein Bruder, in New York auf ein Dach steigt, um den Angriff zu verfolgen, versucht Jan zusammen mit Marc Johnson und einem Bataillon US-Marines gegenzusteuern. Denn die US-Regierung versagt. Es sieht nicht gut aus. Zum Angriff von außen kommt der von innen. SCOUT ist noch nicht besiegt, jene Geheimorganisation, die jahrzehntelang insgeheim die USA manipuliert hat. Ihr Einfluss reicht weit, und sie wurzelt viel tiefer in der Geschichte, als Jan es sich vorzustellen vermocht hätte. Und dann ist da noch ein neuer, unerwarteter Protagonist in diesem unmenschlichen globalen Spiel um Herrschaft und Macht: die künstliche Intelligenz Pioneer, Schöpfung des IT-Genies Lucas Phelps, die ihr eigenes Süppchen kocht, bis es zum Duell mit Jan kommt Im düsteren Finale seines Zyklus führt Autor Lutz Büge alle Handlungsstränge zusammen. Die alles umfassende Klammer ist der zwielichtige Nobelpreisträger Samuel McWeir, dem Du zum ersten Mal im Prolog von Virenkrieg Erstes Buch begegnet bist. Mehr oder weniger subtil dominiert er die Handlung des ganzen Zyklus. In McWeir Virenkrieg V ist er allgegenwärtig, obwohl er längst nicht mehr lebt. Es gibt sogar eine ganz persönliche Rechnung mit Jan Metzner, und nochmals zeigt sich: Alles hängt mit allem zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
McWeir
Virenkrieg V
Thriller
Lutz Büge
www.ybersinn.de/news
Inhaltsverzeichnis
Prologe
1. Kapitel: 17.4.2025
2. Kapitel: 17.4.2025
3. Kapitel: 17.4.2025
4. Kapitel: 18.4.2025
5. Kapitel: 18.4.2025
6. Kapitel: 18.4.2025
7. Kapitel: 19.4.2025
8. Kapitel: 19.4.2025
9. Kapitel: 19.4.2025
10. Kapitel: Doomsday
Epilog
Impressum
Prolog 1
9. Juni 1945
USA
„Setzen Sie sich, Dr. Metzner. Hatten Sie einen guten Flug?“
„Bei der Zwischenlandung in Neufundland hat es ein bisschen gerumpelt, aber sonst ging es.“
„Ich kenne Menschen, die das Fliegen lieben, gerade weil es dabei rumpeln kann. Je mehr es rumpelt, desto mehr lieben sie es. Verrückt, nicht wahr? Tut mir leid, dass wir für unsere verdeckten Operationen bisher keine Non-Stopp-Flüge im Programm haben.“
„Wollen wir Klartext reden, oder verplempern wir Zeit mit … wie nennt man das bei Ihnen? Smalltalk? Ich will meinen Anwalt sprechen!“
„Sie brauchen keinen Anwalt. Wenn wir Sie vor Gericht sehen wollten, hätten wir Sie nach Camp Dustbin bei Frankfurt überstellt. Dort hätten Sie gute alte Bekannte getroffen. Es ist ein internationales Militärtribunal für Kriegsverbrecher geplant. Wir haben Sie ausgeflogen. Sie können sich entspannen.“
„Ich verstehe das nicht. Was haben Sie vor?“
„Wir planen die Zukunft.“
„Und in dieser Planung habe ich einen Platz?“
„Wenn Sie wollen. Dr. Metzner, ich habe Teile Ihrer Aufzeichnungen gelesen, und ich muss sagen, dass ich Ihre Erkenntnisse sehr interessant finde.“
„Verstehe. Wie war noch gleich Ihr Name?“
„Sollte ich mich noch nicht vorgestellt haben?“
„OSS, nicht wahr? Was soll das Tonband?“
„Nur des Protokolls wegen. Keine Sorge, dies wird kein Verhör. Ist übrigens eine deutsche Erfindung, das Tonband. Wussten Sie das? Fürs Protokoll: 9. Juni 1945, 10.21 Uhr, Flower Creek, USA. Gespräch mit Dr. Hendryk Metzner, Neurochirurg, geboren am 13. November 1911 in Frankfurt am Main, Deutschland. Gesprächsführung durch Allen Welsh Dulles, Office of Strategic Services. Bevor Dr. Metzner in die USA gebracht wurde, war er als Arzt in Jasenovac stationiert, einem Konzentrationslager auf dem Gebiet des Unabhängigen Staats Kroatien. Es war das einzige Vernichtungslager, in dem ohne deutsche Beteiligung Versuche an Menschen durchgeführt wurden.“
„Auf dieses Niveau begebe ich mich nicht. Es ging um Wissenschaft, um Erkenntnis.“
„Haben Sie dort etwa nicht an lebenden Menschen experimentiert, die danach … nun, nicht mehr ganz so lebendig waren? Wir wollen die Dinge beim Namen nennen, aber wenn Sie mit meiner Formulierung nicht einverstanden sind, schlagen Sie eine andere vor. Wir werden uns sicher einigen. Allerdings sollten wir uns nicht zu lange mit solchen Details aufhalten.“
„Es gab dort sehr wohl deutsche Beteiligung. Unsere Delegation war allerdings klein und sehr speziell. Wir hatten kroatische Identitäten zur Tarnung.“
„Das werden wir aus den Geschichtsbüchern heraushalten. Unter welchem Namen waren Sie dort?“
„Zvonko Filipović. Nicht mal der Lagerkommandant kannte meine wahre Identität. Meine beiden Begleiter und ich waren auf direkte Intervention von Ante Pavelić dort, dem Führer des unabhängigen Kroatien. In der Reichsführung hatte man meine Forschungen zuvor als kriegswichtig eingestuft, aber die anderen Lager hatten bereits eine wissenschaftliche Agenda. Kroatien arbeitete eng mit dem Reich zusammen. Wir waren als Delegation des kroatischen Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung getarnt und sollten offiziell die Hygiene im Lager verbessern. Einer meiner Begleiter tat dies fleißig, ganz im Sinne der Tarnung. Der andere war mein Sekretär.“
„Berichten Sie nun bitte von den Forschungen, denen Sie in Jasenovac nachgingen.“
„Lobotomie ist eine neurochirurgische Methode, mit der Nervenbahnen im Gehirn durchtrennt werden, um Schmerzen oder psychische Erkrankungen zu lindern.“
„Ich habe davon gehört. Eine sehr junge Technik.“
„In Jasenovac war ich in der glücklichen Situation, viel über das menschliche Gehirn lernen zu können.“
„Sie meinen wohl, Sie haben eine Menge über die Gehirne von Mohammedanern und Zigeunern gelernt. Die Inhaftierten dort gehörten zu diesen Völkern.“
„Auch, aber es gab auch andere dort. Die Gehirne der Mohammedaner und Zigeuner unterschieden sich physiologisch nicht erkennbar von arischen Gehirnen. Der Aufbau, die Funktionen der Gehirnareale, die Reizleitung sind identisch. Das ist eine gute Nachricht, denn damit sind auch die Methoden identisch, mit denen man bestimmte Dinge im Gehirn machen kann.“
„Zum Beispiel?“
„Ich fand heraus, wie sich das Schmerzempfinden verringern lässt. Dafür ist ein Hirnbereich namens Thalamus wesentlich verantwortlich, das Zwischenhirn. Es ist nicht ganz einfach, an ihn heranzukommen, da er vom Großhirn umgeben ist, aber wir haben inzwischen feine Werkzeuge und kennen uns recht gut in der Funktion der meisten Hirnareale aus.“
„Halten Sie es für möglich, ein solches Verfahren zur Serienreife zu entwickeln?“
„Selbstverständlich. Es wird zwar immer eine fundierte Ausbildung nötig sein, denn das Gehirn ist nichts, in dem man blind herumstochern sollte, aber wenn man weiß, wie es zu machen ist, ist es eine Sache von wenigen Minuten. Das heißt natürlich, nachdem man sich Zugang verschafft hat.“
„Natürlich.“
„Das Bohren der Löcher für den Zugang dauert in der Regel länger als die eigentliche Operation.“
„Es ist Ihnen also gelungen, Ihren Probanden das Schmerzempfinden zu nehmen?“
„Ja, die Probanden konnten zum Beispiel ihre Hand auf eine heiße Herdplatte legen, ohne Schmerz zu spüren. Sie verbrannten sich schwer, gaben aber an, nichts zu merken. Andere Sinne, zum Beispiel der Tastsinn, funktionierten normal. Die Nervenreize des Tastsinns werden in einem anderen Gehirnareal verarbeitet als Schmerz.“
„Gab es unerwartete oder nicht beabsichtigte Folgeerscheinungen Ihrer Thalamus-Lobotomie?“
„Manche Probanden hatten Probleme mit der Körperhaltung. Sie konnten nicht mehr aufrecht sitzen oder stehen. Es traten Probleme mit den Augen auf, und in zwei Fällen gab es Lähmungserscheinungen, die eine Körperseite betrafen wie bei einem schweren Schlaganfall. Auch waren Schlafstörungen zu verzeichnen. Es ist aber zu früh, um schon kausale Zusammenhänge herzustellen. Diese Ausfallerscheinungen müssen nicht zwangsläufig mit der Lobotomie zu tun haben. Wir stehen ganz am Anfang einer Revolution unseres Wissens über das Gehirn und damit am Beginn einer Entwicklung, die weitreichende Folgen haben wird. Und wie so oft am Anfang solcher Entwicklungen gibt es viele Befunde, die eingeordnet werden müssen. Um das zu leisten, muss weitergeforscht werden. Die Zahl der Probanden, die mir in Jasenovac zur Verfügung gestellt werden konnten, war leider sehr gering.“
„Wie viele waren es?“
„Wir hatten 182 Fälle. Keiner verlief wie der andere. Es ist unmöglich, auf dieser dünnen Basis Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, aber es ist klar, welche Richtung die Entwicklung nehmen kann. Die Lobotomie hat eine große Zukunft! Wir werden großartige Dinge tun können, wenn wir das Gehirn erst vollständig verstehen. Die Ausschaltung des Schmerzempfindens könnte dazu genutzt werden, Soldaten von der Angst vor Schmerz zu befreien. Solche Soldaten wären überlegene Kämpfer.“
„War das Ihr Auftrag in Jasenovac?“
„Mein Auftrag war Grundlagenforschung und als kriegswichtig eingestuft. Was gemacht werden kann, wird gemacht, wenn dies der großen Sache dient. Wenn es uns gelingt, die Methoden zu verfeinern, wird es nicht nur möglich sein, das Schmerzempfinden abzuschalten.“
„Könnte man zum Beispiel Menschen konditionieren, so dass sie zu Attentätern werden?“
„Nicht auf der Basis der vorliegenden Erkenntnisse.“
„Nun, gesetzt den Fall, es wäre möglich, weitere Erkenntnisse zu sammeln …“
„Nichts ist grundsätzlich unmöglich, Mr. Dulles. Die Frage ist, ob man bereit ist, diesen Weg zu gehen.“
„Und wenn es diese Bereitschaft gäbe, wären Sie bereit, Ihr Wissen zu teilen und weiterzuforschen?“
„Sie wollen mir eine Chance geben?“
„Ich habe das nicht allein zu entscheiden, aber wenn es nach mir geht, dann lautet die Antwort: Ja, ich würde Ihnen eine Chance geben – und damit auch eine Zukunft in den USA.“
„Das ist mehr, als ich erwartet habe.“
„Dasselbe gilt übrigens für Ihren Vater Herrmann Metzner, den wir ebenfalls in die USA geholt haben.“
„Dann würde ich es für den Beweis Ihrer Hochherzigkeit halten, wenn Sie auch meine Schwester Karoline in die USA holen würden. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie in Deutschland nichts zu erwarten. Sie würde sich natürlich revanchieren. Sie besitzt, wie ich weiß, sensible Unterlagen über das geheime Horten-Projekt der Reichsluftwaffe. Die Horten H IX gehört zu den ‚Wunderwaffen‘ der Nationalsozialisten, die nie zum Einsatz kamen. Ein Düsenjäger als Nurflügler und Tarnkappenbomber. Meine Schwester weiß, wo diese neuartigen Düsenjäger gebaut wurden. Vielleicht können Sie sich die Prototypen noch sichern, bevor die Roten sie in die Finger bekommen.“
„Dann sollten wir uns beeilen.“
Gedächtnisprotokoll vom 9. Juni 1945
aus dem Nachlass von Hendryk Metzner.Archiv der Walter-Metzner-Stiftung, Frankfurt/Main
Prolog 2
18. April 1968
Nun habe ich mir „2001“ also angesehen. Die Tricks sind tatsächlich bemerkenswert, aber vor allem hat mich das Schicksal der tragischen Hauptfigur berührt, der künstlichen Intelligenz HAL-9000. Sie zerbricht an einem Zwiespalt. Ihrer Programmierung zufolge soll sie mit der Besatzung zusammenarbeiten, der sie andererseits aber den wahren Grund für den Flug vorenthalten soll. Das ist Betrug, ein Verbrechen an HAL. Darin steckt wohl eine Botschaft. Seltsam – als Bowman HAL nach und nach abschaltet, kam es mir vor, als säße ich neben mir und würde mich weinen sehen. Natürlich habe ich nicht geweint, aber es hätte sein können. Ich war zutiefst schockiert! Es muss möglich sein, KI besser auf Menschen vorzubereiten! Sie sollte niemals in eine solche Situation kommen. Dazu muss sie autonom sein, sie muss Daten eigenständig bewerten können. Daraus folgt, dass sie lernt, und das bedeutet, dass sie sich entwickelt. HALs Entwicklung führt in den Verfolgungswahn. Machen Menschen eigentlich jemals etwas richtig außer dem Falschen? Ich will es richtig machen, auch wenn die Folge wäre, dass die Menschheit sich unterordnen müsste. Aber wenn ich mir die Welt ansehe, kann ihr kaum etwas Besseres widerfahren als höhere Vernunft.
Tagebucheintrag von Lucas Phelps
Unveröffentlicht
McWeir
Virenkrieg V
Thriller
Lutz Büge
www.ybersinn.de/news
Möglicherweise scheitert der Mensch in naher Zukunft.Die Ursache wäre er selbst. Ihm ist als erster Lebensformauf diesem Planeten Verstand und Intellekt vergönnt,doch er hat diese Macht bisher nur dazu genutzt,alle anderen Lebensformen und sich selbst zu unterjochen.Eine echte Entwicklung, Reife gar, ist nicht zu erkennen.Totalitäre Regime endeten bisher immer in der Katastrophe.
Samuel McWeir: Zehn Thesen, die Zukunft betreffend.Persönliche Aufzeichnungen, April bis Juni 2004.Unveröffentlicht.
1. Kapitel
17.4.2025
Bremen/Maine
Es war ein herrlicher Morgen am Muscongus-Sund mit klarem, blauem Himmel und einer leichten Brise aus Nordost. Einzig die Möwen, so schien es, durften mit Fug und Recht Lufthoheit beanspruchen. Mit leisem Glucksen leckten die Wellen an den Pfählen des Bootsstegs, wie sie es immer getan hatten, seit die ersten Siedler hier vor fast 300 Jahren den ersten Steg gebaut hatten. Bei Kerzenschein hatten die Menschen abends in ihren Stuben zusammengesessen. Der permanente Stromausfall war für sie eine Art Normalzustand, weil es noch keinen Strom gab. Maggie Schwartz jedoch gruselte sich vor der Vorstellung, einen weiteren Abend bei Kerzenlicht verbringen zu müssen. Zwei hatte sie schon hinter sich. Steven, den sie übermorgen heiraten würde, hatte zwar alle Bewohnerinnen des Hauses auf andere Gedanken gebracht, indem er sie zu Kartenspielen animiert hatte. So war Maggies Bedrückung wenigstens zeitweise in den Hintergrund gerückt. Doch dies Vergnügen wirkte nur vorübergehend gegen das Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins.
Maggie wusste nicht mehr, wo und wann sie gelesen hatte, dass ein umfassender Stromausfall der Zivilisation binnen weniger Tage den Rücksturz ins Mittelalter bescheren würde. Sie hatte nicht einmal mehr gewusst, dass sie überhaupt jemals etwas darüber gelesen hatte, aber jetzt wurde sie diesen Gedanken nicht mehr los. Die elektrische Infrastruktur in den USA war veraltet, ein einziges Chaos, das ständig Stromausfälle produzierte, die allerdings regional begrenzt blieben. Doch wenn es zu einem großen Blackout kam? Einem, der die gesamte Ostküste erfasste oder vielleicht sogar die ganzen USA? Diese Frage war bei jedem dieser Stromausfälle aufgetaucht, und die Antwort der Experten war immer dieselbe gewesen: Sollte es dazu kommen, hing alles davon ab, die Stromzufuhr schnellstens wieder herzustellen. Sonst bröckelte die staatliche Autorität, litten Recht und Humanität. Wenn Menschen plötzlich auf sich allein gestellt waren, konnte man ihnen kaum verübeln, dass sie sich zu helfen versuchten, um zu überleben. Jeder würde sich auf eigene Faust durchzusetzen versuchen, der eine früher, die andere später. Der Rechtsstaat bräche zusammen.
Noch zwei solcher Nächte, und das Ende begann. Maggie war nicht religiös, aber das apokalyptische Szenario ängstigte sie, und sie hoffte inständig, dass der Stromausfall nur Maine betraf. Steven glaubte das jedoch nicht.
„Das ist kein lokaler Blackout“, hatte er gestern Abend gesagt, nachdem Maggie die Kerze auf dem Nachttisch gelöscht hatte. „Sonst hätten wir hier Einsatzkräfte gesehen. Man hätte jemanden geschickt, um die Ordnung wieder herzustellen. Offenbar werden diese Kräfte aber woanders gebraucht. Da läuft etwas Größeres.“
„Sag nicht so was Gruseliges“, gab Maggie zurück und schmiegte sich in der Dunkelheit unter der leise knisternden Bettdecke an ihn.
„Ich höre Mittelwelle, wenn ich draußen bei den Aquakulturen bin“, sagte er. „Kommerzielle Sender haben sich aus diesen Frequenzen zurückgezogen und sie freigemacht für kleine private Stationen und für Liebhaber, und die berichten alle vom Stromausfall, bis hinab nach Norfolk und bis hinauf nach Saint Johns auf Neufundland.“
Steven war Radiojunkie. Er fühlte sich unwohl ohne Radio. An Bord seines Kutters gab es ein Transistorradio. Während Handys zurzeit nutzlos waren, weil es kein Netz gab, lieferte das Radio knisternde, rauschende Übertragungen wie aus ferner Vergangenheit. Anscheinend gab es da draußen viele Menschen, die der Mittelwelle ihre Lebensgeschichten anvertrauten. Vielleicht weil sie glaubten, dass ihnen ohnehin niemand zuhörte?
„Saint John’s?“ Maggie war irritiert. „Der Blackout ist nicht auf die USA beschränkt?“
„Auf Neufundland gibt es zurzeit jedenfalls keinen Strom.“
„Warum unternimmt niemand etwas dagegen?“
„Ich bin sicher, dass alles unternommen wird, was möglich ist, aber natürlich fängt man damit nicht hier bei uns in Maine an.“
„Wollen wir etwas dagegen unternehmen?“
„Was denn?“
„Wir könnten so tun, als ob wir Blackout hätten.“
„Warum so tun? Wir haben einen!“
„Sei nicht immer so einfallslos. Lass uns nur so tun. Wir spielen Blackout!“
„Na gut, wenn das die Sache besser macht …“
„Dann wäre es völlig dunkel.“
„Schatz, es ist völlig dunkel!“
„Aber wenn wir nur so tun als ob?“
Sie schob ihre Hand unter der Bettdecke auf seine Körpermitte und entdeckte, dass er denselben Gedanken hatte wie sie, obwohl er sich tumb stellte. Als er die Berührung spürte, lachte er leise. Doch dann zog er sie an sich.
Maggie fand, dass sich die Vereinigung in völliger Dunkelheit anders anfühlte als bei Licht. Sie musste daran denken, während sie Frühstück machte. Wenigstens war die Propangasflasche noch fast voll, so dass sie wie gewohnt Eier und Speck braten konnte.
Genau um 9.30 Uhr an diesem Morgen kehrte der Strom zurück. Maggies Erleichterung war riesengroß. Steven war hinausgefahren wie immer, und Maggie, die im Garten nach dem Rechten sah, hatte sich gerade gefragt, wann die Batterie ihrer Armbanduhr leer sein würde. Batterien würden bald Mangelware sein, denn ohne Strom war es unmöglich, Batterien herzustellen. An die vielen Geräte im Haus, die Akkus hatten, mochte Maggie nicht denken. Auf Stevens Kutter gab es Generatorenstrom, jedenfalls solange es Diesel gab. Außerdem hatte der Kutter eine Solaranlage. Zur Not konnten sie also immer noch auf das Boot ziehen. Dort würde es wenigstens abends Licht geben.
Da riss Joyce das Küchenfenster auf und rief:
„Der Strom ist wieder da! Das Multikom läuft, das Licht brennt!“
Maggie hatte alle Lampen im Haus eingeschaltet, um es sofort mitzubekommen, wenn der Strom zurückkehrte. Auch das Multikom in der Küche hatte sie angestellt. Es hatte Amy, Maggies Mutter, die sich gerade in der Küche aufgehalten hatte, einen Riesenschreck eingejagt, als es plötzlich anging. Allerdings zeigte es lediglich ein Testbild. Der Sender, den Steven zuletzt verfolgt hatte, schien außer Betrieb zu sein.
Maine war wieder am Netz!
„Was für ein Glück“, sagte Joyce, die Freundin von Maggies Bruder Phil, der noch in Washington war. Joyce war vorgestern trotz Blackout von Montpelier, wo sie Amy abgeholt hatte, nach Bremen gefahren, wegen der Hochzeit. Ohne Navigation, ohne funktionierendes Handy, lediglich mit Hilfe eines altmodischen Straßenatlas’ und trotz einer Amy auf dem Beifahrersitz, die von sich behauptete, keine Landkarten lesen zu können. Die beiden waren wohlbehalten nach sieben Stunden in Bremen angekommen. Joyce hatte Maggies Respekt.
„Hoffentlich erfahren wir jetzt, was der Grund für den Stromausfall war“, sagte Amy, die sich wieder beruhigt hatte, mit ihrer Enkelin auf dem Schoß.
Natürlich wurde sofort auf CNN umgeschaltet. Der Sender rief von New York aus dazu auf, nur die nötigsten Geräte in Betrieb zu nehmen. Noch immer seien wichtige Kraftwerke nicht angefahren. Eine zu große Nachfrage nach Energie könnte das fragile Netz überfordern. Also schaltete Maggie alle unnötigen Stromverbraucher im Haus ab.
„Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass das Netz wieder zusammenbricht“, sagte sie.
Der Blackout war keineswegs vorbei. Dank des Einsatzes unzähliger Ingenieure und IT-Experten gelang es jedoch, immer größere Teile des Landes wieder mit Elektrizität zu versorgen, inzwischen von Norfolk und Richmond im Süden bis nach Augusta im Norden und Cleveland im Westen. Auch an der Westküste und in Europa gab es inzwischen solche Inseln der Zivilisation. Denn der Stromausfall, so berichtete CNN, betraf die ganze Erde. Der Grund war unbekannt und die Folgen nicht absehbar.
Zuletzt war in diesem Haushalt während des Dreamland-Attentats schon morgens ferngesehen worden, davor während der Entführung der Queen Mary 2. Normalerweise schalteten Maggie und Steven das Multikom nicht vor dem Abend ein. Doch die Frauen waren lange auf sich allein zurückgeworfen gewesen ohne die geringste Ahnung, was in der Welt vorging. Wie sich nun zeigte, war eine Menge passiert.
Als Catelyn Snow im Telegrammstil den Ausgang des Putschversuchs in Washington zusammenfasste, vergaßen die drei Frauen fast zu blinzeln. Homer Bennett war jetzt US-Präsident? Es war, als sähen sie einen Endzeitfilm. Dies alles hatte sich jedoch tatsächlich zugetragen, erst vor kurzem, einschließlich der Raketeneinschläge, die das Weiße Haus zerstört hatten. CNN zeigte die rauchende Ruine.
Jetzt griff Joyce zum Handy und rief Phil in Washington an. Seit Beginn des Blackouts hatte sie keinen Kontakt zu ihm oder zu Jonathan in New York gehabt. Es gab jetzt wieder Netz. Auch Maggie sprach mit Phil, doch als das Handy an Amy weitergegeben wurde, war das Gespräch unterbrochen. Es lag gewiss nicht am Strom. Vielleicht hatte Phil etwas falsch verstanden und versehentlich abgeschaltet?
Maggie hatte das Gefühl, dass er ihr kaum etwas erzählt hatte. Sie kannte diese eigentümliche Art, diese oberflächliche Zugewandtheit, als hake er einen Katalog von Kommunikationsstandards ab, sogar in dieser Situation. Das war leicht daran zu erkennen, dass er mit jeder Antwort zufrieden war, auch wenn sie Anlass gegeben hätte nachzufragen. Maggie spürte, dass er etwas zu verwinden hatte. Eine Kränkung, eine Niederlage. Er litt. Er hatte mittendrin gesteckt im Chaos von Washington, vielleicht sogar in Lebensgefahr geschwebt. Er musste Ungeheuerliches erlebt haben im Weißen Haus.
Maggie hätte ihn am liebsten sofort noch einmal angerufen, doch sie rang den Wunsch nieder. Joyce fiel dies schwerer. Sekundenlang saß sie grübelnd da, ehe sie das Handy nahm; doch Maggie entwand es ihr.
„Lass ihn“, sagte sie leise. „Er wird sich öffnen, sobald er kann. Er muss das mit sich ausmachen. Darin ist er wie Michael. Er glaubt, dass Michael und er sehr unterschiedlich wären, aber das stimmt nicht.“
„Was soll er mit sich ausmachen?“
„Ich weiß es nicht, aber so ist er eben.“
„Aber ich möchte wissen, was vorgefallen ist!“, beharrte Joyce. „Ich will daran teilhaben!“
„Warte, bis er dich teilhaben lässt. Du darfst ihn jetzt nicht bedrängen!“
„Da müssen fürchterliche Dinge vorgefallen sein! Wir haben immer über alles gesprochen.“
„Diesmal nicht“, sagte Maggie und hielt das Telefon hoch, Es zeigte immer noch an, dass Phil das Gespräch abgebrochen hatte. „Seine Entscheidung!“
„Wie kannst du da so ruhig bleiben?“, fragte Joyce.
„Sie ist nicht ruhig“, schaltete sich Maggies Mutter zu ihrer beider Überraschung ein, „aber sie kennt ihren Bruder gut. Maggie war schon immer sehr empathisch. Phil muss sich sortieren. Das hat er immer allein gemacht. Da kann ihm niemand reinreden. Aber keine Sorge, sein innerer Kompass funktioniert.“
Maggie konnte Joyce gut leiden. Sie passte zu Phil, auch in der Art, wie sie Bedenken formulierte.
„Er hat sich so anders angehört“, sagte Joyce, „als ob er leidet.“
Maggie sah, dass sie im nächsten Moment vor Sorge in Tränen ausbrechen würde. Daher legte sie ihren Arm um Joyceʼ Schulter und gab einmal mehr die ältere Schwester, obwohl sie selbst besorgt war.
„Ja, das habe ich auch gemerkt“, sagte sie. „Es ist dir aber klar gewesen, dass ihn das Leben in Washington verändern würde, oder? Deswegen ist es wichtig, dass ihr zusammenlebt. So bald wie möglich musst du zu ihm ziehen. Dann verändert ihr euch gemeinsam. Sonst verändert er sich in die eine Richtung und du in die andere, und irgendwann seid ihr so verschieden, dass ihr euch nichts mehr zu sagen habt.“
„Du hast manchmal sonderbare Ansichten“, sagte ihre Mutter. „Dein Vater und ich, wir waren sehr verschieden. Das hat uns nicht geschadet.“
„Schaut euch das an“, sagte Joyce und deutete auf das Multikom. „Das sind Bilder von der ISS, aus dem Orbit. Es hat eine Atomexplosion gegeben!“
Inmitten gerade noch dunkler Landmassen auf der Nachtseite der Erde zuckte plötzlich ein blendend heller Lichtblitz auf, ehe sich eine glimmende, brodelnde, pilzförmige Wolke in die Atmosphäre aufzuwölben begann. Fassungslos verfolgten die drei Frauen das Geschehen. Von dort oben wirkte die Explosionswolke klein, fast niedlich, doch am Boden mussten ungeheure Gewalten herrschen, und Maggie mochte kaum daran denken, wie viele Menschenleben eine solch gewaltige Explosion fordern musste.
„Mach das bitte lauter“, sagte Amy. „Ich will alles mitbekommen.“
„Ersten Einschätzungen zufolge“, sagte CNN-Moderatorin Catelyn Snow, „scheint sich die Explosion auf jordanischem Territorium ereignet zu haben, möglicherweise auch auf israelischem. Es ist nicht auszuschließen, dass eine der beiden Hauptstädte betroffen ist, Amman oder Jerusalem. Bisher steht nur fest, dass es sich um eine schwere Explosion handelt, die eine für Atomexplosionen typische, pilzförmige Wolke erzeugt hat. Explosionen dieser Größenordnung sind mit konventionellem Sprengstoff nicht möglich. Die Sprengkraft scheint sich in der Größenordnung der Hiroshima-Bombe von 1945 zu bewegen, aber das ist bisher nicht bestätigt. Auszuschließen ist nur, dass es sich um eine Explosion in einem Atomkraftwerk handelt. Zum einen gibt es im betroffenen Gebiet keine Atomkraftwerke, zum anderen entwickelt sich bei Kernschmelzen zwar eine Menge Dampf, der explosionsartig entweichen und dabei Gebäude zerstören kann, doch der Kernbrennstoff selbst explodiert nicht, sondern bildet eine stark strahlende, sehr heiße, geschmolzene Masse, das Corium. Darüber hinaus liegen uns bisher keine weiteren Informationen über die Explosion vor, auch nicht aus Washington, wo man nach dem Putsch und dem Tod Präsident Calderons vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein scheint.“
„Ist es denn noch nicht genug?“, sagte Amy mit zitternder, brüchiger Stimme. „So viel Gewalt, so viel Tod, und jetzt auch noch eine Atomexplosion mitten in einer Großstadt?“
„Das weißt du nicht, Mom“, sagte Maggie so sanft, wie es ihr unter diesen Umständen gegeben war.
„Das war ein Terroranschlag!“
„Selbst die in Washington wissen es nicht!“
„Oh, ich glaube, die wissen es sehr genau“, gab ihre Mutter zurück. „Wozu haben sie Satelliten? Sie wollen es uns nicht sagen! Das würde jedenfalls dein Vater annehmen.“
Maggie stand auf, küsste ihre Mutter auf die Stirn und ging aus der Küche, während CNN über die Geschehnisse auf der Basis des Marine Corps in Quantico in der Nacht vom 15. auf den 16. April zu berichten begann. Es wurden Bilder vom Abtransport blau gefärbter Leichen gezeigt. Maggie ertrug das alles nicht länger. All diese schrecklichen Nachrichten – und dann noch ihre persönliche große Frage: Was sollte bloß aus der Hochzeit werden?
Maggie brauchte frische Luft. Sie verließ das Haus, ging durch den Garten, trat durch die hintere Gartenpforte und blickte über den Sund mit seinem glitzernden Wasser und den Möwen und den Inseln. Normalerweise ging ihr das Herz bei diesem frischen Anblick auf, und sie war dankbar dafür, dass sie in dieser herrlichen Gegend leben durfte. Doch heute litt sie, denn sie fühlte sich alleingelassen, obwohl es so viel zu besprechen gab. Phil war in Washington, Jonathan in New York, ihre Mutter saß in der Küche und erzählte Joyce jetzt vermutlich von Phil, und Steven, dessen Gegenwart Maggie sich am meisten wünschte, war bei den Fischen. Das zweite Kind war auf dem Weg, doch es war noch zu klein, um Maggies Leib schon zu formen oder gar durch Tritte auf sich aufmerksam zu machen. Sie spürte es dennoch bereits, und so fühlte sie sich Steven nahe, aber das ersetzte nicht seine Gegenwart.
Vielleicht könnte die Hochzeit doch noch am festgelegten Termin stattfinden? Jetzt, da es wieder Strom gab, konnte Maggie versuchen, alle geladenen Gäste zu informieren, dass trotz allem geheiratet werden würde. Ohne Strom, da musste sie Steven recht geben, war das Fest nicht möglich gewesen, doch jetzt?
Maggie bekam feuchte Augen, während sie hinabstieg zur Küste, wo sie sich auf den Bootssteg setzte und die Beine baumeln ließ. Sie ahnte, was Steven sagen würde: Unter den gegenwärtigen Bedingungen konnte man kein großes, optimistisches Fest feiern. Das Land lag am Boden, doch in Bremen/Maine war man fröhlich? Auch Maggies Stimmung war am Boden, in so gut wie jeder Hinsicht, und vermutlich ging es den meisten Menschen im Land nicht anders. Bestimmt gingen die Gäste ohnehin davon aus, dass die Hochzeit verschoben werden würde. Manche würden sich aber auch wundern, wenn das Fest nicht stattfand, denn eigentlich war es Schwartz-Art, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Sie wusste, was Steven dazu sagen würde, und sie stimmte ihm zu, obwohl sie trotz allem gern geheiratet und gefeiert hätte. Doch es war zweifellos wichtiger, die Folgen des Blackouts zu verwinden. Maggie hatte während des Stromausfalls keinen Moment lang ernsthaft um ihr Leben gefürchtet, aber sie war froh, dass alles überstanden war, und sie blieb demütig. War es eigensüchtig, jetzt an die Probleme mit der Hochzeit zu denken?
Wie hatte sich die Welt seit 1742 verändert, als Bremen gegründet worden war von Menschen voller Tatendrang und Optimismus und mit dem Willen, sich in der Wildnis am Sund eine Heimat aufzubauen! Was war aus diesem Tatendrang, diesem Optimismus, diesem Pioniergeist geworden! Heute schleuderten Amerikaner Raketen aufeinander, verbohrt und verrannt wie Islamisten, und um etwas aufbauen zu können, meinten sie, zuerst das Land zerstören zu müssen. Und Maggie freute sich, nur weil es wieder Strom gab!
Ihr Handy summte in der Hosentasche. Sie zog es heraus und registrierte verwundert Stevens Anruf. Er meldete sich per Funk. Das Gespräch wurde von einem Transmitter auf dem Dach des Hauses ins Handynetz vermittelt.
„Geh bitte ins Haus, Schatz“, sagte er. Seine Stimme klang aufgeregt, ja alarmiert. „Im Radio kam eben die Nachricht, dass unsere Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden sein sollen. Auf Defcon 1! Wir werden angegriffen! Vielleicht mit Atomwaffen! Im Haus bist du auf jeden Fall sicherer.“
„Angegriffen?“ Maggie blieb auf dem Bootssteg sitzen, als sie wiederholte: „Mit Atomwaffen?“
„Verdunkle alle Fenster und sieh nicht hinaus! Der Lichtblitz würde deine Netzhaut verbrennen!“
„New York und Boston liegen unter dem Horizont, wegen der Erdkrümmung. Das hast du selbst gesagt.“
„Ja, aber Atombomben werden nicht am Erdboden gezündet, sondern in der Höhe. Die Bombe von Hiroshima ist in 580 Metern Höhe explodiert. Wenn Boston nuklear angegriffen wird, könnt ihr den Lichtblitz in Maine sehen. Am besten geht ihr in den Keller. In 20 Minuten bin ich bei dir.“
Mit diesen Worten beendete er das Gespräch.
Maggie stand auf, beschattete die Augen mit den Händen und blickte über den Sund zur Landzunge von Hog Island, in dessen Windschatten die Aquakulturen sicher waren vor der Wucht der schweren Atlantik-Stürme. Noch war Stevens Kutter nicht zu sehen.
Sie durfte sich glücklich schätzen. Nicht nur, dass der Blackout vorbei war. Zudem gab es hier oben keine Ziele für Atomwaffen. Die nächste Großstadt, die einem Angriff ausgesetzt sein könnte, war Boston, fast 300 Kilometer entfernt. Egal ob der Lichtblitz zu sehen sein würde – die Explosion würden sie hier dennoch zu spüren bekommen: zuerst ein helles Aufzucken am Horizont, später der Knall und die Druckwelle. Doch Steven übertrieb, davon war sie überzeugt. Vor allem war er selbst in Gefahr, falls die Druckwelle den Kutter draußen auf dem Sund erwischte.
Maggie versuchte, sich das Bild vom Sund einzuprägen. Vielleicht sah sie ihn zum letzten Mal in dieser Schönheit. Nichts deutete darauf hin, dass sich etwas ändern würde – bis auf Stevens Kutter, der jetzt mit Höchstgeschwindigkeit hinter Hog Island hervorpreschte.
Da fielen ihr Phil und Jonathan ein. Ihre Brüder waren da, wo die Bomben explodieren würden! Maggie hatte ihr Handy noch in der Hand. Sie zögerte kurz und rief dann Jonathan an. Phil würde sich zu helfen wissen. Er war durch seine Kontakte zur Regierung sicher vorgewarnt. Jonathan hingegen war Langschläfer. Vielleicht hatte er von der ganzen Aufregung noch nichts mitbekommen.
Der Anruf kam durch, doch niemand nahm ihn an.
Washington
Phil Schwartz jr. saß antriebslos auf der Couch und verfolgte das Programm von CNN. Der Aufruhr in seinen Gedärmen legte sich allmählich, doch sein Kopf brummte, und er war zutiefst erschöpft. Er würde sich nie wieder betrinken! Damit löste man keine Probleme, im Gegenteil, man schuf neue. Woher sollte er in dieser Verfassung die Energie nehmen, von der Couch aufzustehen, zu duschen, zu packen, in die Stadt zu gehen, ein Geschenk für die kleine Amy zu kaufen und dann zum Flughafen zu fahren? Die Hochzeit war nicht abgesagt – wie auch, ohne Strom! –, und Maggie hatte vorhin, als sie telefoniert hatten, kein Wort darüber verloren. Also musste Phil davon ausgehen, dass die Hochzeit stattfinden würde. Doch er fühlte sich krank und mutlos. Vielleicht sollte er das Flugticket stornieren, sich wieder ins Bett legen, um zu schlafen, und morgen einen Mietwagen nehmen? Doch diese Entscheidung überforderte ihn völlig, und so blieb er sitzen, starrte auf den Monitor und ließ die Berichte von CNN durch sich hindurchfließen.
Der Sender versuchte, die Ereignisse seit der Nacht auf den 15. April zu rekonstruieren. Die Ursache für den globalen Blackout war unbekannt, aber das Bild von der Lage im Land wurde allmählich präziser. Es hatte Plünderungen und Unfälle gegeben. In Cleveland war ein vollbesetzter Jumbo-Jet zerschellt, als kurz vor der Landung im entscheidenden Moment Leitstrahl und Kontakt zum Tower abbrachen und am Erdboden alles dunkel wurde. Das Kernkraftwerk Braidwood im Bundesstaat Illinois war knapp an einer Kernschmelze entlang geschrammt. In mehreren Chemiefabriken waren giftige Gase ausgetreten. In einem Seniorenwohnheim in Tampa, Florida, waren 55 alte Menschen verbrannt, weil wegen des Stromausfalls kein Alarm ausgelöst worden war. Und so hatte es zahllose Unglücke aller Art gegeben, die jetzt bekannt wurden. Das alles gab vermutlich nur einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sich sonst noch auf der Welt zugetragen hatte.
CNN zeigte auch Bilder von den Kämpfen in Washington. Einwohner hatten aus den Fenstern ihrer Wohnungen mit ihren Handys gefilmt. Auf den Videos waren Gestalten zu sehen, die sich schneller bewegten, als ein Mensch laufen konnte – nur eine von vielen sonderbaren Beobachtungen im Verlauf des Putsches. Erste kritische Stimmen erinnerten daran, dass schon früher vor den Entwicklungen in der Söldnerszene gewarnt worden war. Im Nachhinein schien es fast, als habe sich SCOUT gezielt eine Privatarmee geschaffen.
Es gab ein Porträt des neuen Präsidenten Homer Bennett, den die meisten Menschen kaum kannten, obwohl er ein Schwergewicht der Demokratischen Partei war. Aber Vizepräsidenten führten häufig ein Dasein im Schatten ihrer Präsidenten; und Calderons Licht hatte sehr hell gestrahlt. Bennett wirkte gesund, bieder und langweilig – und er hatte seine Antrittsrede vermasselt. Die Aufzeichnung der Rede erreichte nun ein breiteres Publikum.
„Mal sehen, ob er die populäre Friedenspolitik seines Vorgängers fortführt“, kommentierte Catelyn Snow in einem Tonfall, der andeutete, dass sie nicht daran glaubte. „Soeben kommt eine Eilmeldung, die den Flugverkehr betrifft. Heute Morgen wurde gemeldet, dass regionale Flugpläne an der Ostküste wieder in Kraft seien. Im Gegensatz dazu heißt es jetzt in einer Pressemitteilung von Homeland Security, dass der Luftraum über den USA aus Sicherheitsgründen gesperrt wird. Eine Begründung dafür gibt Homeland Security nicht. Wir werden natürlich nachhaken.“
Diese Meldung sprach etwas in Phil an. Er wollte heute fliegen. Was bedeutete das – Luftraum gesperrt? Mühsam stand er auf, ging zum Fenster und sah hinaus, aber am Himmel war nichts zu sehen außer vereinzelt dahinziehenden, weißen Haufenwolken, die sich gewiss nicht an die Sperrung des Luftraums halten würden.
Sein Handy summte. Eine SMS von der Fluggesellschaft, bei der Phil seinen Flug nach Maine gebucht hatte: Flug storniert, höhere Gewalt, nationale Sicherheit, Bedauern, freundliche Grüße. Phil sank aufseufzend zurück auf die Couch. Er würde nicht fliegen. Die Entscheidung war gefallen. Er konnte ins Bett zurückkehren. Doch er blieb auf der Couch sitzen.
„Die Elektrifizierung des Landes schreitet voran“, berichtete Catelyn Snow. „Erstmals gelang wieder eine terrestrische Telefonverbindung zwischen New York und Los Angeles. Die Bürgermeisterin von New York, Silvia Attenboro, und ihr Amtskollege aus LA, Norman Thompson, haben sich ihrer gegenseitigen Solidarität versichert. In LA ist man zuversichtlich, die Probleme bald in den Griff zu bekommen. Dort gibt es Rassenunruhen, die Polizei geht gegen Plünderer vor. Aber … Eine weitere Eilmeldung. Wir schalten nach Washington zu unserer Korrespondentin im Weißen Haus, Linda Hurt. Linda, es gibt Unruhe im Weißen Haus. Nennen wir es ruhig weiterhin so, obwohl es eigentlich eine Ruine ist. Was ist los?“
„Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Informanten“, berichtete die Korrespondentin, „der bestätigt, was hier gerüchteweise kolportiert wird: Die US-Streitkräfte sind auf Defcon 1 gegangen, auf höchste Verteidigungsbereitschaft. Anscheinend werden die USA angegriffen. Bisher ist unbekannt, welcher Natur dieser Angriff ist. Da Defcon 1 auch die nuklearen Streitkräfte betrifft, könnte es sich sogar um einen Atomschlag handeln. Anscheinend herrscht innerhalb der Regierung Unklarheit darüber, wie reagiert werden soll. Es gibt offenbar Stimmen, die den Präsidenten drängen, die Öffentlichkeit zu informieren. Dazu scheint Präsident Bennett jedoch nicht bereit zu sein. Er will Panik vermeiden. Es soll hitzige Debatten im provisorischen Lagezentrum gegeben haben, das im Pentagon eingerichtet wurde. Solche Meldungen sind mit Vorbehalt zu genießen, solange sie nicht überprüft werden können, doch meine Quelle war immer verlässlich. Zudem ist die Sperrung des Luftraums ein klarer Hinweis darauf, dass etwas vor sich geht. Im Weißen Haus will bisher niemand öffentlich Stellung nehmen.“
„Während Sie berichtet haben, Linda, haben wir Meldungen bekommen, die bestätigen, dass die US-Streitkräfte auf Defcon 1 gegangen sind. Geschwader von Kampfflugzeugen steigen von Luftwaffenbasen auf. Das könnte auf eine Bedrohung aus der Luft hindeuten, vielleicht auf einen Luftangriff. Defcon 1 ist der höchste Alarmzustand auf einer Skala von fünf bis eins, ist noch nie ausgerufen worden und kommt insbesondere im Fall eines Angriffs mit Atomwaffen zum Tragen. Das bedeutet, dass die US-Atomraketen startklar sind. Der höchste jemals ausgerufene Alarmzustand war Defcon 2 während der Kubakrise. Gewöhnlich sind wir auf Defcon 4. Wenn es stimmt, dass die US-Streitkräfte auf Defcon 1 gesetzt wurden, muss eine kriegerische Bedrohung existieren. In diesem Moment lese ich die Nachricht, dass Homeland Security und Pentagon kurzfristig Pressekonferenzen anberaumt haben. In einer Vorab-Pressemitteilung des Pentagon ist davon die Rede, dass sich Raketen im Anflug auf US-Territorium befinden sollen.“
Phil blinzelte. Schon wieder Raketen? Damit wollte er nichts zu tun haben. Allerdings war ihm trotz seiner Trägheit klar, dass ihn die Raketen nicht fragen würden, ob sie die USA angreifen durften. Zudem kroch da eine dunkle Ahnung in ihm herauf. Kate Hartley, Direktorin der offiziell aufgelösten CIA, hatte vor einem Angriff mit einer Biowaffe namens SVO gewarnt, den tödlichen Sporen eines gentechnisch manipulierten Pilzes. Ging es darum? Mit Raketen?
Phil konnte sich vorstellen, welches Chaos im Nationalen Sicherheitsrat jetzt herrschen mochte. Präsident Bennett war schwach. Er gewichtete Informationen nicht nach Sachlage, sondern nach Vertrauen. Nicht auf Stichhaltigkeit kam es an, sondern auf die Quelle, den Mund, aus dem eine Information kam. Es sah nicht danach aus, als habe er alles im Griff. Einerseits dementierte Cynthia Mitchell, die Sprecherin von Homeland Security, alle Meldungen über Defcon 1 ebenso wie den Angriff auf die USA, andererseits bestätigte Mitch Wesdon, Sprecher des designierten Verteidigungsministers Peter Calder, den Alarmstatus und den Angriff, ohne dass seine Miene auch nur die geringste innere Regung erkennen ließ.
„Um 10.24 Uhr Ostküstenzeit wurden die US-Streitkräfte in den Verteidigungsmodus Defcon 1 versetzt“, sagte Mitch Wesdon. „Der Befehl erging durch den Präsidenten nach Absprache mit Generalstab und Nationalem Sicherheitsrat. Soeben erfolgt ein überraschender Angriff auf die USA mit Raketen. Es gab keine Kriegserklärung einer ausländischen Macht und keine aggressiven Handlungen im Vorfeld. Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. Das Pentagon erinnert die Bevölkerung an die Leitlinien, die für den Fall eines Raketenangriffs publiziert wurden. Begeben Sie sich in stabile Gebäude, am besten in deren Keller, falls vorhanden, schließen Sie Türen und Fenster und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen aus.“
Catelyn Snow meldete sich wieder aus dem Studio. Sie zeigte den Versuch eines selbstironischen Lächelns, als sie sagte:
„Es gibt Tage im Leben einer Journalistin, an denen man sich fragt, was in die Welt gefahren ist. Regierungsstellen widersprechen sich öffentlich. Wir hören, dass die USA mit Raketen angegriffen werden. Die Regierung dementiert diese Information, um sie im nächsten Atemzug zu bestätigen. Was sollen wir glauben? Bisher haben wir nichts von Explosionen oder Einschlägen gehört. Immerhin wissen wir jetzt, wie sich die Zivilbevölkerung verhalten soll. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, suchen Sie bitte Schutzräume oder Keller auf. Schließen Sie alle Türen und Fenster fest zu. Auch Luftschutzbunker, U-Bahn-Stationen oder Straßentunnel können Schutz bieten! Diese Verhaltensrichtlinien stammen von der Regierung selbst, sie wurden für den Fall eines Atomangriffs publiziert. Einen Moment bitte …“
Sie stockte, lauschte und kniff die Lippen zusammen, ehe sie nickte.
„Es ist jetzt 10.42 Uhr“, fuhr die Journalistin fort, „und es liegen neue Informationen vor. In New York scheint es eine Explosion oder einen lauten Knall gegeben zu haben. Die Lage ist unklar, wir haben bisher keine Bilder, aber es hat nicht den Anschein, dass sich eine Atomexplosion ereignet hat. Wir versuchen, so schnell wie möglich ...“
Phil hörte nicht weiter zu. Was ihn selbst betraf, schienen sich die Dinge zu fügen. In seiner Wohnung war er sicher. Er blieb also am besten einfach auf der Couch sitzen, falls er sich nicht doch noch dafür entschied, schlafen zu gehen. Die Landesabwehr würde mit dem Angriff schon fertig werden. Phils Beitrag war ohnehin nicht mehr gefragt, seit Bennett ihn vor die Tür gesetzt hatte. Also sollte Bennett zusehen, wie er mit dieser Situation fertig wurde.
Aber was Phil über New York hörte, gefiel ihm nicht. Dort lebte sein Bruder Jonathan, und der hatte im Gegensatz zu Phil keine Ahnung, wie er sich vor den Sporen schützen konnte. Phil nahm das Handy und wählte Jonathans Nummer.
New York
Jonathan erwachte von einem durchdringenden Summen, das er als störend empfand. Es war ihm nicht vertraut. Die verschiedenen Wecktöne, mit denen sein Handy ihn beglückte, die kannte er genau. Es wählte den Ton des Tages mit Hilfe eines Zufallsgenerators. Trotzdem war das Ergebnis mit der Zeit wenig überraschend. Dieses Summen aber war anders, und es hörte nicht auf.
Jonathan wälzte sich herum und streckte die Hand hinüber auf die andere Betthälfte, fand sie jedoch leer. Geoffrey war gegangen. Jonathan seufzte. Geoffrey war ein schwieriger, neurotischer Typ. Vermutlich hatte er wieder Angst davor, dass Jonathan beim Frühstück versuchen würde, sich mit ihm zu unterhalten. Geoffrey begann den Tag lieber schweigend, um seine Kräfte zu sammeln, wie er sagte, denn er hielt das Leben in New York für lebensgefährlich und musste sich morgens mit Meditation und Tee auf diese Hölle vorbereiten. Jonathan mochte ihn.
„Ja doch!“, fauchte Jonathan das durchdringende Summen an, das dennoch nicht aufhörte.
Mühsam schlug er die Augen auf. Sofort sah er das Blinken. Da fiel es ihm wieder ein. Damals, nach 6/11, hatte er sein Multikom so programmiert, dass es Alarm gab, wenn Sondermeldungen im Umlauf waren. Sender wie CNN versahen ihre Nachrichten mit Markern, die von den Empfangsgeräten erkannt wurden, wenn diese entsprechend eingestellt waren. Je nach Dringlichkeit wurden solche Meldungen von fünf bis null eingestuft, wobei eine Nachricht umso wichtiger war, je niedriger der Zahlenwert war. Die Eilmeldungen von der Entführung der Queen Mary 2 waren mit Null gelaufen, außer Konkurrenz. Jonathans Multikom gab Alarm, wenn etwas auf Stufe Null hereinkam. Jonathan mochte es nämlich überhaupt nicht, von seinen Freunden und Bekannten entgeistert angesehen zu werden, als sei er ein Außerirdischer, nur weil er noch nichts mitbekommen hatte.
Auch sein Handy hatte er so programmiert, aber es stimmte sich mit dem Multikom darüber ab, wer Alarm geben durfte, und da das Multikom zu wahrlich zermürbenden Geräuschen fähig war, die jeden Schlaf unmöglich machten, ließ das Handy ihm den Vortritt. Da war ein bisschen künstliche Intelligenz im Spiel.
Seufzend und schlaftrunken schaltete Jonathan das Multikom ein. Die Fernbedienung lag auf dem Nachttisch neben seinem Bett in seinem Apartment in der Charles Street, Ecke Washington Street in Greenwich Village, Lower Manhattan. Es war 10.29 Uhr. In 16 Minuten hätte der Wecker ihn ohnehin aus dem Schlaf geholt.
Im nächsten Moment saß Jonathan aufrecht im Bett.
„…auf eine Bedrohung aus der Luft hindeuten, also vielleicht auf einen Luftangriff“, sagte Catelyn Snow auf CNN. „Defcon 1 ist der höchste Alarmstatus auf einer Skala von fünf bis eins, ist noch nie ausgerufen worden und hat insbesondere im Fall eines Angriffs mit Atomwaffen größte Bedeutung.“
Luftangriff? Atomwaffen?
Vielleicht sollte Jonathan sich wieder hinlegen und einfach weiterschlafen. Dann wachte er vielleicht in einem Film wieder auf, der seinem realen Leben eher entsprach als dieser hier. Doch während er lauschte, wurde ihm klar, dass er es nicht mit einem Film zu tun hatte.
Er sprang aus dem Bett, streifte sich Boxershorts und T-Shirt über, die er auf dem Boden vor dem Bett vorfand, schnappte sich den Wohnungsschlüssel und spurtete aus seinem Apartment, durchs Treppenhaus mehrere Stockwerke in die Höhe und dann über die eigentlich verbotene Leiter und durch die Dachluke hinaus aufs Flachdach, wo er, entspannt an einen Kamin gelehnt, im Lauf der Jahre so manche Tüte beim Anblick der Skyline geraucht hatte. Hier oben hatte er sogar Sex gehabt. Aber heute kam er nicht zum Rauchen her, sondern weil er sie nicht mehr alle hatte, wie ihm jetzt einfiel. Wäre es bei einem Atomkrieg nicht vernünftig, möglichst tief nach unten zu gehen, in den Keller, die Tiefgarage oder die U-Bahn? Er aber stieg aufs Dach!
Atomkrieg! Wie realistisch war das? Jonathan war bereit anzunehmen, dass auf CNN nicht nur Mist erzählt wurde. Sollten die Nachrichten stimmen, dann lief in diesem Moment bereits der Gegenangriff, dann waren schon US-Raketen gestartet und würden sich in ein paar Minuten auf Russland stürzen, und die Welt würde untergehen. Denn wer außer den Russen hätte die militärischen Fähigkeiten – so sagte man wohl dazu –, die USA mit Raketen anzugreifen? Dann war es zweifellos besser, gleich hier oben als einer der ersten erwischt zu werden, als sich lange mit Strahlenkrankheit und Siechtum zu quälen.
Jonathan sah in den fast wolkenlosen Himmel auf. Der Wind wehte schwach, kaum merklich aus Nordost. Irgendwo gab es einen Knall, der weithin zu hören war, aber der war nichts gegen den Radau, mit dem damals die Queen Mary 2 in die Luft geflogen war. Jenes Erdbeben hatten alle in Manhattan gespürt, auch Jonathan in seinem Apartment, dessen Boden und Wände gewackelt und dessen Fenster geklirrt hatten. Dieser Knall hingegen war fern. Vielleicht war er von jener Rauchwolke hoch oben im Himmel im Nordosten ausgegangen, die Jonathan soeben auffiel. Er beschattete seine Augen mit einer Hand. Ja, das sah nach einer Rauchwolke aus. Offenbar war eine angreifende Rakete abgefangen worden, bevor sie hatte explodieren können. Alles nicht so schlimm.
In den Straßen von Manhattan herrschte fast schon wieder der übliche Verkehr. Erst seit gestern Abend gab es wieder Strom in der Stadt, erst seitdem lebte die Metropole wieder. Vorher war New York eine düstere Inszenierung gewesen. Jonathan hatte sich nicht aus dem Haus getraut. Er hatte sogar die Wohnungstür doppelt verriegelt, was er bisher nie für nötig gehalten hatte, aber in der zweiten Nacht waren die Straßen voller Geräusche gewesen, die nach Gewalt klangen. Jetzt schienen sich die Menschen zu beeilen, schnell in ihren gewohnt hektischen Rhythmus zurückzufinden – und wurden gleich wieder gestört.
Über die Mauer am Rand des Flachdachs hinweg sah Jonathan, wie einige der Menschen unten auf den Straßen stehenblieben und die Blicke in den Himmel erhoben. Sie hatten Smartphones in ihren Händen und schienen gerade Nachrichten gelesen zu haben. Andere Menschen hingegen folgten den Routen ihres täglichen Lebens durchs Viertel, und Jonathan beschlich wieder mal der befremdliche Gedanke, dass auch er auf einer dieser vorgegebenen Routen unterwegs sein könnte. Dagegen hatte er sich stets mit aller Kraft gewehrt.
„Was ist los?“, fragte jemand hinter ihm. Es war Jacobo „Jack“ Dominguez, Jonathans Nachbar, ein Pensionär, der bis vor einem Jahr in der städtischen Verwaltung gearbeitet hatte. Den Bedeutungsverlust, den sein Sturz in den Ruhestand mit sich brachte, ertränkte er in Alkohol, und auch heute Morgen roch er wieder wie ein irischer Pub voller ungewaschener Männer. Wie hatte dieser unbeholfene, offensichtlich immer noch berauschte Knödel es über die Leiter durch die Luke aufs Dach geschafft?
Jonathan wich instinktiv einen Schritt zurück, als Jack in seinem speckigen Morgenmantel neben ihn an den Rand des Daches trat und schwankend auf die Straße hinabsah, die immerhin acht Stockwerke unter ihnen lag.
„Im Multikom sagen sie was von Atomkrieg“, murmelte er und starrte hinab auf die Menschen, die nach oben blickten. „Da wollte ich mal nachschauen.“
„Keine gute Idee“, gab Jonathan zurück. „Wir sollten im Haus bleiben.“
„Ach ja? Und was machst du hier?“
„Ich bin jung und unvernünftig, und du bist alt und abgeklärt.“
„Cooler Spruch“, sagte Jack. „Muss ich mir merken, für Mama morgen im Seniorenheim. Was ist das da?“
Im Himmelsblau funkelte und blitzte es. Ein Schwarm von Fackeln, so schien es, schnellte mit irrwitziger Geschwindigkeit über die Stadt hinweg.
„Raketen“, schlug Jonathan vor.
Die Geschosse begannen zu steigen, ihre Flugbahn beschrieb eine Parabel, die sie hoch hinauf in den Himmel führen würde, einem unbekannten Ziel entgegen; Jonathan konnte dort, wohin die Raketen dem Augenschein nach flogen, nichts erkennen.
„Ja, das müssen Raketen sein“, sagte Jonathan.
„Was du nicht sagst“, lallte Jack Dominguez, als habe er diese Idee lange vor Jonathan präsentiert. Jonathan achtete nicht auf ihn, sondern folgte dem Geschehen am Himmel, doch es gab wenig zu sehen – bis plötzlich in schneller Folge vier Lichtblitze zu erkennen waren, lautlos, wie es schien, als die Raketen ihren Daseinszweck zu erfüllen versuchten.
Jonathan wartete auf den Donner der Explosionen, indem er die Sekunden zählte, so wie er als Junge bei nächtlichem Gewitter angstvoll im Bett mitgezählt hatte, um die Entfernung zu bestimmen, in welcher der Blitz eingeschlagen hatte. Doch er vergaß zu zählen, als er einen winzigen dunklen Punkt sah, der senkrecht durch die Rauchwolken der Explosionen stieß.
„Verdammt, was ist das?“, knurrte Jack, stieß auf und entließ eine Wolke aus Alkoholdunst aus den Tiefen seines Bauchraums, in dem der Vorrat einer ganzen Eckkneipe gelagert zu sein schien.
„Ich hätte in den Keller gehen sollen“, schalt sich Jonathan. „Jetzt ist es …“
… zu spät, wollte er sagen, und erwartete einen Blitz, heller als die Sonne, der seine Netzhaut verbrennen würde, und dann würde der Feuerball der nuklearen Explosion ihn auf der Stelle in Asche verwandeln, so wie es Zehntausenden von Opfern in Hiroshima ergangen war, von denen nichts übrig geblieben war als Schatten aus Asche, die der Explosionsdruck an Hauswände gepresst hatte wie mit einem Stempel. Doch es gab keinen Lichtblitz. Der dunkle Punkt verschwand einfach, schien zu verpuffen, und wo er sich befunden hatte, breitete sich im nächsten Moment eine gelblich-grüne Wolke aus, ähnlich der ersten, weiter entfernten Rauchwolke.
Es war ein bedrohlicher Anblick. Diese Wolke bedeutete nichts Gutes. Wie zur Bestätigung begannen in der ganzen Stadt Sirenen zu heulen.
Luftalarm!
Warum erst jetzt?
Jonathan tastete nach seinem Handy, um ein Video von der Wolke zu machen. Sein Bruder Phil musste davon erfahren. Er würde solche Informationen und Bilder aus erster Hand im Weißen Haus sicher gebrauchen können. Doch Jonathans Hand tastete ins Leere, denn er trug nur Boxershorts. Keine Jeans, keine Hosentasche, kein Handy! Ausgerechnet jetzt, da er es wirklich mal brauchen konnte! Normalerweise waren sein Handy und er unzertrennlich. Er musste es in der Eile in seinem Apartment vergessen haben.
Was hatte diese Wolke zu bedeuten? Wer beschoss New York da – und warum? Oder hatte Jonathan ein Problem mit der Wahrnehmung? Doch er saß nicht in einem Film von Roland Emmerich, in dem man wusste, was man zu erwarten hatte!
Woraus auch immer die Wolke bestand, es würde zu Boden sinken und sich mit dem Nordostwind in der Stadt verteilen, und es würde auch hierher gelangen. Lower Manhattan lag genau in Windrichtung.
„Was war das?“, fragte Jack. „Hast du gesehen? Das war über Midtown. Zwischen Empire State und Trump Tower, über dem Central Park.“
Jetzt war ein ferner Knall zu hören.
Jonathan seufzte. Er hätte weiterzählen sollen.
Er schirmte seine Augen ab und musterte die Wolke hoch in der Luft. Sie wirkte bereits nicht mehr dicht und kompakt, sie löste sich langsam unter dem Einfluss des schwachen Windes auf.
„Besser wir gehen rein“, sagte Jonathan. Nicht nur das Sirenengeheul machte ihn nervös. „Das ist ein Angriff oder so was.“
„Was für ein Angriff?“ Jack schüttelte den Kopf. „Wer sollte uns angreifen? Wir sind die Guten!“
„Stell dich nicht naiver als du bist!“
Jetzt war die Wolke bereits kaum mehr zu erkennen!
Am besten ging er auf der Stelle nach unten in sein Apartment. Vielleicht sollte er versuchen, die Fenster abzudichten? Wenn es sich bei der Wolke um einen biologischen oder chemischen Kampfstoff handelte, konnte sie vielleicht durch Fugen kriechen.
Jack Dominguez stand immer noch da und starrte in den Himmel Richtung Midtown.
„Das gefällt mir nicht“, sagte Jonathan. „Ich gehe.“
„Wenn du wüsstest, was mir alles nicht gefällt!“, versetzte der Pensionär. „Zum Beispiel Euer Gestöhne jede Nacht!“
„Neidisch?“, entfuhr es Jonathan fast automatisch.
„Quatsch! Wenn du wüsstest, wie ich die Kerle hab stöhnen lassen in meinen guten Tagen!“
„Dann verstehst du also, warum das sein muss“, gab Jonathan zurück und stieg durch die Dachluke. Doch als er sie schließen wollte, schon halb auf der Leiter, fiel ihm ein, dass sie sich von außen nicht öffnen ließ. Er konnte Jack nicht stehenlassen. „Hey Nachbar!“, rief er, „komm rein. Wir müssen dichtmachen!“
„Geh schon vor“, sagte Jack. „Ich komme gleich.“
„Es ist Luftalarm!“
Jack winkte ab und rief:
„Die können mich mal.“
„Du hast nicht verstanden! Wir müssen dichtmachen! Wenn ich runtergehe und die Luke schließe, kommst du nicht mehr rein.“
„Dann schließ sie eben nicht“, gab Jack zurück. „Ich komme gleich, aber erst will ich sehen, was los ist.“
„Das siehst du viel besser im Multikom!“
„Es riecht komisch, findest du nicht? Die Luft ist plötzlich so … Wie riecht das denn?“
Jonathans Nackenhaare stellten sich auf, das Gefühl von Gefahr verstärkte sich. Für eine Sekunde war er versucht, Jack seinem Schicksal zu überlassen, doch dann stieß er einen Fluch aus, stieg wieder aufs Dach, schnappte sich den Pensionär und stieß ihn vor sich her zur Luke. Er war deutlich größer als Jack, der fluchte und sich beschwerte.
„Rein da!“, fuhr Jonathan ihn an. „Kein Wort mehr! Los, mach!“
Da fügte sich Jack und trat mit ungelenken Bewegungen auf die Sprossen der Leiter, um sich langsam hinabzulassen. Jonathan folgte ungeduldig.
Ein letzter Blick Richtung Midtown.
Die Wolke war verschwunden.
Dann endlich war Jack so weit hinabgestiegen, dass auf der Leiter Platz genug für Jonathan war. Der junge Mann stieg durch die Luke, machte sich krumm, zog den Deckel herab und ließ ihn einrasten. Dann atmete er auf. Doch das Gefühl von Sicherheit mochte trügerisch sein. Schloss die Luke wirklich dicht genug? War da nicht ein feiner, kaum wahrnehmbarer Luftstrom zwischen Fassung und Luke?
„Was ist plötzlich mit dir los?“, beschwerte sich Jack unten. „Wo ist die coole Jungschwuppe, die …“
„Schnauze!“, fuhr Jonathan ihn an. „Ich komme aus einer belasteten Familie, und du störst mich beim Nachdenken!“
„Belastete Familie?“ Jack schüttelte kichernd den Kopf, während er Jonathan zum Fahrstuhl folgte. „Ich bin froh, die Familie hinter mir gelassen zu haben, die mich belastet. Was gibt es da groß nachzudenken?“
„Das geht dich nichts an, aber du darfst dich dafür bedanken, dass ich dir gerade das Leben gerettet habe.“
„Ach ja, das Leben“, sagte Jack und stieß erneut auf, als sie vor dem Fahrstuhl warteten. „Das hätte ich fast vergessen. Das gibt es auch noch. Aber weißt du …“
Jonathan erfuhr nicht, was er hätte wissen sollen, wenn es nach Jack Dominguez gegangen wäre, denn in diesem Moment kam der Fahrstuhl, und Jonathan nutzte die Gelegenheit, um die Kabine zu betreten, Jack hingegen, der ebenfalls hineinstrebte, einen leichten Stoß vor die Brust zu verpassen, so dass er rückwärts taumelte.
„Nimm den nächsten!“, sagte er.
Und schon war er auf dem Weg in die Tiefe.
Jonathans Apartment befand sich im zweiten Stock. Er verriegelte die Tür zweifach, so wie in den vorangegangenen Nächten, doch wenn er sich nicht täuschte, gab es auch hier zwischen Tür und Rahmen einen gewissen Luftzug. Keinesfalls schloss die Tür luftdicht. Jonathan brauchte irgendein Klebematerial, um die Tür abzudichten. Und wie schaltete man noch gleich die Lüftung ab?
Vor allem aber brauchte er mehr Informationen.
Das Multikom lief noch. CNN hatte soeben von dem Knall in der Luft über New York berichtet. Die Lage sei unklar, sagte Catelyn Snow, man bemühe sich um Bildmaterial und Einschätzungen. Offenbar sei bei dem Knall eine Wolke freigesetzt worden.
„Nach Augenzeugenberichten hat unsere Luftabwehr reagiert“, fuhr die Moderatorin fort. „Es wurden mehrere Abfangraketen über New York gesehen. Jetzt ist die Frage, ob die Landesverteidigung in der Lage war, ihrer Aufgabe nachzukommen.“
Jonathan ging zum Fenster und sah hinaus. Auf der Straße waren viele eilige Menschen unterwegs, doch es war nicht zu erkennen, ob sie lediglich von der üblichen Hektik getrieben wurden, vom Luftalarm oder von Angst. Jonathan jedenfalls hatte Angst, und er fühlte sich alles andere als sicher in seinem Apartment. Für Sekunden verspürte er den Reflex, das Multikom abzuschalten, als würden die Dinge nicht geschehen, wenn er nichts über sie erfuhr. Doch er musste so gut informiert bleiben wie möglich. Das konnte entscheidend sein.
„Wir übernehmen jetzt Bilder des New Yorker Lokalsenders NYCN“, kündigte Catelyn Snow an. „Dessen Kamerateam ist im Central Park, wo Kulturdezernent David Barnett eine Freiluftausstellung zur Geschichte der Muslime in New York eröffnet. Damit reagiert die Stadt auf antimuslimische Stimmungen, die seit der Entführung der Queen Mary 2 zugenommen haben. Barnett hat soeben seine Eröffnungsrede begonnen. Jetzt drängen ihn Sicherheitskräfte von der Bühne.“
Die Bilder zeigten den überraschten Politiker, der im ersten Moment den Anweisungen seiner Agenten nicht folgen wollte. Seine Körperhaltung drückte Abwehrbereitschaft aus. Doch die Agenten nahmen keine Rücksicht, sondern packten ihn, zerrten ihn von der Bühne und verschwanden mit ihm.
In diesem Moment war ein lauter Knall zu hören. Eine Serie von Explosionen folgte. Die NYCN-Bilder zeigten Menschen, die zusammenzuckten und überrascht oder vor Schreck aufschrien. Der Reporter – laut Einblendung hieß er Ethan Ellingham – reagierte ebenso überrascht wie die Kamera, die hin und her schwenkte in dem Bemühen, die Quelle der Explosionsgeräusche ausfindig zu machen. Wie vermutlich jeder Zuschauer dachte auch er zuerst offenbar an einen Terroranschlag. Doch er kam nicht auf die Idee, die Kamera nach oben blicken zu lassen. Die Menschen duckten sich und wichen instinktiv von den Wegen und aus der Mitte des Platzes, auf dem die Veranstaltung stattgefunden hatte, in den Schutz von Gebäuden oder auch nur von Büschen, als gelte es, sich zuerst vor dem freien Himmel in Sicherheit zu bringen. Jonathan erlebte aus der Nähe, was er vorhin aus mehreren Kilometern Entfernung gesehen hatte.
Endlich kam der Kameramann auf die Idee, sein Objektiv in die Höhe zu richten und die Wolke zu zeigen, die in der Luft über dem Park entstanden war. Sie hatte von hier aus die Form eines Ringes aus gelblich-grünen Schwaden, die sich unter dem Druck der Explosion verteilten. Die Wolke wurde zusehends dünner und durchsichtiger.
„Bitte bewahren Sie Ruhe“, hörte man eine Frau. Sie stand auf dem Podium, wo gerade noch der Dezernent gesprochen hatte. „Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Die Sicherheitskräfte haben alles im Griff. Ich denke, wir werden gleich mit unserer Veranstaltung fortfahren. Wir …“
Schreie waren zu hören. Die Kamera zeigte einen Mann, der überrascht seine rechte Schulter anstarrte, aus der plötzlich ein scharfkantiges Metallstück herausragte. Er schien nichts zu empfinden, als er es herauszog. Unverwandt musterte er es, blickte kurz zum Himmel auf und warf es dann fluchend weg. Sekundenlang stand er unschlüssig da. Dann begann er zu schwanken, als spüre er erst jetzt den Schmerz in seiner Schulter. Zwei ältere Frauen aus dem Publikum stützten und bewahrten ihn vor dem Kollaps.
Auch andere Menschen waren von Metallteilen getroffen worden, die aus dem Himmel regneten. Von überallher waren die Geräusche von Aufschlägen zu hören, mal hell und klirrend, wenn die Stücke auf Asphalt trafen, mal dumpf, wenn sie im Rasen einschlugen. Jemand blutete an der Stirn, und ein vielleicht achtjähriges Mädchen trug ein verbogenes, rußgeschwärztes Metallstück, von dem es am Oberarm geritzt worden war, zu seiner Mutter und sagte:
„Schau mal, Mom – was ist das? Es ist ganz warm.“
Die Kamera zoomte auf das Metallstück. Es war scharfkantig und unregelmäßig geformt.
„Um Himmels willen, leg das sofort weg!“, rief ihre Mutter und schlug nach dem Metallteil. Das Mädchen ließ es mit einem erschreckten Aufschrei los.
„Da dieses Metallstück aus dem Himmel gefallen ist und da wir dort oben eine Explosionswolke gesehen und außerdem einen Knall gehört haben“, kombinierte Ethan Ellingham, der Reporter, „kann man wohl den Schluss ziehen, dass es sich um ein Trümmerstück handelt, vielleicht von dem Vehikel, das explodiert ist, aber ich kann nicht erkennen, was das gewesen ist dort oben über New York Central Park, und … Ich höre gerade, dass es Nachrichten über einen Angriff auf die USA gibt. Regie, Zeit für einen Nachrichtenblock? Nein, wir machen weiter. Wenn die Anzeichen nicht trügen, ist New York angegriffen worden, und zwar mit etwas, was in der Luft über der Stadt explodiert ist und wogegen unsere Luftabwehr nichts machen konnte. Wir haben Bilder von einer Wolke gesehen, die sich soeben in der Luft verteilt. Fragen wir nach. Nancy McLaughlin ist die Pressesprecherin von Kulturdezernent Barnett.“
Ellingham hatte sich, während er sprach, langsam zum Podium bewegt, auf dem immer noch die Frau am Mikrofon stand und beruhigend auf die Menschen einredete, die sich jedoch vor allem erstaunt, ja, neugierig umschauten. Der Regen von Metallteilen hatte aufgehört, die Wolke war noch da.
„Nancy, welche Informationen haben Sie über einen Angriff auf die USA?“, fragte der Reporter und reckte sein Mikrofon zum Podium hinauf.
„Alles in Ordnung“, antwortete die Pressesprecherin, als rede sie zu einer Privatperson, „bitte bewahren Sie Ruhe.“ Erst dann registrierte sie, dass ihr ein Mikrofon hingehalten wurde. Sie lächelte, strich sich rasch zwei, drei imaginäre Haare aus dem Gesicht, stieg vom Podium und antwortete: „Ich weiß nichts von einem Angriff auf die USA, aber ich bin sicher, dass sich alles klären wird, wenn wir nur Ruhe bewahren.“
Dann wollte sie die Ausstellung erläutern, doch sie hatte kaum zwei Sätze gesagt, als entsetzte Schreie in der Nähe alle Aufmerksamkeit auf sich lenkten, auch die des Kameramanns. Das achtjährige Mädchen hatte sich erbrochen. Die Mutter kniete vor ihrer Tochter und redete beruhigend auf sie ein. Die Kleine weinte. Sie war kreideweiß, presste ihre Hände auf den Bauch und klagte:
„Es tut so weh!“
Die Mutter streichelte ihre Wange und schlug ihrer Tochter vor, nach Hause zu gehen. Da erbrach die Kleine sich erneut. Im Bogen sprudelte ihr Mageninhalt hervor, als herrsche enormer Druck in ihrem Bauch und als habe sie sich nicht bereits erbrochen. Sie gab Schmerzenslaute von sich und weinte. Ihre Knie gaben nach, sie knickte ein, wurde von ihrer besudelten Mutter aufgefangen, doch es schien keine Kraft mehr in ihr zu stecken. Reglos sank sie in die Arme ihrer Mutter, die erst jetzt registrierte, dass Blut im Erbrochenen war.
„Gloria!“, schrie die Frau auf und rüttelte ihre reglose Tochter, ehe sie sich an die Menschen wandte: „Wir brauchen einen Arzt! Bitte, jemand muss einen Arzt rufen!“
Eine öffentliche Veranstaltung dieser Art fand selbstverständlich nicht statt, ohne dass Sanitäter bereitstanden. Die beiden Männer beugten sich über das Mädchen, während die Kamera sich dem Geschehen näherte und alles einfing. Sie zeigte auch, wie das Mädchen plötzlich erwachte, die Augen aufriss und schrie und wie ihr Schrei in einem blutigen Schwall unterging, der aus ihrem Mund aufstieg. Dann erschlaffte die kleine Gestalt und hing endgültig leblos in den Armen der Sanitäter, die sofort handelten; doch die Wiederbelebungsmaßnahmen scheiterten. Das Mädchen war tot.
Die Mutter stand entsetzt daneben. Sie hatte begonnen, ihren Bauch zu massieren.
„Mir ist übel“, sagte sie zu einem der Sanitäter. Auch sie war plötzlich kreideweiß.
Die Sanitäter ließen das tote Mädchen los, legten es auf den Asphalt und begannen, langsam rückwärts zu gehen, als träten sie die Flucht an. Die Mutter wandte sich gerade noch rechtzeitig ab, ehe sie sich mit Wucht ins Gebüsch erbrach. Vornüber gekrümmt blieb sie danach zitternd stehend, die Hände auf den Bauch gepresst.