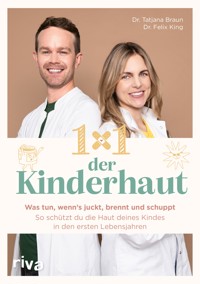
12,99 €
Mehr erfahren.
Gesunde Haut von Anfang an Willkommen in der faszinierenden Welt der Kinderhaut! Die Dermatologen Dr. Tatjana Braun und Dr. Felix King nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die ersten Lebensjahre deines Kindes. Mit einer Prise Humor und jeder Menge Fachwissen erklären sie dir, was Kinderhaut besonders macht, welche Probleme auftreten können und wie du die Haut deines Kindes am besten schützt. Dabei liefern sie dir Antworten auf jede Menge Fragen wie: - »Was gibt es bei der Haut- und Nagelpflege zu beachten?« - »Wie schütze ich mein Kind richtig vor der Sonne?« - »Was tun bei Hand-Fuß-Mund, Insektenstichen und gereizter Haut?« - »Wann sollte ein Muttermal ärztlich begutachtet werden?« Egal ob Neurodermitis, wunder Po oder Windpocken: Ausgestattet mit praktischen Ratschlägen lernst du, beim nächsten Ausschlag gelassen zu bleiben und deinem Kind effektiv zu helfen, wenn es darauf ankommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und [email protected]
Wichtige Hinweise
Dieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder eine qualifizierte Ärztin. Der Verlag sowie der Autor und die Autorin haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© 2025 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Dr. Susanne Meinrenken
Umschlaggestaltung: Sonja Stiefel
Umschlagabbildung: Laura Lindenmann
Illustrationen (Cover und Innenteil): Felix King Autorenporträt, S. 190: Felix King
Layout und Satz: feschart print- und webdesign, Michaela Röhler, Leopoldshöhe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2792-5
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2601-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Titelseite
Dr. Tatjana Braun
Dr. Felix King
derKinderhaut
Was tun, wenn’s juckt, brennt und schuppt
So schützt du die Haut deines Kindes in den ersten Lebensjahren
Illustrationen von Felix King
Inhalt
Vorwort von Felix King
Kapitel 1Die Haut, eine wahre Superheldin
Das größte Organ des Körpers
Die verschiedenen Hautfarben
Was es zu entdecken gibt
Das Besondere an Kinderhaut
Kapitel 2Vorbereitung auf das neue Familienmitglied
Ich packe deinen Koffer
Kapitel 3Die Geburt und die ersten Wochen zusammen
Willkommen auf der Welt!
Die ersten Wochen zu Hause
Wenn sich die Haut verändert
Kapitel 4Kinderhaut im ersten Lebensjahr
Sonnenschutz
Sommersprossen
Allergische Reaktionen
Wenn es juckt und kratzt: Neurodermitis
Rote, schuppende Haut ist nicht immer Neurodermitis
Kapitel 5Von der Kita bis zur Einschulung
Ausschlagepidemien in der Kita
Erst Rotznase, dann Ausschlag
Infektionen im Kindesalter
Verletzungen der Haut
Anhang
Was gehört in die Kinderhaut-Hausapotheke?
Wenn du mehr erfahren willst
Quellen
Dank
Über die Autoren
Für alle Mütter und Väter, die trotz Chaos und Schlafmangel jeden Tag ihr Bestes geben
Vorwort von Felix King
Naturkosmetik oder Kortison, Waschlappen oder Feuchttuch, cremen oder lieber nicht? Wenn es um Kinderhaut geht, gibt es die unterschiedlichsten Meinungen und noch mehr gute Ratschläge. In einem sind wir uns aber alle einig: Als Eltern wollen wir nur das Allerbeste für unser Kind.
Und das beginnt schon lange, bevor das Baby da ist. Vielleicht hast du dir schon in der Schwangerschaft ausgemalt, wie dein Kind wohl aussehen würde. Große Kulleraugen? Eine kleine Stupsnase? Rosige Wangen? Dann kam dieser Moment, der alles veränderte. Dein Baby wurde dir auf die Brust gelegt, winzig und zerknittert, aber mit einem Gesichtsausdruck, der sagte: »Hier bin ich!« Die riesigen Augen haben dich angesehen, und in diesem Augenblick, voller Staunen und Liebe, wusstest du: Für dieses kleine Wesen würdest du alles tun. Und dazu gehört auch die richtige Pflege.
Und hier kommt die Haut ins Spiel – diese faszinierende Hülle, die alles zusammenhält und über die dein Kind mit dir kommuniziert, noch bevor es sprechen kann. Haut ist mehr als bloß Oberfläche: rosig oder blau? Ärzte können daran sofort erkennen, wie es dem Baby geht. Für uns Eltern ist die Haut unseres Kindes Anlass für liebevolle Spekulationen (»Ganz der Papa!«) und ein Freudenfest für die Nase. Denn ehrlich: Gibt es einen besseren Duft als den von Kinderhaut? Aber so einzigartig sie auch ist, Kinderhaut stellt auch besondere Anforderungen. Das hautstraffende Anti-Aging-Serum von Mama, die 10-in-1-Creme von Papa oder die Schrundensalbe von Tante Rosi würde vermutlich kein Elternteil einfach auf die Haut vom Junior geben. Aber welches der unzähligen Produkte aus den langen Regalen im Drogeriemarkt ist denn gut für Kinderhaut? Oder ist weniger doch mehr? Viele Eltern sind sich unsicher, was Kinderhaut wirklich braucht.
Hilfe! Mein Kind hat Hautprobleme
Wunder Po, Sonnenbrand oder Warzen – je älter dein Kind wird, desto mehr Herausforderungen bringt seine Haut mit sich. Zum Glück ist das Meiste harmlos und oft mit ein paar Handgriffen wie einem Pflaster oder einer Creme wieder im Griff. Hautpflege kann wirklich ein Kinderspiel sein! Doch dann gibt es die Hautprobleme, die zwar nicht gefährlich, aber für die ganze Familie eine echte Geduldsprobe sind. Wenn dein Kind zum Beispiel die Krätze mit nach Hause bringt und plötzlich die ganze Familie juckt, braucht es geballtes Teamwork und das richtige Know-how, um die kleinen Krabbler wieder loszuwerden. Und dann gibt es da noch die hartnäckigen Hauterkrankungen, die den Alltag wirklich durcheinanderwirbeln – Neurodermitis zum Beispiel. Ein Kind, das sich Tag und Nacht kratzt, unter wunder Haut und chronischem Schlafmangel leidet, kostet uns Eltern oft den letzten Nerv. Wir fühlen uns hilflos und stellen uns endlose Fragen: »War die Creme die falsche? Habe ich ihm das Falsche zu essen gegeben?«
Die Antwort lautet meist Nein. Selbst wenn du andere Cremes benutzt oder das halbe Leben umstellst, hätte sich die Haut deines Kindes kaum anders entwickelt. Und wenn es wirklich etwas gegeben hätte, was du hättest besser machen können – es ist okay. Eltern sein ist wie Tennis spielen: Manchmal geht der Ball ins Netz, egal, wie gut man ist. Statt dir Vorwürfe zu machen, hilft es, mit klarem Kopf die passende Pflege und Behandlung zu finden, die deinem Kind wirklich hilft. Keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken – lass uns lieber einen Blick in die spannende Welt der Kinderhaut werfen, damit wir verstehen, was diese Haut so besonders macht und wie wir sie glücklich und gesund halten können!
Siegfried und Roy der Kinderhaut
In den Monaten vor der Geburt meines eigenen Kindes habe ich die dicken Lehrbücher aus dem Medizinstudium wieder hervorgekramt und mich durch die Kapitel zur Kinderhaut gelesen. Ich wollte alles richtig machen – die besten Windeln, die optimale Pflege. Doch schnell kam die Erkenntnis: »Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!«. Ihre Haut folgt eigenen Gesetzen, mit Stärken und Schwächen, die es erst einmal zu entdecken gilt. Also rief ich meine ehemalige Kollegin Tatjana »Tati« Braun an, die in meinen Augen die Expertin für Kinderhaut ist. Nach unserer gemeinsamen Ausbildungszeit hat sie von internationalen »Kinderhaut-Gurus« gelernt und sich zur Kinderhautärztin weiterbilden lassen. Die seltensten und ungewöhnlichsten Ausschläge sind ihre Welt und sie kennt die Kinderhaut bis in die letzte Zelle. Ich würde mich nicht wundern, wenn Tatjana regelmäßig von Ekzemen, allergischen Ausschlägen oder Warzen bei Kindern träumen würde.
Ich fragte sie, ob sie Lust hätte, mir und anderen Eltern zu helfen, Licht in die geheimnisvolle Welt der Kinderhaut zu bringen. Tati sagte sofort zu. Seitdem nutzen wir jede Gelegenheit, um Eltern alles zu erklären, was es von A wie Akne bis Z wie Zinksalbe zu wissen gibt. Tati ist die Expertin im Team, für sie ist keine Studie zu kompliziert und keine Wissenslücke zu groß. Und ich? Ich gebe mein Bestes, ihr Fachchinesisch in Alltagssprache zu übersetzen. Zusammen sind wir Siegfried und Roy der Kinderhaut! Tiger haben wir keine im Gepäck, dafür aber jede Menge Bakterien, Zecken und Ausschläge.
Kapitel
1
Die Haut, eine wahre Superheldin
Das größte Organ des Körpers
Als Hautärztin oder Hautarzt hört man ständig diesen Spruch und vielleicht kennst du ihn auch. Die Wichtigkeit der Haut wird hervorgehoben, indem man auf ihre beeindruckende Größe verweist, die alle anderen Organe in ihren Schatten stellt. Es stimmt schon: Die Haut eines Erwachsenen ist ganze zwei Quadratmeter groß und bringt stolze drei oder vier Kilogramm auf die Waage. Aber seit wann sind denn Größe und Gewicht ausschlaggebend?
Auf die Werbetafel für das Gehirn könnte man entsprechend schreiben: »Das Organ mit dem größten Fettanteil! Oder für die Augen: »Kein Organ so rund wie die Augen – und das gleich zweimal!«. Dabei ist allen klar, dass das Gehirn deutlich mehr zu bieten hat, als im Schädel vor sich hin zu schwabbeln. Und dank der Augen sehen wir die Wunder der Welt! Wen interessiert es da, dass sie rund sind?
Billige Werbung hat die Haut meiner Meinung nach gar nicht nötig. Unsere Haut hat nämlich so viel mehr zu bieten als ihre Größe! In ihr steckt ein ganzes Universum. Sie ist eine Welt voller breitschultriger Türsteher, emsiger Maurer, vielarmiger Künstlerinnen und unerschrockener Kämpferinnen. Straßen aus Blutgefäßen durchziehen sie, bringen Nährstoffe, regulieren die Temperatur und lassen uns die Schamesröte ins Gesicht steigen. Dann gibt es noch einen Kabelsalat aus Nerven, der es uns möglich macht, unsere Liebsten und alles um uns herum zu ertasten. Und außerdem ist sie der Sitz der großen und kleinen Haare, die nicht nur unerlässlich sind für eine hippe Frisur, sondern uns auch vor Mückenstichen schützen. Tag für Tag arbeitet die Haut auf Hochtouren. Und das nur, damit wir uns wohl in ihr fühlen.
Die verschiedenen Hautfarben
Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Hautfarben. Achte beim nächsten Spielplatzbesuch darauf und du wirst staunen, wie farbenfroh die menschliche Haut ist. Wie aber entsteht die Farbe der Haut eigentlich? Gibt es einen Grund dafür, dass manche Menschen helle und andere wiederum dunkle Haut haben? Die Antworten auf diese Fragen findest du in diesem Kapitel. Außerdem erfährst du, warum die Hautfarbe wichtig ist, um bei Hautveränderungen auf die richtige Diagnose zu kommen.
Daher kommt unsere Hautfarbe
Die Hautfarbe entsteht durch eine bunte Mischung aus Rot, Blau, Gelb und Braun. Das Rot kommt vom Blut, welches mit Sauerstoff aufgeladen ist, die blaue Farbe vom sauerstoffarmen Blut. Gelb oder Orange wird die Haut, wenn wir mit der Nahrung viele Karotine aufgenommen haben, zum Beispiel aus Karotten oder gelb gefärbter Limonade. Zu guter Letzt kommt der Braunton vom Pigment, das unsere Haut selbst produziert. Das Hautpigment, auch Melanin genannt, hat den größten Einfluss auf unsere Hautfarbe. Grundsätzlich gilt: Wenig Pigment lässt die Haut weiß oder pink erscheinen, viel Pigment sorgt für dunkelbraune bis schwarze Haut. Über das Jahr hinweg schwankt die Menge an Pigment zwar etwas – nach dem Strandurlaub ist sie etwas höher, im Winter niedriger –, aber im Großen und Ganzen entscheiden die Gene über unsere Hautfarbe.
Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir Menschen überhaupt unterschiedliche Hautfarben haben? Ich habe lange gedacht, die Antwort auf diese scheinbar alberne Frage zu kennen. Aber der Schutz vor Sonnenbrand ist nicht der Grund dafür, dass Menschen in wärmeren Regionen dunklere Haut haben. Der Schutz vor Sonnenbrand ist im Prinzip nichts weiter als ein positiver Nebeneffekt. Aber der Reihe nach.
Die Gene für unsere Hautfarbe werden von der Evolution bestimmt. Und seit dem Naturforscher Charles Darwin wissen wir, dass es in der Evolution nur um eines geht: sich möglichst erfolgreich fortzupflanzen. Egal ob Leguan, Meerschweinchen oder Mensch – auf gesunden Nachwuchs kommt es an. Die Topauswahl an Genen, die es in unser Erbgut schaffen, basiert auf diesem einfachen Prinzip: Fördert das Gen die Fortpflanzung oder nicht? Wenn die Antwort Nein lautet, landet das Gen im Nirwana der Evolution.
Allein der Schutz vor Sonnenbrand und Hautkrebs reicht nicht, damit es die Gene für die Hautfarbe in die Auswahl schaffen. Denn trotz Sonnenbrand kann man sich bekanntermaßen problemlos fortpflanzen. Und wenn Jahrzehnte später auf die vielen Sonnenbrände der Hautkrebs folgt, sind die Gene schon längst an die Kinder weitergegeben. Also muss es noch einen anderen Grund geben, und zwar einen, der direkt mit der Fähigkeit zu tun hat, gesunden Nachwuchs zu zeugen. Das Geheimnis lautet: Schutzwirkung der Folsäure. Folsäure – die Leserinnen unter euch erinnern sich bestimmt – ist das Vitamin, das ihr während der Schwangerschaft als Tablette einnehmen musstet. Folsäure ist für das heranwachsende Baby überlebenswichtig. Sie ist für eine korrekte Zellteilung unerlässlich und ein Mangel, zum Beispiel bei unzureichender Zufuhr mit der Nahrung, kann zu schweren Missbildungen oder zum Tod des Kindes führen.
Und was hat das nun mit der Hautfarbe zu tun? Sonnenlicht ist so hochenergetisch, dass es die im Körper vorhandene Folsäure buchstäblich in Stücke schießt, wenn die Haut nicht durch Pigment geschützt ist. In den 200.000 Jahren vor der Erfindung der Sonnencreme war der Mensch also auf Pigment in der Haut angewiesen. Nur so konnten Mütter gesunde Kinder auf die Welt bringen. Menschen, die in den sonnenreichen Gegenden in der Nähe vom Äquator lebten, brauchten besonders viel Pigment und entwickelten daher dunkle Haut. Je weiter vom Äquator entfernt man lebte und je geringer die UV-Strahlung war, desto weniger schützendes Pigment war für gesunde Nachkommen nötig.
Mit der Sonne ist es aber so eine Sache: Auf der einen Seite hat sie so viel Power, dass wir unsere Folsäure vor ihr schützen müssen. Aber wir brauchen die Sonne auch. Sie ist nämlich bei der Produktion eines anderen Vitamins maßgeblich beteiligt: Vitamin D. Wie die Folsäure auch ist dieses Vitamin für gesunde Kinder unerlässlich. Der Körper produziert Vitamin D in Kooperation mit der Sonne. Und wo kein Sonnenlicht ist, entsteht auch kein Vitamin D. In Gegenden mit weniger Sonnenschein ist es deshalb wichtig, einen helleren Hautton zu haben, der mehr Sonne in die Haut lässt. Über Jahrtausende haben sich deshalb die verschiedensten Hautfarben entwickelt – jede genau abgestimmt auf die Sonnenintensität in der jeweiligen Weltregion.
Die Hautfarbe macht den Unterschied
Dass Menschen mit dunklerer Haut weniger Sonnenbrand bekommen, ist klar. Neben Aussehen und Sonnenbrandneigung gibt es aber noch ein paar andere interessante Unterschiede zwischen den Hautfarben. Von »Skin of Color« spricht man übrigens bei Menschen mit den Hauttypen III bis VI (Seite 70).
Sonne verursacht auf der Haut nicht nur Sonnenbrand, sondern verstärkt noch eine Reihe weiterer Probleme. Die Sonnenstrahlen lassen zum Beispiel eine Couperose (Rosacea) im Gesicht erst so richtig aufflammen, zudem verursachen sie Hautschäden, aus denen sich später im Leben Hautkrebs entwickeln kann. Da Menschen mit heller Haut von Natur aus weniger gegen die Sonne geschützt sind, sind sie von diesen Problemen eher betroffen. Außerdem ist das Sonnenlicht maßgeblich für die Hautalterung verantwortlich, weil UV-Strahlen Zellen schädigen und Detox-Prozesse behindern.
In puncto Hautalterung hat dunkle Haut gleich zwei Vorteile: Die hochenergetischen UV-Strahlen werden noch an der Oberfläche abgeblockt und können keinen Schaden in der Haut anrichten. Gleichzeitig ist die Haut von Natur aus etwas robuster. Verantwortlich ist dafür die Menge an Kollagen und elastischen Fasern in der Haut, die bei Menschen mit dunkler Haut etwas höher ist. Diese zusätzlichen Fasern machen die Haut besonders widerstandsfähig und sorgen außerdem für einen Anti-Falten-Effekt.
Doch neben den vielen Vorteilen, gibt es auch einen Nachteil , denn dunkle Haut kann Feuchtigkeit nicht so gut speichern. Deshalb haben Kinder mit dunkler Haut nicht nur häufiger raue, trockene Haut, sondern neigen auch eher zu Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Schuppenflechte.1
Außerdem kommt es nach Verletzungen von dunkler Haut häufiger zu Problemen. Wenn nach einer tieferen Hautwunde die Narbenbildung einsetzt, sind die Kollagen produzierenden Zellen besonders fleißig. Sie bilden Unmengen von Kollagen, das die Lücke in der Haut auffüllen soll. Wie wir schon gehört haben, sind diese Zellen aber bei dunkler Haut im Normalzustand bereits sehr aktiv. Wenn sie durch die Aufgabe, eine Narbe produzieren, zusätzlich stimuliert werden, kann es passieren, dass sie über ihr Ziel hinausschießen. Dann wird so viel Narbengewebe produziert, dass die Narbe dick und wulstig auf der Haut sitzt.
Doch nicht nur bei einer Hautoperation, die eine Narbe hinterlassen kann, sondern auch für andere dermatologische Behandlungen spielt die Hautfarbe eine Rolle. Wenn man bei der Ärztin oder beim Arzt zum Beispiel eine störende Warze weglasern lassen möchte, sollte man wissen, dass der Laser nicht nur die Warze, sondern auch die pigmentierten Zellen zerstören kann. So kann auf dunkler Haut nach der Behandlung ein heller Fleck zurückbleiben.
Auf dunkler Haut sieht manches anders aus
Stell dir vor, dein Kind hat eine Hautkrankheit. Und es vergeht kein Tag ohne Jucken, Kratzen und Tränen. Irgendwann hast du alle Hausmittel ausprobiert, die dir von deinen Freundinnen und Freunden empfohlen wurden. Und weil nichts funktioniert hat, hast du einen Termin in der Hautarztpraxis vereinbart. Als nach wochenlangem Warten der Tag endlich kommt, begleitest du dein Kind mit klopfendem Herzen ins Untersuchungszimmer. Die Hautärztin betritt den Raum. Aber anstatt wie aus der Pistole geschossen die Diagnose zu verkünden, hat sie Fragezeichen in den Augen. Der traurige Grund: Ärzte sind oft farbenblind, wenn es um Hautprobleme auf dunkler Haut geht.
So geht es vielen Kindern, die keine weiße Hautfarbe haben. Sie pilgern von Ärztin zu Arzt und kriegen oft nicht die Hilfe, die sie brauchen. Der Wille ist da, aber es fehlt oft schlichtweg die Erfahrung mit Haut, die nicht weiß ist. Hauterkrankungen sehen nämlich auf den unterschiedlichen Hautfarben ganz unterschiedlich aus.
Der Mangel an Expertise im Umgang mit nicht weißer Haut hat den einfachen Grund, dass 95 Prozent der Abbildungen in Lehrbüchern weiße Haut zeigen. Und diese Bilder speichern wir Ärztinnen und Ärzte wie bei einem Memory-Spiel in unserem Hirn ab. Wenn eine Patientin oder ein Patient zu uns kommt, vergleichen wir das, was wir auf der Haut sehen, so lange mit den Memory-Karten in unserem Kopf, bis wir einen Treffer landen. Wenn die entsprechende Karte aber fehlt, zum Beispiel weil wir nicht abgespeichert haben, dass eine Hautentzündung auf dunkler Haut braun-lila aussieht, sind wir erst einmal ratlos.
Bei Kindern mit dunkler Haut wird die korrekte Diagnose erst sehr spät gestellt und die richtige Behandlung verzögert sich. Für die Familien bedeutet das längere Leidenswege, mehr erfolglose Therapieversuche und ganz viel berechtigte Frustration.
Die gute Nachricht ist, dass es mittlerweile einige Bemühungen gibt, diesen Missstand zu beheben. Spezielle Sprechstunden wurden eingerichtet, Expertenkommissionen gegründet und Abbildungen in Lehrbüchern zunehmend mit solchen mit nicht weißer Haut ergänzt. Bis die Lücke geschlossen ist und alle Kinder gleich gut behandelt werden, werden aber noch einige Jahre ins Land gehen.
Was es zu entdecken gibt
Hautfarbe ist aber nur der Anfang. Widmen wir uns nun den Aspekten der Haut, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Wie ist sie aufgebaut und was steckt alles in ihr? Du wirst sehen, dass die Ursachen von vielen Hautproblemen bei Kindern glasklar werden, wenn man die verschiedenen Schichten und die Funktionen der Haut durchschaut hat. Wenn man zum Beispiel weiß, welche Aufgabe die Hautbarriere hat, wird verständlich, warum Eincremen bei Neurodermitis so wichtig ist. Die Haut hat drei Schichten:
Die Epidermis (epi für »oben drauf«, dermis für »Haut«) ist die oberste Hautschicht.
Unter der Epidermis liegt in der Mitte die Dermis, auch Lederhaut genannt, eine derbe Schicht, die die Haut strapazierfähig macht.
Unter der Lederhaut findet man die Subkutis (sub für »unter«, kutis für »Lederhaut«), das Fettgewebe als Polsterung und Isolationsschicht. Damit sind unser Hüftgold und die sonstigen Fettpölsterchen gemeint. Sie werden auch zur Haut gezählt. In diesen drei Schichten ist einiges los.
Barriere mit doppeltem Boden
In der Epidermis wird fleißig gewerkelt, Millionen von Zellen sind am Werk und produzieren Tag für Tag die Hornhaut. Man kann sich die Epidermis wie eine Produktionsstraße vorstellen. In der untersten Etage befinden sich unreife Zellen, die wie mit einem Aufzug langsam nach oben Richtung Hornhaut aufsteigen. Die Fahrt dauert insgesamt etwa 28 Tage. In dieser Zeit reifen die Zellen und machen sich bereit für ihren Einsatz. Dafür bauen sie ihren Zellkörper um, entwickeln kleine Säckchen, in denen sie Horn speichern und bekommen Hautpigment aufgeladen. Oben an der Hautoberfläche angekommen, heißt es für die Hornzellen, Abschied zu nehmen und als abgestorbener Zellrest Teil der Hornschicht zu werden. Die Hornzellen geben ihr Leben für den Schutz unserer Haut!
Die Hornschicht ist eine hauchdünne Schutzschicht, die unseren gesamten Körper umschließt. Sie ist elastisch und biegsam, damit sie unsere Bewegungen nicht einschränkt. Aber sie ist auch widerstandsfähig genug, um uns vor schädlichen Einflüssen unserer Umwelt zu schützen. Wenn man mit einem Mikroskop in die Hornschicht hineinzoomt, erinnert der Aufbau der Hornschicht an eine Backsteinmauer. Man sieht die toten Hornzellen wie Backsteine neben- und aufeinander gestapelt. Der Mörtel, der die Zwischenräume auskleidet, besteht aus Fetten (Lipiden). Es gibt Erkrankungen, bei denen der Fettmörtel fehlerhaft ist, was die ganze Backsteinmauer spröde und die Hornschicht durchlässig macht. Aber dazu später mehr.
Weil unsere Körperteile unterschiedlich stark belastet werden, ist die Hornhaut an manchen Stellen dicker und an manchen dünner: An den Augenlidern, wo sie kaum Belastung aushalten muss, ist sie mit circa zehn Mikrometern sehr dünn.2 An den Fußsohlen, wo sie jeden Tag einiges aushalten muss, erreicht sie bis zu anderthalb Millimeter und ist 150-mal so dick.
Als Schutzhülle gehört es zu den Aufgaben der Hornschicht, Keimen den Weg in die Haut möglichst schwer zu machen. Dafür hat sie unter anderem ihren berühmten Säureschutzmantel. Er besteht aus Schweiß, Talg und abgeschilfertem Hornmaterial und bildet einen leicht sauren Film auf der Haut. Der ist etwa so sauer wie ein milder Weißwein (pH-Wert 4,5 bis 5,5) und hilft, Bakterien (und andere üble Zeitgenossen) auf Abstand zu halten. Häufiges Reinigen spült diesen Säureschutzmantel übrigens von der Haut. Dasselbe gilt für Händedesinfektionsmittel.
Eine intakte Hornschicht ist für unsere Gesundheit extrem wichtig. Wenn sich also die Haut deines Kindes rau oder spröde anfühlt, dann ist es Zeit, der lieben Hornschicht etwas unter die Arme zu greifen. Mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme wird sie schnell wieder geschmeidig und kann unsere Haut erfolgreich schützen.
Kommen wir noch einmal zurück zur Epidermis, dem Teil der Haut, der für die Produktion der Hornschicht verantwortlich ist. Neben den Hornzellen sitzen hier außerdem die Pigmentzellen. Sie sind wie kleine Oktopusse, die schwarze Tinte, sogenanntes Melanin, produzieren und dieses mittels ihrer vielen Tentakeln an die Hornzellen abgeben.
Das Pigment schützt die Hornzellen selbst, aber auch den Rest des Körpers vor den schädlichen Wirkungen des Sonnenlichts. Die braune Farbe nimmt dabei die Sonnenstrahlen auf und wandelt sie in Wärme um. Durch diesen Trick verhindert das Hautpigment Erbgutschäden und schützt uns unter anderem vor Hautkrebs. Immer, wenn Sonnenlicht auf die Haut fällt, beginnt die Arbeit der oktopusartigen Pigmentkünstler. Wenn die Haut nicht an der Sonne ist, können sich die Melanozyten entspannen – und die Haut bleibt blass.
Die Epidermis bildet Aussackungen, die wie Strümpfe an der Wäscheleine nach unten in die Lederhaut baumeln. Darin befinden sich unsere Haare, die mit ihren Haarwurzeln fest in der Lederhaut verankert sind. Die Haarwurzel-Hornzellen haben dieselbe Aufgabe wie ihre Kollegen, die für die Hornhaut weiter oben verantwortlich sind: sich schrittweise in Hornmaterial zu verwandeln. Das Horn wird dann in das Haar eingebaut. Und mit jeder Hornzelle, die ihr Horn zur Verfügung stellt, wird das Haar ein kleines bisschen länger.
Eine undichte Hautbarriere ist Einfallstor für Krankheitserreger und hautreizende Stoffe.
Unser Körper ist fast vollständig behaart. Es gibt ein paar haarlose Stellen, wie die Hand- und Fußflächen, ansonsten wuchern Haare überall aus der Haut. Neben den langen Haaren, die man nicht übersieht, wachsen auch Tausende Miniaturhaare auf unserer Haut, deren Aufgabe bei einer Gänsehaut zu sehen ist: Bei Kälte stellen sie sich auf und bremsen so den Luftstrom über der Haut. Diese Luftbremse hat den Effekt, dass die Haut weniger Wärme an ihre Umgebung verliert. Die Länge unserer Haare ist übrigens von der Dauer der Wachstumsphase abhängig. Haare am Kopf können jahrelang wachsen, und zwar etwa einen Zentimeter im Monat.3 Körperhaare wiederum wachsen nur wenige Monate und nach wenigen Millimetern ist Schluss.4
In der Mitte der Haut ist das Reich der Lederhaut. Wie deine italienischen Luxusschuhe aus feinem Kuhleder ist unsere Lederhaut ebenfalls ziemlich cool – und robust. Das liegt an den vielen Kollagenfasern, aus denen die Lederhaut besteht und die dicht wie ein Teppich gewebt sind. Diese Webtechnik hat den Vorteil, dass sie die Haut nicht nur unglaublich reißfest macht, sondern gleichzeitig elastisch und flexibel lässt.
In der Lederhaut ist einiges los: Hier verläuft das unüberschaubare Verkehrsnetz der Blutgefäße, das für die Nährstoffversorgung und die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur verantwortlich ist. Beim Thema Körpertemperatur dürfen wir auch die Schweißdrüsen nicht vergessen: Hiervon besitzen wir stolze drei Millionen Stück!5 Schweißdrüsen sind Miniorgane, die eine salzige Flüssigkeit über die Poren auf die Hautoberfläche spülen. Neben Kochsalz (Natriumchlorid) transportiert der Schweiß Abfallstoffe wie Harnstoff, Milchsäure und Ammoniak aus dem Körper, hilft also bei der Entgiftung.
Die Kältewirkung des Schweißes kommt dadurch zustande, dass der Übergang von flüssigem Schweiß in eine Schweißdunstwolke eine Zunahme an molekularer Unordnung bedeutet. Der Übergang von einem geordneten in einen chaotischeren Zustand entzieht unserem Körper Energie, was wir als Abkühlung wahrnehmen. Merke: Unordnung entzieht dem Menschen Energie. Grund genug, mal wieder Ordnung in das Chaos auf dem Schreibtisch zu bringen!
In der Lederhaut sitzen außerdem Talgdrüsen, und zwar zwei bis vier Millionen Stück bei jedem von uns.6 An der Kopfhaut, im Gesicht, an Brust und oberem Rücken sind besonders viele von ihnen. In der Haut ist jede Talgdrüse über einen kleinen Kanal mit einer Haarwurzel verbunden. Diesen Verbindungsweg nutzt die Drüse, um ihren Talg auf das wachsende Haar zu bringen und hält es so schön fettig und geschmeidig. Die Menge des produzierten Talgs ist dabei besonders vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron abhängig. Testosteron regt die Talgdrüsen förmlich zu Höchstleistungen an! Wenn bei Jungen und Mädchen während der Pubertät die Testosteronproduktion in die Höhe schießt, macht sich das durch fettige, pickelige Haut bemerkbar. Dasselbe passiert übrigens auch bei den Babys von stillenden Müttern: Durch die Muttermilch erhält der Säugling Testosteron der Mutter, welches die Babytalgdrüsen stimuliert und die Babyhaut so unglaublich geschmeidig macht. Du kannst die aktiven Talgdrüsen sogar mit bloßem Auge bei deinem gestillten Neugeborenen erkennen: An den kleinen gelb-weißen Pünktchen auf der Nase. Kinder, die nicht gestillt werden, haben niedrigere Testosteronspiegel und deshalb eine etwas trockenere Haut.
Ob dick oder dünn, bei allen Menschen liegt unter der Lederhaut eine Fettschwarte namens Subkutis. Diese schwabbelige Schicht ist je nach Ernährungsgewohnheiten unterschiedlich dick und hat mehrere Funktionen: Sie federt Druck oder Stöße ab, zum Beispiel wenn wir mit unseren Kindern raufen oder mit ihnen die Rutsche runter sausen. Sie ist aber auch ein wichtiger Energiespeicher. Fett ist für unseren Körper wie Kerosin für ein Flugzeug: Es ist der Kraftstoff, der uns antreibt. Das subkutane Fettgewebe ist die Reserve, auf die der Körper zugreift, wenn anderswo Energie fehlt.
Bei Babys hat Fettgewebe noch eine ganz besondere Superpower: Es kann Wärme produzieren. Wir Erwachsenen müssen uns irgendwie körperlich betätigen, zum Beispiel von A nach B laufen, wenn uns kalt ist. Oder wir zittern. Babys können beides noch nicht – und sie müssen es auch nicht, um warm zu bleiben. Ihr Fettgewebe funktioniert nämlich wie eine Standheizung: Bei Kälte wird es aktiviert, setzt Energie frei und hält das Baby warm.
Ein weiteres Highlight der Haut ist ihre Rolle bei der Sinneswahrnehmung. Der Tastsinn, auch Hautsinn genannt, entwickelt sich bereits erstaunlich früh, etwa acht bis elf Wochen nach der Empfängnis, und ist bei der Geburt der am besten ausgeprägte Sinn des Babys. Für uns Menschen als soziale Wesen ist das Fühlen überlebenswichtig, denn Berührung und Nähe sind zentrale Bausteine unserer emotionalen Gesundheit. Schon vom ersten Atemzug an hilft uns die Haut, wie der Touchscreen eines Smartphones, Kontakt zur Welt und zu unseren Liebsten aufzunehmen.
Das Immunsystem in der Haut
Unser Immunsystem hat sich über hunderte Millionen Jahre zu einer Mega-Firewall entwickelt, die fast jedem Hackerangriff standhält. Die Keime, die in unseren Körper gelangen, haben kaum eine Chance. In 99,9 Prozent der Fälle werden sie platt gemacht, noch bevor wir etwas von ihnen merken. Wenn das Immunsystem nicht so präzise und verlässlich wie ein Uhrwerk funktioniert, bricht Chaos im Körper aus.
Die Haut umschließt unseren Körper. Deswegen trifft alles, was mit uns in Berührung kommt, als Erstes auf die Haut. Da ist es kaum überraschend, dass das Immunsystem in der Haut besonders aktiv sein muss. Um einen guten Schutz zu gewährleisten, stehen rund um die Uhr zahllose Immunzellen bereit zum Einsatz. Sobald sich Keime, zum Beispiel über eine kleine Wunde, in die Haut verirrt haben, beginnt eine regelrechte Hetzjagd: Das Wachpersonal, zu dem auch die Mastzellen gehören, reagiert als erstes und schlägt Alarm. Dabei schütten sie Botenstoffe aus, darunter Histamin, das die Blutgefäße weitstellt und so den Transport von Blutzellen an ihren Einsatzort erleichtert. Weiße Blutkörperchen, besonders sogenannte Fresszellen, sind die Kannibalen des Immunsystems. Sie machen Jagd auf die Bakterien und lassen nicht nach, bis sie geschnappt wurden. Und dann fressen sie die Unruhestifter genüsslich auf. Guten Appetit!
Das Zusammentrommeln von Immunzellen in der Haut oder in anderen Organen nennt man Entzündung. Es gibt auch noch andere Akteure des Immunsystems, die dabei eine Rolle spielen, zum Beispiel die Lymphozyten. Das Coole ist, dass man eine Entzündung der Haut sogar von außen erkennen kann – an der Rötung. Dunkle Haut wird bei Entzündung dunkelbraun oder lilafarben. Eine Entzündung tritt zum Beispiel als Folge einer Infektion oder einer Allergie auf, also wenn ein Krankheitserreger oder ein allergieauslösender Stoff in die Haut eindringen. Hautentzündungen spielen bei den meisten Hauterkrankungen eine wichtige Rolle.
Ein Wachposten ruft die Fresszellen auf den Plan.
Das Immunsystem strengt sich unglaublich an – trotzdem kommen gelegentlich folgenschwere Fehler vor. Das gilt besonders, wenn das Wachpersonal sich täuscht und harmlose Stoffe mit gefährlichen Krankheitserregern verwechselt. Dann ertönt der Alarm, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Wenn der Auslöser für den Fehlalarm ein körpereigenes Eiweiß ist, ist die Folge eine Attacke des Immunsystems gegen Strukturen des eigenen Körpers. Dieses »Friendly Fire« nennt man Autoimmunerkrankung. Wenn aber zum Beispiel ein Erdnussflip, also ein harmloser Stoff aus unserer Umwelt, das Immunsystem entzündet, dann hat der Betroffene eine Allergie. Damit wir gesund bleiben, muss das Immunsystem also zwischen Harmlosem und Gefährlichem unterscheiden können. Und das ist eine absolute Mammutaufgabe, wenn man überlegt, mit wie vielen Stoffen wir täglich in Kontakt kommen! Vom Tofuhack in der vegetarischen Bolognesesoße über Erkältungsviren am Haltegriff der U-Bahn bis zu den Laktobazillen im linksdrehenden Biojoghurt – die Liste ist lang. Und nie darf das Immunsystem einen gefährlichen Erreger übersehen – oder einem Erdnussflip den Krieg erklären.
Juckreiz
Neben den verschiedenen Zellen sind auch viele Nervenendigungen in der Haut. In der Epidermis sitzen besonders viele Nerven, die ein Gefühl vermitteln, auf das die meisten gern verzichten würden: Juckreiz. Wie schön wäre es, wenn man sich nach einem Mückenstich nicht die Beine blutig kratzen würde! Was bringt uns Juckreiz eigentlich, außer schlaflose Nächte und aufgekratzte Haut?
Schauen wir uns den Juckreiz einmal genauer an. Bei allergischen Reaktionen, Insektenstichen oder Hautentzündungen schütten die Mastzellen des Immunsystems massenweise Histamin aus. Und es dauert nur einen kurzen Moment, bis das frei herumschwimmende Histamin eine Nervenzelle gefunden hat. Das Histamin dockt an und der Nerv meldet aufgeregt an das Gehirn: »Turbo Juckreiz!« Das ist der Moment, in dem eine Hautstelle wie wild zu jucken beginnt. Und was machen wir Menschen? Wir kratzen. Und zwar so lange, bis der Juckreiz nachlässt. Im Falle eines Mückenstichs ist das erst dann, wenn wir einen tiefen Krater in der Haut produziert haben.
Ein paar Wochen später siehst du dann die Narbe, die durch das heftige Kratzen entstanden ist. Vielleicht ärgerst du dich dann, dass du deine Kratzwut nicht besser im Griff gehabt hast. Aus biologischer Perspektive hast du aber genau das gemacht, was dir dein Körper signalisieren wollte: Du hast mit deinen Fingernägeln die Mückenspucke aus der Haut herausgepult. Mission erfüllt: Du hast einen Stoff, der in der Haut nichts verloren hat, erfolgreich entfernt. Dass dadurch eine Wunde entsteht, die sich auch durch Bakterien infizieren kann, scheint dem Körper dabei völlig egal zu sein.
Neben Fremdstoffen ist Trockenheit ein weiterer Grund für Juckreiz. Wenn die Haut austrocknet, wird sie spröde und reißt. Diese kleinen Hautverletzungen rufen die Immunzellen auf den Plan und eine Entzündung entsteht. Und diese motiviert die Mastzellen dazu, ihr Juckreiz verursachendes Histamin auszuschütten. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Haut bei Neurodermitis oder Nesselsucht so sehr juckt.
»Hab’ dich nicht so, es juckt doch nur ein bisschen!« Das sagt nur jemand, der selbst noch keine Erfahrungen mit starkem Juckreiz gemacht hat. Es gibt eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, die belegen, dass andauernder Juckreiz, zum Beispiel bei einer Nesselsucht, für Betroffene genauso schlimm ist wie starke Schmerzen.7





























