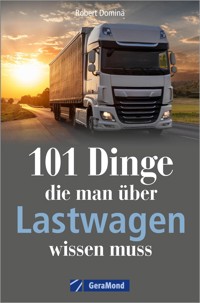
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GeraMond Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie schwer war der schwerste Schwertransport über die Straße? Warum machen manche Lkw Pause auf dem Standstreifen? Und warum gibt es in Europa eigentlich keine "Road-Trains" wie in Australien? Hier finden Sie die Antworten und noch vieles mehr - Rekorde, Unbekanntes, Extremes und Kuriositäten rund um das Thema Lastwagen. Wagen Sie eine Reise durch die Lkw-Geschichte. Hier erlebt jeder Lastwagen-Fan 101 Aha-Momente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
101 Dinge, die man über Lastwagen wissen muss
Der neue Mercedes Benz Actros TGX mit Mirror Cams und weiteren ausgeklügelten Aerodynamik-Verfeinerungen.
Bild: Daimler Truck
Robert Domina
101 Dingedie man überLastwagenwissen muss
Inhalt
1
Was ist eigentlich ein Lkw?
2
Gesamtgewicht als Schlüssel
3
Sattel- oder Gliederzug?
4
Geschwindigkeit
5
Bei uns bedeutungslos
6
Eine Nummer kleiner
7
Hinten angebaut: Typ 1
8
Mit Dolly oder ohne?
9
Hohe Schule: Schwertransport
10
Cargolifter: Auf Sand gebaut
11
Teardrops
12
Holland ist DAF-Land
13
Ford
14
Iveco
15
Man
16
Mercedes
17
Renault Trucks
18
Scania
19
Volvo
20
Skandinavien
21
US-Trucks im Wandel der Zeit
22
Trucking Down Under
23
Die Wüsten-Trucker von Dubai
24
»Esta Kuba!«
25
40 Meter unter dem Meer
26
Kombinierter Verkehr
27
RoLa und HuPa
28
Schrägverladung
29
Achtung: Tote Winkel!
30
Achtung Gefahrgut!
31
Kennzeichnungs-Allerlei
32
Nonverbale Kommunikation
33
Nehmen was übrig ist
34
Kein Fadenkreuz
35
Mit Kindern unterwegs
36
Das kann dauern
37
Tankzug-Voraus
38
Der Traum vom Platoon
39
Blockabfertigung
40
Kreiseln will gelernt sein
41
Lkw-Checker vom Bundesamt
42
Streng geregelt
43
Tachograph und Fahrerkarte
44
Hinterm Lenkrad
45
Die große Reform?
46
Kostenfaktor Maut
47
Selbstanzeige von Lkw-Fahrern
48
Das Eis brechen
49
Alles andere als »Stinker«
50
Parkplatznot ist überall
51
Verschärfte Bedingungen
52
Platz in der kleinsten Hütte?
53
Energiehaushalt in der Kabine
54
Harte Arbeit
55
Langfinger sind überall
56
Das »Ein-Schuh-Mysterium«
57
Babylonische Sprachverwirrung
58
Der Lkw-Antrieb
59
Alternative Antriebe
60
Der Dieselmotor
61
LNG als Alternative
62
Der H2-Direktverbrenner
63
Effiziente Schwergewichte
64
Kraftwerk Brennstoffzelle
65
Quarzt wie eine Dampflok
66
Bremsenergie fürs Kühlgerät
67
Wenn der Trailer mit anschiebt
68
Das stärkste Glied
69
Herzstück Dieselmotor
70
Schwerstarbeiter
71
Hydrodrive statt Allrad?
72
Die Differenzialsperre
73
Warum so viele Gänge?
74
Aus vier mach 16
75
Automatisierte Schaltgetriebe
76
Die Turbo-Retarder-Kupplung
77
Schonende Anfahrvorgänge
78
Gefahren von Gefällestrecken
79
Letzte Ausfahrt Notweg
80
Motorbremse und Co.
81
Von hinten her gedacht
82
Bergab ist Erntezeit
83
Assistenzsysteme
84
Spiegelbildlich gesehen
85
Warum Monitore statt Spiegel?
86
Um die Ecke sehen
87
Trucks, die lesen können
88
Der aktive Bremsassistent
89
Der GPS-Tempomat
90
Der Interurban-Tempomat
91
Fast schon autonom
92
Wie von Geisterhand
93
Spektakel Truck-Race
94
Sandige Angelegenheit
95
Entdeckung der Langsamkeit
96
Von der Natur abgeschaut
97
Die französische Legende
98
Kein Flachwitz
99
Liebenswertes Dickerchen
100
Shit happens
101
Die Pointe zählt
Impressum
Über den Autor
Dem Eintonner-Pick-Up sieht man nicht unbedingt an, dass er ein echter Lkw mit Rahmen und Aufbau ist. Ladefläche und Kabine sind auf einem Leiterrahmen aufgesetzt. Auch in der Zulassung steht: »Lkw mit offener Ladefläche«.
Auch der Iveco Daily baut auf einem Lkw-Rahmen auf. Er gilt daher als robuster im Vergleich zu seinem Transporter-Kollegen mit Rahmen aus geschweißten Hutprofil-Blechen.
Bilder: rod
Eines der aufwendigeren Fahrgestelle: Dieser 8x4-MAN mit Tridem-Aggregat (zwei angetriebene Achsen, eine Nachlaufachse) könnte einen Abrollkipper, eine Baustoffpritsche mit Heckkran oder einen Saugbagger-Aufbau tragen.
Bild: MAN
1 Was ist eigentlich ein Lkw?
Rückgrat Leiterrahmen
Wo hört eigentlich der Transporter auf und wo beginnt der Lkw? Das ist an erster Stelle keine Frage des Gewichts, sondern der Bauart. Klassische Transporter vom Schlage eines Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter sind in der Bauform Kastenwagen immer selbsttragende Konstruktionen. Das heißt: Die Kastenstruktur verteilt die Last der Achsen auf die ganze Konstruktion, die als statisch sehr stabiler und sehr steifer Blechkasten definiert ist. Eine Ausnahme bildet hier von jeher der Iveco Daily, der vom 2,8-Tonner bis zum 7,2-Tonner durchgehend auf einem klassischen Lkw-Rahmen aufbaut. In dieselbe Kerbe schlagen übrigens die Eintonner-Pick-Ups, denn auch sie basieren auf einem sogenannten Leiterrahmen, dessen Bauweise bildlich zu nehmen ist: Zwei kräftige Längsträger sind dabei mit Querträgern verbunden, vorne und hinten schließen Front- und Endprofile die »Leiter« ab.
Stabile Konstruktion
Der Leiterrahmen ist also das Rückgrat aller Lkw-Konstruktionen. Zusammen mit den angeschraubten Achsen, dem Antriebsstrang, bestehend aus Motor und Getriebe und dem Fahrerhaus, bildet er das sogenannte Fahrgestell oder »Chassis«. Und das kann tatsächlich außer Fahren noch nicht viel. Denn erst der Aufbau macht aus einem Fahrgestell ein nützliches Vehikel, also einen Lastkraftwagen (Lkw).
Während die klassischen Transporter meist über die Vorderachse und mit quer eingebauten Motoren angetrieben werden, sind Lkw-Konstruktionen in aller Regel Hecktriebler mit einem in Längsrichtung eingebauten Antriebsstrang. Da Fahrgestell und Aufbau im Grunde getrennte Einheiten sind, erweist sich das Lkw-Prinzip als ungeheuer vielseitig. Verschiedene Kabinengrößen sind so relativ einfach darzustellen, ebenfalls die unterschiedlichsten Aufbauarten. Ein und dasselbe Chassis kann also eine offene Pritsche, einen Kipper oder einen geschlossenen Kastenaufbau tragen – das ist schon mal ziemlich universell.
2 Gesamtgewicht als Schlüssel
Solo-Lkw: Bis 32 Tonnen Gesamtgewicht
Das zulässige Gesamtgewicht, abgekürzt zGG, kennzeichnet den Lkw am einfachsten. Hierzulande begann die Einteilung der Lkw-Klassen beim klassischen 7,5-Tonner-Leicht-Lkw. Seine Daseinsberechtigung bestand in der Hauptsache darin, dass er mit dem alten Pkw-Führerschein »Klasse 3« gefahren werden durfte. Wer also bis 1999 seinen Auto-Führerschein in der Tasche hat, darf damit sogar einen Leicht-Lkw bis 7,5 t GG bewegen.
Die 12- und 18-Tonner
Der nächstgrößere Solo-Lkw ist der 12-Tonner. Er ist optisch vom 7,5 Tonner kaum zu unterscheiden. Beide rollen auf 17,5-Zoll-Rädern und wirken schon dadurch etwas zierlicher als der nächstgrößere 18-Tonner, der – je nach Einsatzart bereits auf 19,5-Zoll- oder sogar auf ausgewachsenen 22,5-Zoll-Lkw-Rädern daherkommt. Der 18-Tonner Solo-Lkw weist bereits die typischen Achslasten für Lkws auf: Vorne 7,5 t maximale Achslast, hinten 11,5 t. Das macht in der Summe zwar technisch 19 t zulässige Achslast, die StVZO billigt dem zweiachsigen Lkw jedoch nur 18 t Gesamtgewicht zu. Diese Eingrenzung zwischen technisch zulässiger Achslast und dem zulässigen Gesamtgewicht hat etwas mit der Belastung von Straßen und Brücken zu tun. Außerdem schadet eine kleine technische Reserve ja nicht, sollte man den Lkw aus Versehen mal ein klein wenig überladen.
Der klassische 7,5-Tonner mit Kofferaufbau: Rund 2,5 Tonnen Nutzlast lassen sich damit auch in engsten Altstadt-Situationen bewegen. Führerscheininhaber der alten Pkw-Klasse III, jetzt Klasse C1E, dürfen den Leicht-Lkw fahren.
Bild: rod
Der 18-Tonner ist der schwerste Lkw, der sich bei uns auf zwei Achsen darstellen lässt. Er kann als Koffer schon um die zehn Tonnen Nutzlast tragen.
Bild: rod
Der Vierachser (hier als 8x4 Kipper) ist der schwerste Solo-Truck auf unseren Straßen. Sein zulässiges Gesamtgewicht ist 32 Tonnen, die Nutzlast eine 8x4 Kippers liegt bei 17 Tonnen.
Bild: rod
Die oben erwähnten 7,5-Tonner und 12-Tonner kommen entsprechend mit kleineren Achslasten daher.
Dreiachser 26 t, Vierachser 32 t
Den dreiachsigen Lkw gibt es in vielen Spielarten. Ihnen allen ist gemein, dass das zulässige Gesamtgewicht 26 t hierzulande nicht überschritten werden darf. Ähnliches gilt für den Vierachser: Ihn treffen wir hauptsächlich als Solo-Kipper auf unseren Straßen an. Er rollt auf zwei Lenkachsen vorne und zwei angetriebenen Achsen hinten. Dieser Typ wird neben dem Dreiachser gerne auch als nutzlaststarkes Betonmischer-Fahrgestell eingesetzt. Sein zulässiges Gesamtgewicht darf bei uns in Deutschland 32 Tonnen nicht überschreiten.
3 Sattel- oder Gliederzug?
Warum der Sattelzug praktischer ist
Der klassische »38-Tonner« hielt sich lange als Kurzbeschreibung eines schweren Lkw im Sprachgebrauch. Er stand (und steht fälschlicherweise immer noch) für einen ausgewachsenen Fernverkehrs-Truck. Gerne wurde er in Countrysongs als solcher verewigt, und in Zeitungsberichten taucht er als 38-Tonner noch heute auf, wenn der Reporter einen schweren Lkw meint. Dabei wurde aus dem klischeehaft romantisierten 38-Tonner schon 1993 der 40-Tonner, wie wir ihn noch heute als Fernverkehrs-Truck auf unseren Straßen wahrnehmen. Schuld für die Auflastung war natürlich mal wieder die EU, die europaweit die zulässigen Gesamtgewichte der Lkw anglich.
Mittlerweile ist der Sattelzug mit 40 Tonnen Gesamtgewicht die häufigste Lkw-Gattung auf Europas Straßen und gleichzeitig die am häufigsten anzutreffende Lkw-Zugkombination. Er besteht aus der »ziehenden Einheit«, der Sattelzugmaschine, und der »gezogenen Einheit«, dem Sattelauflieger. Allein letzterer kann eine Fracht befördern, die Sattelzugmaschine kann alleine, außer einen Auflieger ziehen, eigentlich gar nichts. Der Begriff Sattelzugmaschine passt hier also bestens.
Schon ab Mitte der 1980er-Jahre lief der Sattelzug dem bis dahin vorherrschenden »Gliederzug« den Rang ab. Der Gliederzug, bestehend aus einem zwei- oder dreiachsigen Motorwagen und einem Drehschemel-Anhänger, gilt jedoch bis heute als sehr flexibel einsetzbar. Sein Zugfahrzeug kann auch als Solo-Lkw eine Ladung transportieren und ist dabei noch ziemlich wendig. Mit Anhänger gilt das nicht mehr, wobei es darauf ankommt, ob der Motorwagen einen Drehschemelanhänger zieht oder einen Zentralachsanhänger. Der Unterschied der beiden Anhängerarten liegt in der Anzahl der Gelenke, über die der Hänger mit dem Zugfahrzeug verbunden ist. Beim Drehschemel sind es zwei Gelenke: Einmal das Zugauge der Deichsel und einmal der Drehschemel selbst, der die Vorderachse des Anhängers lenkt. Diese Zugkombination erfordert hohes Können beim Rückwärts-Rangieren. Der Hänger reagiert schon bei kleinsten Lenkbewegungen des Motorwagens sehr empfindlich und läuft einem, wie man sagt, »schnell weg«, also aus der gewollten Spur. Heftiges Gegenlenken bewirkt dann genau das Gegenteil, man verliert den geplanten Kurs, muss nochmal gerade ziehen und kann von vorne beginnen. Der Gliederzug erfordert also einen echten Könner am Lenkrad. Und davon gibt es mit gültigem Führerschein nur noch ganz wenige.
Angedockt: Der klassische 40-Tonner-Sattelzug, bestehend aus einer zweiachsigen Zugmaschine und einem dreiachsigen Schiebeplanen-Auflieger, ist heute europaweit der Standard-Lkw.
Bild: rod
Das erklärt zwar auch ein Stück weit den Siegeszug des Sattels, mit nur einem Gelenk zwischen Zugfahrzeug und Sattel (ein Sattelanhänger ist ein Sattelauflieger, kein Hänger!). Er ist viel einfacher zu rangieren. 90 Grad um die Ecke an die Laderampe ist auch für einen Fahranfänger mit etwas Übung machbar: Den Zug mit einer Lenkbewegung einknicken (vorzugsweise auf der linken Seite, weil der Fahrer hier besser sieht, was hinten passiert), und dann, wie man sagt, »dem Auflieger hinterherfahren«. Das lässt sich mit etwas Gefühl in der Lenkhand leicht bewerkstelligen, weil man als Fahrer nicht – wie beim Gliederzug – doppelt um die Ecke denken muss. Das leichtere Rangieren ist also ein Vorteil des Sattelzuges, seine ungeteilte Ladefläche der andere: Während sich der Gliederzug, ohne ihn trennen zu müssen, nur seitlich beladen lässt, ist der Standard-Sattel von drei Seiten und nicht selten auch von oben beladbar, sofern er mit einem Schiebeverdeck ausgestattet ist.
Aber auch die Veränderungen in der Logistik kamen dem Sattelzug zupass: Heute laufen die Verkehre zu einem großen Teil über Güterverteil-Zentren (neudeutsch: »Hubs«). Dort docken die Lkw mit dem Heck an eines der vielen Ladetore an und können so schnell per Hand oder Stapler be- und entladen werden.
Zwar bietet der 13,6 Meter lange Standard-Sattelauflieger im Vergleich zum Gliederzug eine Reihe Paletten-Stellplätze weniger, trotzdem war sein Siegeszug, beginnend im internationalen Fernverkehr, nicht mehr aufzuhalten.
4 Geschwindigkeit
Wie schnell dürfen Lkw eigentlich fahren?
Ist doch ganz einfach: 60 auf der Landstraße und 80 km/h auf der Autobahn. Soweit so allgemein bekannt. Ob das auch eingehalten wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber stimmt das auch? Und was ist mit den kleineren Lkw, zum Beispiel dem klassischen 7,5-Tonner oder dem sogenannten »schweren Transporter« zwischen 3,5 t und 7,5 t zGG? Unsicherheiten sind hier einmal auf Grund oftmals reichlich kompliziert formulierter Gesetzestexte vorprogrammiert. Aber auch dadurch, dass besonders die Kategorie der »schweren Transporter« bei uns seit der EU-Führerscheinreform praktisch kaum mehr vorkommt. Für Fahrzeuge über 3,5 t zGG benötigt man nämlich seit der Reform den Führerschein Klasse C1E. Der entspricht in groben Zügen dem alten Führerschein Klasse III für Pkw, der damals auch für leichte Lkw bis 7,5 t zGG galt – aber das ist wieder ein anderes Thema.
Fangen wir bei den Pkw und Lkw unter 3,5 t zGG an. Das kann zum Beispiel ein Pick-Up sein oder ein Transporter mit Einzel- oder Doppelkabine und einer Pritsche oder einem Kipper als Aufbau dahinter. Neben den zulässigen Gesamtgewichten, also der »Schwere« des Fahrzeugs orientiert sich der Gesetzgeber gerne an dem »Wo?«, also an der örtlichen Gegebenheit für die Definition der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.
Dieser Actros rollt ausgekuppelt (Drehzahl: 500/min) den Berg hinunter und gönnt sich einen Dipp von plus 2 km/h ins Speed-Töpfchen für 92 km/h. Droht diese Rollphase mit über 90 km/h länger als 60 Sekunden zu dauern, erfolgt eine Warnung im Display.
Bild: rod
Für alle gilt innerhalb geschlossener Ortschaften, also ab dem Ortsschild: nicht schneller als 50 km/h. Das ist einfach. Ausnahmen gibt es, etwa für mehrspurige Ringstraßen oder Ausfallstraßen, wo dann auch mal 60 km/h gelten können, angezeigt durch das entsprechende Schild. Andersherum gibt es auch »30er-Zonen«, ebenfalls als solche gekennzeichnet. Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt in der Regel: maximal 100 km/h für Pkw und andere Kfz-Fahrzeuge kleiner als 3,5 t zGG. Obacht! Mit Anhänger gilt hier: maximal 80 km/h.
Handelt es sich um jenen oben schon zitierten »schweren Transporter« zwischen 3,5 und 7,5 t zGG gelten ebenfalls maximal 80 km/h. Was vielen Verkehrsteilnehmern nicht immer präsent ist: Mit Anhänger am Haken ist diese Fahrzeugkategorie sogar auf 60 km/h begrenzt! Über 7,5 t zGG gelten 60 km/h Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften, also auf der »Landstraße«, egal ob hier ein Anhänger dabei ist oder nicht.
80 km/h dürfen Lkw über 7,5 t zGG per Definition (§ 18 StVO) natürlich auf Autobahnen fahren. Zur Geschwindigkeit sagt § 3 der StVO folgendes: »Diese Geschwindigkeitsbeschränkung [60 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften] gilt nicht auf Autobahnen sowie auf anderen Straßen mit Fahrbahnen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind. Sie gilt ferner nicht auf Straßen, die mindestens zwei durch Fahrstreifenbegrenzung oder durch Leitlinien markierte Fahrstreifen für jede Richtung haben.«
Kein Wort darüber, dass hier 80 km/h für Lkw erlaubt sind. Entscheidend ist offenbar die Mehrspurigkeit einer Straße, die sie von der Bauart her einer Autobahn ähneln lässt. Man geht einfach davon aus, dass ein Lkw hier 80 statt 60 km/h fahren darf, weil es nicht anders definiert ist.
Was ist üblich?
Nun ist es beileibe nicht so, dass alle Lkw 60 und 80 km/h fahren. Außer im Gefahrgut-Bereich. Wer mit Benzin oder Diesel oder anderen gefährlichen Gütern unterwegs ist, hält sich peinlich genau an die 60 auf der Landstraße und 80 km/h auf der Autobahn. Auch wegen der Kontrollen durch die BALM oder die Polizei: Wer hier erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Aber auch die Gefahrgut-Transportunternehmen achten auf die Einhaltung der Regeln. Zu schwer wiegt der Image-Verlust für ein Gefahrgut-Unternehmen, das häufiger in Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit verwickelt ist.
Ansonsten tolerieren die Kontroll-Organe einiges an GeschwindigkeitsÜberschreitungen. »Solange nichts passiert…«, möchte man hinzufügen. Aber 67 bis 69 km/h auf der Landstraße sind kein Problem für jeden Kieskutscher oder Lebensmittel-Verteiler. Auf der Autobahn sind die gefahrenen Geschwindigkeiten mehr oder weniger vom Dieselpreis abhängig: Wer an günstigen Diesel kommt, fährt schon mal Bleifuß mit 90 km/h immer am Begrenzer. Dass das extrem unwirtschaftlich ist, hat sich herumgesprochen und so pendeln sich die Autobahngeschwindigkeiten unter Truckern meist zwischen 82 und 85 km/h ein. Da hat niemand etwas dagegen. Der Verkehr fließt so einigermaßen und der Verbrauch hält sich Grenzen.
Schwungspitzen
Etwas anderes sind sogenannte »Schwungspitzen« den Berg hinunter. Hier nutzen die Lkw und die in ihnen verbauten GPS-Tempomaten den Schwung der eigenen Masse. Dabei lässt der Computer (oder auch der Fahrer, wenn er partout nicht mit GPS-Tempomat fahren will), die Fuhre schon mal bis 90 km/h rollen, einfach um den Schwung zu nutzen. Das spart enorm Sprit, zumal diese Schwungspitzen oft mit einer »Segelphase« verbunden sind, bei denen der Truck ausgekuppelt und damit sehr widerstandsarm rollt. So kann er mit Gratis-Energie sogar schon in die nächste Steigung rollen.
Ungeliebt: Der »Dipp«
Noch eines drauf setzen die Entwickler automatisch agierender Tempomaten, wenn sie sogar jenseits der 90 km/h noch einem bis zu drei km/h extra draufsetzen. Dieser »Dipp« ins Speed-Töpfchen muss aber zeitlich begrenzt sein, sonst notiert der digitale Fahrtschreiber einen Geschwindigkeits-Übertritt über mehr als 60 Sekunden. Und dann wird’s teuer, weil BALM und Polizei solche Eintragungen jederzeit auslesen und ahnden können.
Viele Trucker halten den Dipp auch für übertrieben, obwohl er erwiesenermaßen den Verbrauch auf hügeligen Strecken im Prozentbereich (das ist viel!) senken kann. Aber vielen ist diese hohe Geschwindigkeit mit 40 Tonnen im Kreuz nicht ganz geheuer. Deshalb plädiere ich bei meinen Lkw-Tests auch immer dafür, den Dipp abschaltbar zu gestalten. Man muss niemanden dazu zwingen, schneller zu fahren als er möchte.
DAF lässt bei seinen Trucks keinen Dipp zu. Das blaue Band in der Tachoskala und die Zahlen für Ober- und Unterschwinger zeigen: Maximal 91 km/h (85 plus 6 km/h) und minimal 85 minus 6 km/h darf gerollt werden.
Bild: rod
5 Bei uns bedeutungslos
Geschwindigkeits-Aufkleber am Lkw-Heck
Manchmal sieht man am Heck eines Lkw zwei oder mehr kreisrunde, rot umrandete Aufkleber mit einer Zahl in der Mitte. Manchmal in völlig wirrer Reihenfolge und unterschiedlicher Größe. Dass die Zahl eine Höchstgeschwindigkeit meint, liegt nahe, schließlich sehen die Aufkleber ja auch aus wie Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Es handelt sich in der Tat um Höchstgeschwindigkeiten, die dieser Truck auf verschiedenen Straßentypen fahren darf. Die Aufkleber sollen der Polizei und den Kontrollbehörden in verschiedenen Ländern helfen, die Höchstgeschwindigkeiten dieses Lkw einzuordnen.
In Deutschland haben diese Aufkleber allerdings keine Bedeutung, es besteht auch keine Pflicht dafür. Was an sich schon ungewöhnlich ist, da bei uns doch vieles bis ins kleinste Detail geregelt ist. Hier ausnahmsweise einmal nicht.
Also: Die Aufkleber haben für bundesdeutsche Verkehre zwar keine Bedeutung, wohl aber in manchen Nachbarländern. Die Aufkleber gelten auch nur für das Land, in dem der Lkw zugelassen ist und benennen die jeweiligen Höchstgeschwindigkeiten, die für diesen Lkw, auf bestimmten Straßentypen im Zulassungsland gelten.
Für unsere Verhältnisse eher verwirrend: Die italienischen Kontrollorgane können diese Aufkleber-Sammlung sicher richtig interpretieren.
Bild: rod
6 Eine Nummer kleiner
Warum nur vier statt fünf Achsen am Sattelzug?
Vergleichstest: Zweiachsiger (rechts) gegen dreiachsiger Trailer. Der Zweiachser spart mindestens drei Prozent Diesel durch seinen geringeren Rollwiderstand.
Bild: rod
Wieso fährt jetzt da ein Sattelzug mit nur zwei Aufliegerachsen statt der üblichen drei? Die einfache Antwort wäre: Weil er’s kann. Doch im Transportwesen ist nichts so einfach, wie es zunächst erscheint. Der vierachsige Sattelzug (zwei Achsen an der Zugmaschine, zwei am Auflieger) ist nämlich ganz schön tricky. Und ganz schön clever – auf den ersten Blick jedenfalls. Denn wie jede Transportidee hat dieser »Eine-Nummer-Kleiner«-Zug seine Vor- und auch Nachteile. Und ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem sogenannten Zweiachs-City-Sattel, wie er oft von den Lebensmittel-Verteilern genutzt wird. Der ist nämlich kürzer und hat fast immer eine gelenkte Nachlaufachse, die ihn besonders wendig macht. Der City-Sattel spielt deshalb in einer völlig anderen Liga.
Was aber kann der vierachsige Sattelzug? Sein Trailer ist genauso lang wie der fünfachsige Standard-Zug, nämlich um die 13,6 Meter. Aber: Er bietet natürlich weniger zulässiges Gesamtgewicht. Nämlich 36 Tonnen, wenn der Abstand der Trailerachsen kleiner oder gleich 1,8 Meter ist. Bei über 1,8 Metern Achsabstand sind damit 38 t Gesamtgewicht möglich.
Wie kommt man auf so etwas? Und wie wirken sich die zwei Tonnen weniger Gesamtgewicht auf die Nutzlast und die Transport-Performance aus? Den Hintergrund liefern, kurz gesagt, die Mautgebühren und die sich verändernden Gewichte der üblichen Frachten. Letztere wurden über die letzten paar Jahrzehnte immer leichter. Selbst die großen Trailer-Hersteller sind sich einig darüber, dass zwischen »gut 70 Prozent« (Krone) bis »nahezu 90 Prozent« (Fliegl) aller Transporte weit unter den zulässigen 40 Tonnen Gesamtgewicht ablaufen. Die logische Konsequenz wäre also, auch das Transport-Equipment leichter zu bauen. In diesem Fall also eine Achse einfach wegzulassen, denn die beste und billigste Achse ist die, die man nicht braucht. Zumal vier Achsen weniger Maut kosten als fünf. Die Differenz in den Mautkosten zwischen Vier- und Fünf-Achser liegt bei 2,4 ct/km. Über die Laufleistung eines Fernverkehrszuges – 120.000 km im Jahr sind hier ein praxisgerechter Wert – kommen da immerhin 2.880 Euro an gesparter Maut zusammen.
Ein geringerer Rollwiderstand mit Spriteinsparungen bis zu drei Prozent ist das Eine. Hoher Reifenverschleiß bei Kurvenfahrt das Andere. Beim zweichsigen Trailer bleibt viel Gummi auf der Straße.
Bild: rod
Wie wirkt sich nun die eine Achse weniger auf die Nutzlast aus? Nicht viel: Zum klassischen, fünfachsigen Sattelzug mit 40 t zGG fehlen dem vierachsigen Zug mit 38 t gerade mal zwei Tonnen. Aber: Der Sattelauflieger mit nur zwei Achsen ist ja auch deutlich leichter. Vom Leergewicht her etwa 1,3 Tonnen. Eine fehlende Achse samt Aufhängung, Federung und Rädern kommt also um etwa diesen Betrag direkt der Nutzlast des zweiachsigen Trailers zugute. Will sagen: Der Nutzlast-Nachteil des vierachsigen 38-Tonnen-Zuges beträgt im Vergleich zum fünfachsigen 40-Tonnen-Zug nur noch rund 700 kg. So what? – Wenn die Frachten ohnehin immer leichter werden?
7 Hinten angebaut: Typ 1
Einfachste Form des Lang-Lkw in Deutschland
Während in Skandinavien und Australien regelrechte Road-Trains mit zwei Aufliegern oder – wie in Australien – mit bis zu vier Anhängern fahren dürfen, tun sich die Zentraleuropäer schwer mit Lang-Lkw oder »Giga-Linern«, wie sie auch genannt werden. Teilweise durchaus nachvollziehbar: Zentraleuropa ist dicht besiedelt, Platz für Straßen und Parkplätze ist knapp. Dennoch lässt sich die Anhänger-Industrie immer wieder neue Lösungen einfallen, um mit einem Zug und einem Fahrer ein mehr oder weniger großes Plus an Fracht transportieren zu können.
Lang-Lkw sind effizienter
In Deutschland haben es Innovationen rund um den Lang-Lkw traditionell schwer. Die Interessenvertreter der Pkw-Fahrer und die Freunde der Schiene wettern gegen immer längere Fahrzeug-Kombinationen, die ein deutliches Plus an Transport-Effizienz bieten würden.
Hierzulande hat man die verschiedenen Spielarten genehmigungsfähiger Lang-Lkw in fünf Kategorien eingeteilt (vgl. Grafik). Die einfachste Art ist der Lang-Lkw »Typ 1«. Hier verlängern die Trailer-Bauer einfach den Auflieger vom Standard-Maß 13,6 Meter auf 15 Meter, also um rund 1,4 Meter nach hinten. Das Dreiachs-Aggregat des Trailers wandert dabei um knapp einen halben Meter nach hinten (Radstands-Verlängerung). Der nach hinten verlängerte Zug kann nun vier Euro-Paletten mehr transportieren, ein Gewinn in Volumen von gut zehn Prozent.
Betrachtet man sich so einen Typ-1-Zug von der Seite, fällt der enorme hintere Überhang auf: Passt so was denn durch die Kreisverkehre und Kurven nach BO-Kraftkreis? Ja. Allerdings behilft man sich hier in vielen Fällen mit einer sogenannten »Lastverlagerungsachse«. Damit ist gemeint, dass die letzte der drei Trailerachsen über die Federbälge der Luftfederung bei Kurvenfahrt entlastet werden kann. Das kommt praktisch einer Radstands-Verkürzung gleich, der Auflieger zieht nicht mehr so stark in Richtung Kreiselinneres und läuft leichter durch den Kreisel. Manche Hersteller bieten auch Versionen mit einer gelenkten Nachlaufachse kann. Die sitzt dann abermals etwas nach hinten versetzt zur mittleren Trailerachse und lenkt mit. Damit erreicht der Typ-1-Lang-Lkw praktisch die Wendigkeit eines Standard-Sattels.
Diese Zugkombinationen zählen zu den »Lang-Lkw«.
Bild: BMVI
Der Lang-Lkw Typ 1 ist ein Sattelzug mit verlängertem Heck. Trotz Radstands-Verlängerung der drei Trailerachsen bleibt noch ein gewaltiger hinterer Überhang. Dank der letzten »Lastverlagerungsachse« passt dieser Typ 1 durch die gängigsten Kreisverkehre nach BO-Kraftkreis.
Bild: Krone
Die Zulassung für den Deutschen Straßenverkehr für diesen Lang-Lkw-Typ wurde erneut verlängert, diesmal bis Ende 2028. Ob der Typ 1 jemals zum Standard werden wird, ist eher unsicher: Er ist auf Grund seiner Länge ein Spezialfahrzeug, weil die hiesige Be- und Entladestruktur nun mal auf den 16,5-Meter-Sattel mit 13,6-Meter-Auflieger eingespielt ist. Beim Schrägparken auf Raststätten hat der Typ1 laut BAST-Studie keine Probleme, schließlich sei er mit seinen 17,8 Metern Gesamtlänge fast einen Meter kürzer als ein regulärer Gliederzug mit 18,7 Metern Gesamtlänge. Zu beachten seien jedoch die Fahrgassenbreiten im Bereich der »Schrägparkparkstände« (= Lkw-Parkplätze). Und das heißt wiederum durch die Blume, dass man als Fahrer eines Typ 1 beim Ein- und Ausfahren aus Schrägparkplätzen höllisch auf sein ausschwenkendes Heck aufpassen muss.
8 Mit Dolly oder ohne?
Lang-Lkw vom Typ 2 und Typ 3
Sie sind mit 25,25 Metern Länge derzeit die längsten Gespanne, die auf (den meisten) unserer Straßen erlaubt sind. Ist der Lang-Lkw vom Typ 1 eigentlich nur ein Sattelzug mit verlängertem Auflieger, spricht die Branche bei den Lang-Lkw-Typen 2 und 3 bereits von »Giga-Linern«. In der Tat sind beide Spielarten mit maximal 25,25 Metern Länge schon deutlich länger als der Standard-Gliederzug mit 18,75 Metern maximal zulässiger Gesamtlänge. Das kann natürlich nur als Motorwagen-/Sattelangerkombination oder als Sattel plus Anhänger funktionieren.
Typ 2 am häufigsten
In dem seit Jahren laufenden Studien und Großversuchen der BASt (Bundesanstalt für Straßengüterverkehr) und des BMVI ist der Typ 2 mit rund 60 Prozent der bei der BASt gemeldeten Lang-Lkw der häufigste Typ. Er besteht aus einem Standard-Sattelzug plus tief gekuppeltem Zentralachs-Anhänger. »Tief gekuppelt« heißt, dass die Deichsel (Zugstange) des Zentralachs-Anhängers weit unter das Heck des ziehenden Sattel reicht. Das ist notwendig, damit der Anhänger sauber in der Spur des Aufliegers durch Kurven und Kreisverkehre läuft.
Diese Kombination ist sehr praktisch und vergleichsweise kostengünstig für die Betreiber, weil nur wenige Spezialteile für das Funktionieren dieser Kombination notwendig sind. Und immer wenn von solchen Zügen die Rede ist, spielen auch die standardisierten Behälter des Kombiverkehrs eine große Rolle. Sowohl der Typ 2 als auch der Typ 3 können einen Sattel plus einen 7,45-Meter-Wechselbehälter transportieren. Ist der Sattel ein Container- oder Wechselbehälter-taugliches Chassis, lassen sich darauf zwei 7,45er Wechselbrücken packen. Alles in allem also bis zu drei Wechselbrücken oder ein Sattel plus eine Wechselbrücke.
Typ3 benötigt ein Dolly
Beim Typ 3 dreht man die Sache einfach um: Hier zieht ein dreiachsiger Motorwagen (6x2) mit gelenkter Nachlaufachse einen Standard-Sattel. Das funktioniert freilich nur mit einem zwischengeschalteten »Dolly«. Dieses zweiachsige Zwischenfahrgestell trägt eine Sattelkupplung und vorne eine Deichsel, die es mit dem Zugfahrzeug verbindet. Vorteil dieser Kombi: der Zugwagen ist ein seriennaher 6x2-Standard-Dreiachser, der sowohl einen 20-Fuß-Container oder eine 7,45-Meter-Wechselbrücke tragen kann. Für den gezogenen Sattel gilt das gleiche wie für den Typ 2. Knackpunkt beim Typ 3 ist das Dolly. Das Dolly ist ein eigenes, kostspieliges und hoch komplexes Bauteil, vor allem in gelenkter Ausführung. Und mit seinem Eigengewicht von rund 1,5 Tonnen schmälert es die Nutzlast des Typ-3-Lang-Lkw. Apropos Nutzlast: Anders als in Skandinavien, wo Lang-Lkw in den verschiedensten Spielarten mit bis zu 70 Tonnen Gesamtgewicht unterwegs sind, sind die Lang-Lkw in Deutschland und in manchen Nachbarländern auf 40 Tonnen Gesamtgewicht begrenzt, im Kombiverkehr (vgl. Kapitel »Kombinierter Verkehr«) auf 44 Tonnen.
So sieht das Dolly für einen Lang-Lkw Typ 3 aus. Diese Version von Krone verfügt über eine gelenkte Achse. Es gibt aber auch Dollys mit starren Achsen.
Bild: Krone
Dass Lang-Lkw besonders viel Nutzlast befördern können, stimmt also nicht – eher weniger als bei einer Standard-Zugkombination, die ja vom Leergewicht her leichter ist. Was aber sind dann die Vorteile der Lang-Lkw? Zunächst gilt einmal die Formel »Zwei Lang-Lkw ersetzen drei Standard-Lkw«. Und damit gilt auch: Es sind auch nur zwei statt drei Fahrer für die gleiche Transportleistung notwendig. In Zeiten akuten und sich verschärfenden Fahrermangels ist das für die Betreiber ein Riesen-Argument pro Lang-Lkw.
Der Lang-Lkw Typ 3 von Krone mit gelenktem Dolly in einem Kreisverkehr: Der Auflieger folgt hier brav der Spur des Zugfahrzeugs und läuft nur minimal ein.
Bild: Krone
Hauptsache BO-Kraftkreis-tauglich
Dürfen die Typen 2 und 3 eigentlich überall fahren? Klares Nein. Beide Bauarten meistern zwar, wenn auch knapp, den BO-Kraftkreis, dürfen aber nur bestimmte, für sie freigegebene Strecken befahren. Welche das sind, ist auf einer »Positiv-Netz« genannten Landkarte für Deutschland dargestellt. Grün sind hier praktisch 70 Prozent aller Autobahnen markiert. Ein seitenlanger Tabellen-Anhang regelt darüber hinaus haarklein, welche Bundesstraßen- und Staatsstraßen-Abschnitte für Lang-Lkw freigegeben sind.
Ist das Streckennetz schon sehr speziell, gilt das erst recht für das Handling von Lang-Lkw. Das Abbiegen und Rangieren ist je nach Platzverhältnissen und der Fahrkunst des Chauffeurs eine Herausforderung. Immerhin haben wir es bei beiden Lang-Lkw mit zwei Gelenken im Zug zu tun. Das gilt zwar auch für einen normalen Gliederzug mit Drehschemel-Anhänger. Nur geübte Drehschemel-Fahrer schaffen es, und sei es nur rückwärts geradeaus, zwei schnurgerade abgestellte Wechselbrücken ohne Feindberührung zu unterfahren und aufzunehmen. Rückwärts und 90 Grad um die Ecke ist dann schon die »Hohe Schule«.
Rangieren? Schwierig
Mit einem Lang-Lkw Typ 2 oder Typ 3 rückwärts zu rangieren, ist vielleicht geradeaus für einen geübten Fahrer noch machbar. Irgendwie um die Ecke rückwärts so gut wie unmöglich. Am Güterverteil-Zentrum angekommen, heißt es dann erst mal den Lang-Lkw zu trennen. Hier hat der Typ 2 eindeutig Vorteile, weil im Grunde ja nur der angehängte Zentralachser abgestellt werden muss. Der Solo-Sattel kann dann rückwärts sofort an einem Lade-Tor andocken. Beim Typ 3 müsste zuerst der Sattel mit dem Dolly abgestellt werden, erst dann kann eine Wechselbrücke vom Zugfahrzeug abgestellt werden. Wie man es auch dreht und wendet: Der Ladungswechsel bei den großen Lang-Lkw ist so oder so nicht ganz einfach.
Hierzulande haben sich die Lang-Lkw Typ 2 oder 3 jedenfalls noch nicht so richtig durchgesetzt. Eine gewisse Attraktivität bieten sie im Zu- und Ablauf des Kombinierten Verkehrs mit Containern oder Wechselbrücken und auch als rationeller Träger für Wechselbrücken bei den Paketdiensten. Von den universellen Einsatzmöglichkeiten eines Wald- und Wiesen-Sattels sind sie jedoch meilenweit entfernt.
9 Hohe Schule: Schwertransport
Lang, breit, hoch und schwer
Was aus der normalen Transportwelt heraussticht, heißt Schwertransport und ist oft spektakulär. Schwertransporte sind in vielerlei Hinsicht schwer: vor allem aber sind sie schwer zu planen und schwer durchzuführen. Am Anfang jeden Schwertransports steht eine intensive, zeitfressende Planungsphase. Wenn klar ist, welche Maße und Gewichte mit welchem Fahrzeug zu transportieren sind, beginnt die Routenauswahl. Lange Umwege sind vorprogrammiert, sorgfältige Recherche-Arbeit ist unerlässlich: Welche Kurvenradien benötigt der Transport, kommen wir da überhaupt um die Ecke?
Erstaunlich wendig
Das ist noch das geringste Problem, denn sowohl die Schwerlast-Zugmaschine als auch die verwendeten Transport-Plattformen sind heute enorm wendig. Die Tiefbett-Auflieger und Träger-Module lassen sich der Last entsprechend konfigurieren und damit auch die Achszahl, die wiederum entscheidend für die Tragfähigkeit des Schwerlast-Zuges ist. Da meist alle Achsen des Aufliegers oder Anhängers einzeln und unabhängig voneinander lenkbar sind, stellt sich meist nur die Frage nach dem verfügbaren Ausschwenkraum im Umfeld einer Kurve. »Nur« ist jetzt ein wenig vereinfacht. Denn meist sind es Verkehrszeichen, Laternenpfähle oder Ampeln, die die Begleit-Crew mal schnell abmontieren und wieder aufstellen muss, wenn der Transport durch ist. Die Leute, die das machen, sind absolute Profis und beherrschen ihr Metier. Man glaubt als Beobachter gar nicht, wie schnell eine eingespielte Schwertransport-Mannschaft eine Kreuzung von sämtlichen Vertikalhindernissen frei räumen und anschließend wieder in den Urzustand zurück versetzen kann. Meist sind mehrere solcher Crews im Vor- und Nachlauf des Schwertransports unterwegs.
Dieser Actros SLT 4163 befördert die Gegengewichte eines Mega-Krans. Die zehn Einzelachsen des Aufliegers sind alle lenkbar und erlauben einen seitlichen Neigungsausgleich.
Bild: rod





























