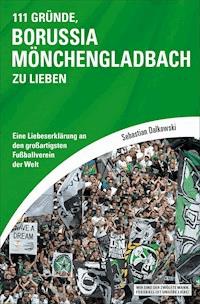
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wer in jener Gegend zwischen Holland und Ruhrgebiet aufgewachsen ist, die sich Niederrhein nennt, der hat nicht viele Möglichkeiten: Entweder er wird Fan von Borussia Mönchengladbach oder aber er interessiert sich nicht für Fußball und hält zu Bayern München. Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch hat mal gesagt 'Der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären.' Und so weiß der Borussia-Fan gar nicht so genau, warum er letztlich Anhänger der Fohlenelf ist, hat dafür aber sehr viele Erklärungen. Es ist die Mannschaft, die nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Region zusammenhält. Es sind die goldenen Siebziger mit Günter Netzer, Jupp Heynckes und Allan Simonsen, in denen Mönchengladbach mit tollem Konterfußball fünf Mal Meister wird und damit häufiger als Bayern München. Es ist dieses ständige Auf und Ab. Für den Weg von Europa bis in die Zweite Liga brauchte Borussia keine drei Jahre, für den umgekehrten Weg immerhin fünf. Es ist ein Pfostenbruch, ein Dosenwurf, ein 12:0 und eine Erinnerung namens Bökelberg. Es ist Borussia Mönchengladbach, die Elf vom Niederrhein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sebastian Dalkowski
111 GRÜNDE, BORUSSIA MÖNCHEN-GLADBACH ZU LIEBEN
Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt
VORWORT
WIR SIND JA SO BESCHEUERT
Bei mir fing es ja so an, dass der Nachbar uns Anfang der 90er zwei signierte Autogrammkarten mitbrachte. Meinem Bruder gab ich die von Martin Max, ich behielt die von Hans-Jörg Criens, den ich für den größten Stürmer unter der Sonne hielt. Danach war irgendwie klar, zu welchem Verein ich halten würde. Vielleicht ist es so banal.
Mehrere Milliarden Menschen sind kein Fan von Borussia Mönchengladbach. Die Mehrheit der Weltbevölkerung liebt entweder einen anderen Verein oder interessiert sich nicht für Fußball. Das ist bedauerlich und zeigt, dass der Mensch keine genetische Veranlagung besitzt, Borusse zu werden. Irgendwas macht die einen dazu, die anderen verschont es. Sehr hoch ist die Wahrscheinlichkeit, angesteckt zu werden, wenn man wie ich am Niederrhein aufgewachsen ist, jenem platten Land zwischen Holland und Ruhrgebiet, zu dem auch Mönchengladbach gehört.
Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch hat mal gesagt »Der Niederrheiner weiß nichts, kann aber alles erklären.« Und so weiß der Borussia-Fan gar nicht so genau, warum er letztlich Anhänger der Fohlenelf ist, hat dafür aber sehr viele Erklärungen. Es ist die Mannschaft, die nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Region zusammenhält. Es sind die goldenen 70er mit Günter Netzer, Jupp Heynckes und Allan Simonsen, in denen Mönchengladbach mit Konterfußball fünfmal Meister wurde. Es ist dieses ständige Auf und Ab. Für den Weg von Europa bis in die Zweite Liga brauchte Borussia keine drei Jahre, für den umgekehrten Weg immerhin fünf. Es ist ein Pfostenbruch, ein Dosenwurf, ein 12:0 und eine Erinnerung namens Bökelberg.
Oder ist es doch etwas ganz anderes, das die Liebe weckt?
Dies ist ein Buch für die, die nicht verstehen, warum der Ehemann, die Ehefrau, der Nachbar, der Sohn, die Tochter, der Arbeitskollege jeden Samstag herbeisehnen wie den Tag der Gehaltsüberweisung. Dies ist ein Buch für die, die sich vergewissern wollen: Ach ja, deshalb bin ich so bescheuert. Und nicht zuletzt ist dies ein Buch über einen Verein, der uns nicht alles bedeutet. Sondern viel mehr. Borussia Mönchengladbach, die Elf vom Niederrhein.
Sebastian Dalkowski
I. KAPITEL
SCHÖNER GING’S NICHT
DIE GOLDENEN 70ER
GRUND NR. 1
Weil Hennes Weisweiler aus Borussia die Fohlenelf machte
Wie lässt sich die Bedeutung von Trainer Hennes Weisweiler für Borussia Mönchengladbach auf den Punkt bringen, ohne zu übertreiben? Zum Beispiel so: Er war die wichtigste Person in der Vereinsgeschichte. Ohne ihn wäre die Borussia heute so bedeutend wie Westfalia Herne oder Sportfreunde Siegen. Ohne ihn hieße die Hennes-Weisweiler-Allee, die zum Stadion im Nordpark führt, heute vielleicht … nein, ohne ihn gäbe es gar kein Stadion im Nordpark.
Als der Regionalligist Borussia Mönchengladbach und Hennes Weisweiler im April 1964 zusammenfinden, haben sie eines gemeinsam: Große Zeiten haben sie noch nicht erlebt. Okay, Gladbach hat 1960 den DFB-Pokal gewonnen, und Hennes Weisweiler den 1. FC Köln mit einigem Erfolg trainiert, aber sonst? Sepp Herberger hat der Borussia seinen früheren Assistenten empfohlen, der die DFB-Lehrgänge zur Trainerausbildung an der Sporthochschule Köln leitet. Der Verein sucht einen neuen Fußballlehrer, weil Fritz Langner zu Schalke 04 wechselt. Als Weisweiler den Club 1975 verlässt, ist Borussia ein anderes Team. Drei Deutsche Meisterschaften hat er mit ihnen gewonnen, einmal den DFB-Pokal und zu seinem Abschied den UEFA-Pokal.
Weisweiler macht gleich zu Beginn so ziemlich alles anders als Langner. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist es, die schwarzen Trikots, in denen Borussia bisher aufgelaufen ist, durch weiße zu ersetzen – angeblich auf Anraten seiner Frau. Dann sortiert er nach und nach die alten Recken aus und setzt auf junge, talentierte Spieler. Der Etat lässt ohnehin keine großen Sprünge zu. Weisweiler baut auf Netzer, auf Heynckes, auf Laumen, allesamt in der Blüte ihrer Jugend, und macht sie wie später auch Vogts zu Spitzenspielern. Und: Er lässt sie nicht den üblichen langweiligen Fußball kicken, sondern immer schön offensiv. Lieber 5:4 gewinnen als 1:0. Langner hat auf Disziplin und Ordnung gesetzt, Weisweiler gibt seinen Spielern Freiheiten und lässt auch Diskussionen zu. So schafft er die Fohlenelf, wie der Sportjournalist Wilhelm August Hurtmanns das Team aufgrund seiner Jugendlichkeit und der unbekümmerten Angriffslust tauft. Gleich im ersten Jahr gelingt der Aufstieg in die 1. Bundesliga. In der zweiten Saison schlägt Borussia Schalke mit 11:0, der Begriff »Torfabrik« macht die Runde. In ganz Deutschland gewinnen die Fohlen Freunde mit ihrem einzigartigen Konterfußball, den Weisweiler sie gelehrt hat.
Doch nicht die Abteilung Angriff ist verantwortlich für die erste Meisterschaft, sondern die Defensive. Nachdem Netzer Weisweiler erfolgreich gedrängt hat, die arg löchrige Abwehr endlich zu stopfen, holt der Verein für die Saison 1969/70 in Vorstopper Ludwig Müller und Libero Klaus-Dieter Sieloff, zwei erfahrene Verteidiger. Prompt hat Gladbach die beste Defensive und gewinnt den Titel, bleibt aber das Gegenstück zur anderen großen deutschen Mannschaft der 70er, Bayern München, die eher pragmatischen Fußball spielt. Mit den Auftritten im Europapokal sorgt Borussia auch im Ausland für Aufsehen. All das ist das Werk von Hennes Weisweiler, dem Kölner, der ausgerechnet in Gladbach seine größten Erfolge feiert. Doch er will sein Werk nicht bis in alle Ewigkeit weiterführen.
1975 ist er zusammen mit Udo Lattek bei Dalli, Dalli zu Gast. Weisweiler verkorkt Weinflaschen und gibt sie an Lattek weiter. Niemand ahnt, dass er nur ein paar Monate später auch seinen Trainerposten an Lattek weitergeben würde. Gleich nach dem Gewinn des UEFA-Pokals teilt er der geschockten Vereinsführung mit, dass er zum FC Barcelona wechselt. Zum einen, weil er mit Borussia alles erreicht hat, was er erreichen will, zum anderen, weil er bei Barcelona deutlich mehr verdient. Nach elf Jahren ist die Ära Weisweiler vorbei, seine Leistungen aber strahlen bis heute. Mehr noch als seine Titel.
GRUND NR. 2
Weil selbst ein Pfostenbruch Borussia nicht stoppen konnte
Es gibt Geschichten, die hat ein Borussia-Fan schon tausend Mal gehört. Doch weil sie so gut sind, hört er sie gerne ein tausendundeinstes Mal. Zum Beispiel jene, wie Gladbach dafür sorgte, dass die Tore nicht mehr aus Holz, sondern aus Aluminium gefertigt werden. Es ist der 3. April 1971. Borussia tritt am 27. Spieltag zu Hause gegen Bremen an. Mönchengladbach, aktueller Deutscher Meister, befindet sich im Titelkampf in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bayern München. Jeder Punktverlust kann die Entscheidung bedeuten. Horst Köppel schießt Borussia in der siebenten Minute mit 1:0 in Führung, doch Heinz-Dieter Hasebrink gleicht bereits neun Minuten später aus. Borussia stürmt ununterbrochen weiter. Ohne Erfolg. Es sieht ganz danach aus, als würden die Fohlen sich mit einem Punkt begnügen müssen. Dann bricht die 88. Minute an. Günter Netzer bringt einen Freistoß hoch in den Bremer Strafraum, Torhüter Günter Bernard befördert den Ball vor dem heranfliegenden Herbert Laumen über die Latte. Der hat so viel Schwung, dass er ins Tor läuft, sich im Netz verheddert und zu Boden geht. Leider reißt er dabei auch den von ihm aus gesehen rechten Torpfosten mit sich, der knapp oberhalb der Grasnarbe auseinanderbricht. Die Tore bestehen damals noch aus Holz, nicht aus Aluminium. Und Holz wird manchmal morsch. Das Tor fällt über Laumen zusammen, er liegt wie ein Fisch im Netz.
Großes Gelächter unter den Spielern und auf den Rängen. Während die Bremer versuchen, das Gehäuse wieder aufzurichten, dämmert den Borussen, dass dies die Gelegenheit ist, den Punktverlust doch noch zu vermeiden. Wenn die Partie abgebrochen wird, gibt es ein Wiederholungsspiel, und das würden sie dann gewinnen. Also beteiligen sie sich nicht mit vollem Einsatz an den Reparaturversuchen. Sogar die Borussen-Chronik zum 110-jährigen Bestehen hält fest: »Gladbacher Ordner waren nicht übermäßig aktiv bei der ›Ersten Hilfe‹: Ihnen war wie allen Borussenfans und wohl auch den Spielern ein Wiederholungsspiel lieber, um dann doch noch zwei Punkte einzufahren.«1
Netzer sagt sogar zum Schiedsrichter, er könne doch sehen, dass hier nichts zu machen sei. Am besten breche er das Match ab. Doch Schiri Gert Meuser, der erst sein fünftes Bundesligaspiel pfeift, schlägt vor, Ordner sollen den Pfosten die letzten Minuten stützen. Die stellen sich selbstverständlich ungeschickt an, auch Hammer und Nägel helfen nicht weiter. Meuser resigniert und bricht das Spiel ab. Gladbach scheint sein Ziel erreicht zu haben. Wenn da nicht der DFB wäre. Der erklärt Werder Bremen am 29. April zum Sieger und brummt Gladbach noch 1.500 DM Geldstrafe auf. Ein Grund für das Urteil ist die Passivität, die die Borussen bei den Wiederaufbaumaßnahmen an den Tag gelegt haben. Den Einspruch lehnt der DFB ab. Offizielle Begründung: »Ein Bundesligaverein ist nun mal kein Dorfverein. Er hat dafür zu sorgen, dass in angemessener Frist ein zusammengebrochenes Tor wieder sachgemäß aufgestellt werden kann.« Dass heute trotzdem eine Loge im Borussen-Stadion Pfostenbruch heißt, hat auch damit zu tun, dass die Geschichte für Gladbach doch noch gut ausging. Borussia wurde trotzdem Meister. Herbert Laumen wechselte nach der Saison ausgerechnet zu Werder Bremen und wurde dort nicht glücklich. Und die Bundesligavereine setzten seit dem 3. April 1971 lieber auf Aluminium.
GRUND NR. 3
Weil es dafür schon einer Limodose bedurfte
»And the Oscar goes to …«. Die Zuschauer im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles halten den Atem, als Liza Minnelli am 10. April 1972 bekannt gibt, wer die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller erhält. Gene Hackman oder doch Walter Matthau? Minelli öffnet den Umschlag, sieht auf den Zettel, blickt leicht verwirrt zu den Zuschauern und sagt dann: »Roberto … ähem … Boninsegna.« Roberto wer? Roberto B-o-n-i-n-s-e-g-n-a, Stürmer von Inter Mailand, zum Zeitpunkt seiner größten schauspielerischen Leistung 27 Jahre alt. Es ist Mittwoch, der 20. Oktober 1971. Borussia Mönchengladbach tritt auf dem Bökelberg zum Achtelfinalhinspiel des Landesmeisterpokals gegen Inter an. Es sollte die größte und schlimmste Nacht aller Zeiten für jeden Borussen werden. Gladbach überrollt Inter Mailand mit 7:1. Heynckes, le Fevre und Netzer treffen doppelt, Klaus-Dieter Sieloff verwandelt in der 83. Minute einen Elfmeter zum Endstand. Eine Sensation. Besser sieht niemand die Borussia je spielen.
Die Sache hat bloß einen Haken: die 28. Minute. Gladbach führt mit 2:1, als sich Inters Stürmer Boninsegna und Borussias Verteidiger Luggi Müller um einen Einwurf streiten. Eine Dose der Marke Coca-Cola fliegt von den Rängen und trifft Boninsegna. Danach gehen die Versionen auseinander. Die Inter-Version lautet so: Boninsegna wird von einer vollen Büchse am Kopf getroffen, ist sofort bewusstlos und muss deshalb auf einer Trage vom Platz in die Kabine transportiert werden, quasi mit dem Tod kämpfend. Die Gladbacher Version: Boninsegna wird von einer leeren Dose bloß an der Schulter getroffen und lässt sich erst fallen, als ihn Inter-Kapitän Sandro Mazzola dazu auffordert. So versucht das Team, die sich abzeichnende Niederlage am Grünen Tisch zu verhindern oder einen Spielabbruch zu erzwingen. Immer wieder will der Stürmer aufstehen, aber der Masseur drückt ihn immer wieder zu Boden.
Filmaufnahmen des Wirkungstreffers gibt es nicht, so wie es überhaupt kaum Aufnahmen von der Partie gibt. Kurz vor Spielbeginn ist die Übertragung abgesagt worden, weil sich Borussia und ARD nicht darüber einig waren, wer die Mehrwertsteuer von 6.600 DM für den Erwerb der Übertragungsrechte zahlen soll. Nur die 27.500 Zuschauer im Stadion werden Zeugen dieses Jahrhundert-Spektakels.
Der Werfer ist bis heute unbekannt. Zwar wird direkt nach der Tat ein 29-Jähriger aus dem niederrheinischen Bracht festgenommen, der aber bestreitet das Vergehen. War der Werfer vielleicht ein Italiener? Sollte die Dose Müller treffen und nicht den Inter-Stürmer? Die UEFA interessiert das alles nicht. Ganz Gladbach rechnet bloß mit Platzsperre oder Geldstrafe. Beides gibt es auch, aber das ist nicht alles: Das Spiel wird annulliert. Die größte Sternstunde der Borussen – einfach ausgelöscht. Die Stadt ist in Aufruhr, die Kneipen sind voll. Tenor: Die Mannschaft wird für etwas bestraft, für das sie nichts kann. Sternstunden haben es so an sich, dass sie sich nicht wiederholen lassen. Das Rückspiel verliert Gladbach mit 2:4, das Wiederholungsspiel im Berliner Olympiastadion endet 0:0. Borussia fliegt raus. Ausgerechnet im Zweikampf mit Boninsegna bricht sich Verteidiger Müller das Bein.
Bis 2012 steht die Dose im Vereinsmuseum von Vitesse Arnheim. Der niederländische Schiedsrichter Jef Dorpmans hat sie mit nach Hause genommen und seinem Heimatverein übergeben. Zum 40. Jahrestag des Büchsen-Debakels bemüht sich Borussia um die Rückkehr der Dose. 2012 darf eine nach Arnhem geschickte Delegation sie schließlich an sich nehmen. Im geplanten Borussia-Museum soll sie einen Ehrenplatz erhalten.
GRUND NR. 4
Weil Borussia als erster Bundesligist den Meistertitel verteidigte
Das ist doch unerhört. Steigt da so ein Verein aus der niederrheinischen Provinz in die Bundesliga auf, sieht sich die Veranstaltung vier Jahre lang an und wird dann 1970 mit einem unterdurchschnittlichen Etat und einem der kleinsten Stadien einfach Deutscher Meister. Ein Dorf von 150.000 Einwohnern. Da ist ja selbst Braunschweig größer, dessen Eintracht die Schale in der Saison 1966/67 geholt hatte. Und nun bilden sich die Borussen ein, dass sie den Titel in der nächsten Saison verteidigen können? Unerhört, einfach unerhört. Das ist doch bisher keiner Bundesligamannschaft gelungen.
Lange dauert es nicht, bis all diejenigen verstummen, die Gladbachs erste Meisterschaft für eine Laune der Natur gehalten haben. Nach 13 Spieltagen steht Borussia Mönchengladbach souverän und als einziges Team ohne eine Niederlage an der Tabellenspitze. Selbst den Bayern gelingt daheim gegen die Fohlen nur ein 2:2. Die Torfabrik läuft wieder. 5:0 gegen Kaiserslautern, 6:0 gegen Oberhausen. Wer will diese Mannschaft noch stoppen? Erst mal stoppt sie ein englischer Verein. In der 2. Runde des Europapokals der Landesmeister tritt Gladbach gegen den FC Everton an. Das Hinspiel endet 1:1, das Rückspiel ebenfalls. Elfmeterschießen! Borussia verliert das Drama. Gegen Hertha BSC kassiert Gladbach die erste Niederlage der Saison, Bayern holt sich die Tabellenführung und wird Herbstmeister. Schon am 19. Spieltag steht Borussia wieder dort, wo sie hingehört, doch das Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter. Andere Teams sind im Titelkampf nicht zugelassen.
Als Gladbach mit 3:1 gegen Bayern gewinnt, scheinen die Borussen endlich davonzuziehen. Doch wenn der Nackenschlag der Hinrunde das Elfmeterdrama gegen Everton war, ist der Nackenschlag der Rückrunde die Niederlage am Grünen Tisch gegen Werder Bremen nach dem Pfostenbruchspiel. So ist die Situation nach 31 Spieltagen folgende: Gladbach Tabellenführer mit 44:18 Punkten, dahinter Bayern München mit ebenfalls 44:18 Punkten und die nur um eins schlechtere Tordifferenz. Am 32. Spieltag gewinnen beide nur mit einem Tor Unterschied. Borussia holt auswärts einen 2:0-Rückstand gegen Dortmund auf, schießt in sieben Minuten drei Tore und gewinnt 4:3. Am vorletzten Spieltag der Schock: Bayern siegt 4:1 gegen Braunschweig, auch Borussia führt gegen den Tabellenletzten Rot-Weiss Essen 4:1, könnte sogar sieben, acht Buden machen, kassiert dann aber noch zwei Gegentreffer.
Bayern geht deshalb als Tabellenführer in den letzten Spieltag mit 74:34 Toren, die punktgleiche Borussia hat ein Torverhältnis von 73:34, also bloß ein Tor weniger geschossen. Mehr Spannung geht nicht. Für den Fall, dass am Ende Gleichstand herrscht, hat der DFB bereits den Termin für das Entscheidungsspiel festgelegt. Bayern fährt ins Ruhrgebiet nach Duisburg, die Zebras sind sorgenfrei und können allenfalls noch die UEFA-Pokal-Teilnahme erreichen. Gladbach tritt in Frankfurt an, die Eintracht ist noch in Abstiegsgefahr. In Frankfurt ist auch die Meisterschale. Werden die Bayern Meister, sollen sie die auf dem Heimweg mitnehmen. Ab Samstag, 15.30 Uhr hält Fußballdeutschland die Luft an. In der 43. Minute erzielt Netzer das 1:0, doch die Tabellenführung währt nur zwei Minuten, dann gleicht Frankfurt aus. In Duisburg steht es zur Pause 0:0. Die Entscheidung wird auf die zweite Halbzeit vertagt. Dann geht alles sehr schnell. Duisburgs Tormaschine Rainer Budde schießt in der 55. Minute das 1:0 und legt in der 69. Minute nach. Im Frankfurter Waldstadion besinnen sich die Borussen endlich auf ihre Stärke. Köppel trifft in der 70., kurze Zeit später lässt Heynckes einen Doppelschlag folgen. Borussia Mönchengladbach hat die Meisterschaft verteidigt.
Doch schon einen Tag später redet kaum mehr jemand vom spannendsten Bundesligafinale aller Zeiten. Während ganz Gladbach am Sonntag seine Helden in der Innenstadt feiert, deckt der Präsident von Bundesligist Kickers Offenbach, Horst-Gregorio Canellas, während seiner Geburtstagsfeier den größten Bestechungsskandal aller Zeiten im deutschen Profifußball auf.
GRUND NR. 5
Weil Borussia in den 70ern häufiger Meister wurde als Bayern München
Es gibt nur zwei Arten von Borussia-Fans: Die, die die 70er erlebt haben, und die, die zu spät geboren wurden. Zu diesen Zu-Spät-Geborenen gehöre ich. Meine Zeit mit der Borussia begann 1990. Damals fing Gladbach an, regelmäßig mit dem Abstieg zu tun zu haben. Für unsere Generation war Borussia eine Mannschaft, deren zugewiesenes Territorium der Tabellenkeller war. Die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, ja sogar ein einstelliger Tabellenplatz, schienen völlig abwegig.
Für die Zu-Spät-Geborenen war es unvorstellbar, dass es mal eine Zeit gegeben haben soll, in der Borussia den deutschen Fußball dominierte. Selbst wenn ich heute die Geschichten aus den goldenen 70ern höre, bin ich eher geneigt, Harry Potter für ein Sachbuch zu halten, als die Geschichte der Fohlenelf für eine wahre Begebenheit.
Also noch mal: In den 70er Jahren gehörte Borussia Mönchengladbach zu den besten Vereinsmannschaften Europas. Europas! Fünfmal wurde das Team in den 70er Jahren Deutscher Meister (1970, 1971, 1975, 1976, 1977), so häufig wie keine andere Mannschaft. Selbst den Bayern gelang das nur dreimal. Borussia war das erste Team, das den Meistertitel in der Bundesliga verteidigte, und bis heute ist es neben der Borussia bloß Bayern München gelungen, dreimal in Folge Deutscher Meister zu werden. Bis 1980 war Borussia Rekord-Meister der Bundesliga. Nicht Dortmund, Leverkusen oder Bremen waren damals die Konkurrenten der Münchener um den Meistertitel, nein, mein Verein, Borussia Mönchengladbach. Wirklich wahr. Außerdem wurde das Team in dieser Zeit zweimal UEFA-Pokal-Sieger, einmal DFB-Pokal-Sieger und stand einmal im Finale der Landesmeister. Damals trat die Borussia in dem sicheren Gefühl an, zu gewinnen. Niederlagen waren nicht völlig zu vermeiden, aber das war dann direkt national news. Vier, fünfmal pro Saison, dann war aber auch Schluss. Und 70, 80 Tore waren Pflicht. Heute glaubt ja selbst ein Team wie Hoffenheim, dass es aus Gladbach drei Punkte mitnehmen darf. So ein Verein wurde damals mit 6:0 abgefertigt und zurück in den Zug gesetzt. Ja, Günter Netzer spielte für Borussia, auch Jupp Heynckes, Berti Vogts, Allan Simonsen, Europas Fußballer des Jahres 1977. Habe ich noch jemanden vergessen? Ach ja, Wolfgang Kleff, Hacki Wimmer und Rainer Bonhof. Damals kickte der halbe Kader in der deutschen Nationalmannschaft, nicht bloß bei der slowakischen oder belgischen.
Die Orientierungspunkte waren nicht Hannover, Bremen, Hamburg oder Stuttgart, sondern Liverpool und Inter Mailand. Gladbach war in den 70ern erfolgreicher als der FC Barcelona. Barcelona! An die Zeit danach denke ich jetzt einfach nicht. Das hier ist schließlich ein Märchen, und ein Märchen braucht ein Happy End.
GRUND NR. 6
Weil Günter Netzer sich selbst einwechselte …
Die Chinesische Mauer, so heißt es immer wieder falsch, soll das einzige Bauwerk sein, das sich aus dem Weltraum erkennen lässt. Wahr ist allerdings: Das einzige Ereignis, das sich vom Weltraum aus erkennen ließ, war die Tat eines Borussen namens Günter Netzer. Sie trug sich zu am 23. Juni 1973 im Düsseldorfer Rheinstadion.
Es ist ein Samstag, und Borussia Mönchengladbach tritt zum DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Köln an. Köln ist Favorit, Gladbach droht eine Saison des totalen Scheiterns. Meister ist das Team nicht geworden, im UEFA-Pokal-Finale hat es gegen Liverpool, natürlich gegen Liverpool, verloren. Es ist das letzte Spiel von Günter Netzer, der ein paar Tage zuvor seinen Wechsel zu Real Madrid bekannt gegeben hat. Nach 230 Bundesligaspielen und 82 Bundesligatoren für seine Borussia ist Schluss. Mehr als eine Million DM Ablöse erhält der Verein, Netzer 350.000 DM pro Jahr. Doch die ewige Nummer 10 steht nicht in der Startelf. Selbstverständlich gibt Trainer Weisweiler nicht den Groll auf Netzer als Grund an, sondern dessen fehlende Fitness. Was nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Netzer ist im Trainingsrückstand wegen einer Verletzung, hatte einen Autounfall, seine Mutter ist kurz zuvor gestorben.
Stattdessen bringt Weisweiler den defensiven Heinz Michallik. Netzer, der ewige Rebell, die ewige Nummer 10, nimmt mit der Nummer 12 auf der Bank Platz. Am liebsten hätte er sich auf die Tribüne gesetzt oder wäre gar nicht erst ins Stadion gefahren, doch seine Mitspieler überzeugen ihn vom Gegenteil. Auch ohne Netzer entwickelt sich ein Spiel, das bis heute zu den besten Endspielen in der Geschichte des DFB-Pokals zählt. Trotz brütender Hitze rennen die Spieler auf und ab, Torchance folgt auf Torchance. Dass es nach 90 Minuten nur 1:1 steht, ist ein Wunder. Und der Grund, warum Netzer die Gelegenheit hat, Geschichte zu schreiben. Kurz vor Beginn der Verlängerung geht er zu Christian Kulik, der völlig ausgebrannt auf dem Platz liegt. Netzer fragt ihn, ob er noch kann. Kulik verneint dies entschieden, ist froh, dass Netzer für ihn spielen möchte, und bleibt einfach liegen. Netzer stapft zu Weisweiler, verkündet seinen Entschluss, dass er nun zu spielen gedenke. Weisweiler nimmt das wortlos hin. Noch in der Halbzeit hat er ihn selbst einwechseln wollen, bloß wollte Netzer nicht.
Der zieht nun seinen blauen Trainingsanzug aus, Jubel brandet auf im Stadion. Der berühmteste Sohn der Stadt tritt zu seinem letzten Akt an. Und als ob dieses Finale nicht schon dramatisch genug wäre, die Hitze, das Derby, Heynckes’ verschossener Elfmeter, die Selbsteinwechslung, setzt Netzer noch einen drauf. Kaum auf dem Platz spielt er Doppelpass mit Bonhof und hämmert den Ball aus knapp 13 Metern mit links in den Torwinkel, obwohl oder gerade weil er den Ball nicht richtig trifft. Gladbach hält das 2:1 bis zum Schluss und holt zum zweiten Mal den DFB-Pokal. Beim anschließenden Bankett würdigen sich Netzer und Weisweiler keines Blickes. Vertragen werden sie sich erst später. Wie immer.
In der Berichterstattung am nächsten Tag spielt die Selbsteinwechslung Netzers kaum eine Rolle. Weil gar nicht bekannt ist, dass Netzer sich selbst eingewechselt hat. In einem Interview mit 11 Freunde vom 6. März 2013 sagte Netzer: »Die Entwicklung dieser Geschichte ist unglaublich! Zehn Jahre lang wusste niemand von meiner Selbsteinwechslung. Ich habe mit keinem darüber gesprochen, solange Weisweiler noch lebte. Eine Frage der Ehre. Erst nach seinem Tod habe ich es einmal erwähnt – und niemand hat mir geglaubt.«2
GRUND NR. 7
… und eine Disco eröffnete
Es gibt einen schönen und zugleich traurigen Satz im Wikipedia-Eintrag der Stadt Mönchengladbach: »Vor allem in den siebziger und achtziger Jahren lockte das attraktive Nachtleben noch junges Szene-Publikum aus Düsseldorf an.« Wer heute durch die Gladbacher Altstadt geht, merkt sofort: Diese Zeiten sind vorbei.
Einer, der großen Anteil am legendären Ruf der Altstadt hatte, hatte auch einen großen Anteil am Erfolg der Borussia in den 70ern. Günter Netzer eröffnete im Frühjahr 1971 an der Waldhausener Straße die Disco Lover’s Lane, einen Steinwurf von seinem Geburtshaus entfernt. In einem Interview mit der ZEIT begründete er diesen Schritt mit finanzieller Notwendigkeit. »Mein Verein Borussia Mönchengladbach hatte damals ein Stadion mit nur 2600 Sitzplätzen. Der Verein konnte uns nicht viel bezahlen. Die anderen haben das Dreifache verdient, der Franz Beckenbauer in Bayern und auch der Wolfgang Overath in Köln!«3
Die Ironie der Geschichte wollte es so, dass dort zuvor ein Friseur untergebracht war. Ausgerechnet ein Friseur, sind Netzers bekanntestes Markenzeichen doch bis heute seine langen blonden Haare. Schuld daran war Netzers damalige Freundin Hannelore, die entscheidend daran beteiligt war, dass Netzer der erste Popstar der Bundesliga wurde. Sie übernahm auch die Gestaltung des Lovers’ Lane. Netzer gab seinen Namen her und steckte das Geld rein, sein nächster Schritt als Geschäftsmann, immerhin hatte er auch das Fohlen-Echo auf den Weg gebracht. Hannelore beschloss, den ganzen Laden schwarz streichen zu lassen, die Wände, die Decke, den Boden.
Um die Gäste anzulocken, griffen die Mitarbeiter vor allem zu Beginn noch zu einem Trick: Sie stellten Netzers Ferrari vor die Tür, auch wenn er nicht da war. Das zog. Kaum öffnete der Club, drängten die Leute hinein. Viele waren aus Köln oder Düsseldorf angereist. Doch Türsteher Rainer Mumbauer war streng. Wenn es klingelte, öffnete er eine Klappe auf Augenhöhe und musterte die Gäste. Wer nicht ordentlich angezogen war oder zu tief ins Glas geschaut hatte, konnte wieder umdrehen. Wer ein Fußballtrikot trug, versuchte es auch besser anderswo. Spieler von Borussia kamen selbstverständlich immer hinein, Jupp Heynckes und Rainer Bonhof gehörten zu den Stammgästen, auch Beckenbauer schaute nach Auswärtsspielen vorbei, Udo Jürgens und die Schauspielerin Elke Sommer setzten sich an die Theke, sogar Sepp Herberger kam mal vorbei. Die Leute sollen applaudiert haben, als er seinen Hut ablegte. Nur Weisweiler ließ sich dort nie blicken. Er hatte den starken Verdacht, dass Netzer völlig verrückt geworden war.
Mehr als 60 Leute passten nicht hinein in die Sardinenbüchse Lovers’ Lane. Denen mixte der italienische Barkeeper Picco für sechs bis acht Mark legendäre Drinks und sorgte dafür, dass sie zahlreich bestellten. Aus elf Leuten bestand das Team inklusive Chef, weshalb es den Spitznamen »Netzers Geldelf« bekam. Nur einen DJ gab es in der Geldelf nicht. Wer am Regal mit den Platten stand, legte eine Scheibe auf. Oder aber die Musik kam vom Tonband, nicht selten Bob Dylan, einer von Netzers Lieblingsmusikern. Netzer sah allerdings davon ab, zu tanzen, er konnte es schlicht nicht.
Dann wurde alles anders. Als Netzer 1973 zu Madrid wechselte, zeigte sich, weshalb der Laden stets so voll gewesen war: Es war Netzers Anwesenheit beziehungsweise der Verdacht, er könne anwesend sein. Kaum war er fort, sanken die Besucherzahlen. Ab den 80ern versuchten andere Betreiber ihr Glück, doch keiner kam an den Erfolg von Netzer heran. Heute kämpft dort ein R&B-Club ums Überleben. Zum Feiern fahren die Gladbacher nun – welch Frevel – in eine andere Altstadt: in die von Düsseldorf.
GRUND NR. 8
Weil Hacki Wimmer lief und lief und lief
Der Mann, den sie »Hacki« nannten, war ein fauler Hund. Wenn die anderen noch im Kraftraum schwitzten, saß Hacki bereits frisch geduscht in der Eisdiele am Alten Markt und ließ sich seinen Bananensplit schmecken. Bei Heimspielen brachte er die Fans mit seinen ständigen Alleingängen zur Verzweiflung, den Pass auf den besser stehenden Kameraden zu spielen, war nicht seine Art. Abwehrarbeit lehnte er ab und trotzdem war er einer der ersten, denen die Puste ausging. Schnell war er erst wieder, als es hieß, sich vor ein Fernsehmikrofon zu stellen. Was Weisweiler auch versuchte, Hacki weigerte sich. »Fußball ist ein einfaches Spiel«, hat Hacki mal gesagt, »21 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, da muss ich nicht auch noch mittun.«
Wer über Herbert »Hacki« Wimmer irgendetwas Schlechtes sagen möchte, der muss schon lügen, bis der Torpfosten bricht. Man wird auf der ganzen Welt keinen Menschen finden, der sich negativ zu ihm äußert. Vielleicht gehört er deshalb bis heute zu den beliebtesten Spielern der Borussia, vielleicht wurde er deshalb in die Jahrhundertelf gewählt. Weil er einfach ein durch und durch anständiger Kerl ist. Wer über Wimmer schreiben will, dem bleibt also nur die Lobhudelei.
Dann los! Hacki Wimmer war exakt zwölf Jahre Fußballprofi. Zwölf davon spielte er für Borussia Mönchengladbach. Als er 1966 mit 21 Jahren vom Aachener Stadtteil-Verein Borussia Brand nach Gladbach wechselt, ohne allerdings je von Aachen an den Niederrhein zu ziehen, ist er Außenstürmer und bleibt das auch zu Beginn seiner Profizeit. Weil er ein guter Dribbler ist und der Gegner von ihm meist nur die Hacken sieht, verpasst ihm Torhüter Manfred Orzessek den Spitznamen Hacki. Sein richtiger Vorname gerät in Vergessenheit. Seine eigentliche Bestimmung findet er im defensiven Mittelfeld. Jahrelang hält er Netzer den Rücken frei für dessen Offensiveskapaden, er läuft und läuft, unermüdlich, bis zum Schluss, jeden Spieltag. In keiner Saison bestreitet er weniger als 26 Spiele. Er kommt dabei, obwohl er Defensivspieler ist, ohne Grätschen aus, ohne Knochenbrecher-Mentalität. Lieber setzt er auf Technik und Übersicht. Netzer ist das Herz des Spiels, Wimmer die Lunge. Netzer steht im Rampenlicht, Wimmer in seinem Schatten. Netzer ist Dauergast in den Medien, Wimmer ist froh, wenn ihn die Reporter in Ruhe lassen. Wer weiß schon, dass Wimmer das erste Tor im DFB-Pokal-Finale gegen den 1. FC Köln geschossen hat? Dass Wimmer im EM-Endspiel 1972 gegen die Sowjetunion das 2:0 erzielte? Dafür ist er der einzige, dem Weisweiler das Du anbietet. Als Entschuldigung dafür, dass der Trainer einmal gesagt hat, mit so einem anständigen Spieler könne man nicht Meister werden.
Als Netzer 1973 zu Real Madrid wechselt, zeigt Wimmer, dass er mehr ist, als der erste Wasserträger des deutschen Fußballs. Die Lunge kann auch ohne das Herz. Fünf Meisterschaften holt er mit Borussia, zwei UEFA-Pokal-Siege und den DFB-Pokal, macht 366 Bundesligaspiele, und schießt 51 Tore. Auch nach dem Ende seiner Karriere sucht Wimmer nicht das Rampenlicht. Fernsehexperte oder Trainer, das ist nichts für ihn. Stattdessen übernimmt er das Zeitschriftengeschäft seines Vaters in Aachen, bis seine Hüfte nicht mehr mitmacht und er sich einige Male auf den OP-Tisch legen muss. Heute läuft die Lunge nicht mehr. Sie fährt Fahrrad.
GRUND NR. 9
Weil Jupp Heynckes seine Bundesliga-Karriere dort beendete, wo sie begann
Der Mann, der dort oben auf dem Podium sitzt, hat alles erlebt und alles gewonnen. Er hat Pfosten brechen und Büchsen fliegen sehen. Er ist Deutscher Meister geworden und DFB-Pokal-Sieger, er hat die Champions League geholt. Er hat Tore geschossen, viele Tore, und er hat auf der Trainerbank gesessen. Es ist die Pressekonferenz nach seinem letzten Spiel in der Bundesliga. Es ist der 18. Mai 2013. Und gleich wird der Mann zum ersten Mal in seinem Leben anfangen, vor einer Fernsehkamera zu weinen. Weil sich ein Kreis geschlossen hat. Der Mann, der dort sitzt, heißt Jupp Heynckes.
Jetzt erst mal tief Luft holen.
Das Leben von Jupp Heynckes beginnt am 9. Mai 1945 in einem Mönchengladbacher Krankenhaus. Er wächst im Stadtteil Holt auf. Auch die Bundesligakarriere von Jupp Heynckes beginnt in Mönchengladbach. 1962 wechselt er von Grün-Weiß Holt zur Borussia. 1964 holt ihn Weisweiler von der Reserve in die 1. Mannschaft. Am 14. August 1965 bestreitet er sein erstes von 1.011 Bundesliga-Spielen. Eine Woche später schießt der Stürmer sein erstes Bundesligator, das auch das erste Bundesligator am Bökelberg ist. Er wird für den Verein in der Liga noch weitere 194 Tore machen. So viele wie kein anderer Borusse. Und es wären noch mehr geworden, wenn er nicht 1967 zu Hannover 96 gewechselt wäre. Ein Irrtum, den er 1970 wieder korrigiert. Und er trifft weiter. Drei Tore beim 5:1 gegen Twente Enschede, fünf Tore beim 12:0 gegen Dortmund, seiner letzten Partie als Spieler. Er ist 33, seine Knie machen nicht mehr mit.
Das Leben von Jupp Heynckes als Trainer beginnt in Mönchengladbach. Ein Jahr assistiert er Udo Lattek, dann wird er 1979 selbst Chef. Er hat Erfolg, aber er bleibt ohne Titel. 1980 erreicht er das UEFA-Pokal-Finale, 1984 das DFB-Pokal-Finale. Um Deutscher Meister zu werden, wechselt er 1987 zu Bayern München und beginnt eine Weltkarriere. 2006 kehrt der Mann, der mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat, auf die Trainerbank von Borussia zurück. Er soll das Team in die obere Hälfte der Tabelle führen. Der Versuch geht brutal daneben. Borussia steht auf einem Abstiegsplatz, als er am Morgen des 31. Januar 2007 seinen schwarzen Dienstwagen volltanken lässt und danach Präsident Rolf Königs Papiere und Fahrzeugschlüssel überreicht. Es hat Morddrohungen gegeben. Der Verein schafft es nicht, ihn umzustimmen. Doch es ist nicht sein Karriereende. 2009 führt er Bayern als Interimstrainer noch in die Champions League. Dasselbe gelingt ihm als Coach von Bayer Leverkusen.
Dann kommt die Saison seines Lebens. 2013 holt er mit Bayern Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Der erste deutsche Trainer, der das Triple gewinnt. Sein letztes von 1.011 Bundesligaspielen führt ihn zu Borussia. Es ist das kitschigste Drehbuch, das sich denken lässt. Am Abend zuvor hat er die DFB-Pokalsiegermannschaft von 1973 getroffen, vor dem Spiel verabschiedet ihn Borussias Vereinsspitze auf dem Rasen, die Nordkurve hält ein Transparent hoch mit der Aufschrift »Ein echtes Fohlen dreht seine letzte Runde – mach’s gut, Jupp« und feiert ihn mit Sprechchören. Es ist das erste Mal, dass Borussen-Fans einen Angestellten des FC Bayern München feiern. Weil sie wissen, dass er immer Borusse geblieben ist. Seinen Hauptwohnsitz hat er in dem Ort Waldniel, gleich an der Grenze zu Mönchengladbach, in einem restaurierten Bauernhof. Als der Stadionsprecher Bayern zur Meisterschaft gratuliert, fangen die Borussia-Anhänger sofort an zu pfeifen. Sie freuen sich für ihren Jupp, nicht für die Münchener. In der Pressekonferenz nach dem Spiel wird er auf den überwältigenden Empfang angesprochen. Der sonst so gefasste Heynckes antwortet: »Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Borussen-Fans und Zuschauern für den wunderbaren Abschied, weil …« Und da gerät seine Stimme ins Stocken, er räuspert sich hält inne. »… das zeigt mir, dass … ja, dass das meine Heimat ist.« Danach verliert der Mann, der dort oben auf dem Podium sitzt, den Kampf gegen die Tränen.
GRUND NR. 10
Weil Otto Kleff einfach nicht aufhören wollte
Der Mann heißt Peter Cestonaro und er kommt aus Haiger-Langenaubach. Dieser Peter Cestonaro aus Haiger-Langenaubach spielt am 29. Mai 1982 für den SV Darmstadt 98 gegen Mönchengladbach. Es ist der 34. Spieltag, es steht 5:0 für Borussia, als ihm in der 65. Minute der Ehrentreffer gelingt. Zum letzten Mal in seinem Leben holt Wolfgang Kleff als Borussen-Torhüter einen Ball aus dem Netz. Seine Mitspieler heißen nicht mehr Berti Vogts und Günter Netzer, sondern Lothar Matthäus und Armin Veh. Wolfgang, jetzt mal unter uns, du wirst im November 36, wäre es nicht an der Zeit, ganz aufzuhören?
Wie bitte, aufhören? Du tickst ja wohl nicht mehr richtig.
Was bisher geschah. 1968: Kleff, Jahrgang 1946, kommt zur Borussia, verliert in der ersten Saison mehr als zehn Kilo, meine Güte ist die 1. Liga hart. Will schon fast zurück nach Schwerte, steht dann plötzlich im Tor und bleibt im Tor beziehungsweise in der Nähe des Tores, denn Kleff gehört zu den ersten mitspielenden Keepern. Macht sieben Jahre lang jedes Bundesligaspiel mit. 4. November 1970: Achtelfinale im Pokal der Landesmeister gegen Everton, Rückspiel. Im Hinspiel hat Kleff eine Toilettenrolle vom Spielfeld befördert, derweil schlug der Ball in seinem Tor ein. Große Scheiße. Im Rückspiel kassiert er nach einer Minute das 0:1. Hält danach alles. Alles. Hat plötzlich acht Arme und zwölf Hände. Sogar der Schiedsrichter klatscht. Sagt Kleff. Borussia fliegt trotzdem nach Elfmeterschießen raus. Egal. Dafür nimmt Kleff alles mit, was Borussia gewinnt. Meisterschaften, UEFA-Pokal, DFB-Pokal. Kleff immer im Tor. Kurze Hosen, nein, kürzeste Hosen. Sieht aus wie Otto und heißt deshalb bei allen auch Otto. Ist mindestens so lustig wie er. Spielt später in einem seiner Filme einen schwulen Friseur.
7. Juli 1974: Kleff sitzt auf der Bank. Im Münchener Olympiastadion. Während des Endspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden. Im Tor: mal wieder Sepp Maier. Sechs Länderspiele macht Kleff in seiner Karriere. Dann Leistenbruch. Plötzlich steht dieser Kneib im Tor von Borussia. Ein Jahr Hertha BSC. Jupp Heynckes sagt: Komm zurück, Otto. Noch mal zwei Jahre Borussia, dann Peter Cestonaro und Schluss.
Wie Schluss? Ich mach noch weiter.
Zwei Jahre Fortuna Düsseldorf als Stammtorhüter in der 1. Liga. 3. Spieltag 0:6 gegen HSV, 4. Spieltag 0:5 gegen Mönchengladbach. In seinem letzten Spiel für Fortuna ausgewechselt. Kleff ist 37 und ein halbes Jahr. Otto, wäre nun nicht der richtige Zeitpunkt, die Handschuhe an den Nagel zu hängen?
Was sagst du da? Bist du bescheuert?
Ein Jahr Oberhausen, 1984/85, 2. Bundesliga. VfR 1910 Bürstadt und Hessen Kassel statt Bayern München und Schalke 04. Wieder Stammtorhüter. Wolfgang, ich frag dich noch mal: Wie wäre es mit Ruhestand? Du bist 38,5.
Jetzt lass mich doch noch. Arme, Beine, ist doch noch alles dran.
Ein Jahr VfL Bochum, 1985/86, 1. Liga. 1:4 gegen Waldhof Mannheim, 2:4 gegen Bayer Leverkusen, 1:6 gegen Bayern München. 0:3 gegen Köln. Aber auch 6:1 gegen Borussia Dortmund. 20 Spiele. Wolfgang, jetzt aber, oder? Du wirst in ein paar Monaten 40.
Na und?
Ein Jahr FSV Salmrohr, 2. Bundesliga, 1986/87. 25 Spiele. 1:6 gegen Rot-Weiß Oberhausen, 0:5 gegen VfL Osnabrück, 0:4 gegen Arminia Bielefeld, 0:8 gegen SV Darmstadt. Im letzten Match kassiert Kleff fünf Gegentore. Das Team steigt mit 48:94 Treffern als Tabellenletzter ab. In Mönchengladbach steht mittlerweile Uwe Kamps im Tor. Wolfgang? Ich will ja nix sagen, aber …
Ich bin erst 40 Jahre und ein halbes.
Fünf Jahre SV Straelen, von 1987 bis 1992. Amateurfußball. 58 Spiele. So, Wolfgang, nun ist aber Schluss. Du bist 45.
Ja, vielleicht. Also erst mal.
Ein Jahr KFC Uerdingen, Regionalliga, 1999/00. Ersatztorhüter. Mit 52 Jahren. Null Spiele. Otto, jetzt lass den Quatsch.
Mal sehen.
9. März 2008: 35 Minuten im Tor für den NRW-Landesligisten FC Rheinbach. Mit 61 Jahren. Ein paar Monate nach einem Schlaganfall. Ausgewechselt, weil ein Gegenspieler das Knie in seinen Oberschenkel rammt. Da steht es 1:0 für Rheinbach. Das Spiel endet 1:4. Im Tor von Borussia steht mittlerweile Christofer Heimeroth.
2009: Herzoperation nach Herzrhythmusstörungen.
Wolfgang, jetzt ist aber Schluss, ne?
Och …
GRUND NR. 11
Weil ein Fliegengewicht Borussia zum europäischen Schwergewicht machte
Es hat Allan Simonsen wirklich gegeben. Er ist niemand, den sich unsere Väter ausgedacht haben, damit wir begreifen, warum damals alles besser war. Simonsen, sagen die Leute und meinen damit nur zu einem Drittel eine Person. Zu einem Drittel meinen sie damit eine Spielkultur und zu einem Drittel eine Sehnsucht. Wer an den Konterfußball der Fohlen denkt, denkt erst an Netzer und dann sofort an Simonsen. Netzer machte Borussia in Deutschland bekannt, Simonsen in Europa. Sechseinhalb Jahre spielte der dänische Stürmer am Niederrhein. Er kam 1973 als Talent, er ging 1979 als Weltstar.
Dabei sah es mehr als ein Jahr so aus, als würde Simonsen bei Borussia überhaupt nichts reißen. Zwar hat er, als er mit 19 für 200.000 DM von Vejle BK wechselt, in seiner Heimat schon für Aufsehen gesorgt, aber die dänische Liga ist eben nicht die Bundesliga. Plötzlich muss er zwei- bis dreimal täglich trainieren. Weisweiler schickt ihn bewusst in die Zweikämpfe mit Terrier Vogts, den Simonsen später als seinen härtesten Gegner bezeichnen wird. Es scheint, als könne sich Simonsen, 1,68 Meter groß, 57 Kilo leicht, nicht durchsetzen. Er spielt kaum, wenn, dann wird er eingewechselt. Am Ende der Saison 1973/74 will Weisweiler ihn schon loswerden, aber dem Zweitligisten Augsburg ist die Ablöse zu hoch.





























