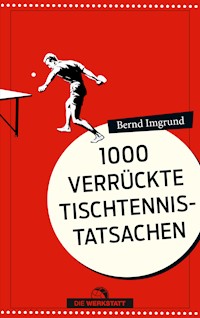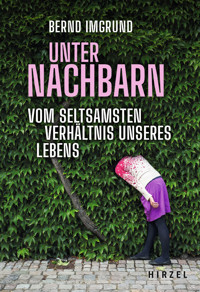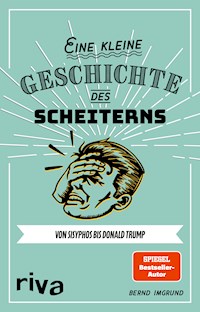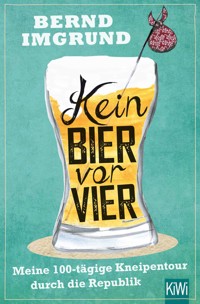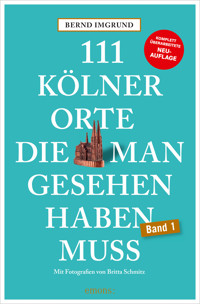
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: 111 Orte ...
- Sprache: Deutsch
Warum in die Ferne schweifen, wenn man selbst die eigene Stadt noch nicht kennt und Verborgenes entdecken kann. Die touristischen Highlights Kölns finden sich in jedem Reiseführer. Aber wer kennt schon den Commonwealth-Friedhof in Zollstock mit über 3000 Gräbern, die unter britischer Obhut stehen? Wer ist in der Domstadt einmal durch ein Bergwerk oder durch die Finnensiedlung mit ihrem Bullerbü-Charme spaziert? Und wer hat je Kölns höchsten Berg, den Monte Troodelöh im Königsforst, je erklommen? Die schönsten, skurrilsten und schaurigsten Schauplätze der Domstadt hat der Kölner Autor Bernd Imgrund in seinem neuen Buch zusammengestellt, Britta Schmitz hat sie mit Blick fürs Detail fotografiert. Viele staunenswerte Orte dürften auch gebürtigen Kölnern noch unbekannt sein. 111 Entdeckungsreisen, um den Blick auf die geschichtsträchtige Stadt am Rhein zu erweitern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
© Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
© alle Fotografien: Britta Schmitz,
außer: Ort 2 oben: Archiv Kiepe Electric GmbH
Layout: Barbara Thoben, nach einem Konzept
von Lübbeke | Naumann | Thoben
Kartografie: altancicek.design, www.altancicek.de
Kartenbasisinformationen aus Openstreetmap,
© OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL
E-Book-Erstellung: XXX
Erstausgabe 2008
ISBN 978-3-98707-282-6
Aktualisierte Neuauflage Juni 2024
Unser Newsletter informiert Sieregelmäßig über Neues von emons:Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Vorwort
Kennen Sie die Schlackenbergwerft am Mülheimer Rheinufer? Haben Sie je unterm Rodenkirchener Lügenbaum oder im Fühlinger Mündungspark gesessen? Und wissen Sie, wo in Köln der erste Verbrennungsmotor der Weltgeschichte zu besichtigen ist?
Wenn nicht, werden Sie diese Orte hier kennenlernen. Es handelt sich um vier von vielen, die beim Relaunch dieses Buches neu hinzugekommen sind.
In einer zweitausend Jahre alten Stadt findet man kaum einen Ort, der nicht eine Geschichte erzählen könnte. Bei der Auswahl dieser Orte haben wir versucht, jenseits der ausgetretenen Pfade zu wandeln. Die historischen Highlights Kölns finden sich in jedem Reiseführer, seltener hingegen liest man beispielsweise von den Dellbrücker Hallstattgräbern, vom Deutzer Flamingoweiher oder von der Porzer Germania-Siedlung mit ihrem außergewöhnlichen Ensemble von Arbeiter- und Meisterhäusern. Ein geschichtlich bedeutsamer, touristisch jedoch gänzlich unerschlossener Ort ist auch die Ecke Militärring und Berrenrather Straße, wo der Duffesbach in einer Betonröhre versinkt. Ohne diesen kleinen Fluss wäre Köln nicht dort gegründet worden, wo es noch immer liegt. Heutzutage verliert sich seine Spur an jener Straßenkreuzung; unterirdisch und unsichtbar durchfließt er die Stadt, um auf Höhe des Filzengrabens in den Rhein zu münden.
»111 Kölner Orte, die man gesehen haben muss«, das sind 111 schöne, schräge, schaurige Schauplätze, die den Blick auf diese Stadt erweitern. Viele von ihnen dürften auch gebürtigen Kölnern noch völlig unbekannt sein. In diesem Sinne: Nichts gegen den Dom, aber auch die Besteigung von Kölns höchstem Hügel, dem Monte Troodelöh im Königsforst, ist ein Abenteuer!
111 Orte
1__ Der Alte Kalker FriedhofMorbider Charme zwischen Kloster und Polizeistation
2__ Die Alweg-BahnMit 180 Sachen durch Fühlingen
3__ Am KümpchenshofJan und Griet und wo alles begann
4__ Das ArboretumEin vergessener Garten aus den 1930ern
5__ Der AtombunkerDer Kalte Krieg in Kalk
6__ Die BachkreuzungDie fleißige Strunde und der faule Bach
7__ Der BarbarastollenSchwarzes Gold unter dem Uni-Hauptgebäude
8__ Die BelvederebrückeSchöne Aussichten zwischen Wiese, Wald und Gewerbe
9__ Bölls ArbeitszimmerDas Mobiliar eines Nobelpreisträgers
10__ Die Brauer-KapelleDas Kölsch und die katholische Kirche
11__ Die Brücke am WeiherEin hölzerner Steg als Trittbrett der Korruption
12__ Der ChargesheimerplatzUnort für Kölns bedeutendsten Nachkriegsfotografen
13__ Das ChinesenviertelHurra-Patriotismus in Neu-Ehrenfeld
14__ Der Commonwealth-EhrenfriedhofEnglischer Rasen auf dem Südfriedhof
15__ Das CranachwäldchenKugelhagel und ein wikingerhaftes Gelage
16__ Der Dorfanger von AuweilerWo Köln Provinz ist
17__ Das DreikönigenpförtchenEin kleines Tor, das große Geschichte schrieb
18__ Der DuffesbachWo Kölns wichtigster Wasserlauf im Untergrund versinkt
19__ Die Edith-Stein-Kapelle... und ein Stück der Berliner Mauer
20__ Die ElendskircheHerr Neuhaus und sein Fisternöll in St. Gregor
21__ Der Erich-Klibansky-PlatzEin Brunnen erinnert an die einstige jüdische Gemeinde
22__ Der erste MotorNikolaus Ottos Prototyp
23__ Der FernwärmetunnelEinmal so richtig »unten durch« sein
24__ Finkens GartenAnanas-Salbei, Kaugummipflanze und Gummibärchengewächs
25__ Die FinnensiedlungBullerbü in Höhenhaus
26__ Der FischmarktVon Feschwievern und geistlichen Grundstücksspekulanten
27__ Der FlamingoweiherWasserspiegel am Südostzipfel des Rheinparks
28__ Der freundliche PolizistOskarverleihung im Polizeipräsidium
29__ Der Garten der ReligionenEin kontemplatives Refugium
30__ Die Geldgeschichtliche SammlungSteinräder, Sparschweine und Falschmünzer
31__ Der GereonsdrieschMaria, Gereon und der Mordhof
32__ Die Germania-SiedlungKlassengegensätze und Architektur
33__ Der GeusenfriedhofProtestanten in der katholischen Hochburg
34__ Die Glockenstube des DomsFledermäuse, Spinnen und der »Decke Pitter«
35__ Die Goldene Kammer von St. UrsulaKnochen, Knochen und nochmals Knochen
36__ Das Grabungsfeld unter St. SeverinDes Regenmachers unterirdische Keimzelle
37__ Die Greifvogel-SchutzstationEine Pension für Bussarde, Falken und Schnee-Eulen
38__ Das Gremberger WäldchenWo Kölns älteste Buchen wachsen
39__ Der GroßmarktZwiebeln, Fisch und eine 132 Meter lange Parabel
40__ Die Hallstattgräber am PilzwegPrähistorische Hügel und ein silberner Sarg
41__ Die Helios-WerkeEin Leuchtturm fernab der See
42__ Hinter C&ADreißig Meter Niemandsland
43__ Der Hochbunker in der ElsaßstraßeEin Wandbild und seine Geschichte
44__ Die HühnergasseDoornkaat-Cola und die Kießling-Affäre
45__ Die HumboldtsiedlungVom Fliegerhorst zum Wohnquartier
46__ Im Bauch der Deutzer BrückeSpannbeton und Adenauergrün
47__ Die IndianersiedlungAlternatives Leben am Grünrand der Großstadt
48__ Der InvalidendomLouis XIV. und das Früh em Veedel
49__ Der Jüdische Friedhof in BocklemündKunstvolle Grabsteine und bedeutende Denkmäler
50__ Der Kalscheurer WeiherNilgänse, Kormorane und ein fantastischer Sonnenuntergang
51__ Das Kalte EckTotensteine am Rheinufer
52__ Der Karl-Berbuer-PlatzEin Narrenschiff in mittelalterlichem Fahrwasser
53__ Der KatzenbuckelKleine Brücke mit großem Panorama
54__ Die KiesgrubeSpiegelndes Laichkraut, Ähriges Tausendblatt und Wasserpest in Meschenich
55__ Der Kreuzgang von St. GeorgEin Friedhof für die Toten des 2. März 1945
56__ Das Krieler DömchenBeten, Beichten und Richten
57__ Der KronleuchtersaalWie der Kaiser zur Kloake kam
58__ Die Krypta von Groß St. MartinEin römisches Schwimmbad auf der alten Rheininsel
59__ Der KunibertspützWo die Kölnerinnen ihre Kinder bekommen
60__ Die Lindenthaler KanäleEine Wasserstraße zwischen Innerem und Äußerem Grüngürtel
61__ Das LommerzheimDie kölscheste aller Kölschkneipen
62__ Der LüchbaumFlunkern als Zeitvertreib
63__ Die LuftfahrtsteleFlieger in Ossendorf
64__ Die Madonna in den TrümmernGroße Kunst und private Andacht
65__ Der Monte KlamotteEin Trümmerhügel und sein Spitzname
66__ Der Monte TroodelöhEin kölscher »Mount Everest« im Königsforst
67__ Der MündungsparkWo der Randkanal in den Rhein mündet
68__ Die »Namen der Autoren«Ein Mahnmal zur Bücherverbrennung
69__ Das Naturtheater im Raderthaler VolksparkEin stilles Idyll unter gewaltigen Buchen
70__ Die NikolauskapelleGlaube, Schmuggel, Stapelrecht
71__ Das OberlandesgerichtTrinkbrunnen, Aufzüge und eine elektrische Entstaubungsanlage
72__ Oliv in WahnheideDie Militärgeschichtliche Sammlung
73__ Die Palmenallee in der FloraWandeln unter Wedeln
74__ Die Poller KöpfeUmspülte Landzungen, ohne die Köln nicht Köln wäre
75__ Der Räderraum der SchokoladenfabrikVerwaiste Industriehistorie in der Südstadt
76__ Die Rheinau-TiefgarageEin Tunnel im Überschwemmungsgebiet
77__ Die RheinkehlmauerAn der Wiege des Deutschen Schäferhundes
78__ Die Rhododendron-SchluchtFarbenpracht im alten Infanteriegraben
79__ Das Rodenkirchener KapellchenDie Legende vom Kahn, der flussaufwärts schipperte
80__ Das Römergrab von WeidenDie besterhaltene Gruft nördlich der Alpen
81__ Die römische HafenstraßeEine holprige Gasse aus schimmerndem Basalt
82__ Der Rosengarten im Fort XEher Korallenriff als Blumenmeer
83__ Die Ruine von St. AlbanDas »Trauernde Elternpaar«
84__ Die ScheinbushaltestelleKein Stopp, niemals
85__ Die SchlackenbergwerftDer alte Hafen von Felten & Guilleaume
86__ Die Siedlung WilhelmsruhEine Kolonie für die Zucker-Arbeiter
87__ Die Spitze der RheinauhalbinselAm Bug des Schokodampfers
88__ Die Sprechecke im StadtgartenRatlose Behörden und ein verwunschener Stein
89__ St. AdelheidDer misslungene »Dorfplatz« von Neubrück
90__ Der Stammheimer SchlossparkAuserlesene Skulpturen, aber kein Schloss
91__ Der StavenhofDie berüchtigte Bordellmeile am Eigelstein
92__ Die SüdbrückeKleinvieh macht auch Mist
93__ Der SüdparkGrüne Oase im Villenviertel
94__ Der Thurner HofWo Küchenschelle und Guter Heinrich gedeihen
95__ Die Tiefgarage unter dem DomAntike Mauern und ein mittelalterliches Loch
96__ Das Treppenhaus des Spanischen BausEin Halbrund am Meistermann-Fenster
97__ Das UbiermonumentKölns ältestes Bauwerk
98__ Der Untere ScheuermühlenteichEin Dschungel am Rande der bergischen Heideterrasse
99__ Die Villa SchröderWo die »Geburtsstunde des Dritten Reiches« schlug
100__ Die WachsfabrikWildwuchs, Künstlerateliers und 200 Jahre Industriegeschichte
101__ Das WaldbadEine Dünnwalder Erfolgsgeschichte
102__ Der Wasserfall im VolksgartenEin künstlicher Dschungel en miniature
103__ Der Wasserturm135 Jahre Soda in Kalk
104__ Der Weißer RheinbogenSchwemmsand aus dem Holozän
105__ Die Weiße StadtSozialer Wohnungsbau im Bauhausstil
106__ Die Westterrasse des Museum LudwigAuf Augenhöhe mit dem Domchor
107__ Das Westwerk von St. PantaleonTheophanu, die kölsche Griechin
108__ Der Wildpark DünnwaldUrviecher mit empfindlichen Nasen
109__ Die ZechenbrauereiSünner aus Kalk, Erfinder des »Kölsch«
110__ Zum Dode MannDie St.-Amandus-Kirche in Rheinkassel
111__ Das Zwischenwerk VIII bFestungsmuseum und Skulpturenpark
1__ Der Alte Kalker Friedhof
Morbider Charme zwischen Kloster und Polizeistation
Der rechtsrheinische ehemalige Industrievorort Kalk ist nicht gerade gesegnet mit Grünflächen. Wer hier sein Kind spazieren fahren will, geht entweder in den kleinen Stadtgarten an der Hauptstraße oder er (bzw. sie) biegt in die Kapellenstraße ab. Denn dort, gleich neben dem ehemaligen Klarissenkloster, liegt hinter braunen Backsteinmauern und schmiedeeisernen Gittern eine verträumte grüne Oase.
Die Anlage geht zurück auf das Jahr 1856. Damals wurde die Kalker Kapelle zur Pfarrkirche erhoben, die katholische Pfarrgemeinde Kalk-Vingst entstand. Ein Jahr darauf eröffnete man den kommunalen Friedhof. Die Industrielle Revolution spülte in den folgenden Jahrzehnten so viele Menschen nach Kalk, dass mehrere Erweiterungen nötig wurden (1843: 96 Einwohner, 1880: 9.590). 1904 jedoch waren dann endgültig die letzten Platzreserven ausgeschöpft. Zum 1. November (Allerheiligen) wurde der alte Friedhof für Bestattungen geschlossen und der neue am Kratzweg im östlicheren Merheim eingeweiht. Aus demselben Jahr stammt übrigens der über vierzig Meter hohe Wasserturm (siehe Ort 103) am anderen, westlichen Ende von Kalk, der als letztes Relikt an die Ära der Chemischen Fabrik erinnert.
Heutzutage versprüht das Areal an der Kapellenstraße einen morbiden Charme. Einige verwitterte, umgestürzte und zum Teil überwachsene Grabsteine haben sich über das Jahrhundert gerettet, im Schatten hoher Bäume sehen sie ihrem endgültigen Verfall entgegen. Relativ gut erhalten ist noch das 1871 errichtete Kriegerdenkmal im Eingangsbereich. Im pompösen Stil eines römischen Grabmals sollte es an die Gefallenen der Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 erinnern, die zur Gründung des Deutschen Reiches führten. Die entsprechenden Schrifttafeln sind heute allerdings verschwunden, wie dem Monument ohnehin ein kurioser Zug anhaftet: Bei den erwähnten Feldzügen fiel kein einziger Kalker Bürger.
Adresse Kapellenstraße, direkt neben Nr. 51 – 55 (ehemaliges Klarissenkloster) | ÖPNV Bahn 1, 9, Haltestelle Kalk-Kapelle | Tipp Auf der Ecke Kapellen- und Kalker Hauptstraße liegt die sehenswerte Kalker Kapelle, wegen ihrer Madonna seit dem 17. Jahrhundert ein beliebter Wallfahrtsort.
2__ Die Alweg-Bahn
Mit 180 Sachen durch Fühlingen
Wenn man die recht zahlreich vorhandenen Fotos dieses Projekts betrachtet, will man nicht glauben, dass es gar keine Spuren hinterlassen haben soll. Anfang der 1950er Jahre begann man im Kölner Norden damit, eine Teststrecke für ein neuartiges Fortbewegungsmittel anzulegen. Es ging um eine Einschienen-Hochbahn, die Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h erreichen sollte. 1951 war in Köln die Alweg-Forschungsgesellschaft gegründet worden, benannt nach dem Finanzier des Unternehmens, dem schwedischen Industriellen Axel Lennart Wenner-Gren (1881 – 1961). Obwohl die Sache höchst geheim gehalten werden sollte, wusste der »Spiegel« bereits im Mai 1952: »In der Fühlinger Heide bei Köln wird jetzt die Eisenbahn des Jahres 2000 geplant und erprobt.«
Der ersten Probefahrt im Oktober 1952 wohnte Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard bei. Später tauchte auch der Bundeskanzler und gebürtige Kölner Konrad Adenauer auf, um begeistert ein paar Runden zu drehen. Der »rasenden Torpedo«, wie die Presse ihn nannte, kam auf eine Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometern und schien zunächst alle Involvierten zu überzeugen. Planungen für zukünftige Strecken wurden auf den Weg gebracht. Köln sollte mit den Leverkusener Bayer-Werken und Opladen verbunden werden, auch der 1957 eröffnete Flughafen Köln/Bonn galt als mögliches Ziel einer Alweg-Bahn. Aber die Entwicklung schleppte sich dahin, technische Probleme und nachlassendes Interesse begruben das Unternehmen. Schon 1967 wurden die Testaufbauten komplett wieder abgerissen.
Keine Spuren also? Doch, wenn auch nur eine sehr unscheinbare. Direkt rechts vom Ortseingangsschild von Fühlingen steht eine kleine Mauer. Keinen halben Meter hoch und vielleicht zwanzig Meter lang ist sie. Historische Fotos bestätigen: Sie ist das letzte Relikt der Alweg-Bahn, die genau hier, in luftiger Höhe, die Neusser Landstraße kreuzte.
Adresse Neusser Landstraße, Ortseingangsschild | ÖPNV Bus 120, Haltestelle Fühlingen | Tipp Auf der Mauer liegt ein Baumstamm, den der »Waldmaler« Wolfgang Schieffer liebevoll mit Motiven der Alwegbahn ausgestattet hat. Die Böschung hinunter gelangt man an das Nordende des Fühlinger Sees.
3__ Am Kümpchenshof
Jan und Griet und wo alles begann
Die Geschichte von Jan und Griet ist eine der beliebtesten Legenden Kölns. Dies erstaunt in mehrerlei Hinsicht: Zum einen war der berühmte Jan von Werth, dem am Alter Markt sogar ein monumentales Denkmal gewidmet ist, beileibe kein positiver Held. Ein Söldner und Kriegsherr war er, der während des dreißigjährigen Gemetzels von 1618 bis 1648 marodierend durch Europa zog. Und zum anderen handelt es sich bei seiner »Affaire« mit der schönen Griet um alles andere als eine Liebesgeschichte. Hier geht es vielmehr um den Hochmut, der vor dem Fall kommt, um späte Scham und billige Rache. Aber der Reihe nach.
Das kleine Schaustück von Jan und Griet wird alljährlich zum Karnevalsanfang auf der Severinstraße gegeben. Hier fand die Geschichte – glaubt man denn der Überlieferung – auch tatsächlich ihr Ende: Die alt gewordene und arm gebliebene Griet kauert am Straßenrand, während der zu Reichtum und Ansehen gekommene Jan hoch zu Ross in die Stadt einzieht. »Griet, wer et hätt gedonn!«, sagt der General, und seine einstige Angebetete antwortet: »Jan, wer et hätt gewoss!« Begonnen hatte jedoch alles am Kümpchenshof nahe dem heutigen Mediapark. Hier diente der aus Büttgen bei Neuss stammende Jan als Reitknecht und verliebte sich in jene bildhübsche Magd namens Griet. Seinen Heiratsantrag jedoch lehnte das ambitionierte Fräulein brüsk ab: »Was glaubst du, wer du bist?«, soll sie ihn angeblafft haben. Griet träumte stattdessen vom Prinzen auf dem weißen Pferd, von einem Mann, der »jet an de Fööss hät«. Jan verließ den Kümpchenshof und zog in den Krieg, der Rest ist bekannt.
Der historische Jan hatte im Übrigen wenig Glück mit den Frauen, vor allem mit seiner letzten, der jungen Gräfin Kuefstein. Im Februar 1652 erfuhr er aus abgefangenen Briefen, dass sie ihn schmählich mit anderen Männern betrog. Als sie dann auch noch schwanger wurde, befiel den Sechzigjährigen ein hohes Fieber. Ein halbes Jahr später, am 12. September, war er tot.
Adresse Kümpchenshof | ÖPNV Bahn 12, 15, Haltestelle Christophstraße/Mediapark | Tipp Von der Historie in die Moderne führt der Spaziergang durch den angrenzenden Mediapark.
4__ Das Arboretum
Ein vergessener Garten aus den 1930ern
Kennen Sie die Hängedotter-Weide? Haben Sie schon einmal vor einer Hupeh-Stinkesche gestanden? Oder gar vor einem Exemplar der Gemeinen Pimpernuss? Letztere – halb Strauch, halb Baum – ist selten geworden, sie steht auf der Roten Liste. Und eigentlich wächst sie sowieso lieber in Südosteuropa. Aber im Kölner Grüngürtel, da findet man sie noch. Als Nummer 12 eines 19 Bäume umfassenden, fast vergessenen Arboretums.
Ursprünglich hatte die Stadt Köln hier einen Botanischen Garten anlegen wollen. Anfang der 1930er Jahre begann man mit ersten Anpflanzungen und Erdbewegungen. Aber das Projekt blieb in den Kinderschuhen stecken und geriet während des Krieges schließlich für viele Jahrzehnte in Vergessenheit. Erst 2008 fand sich mit der Kölner Grün Stiftung und RWE Power ein Duo, das sich des überwucherten Areals annahm. Seitdem erschließen Übersichtstafeln sowie Hinweisschilder vor den Bäumen das Arboretum auch dem nichtsahnenden Spaziergänger.
Begrenzt werden die rund 17 Hektar vom Militärring, der Dürener Straße und der Straßenbahntrasse gen Frechen. Auch in der unmittelbaren Umgebung gibt es einiges zu sehen. Am westlichen Ende der Grünfläche liegt der historische Stüttgenhof. Er wurde 1271 erstmals urkundlich erwähnt und gehört zu den ältesten und besterhaltenen Hofanlagen Kölns. Längst vergangen, aber durch Hinweisschilder in Erinnerung gerufen: die gut 6.000 Jahre alte Bandkeramiker-Siedlung, die hier 1929 ergraben wurde. Im Mittelalter regulierte der Frechener Bach den Wassergraben des Stüttgenhofes. Ab 1962 verschwand er für viele Jahrzehnte im Südlichen Randkanal, um schließlich ab 2018 auf einer Teilstrecke renaturiert zu werden. So entstand ein ökologischer Kreislauf, denn sein Wasser mutiert nun wieder zum Nährstoff für die Pflanzen des Waldes. Auch die Gemeine Pimpernuss wird sich ganz bestimmt darüber freuen.
Adresse westlich des Militärrings zwischen Dürener Straße und Bahntrasse | ÖPNV Bahn 7, Haltestelle Stüttgenhof | Tipp Vergleichbare Eindrücke liefern der Forstbotanischen Garten in Rodenkirchen und das Dünnwalder Arboretum (www.koelner-gruen.de/arboretum).
5__ Der Atombunker
Der Kalte Krieg in Kalk
»Stell dir vor, es ist Krieg, und du kommst nicht mehr rein«, mag man denken, wenn man durch den Atombunker Kalk-Post geführt wird. Die gesamte U-Bahn-Anlage ist ein Relikt des Kalten Krieges der siebziger Jahre, als man noch damit rechnete, dass jederzeit »der Russe« käme. Hinter unscheinbaren blechernen Wandverkleidungen steckten massive Stahlschleusentore, die im Ernstfall geschlossen werden konnten. Dahinter, in einem kaum quadratmetergroßen Kämmerchen, hätte dann der Schleusenwart gezählt: »1, 2, 3 ... 2.365.« Denn Platz war hier für 2.366 Flüchtende, deren letzter der Zähler selbst gewesen wäre. Die Frage, was denn mit dem 2.367. geschehe, beantwortete ein freundlicher Führer von der Berufsfeuerwehr einst eindeutig: »Tja, Feierabend. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.«
Wem jedoch Einlass gewährt wurde, der kam in den Genuss eines ockergelb gestrichenen, verzweigten Geländes samt Operationssaal, Lebensmittellager für maximal vierzehn Tage und einem eminent wichtigen Luftkühlungssystem. Weil ein jeder Mensch ein Wärmekraftwerk mit einer Leistung von 100 Watt pro Stunde ist, kann es in Bunkern binnen kürzester Zeit recht schwül werden. Im Ernstfall hätten sich hier fünfzig Leute eine Kloschüssel geteilt, hundertfünfzig Männer ein Urinal.
Auch der Rudolfplatz beherbergt übrigens eine solche Anlage, insgesamt konnten sich kölnweit einige tausend Menschen Hoffnungen auf einen Bunkerplatz machen. Geschlafen hätte man in Kalk unter anderem rechts und links der Gleisanlagen. Dort konnten ebenfalls Tore herabgelassen werden, und dazwischen hätten 1.096 mausgraue Feldbetten gepasst. Die übrigen Schlafstätten verteilten sich auf abgestellte KVB-Bahnen und Aufenthaltsräume.
Die gesamte Anlage war extrem funktional ausgerichtet, Video-, Spiel- oder Fitnessräume suchte man vergeblich. Seit 2015 präsentiert sich der Bunker nach Jahren des Verfalls museal aufbereitet – und kann gefahrlos besichtigt werden.
Adresse U-Bahn-Station Kalk-Post | ÖPNV Bahn 1, 9, Haltestelle Kalk-Post | Öffnungszeiten Führungen nach Anmeldung unter www.do-kk.de. | Tipp Vom Kalten Krieg in die Konsumwelt der Gegenwart führt der Weg in die oberirdischen KölnArkaden.
6__ Die Bachkreuzung
Die fleißige Strunde und der faule Bach
Kreuzen können sich Straßen oder Bahngleise, auch Pflanzen und Tiere kann man kreuzen. Wer hingegen von einer »Bachkreuzung« spricht, erntet zunächst einmal skeptische Blicke. Ist es doch gemeinhin so, dass ein Gewässer in das andere mündet und nicht darüber hinwegfließt. In Köln jedoch, genauer gesagt in Holweide, findet man einen solchen Ort: Hier kreuzen sich die Strunde und der Faulbach.
Die Strunde, einer von zweiunddreißig Kölner Bächen, diente jahrhundertelang als das wichtigste Fließgewässer im Rechtsrheinischen. Waren es zunächst vor allem Getreidemühlen, deren Räder mit der Kraft des bergischen Bächleins betrieben wurden, so kamen später auch Öl-, Loh-, Walk-, Säge- und Pulvermühlen hinzu. Über vierzig dieser Wasserwerke säumten zeitweise die Ufer, deren erstes nur zweihundert Meter hinter der Quelle in Herrenstrunden lag. Mit einigem Recht sprach deshalb der bergische Dichter Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio (1806 – 1876) vom »fleißigsten Bach Deutschlands«. Mit der industriellen Nutzung einher ging jedoch die zunehmende Verschmutzung der Strunde, und hier beginnt auch die Geschichte des seltsamen Wasserkreuzes.
Die ungeklärten Abwässer der Betriebe führten zu einem rasanten Fischsterben, und auch als Trinkwasser oder zur Bewässerung der Felder konnte die Strunde bald nicht mehr genutzt werden. Darunter litten vor allem die Bürger von Mülheim, die ihren Durst mit dem Wasser des Baches stillten. Glücklicherweise gab es jedoch in Holweide einen sauberen Zulauf der Strunde, den Faulbach. Sein Name rührt daher, dass er im Gegensatz zu seinem fleißigen Bruder eben kein einziges Mühlrad antrieb. Und so entschloss man sich, die Strunde mittels einer Brücke über den Faulbach zu führen, sodass dieser ohne Verunreinigung gen Westen rinnen konnte. Fortan floss wieder klares, reines Wasser nach Mülheim, und der »faule Bach« gelangte zu nie gekanntem Ansehen.
Adresse Schlagbaumsweg 145, direkt an der östlichen Seite der Überführung über die A3 | ÖPNV Bus 157, Haltestelle Schlagbaumsweg | Tipp Dem Schlagbaumsweg über die A3 hinweg gen Westen folgend erreicht man nach hundert Metern die Herler Mühle mit erhaltenem Wasserrad. Heute ein Wohnhaus, diente sie einst als Getreidemühle.
7__ Der Barbarastollen
Schwarzes Gold unter dem Uni-Hauptgebäude
Hunderttausende von Studenten sind über ihn hinweggelaufen, ohne auch nur zu ahnen, dass er existiert. Aber tatsächlich: Kaum zehn Meter unter dem Foyer der Uni-Aula befindet sich ein Bergwerk. Es ist keines, in dem je Kohle abgebaut wurde, diente es doch seit seiner Eröffnung im Jahr 1932 als Industriemuseum sowie als Schauraum für Studenten der Mineralogie und Geologie. Neben der Technik des Bergbaus wurden hier die harten Bedingungen der Arbeit unter Tage demonstriert.
Der Essener Zeichner und Graphiker Franz Holl verwirklichte seinen lang gehegten Bergwerksplan in den 1930er Jahren in einem leer stehenden Raum des Universitätskellers. Dort hinein baute er einen fünfundzwanzig Meter langen Stollen, die Bautechnik übertrug er von im Ruhrgebiet nach Originalen gefertigten Zeichnungen. Auch alle Einrichtungsgegenstände – Lore, Aufzug, Grubentelefon, Presslufthammer usw. – stammen aus ausrangierten Pütt-Beständen. Während des Krieges geriet das Kölner Schaubergwerk in Vergessenheit. Vermutlich war es ein Mitglied der Hausmeisterschaft, das in den 1960ern auf die Idee kam, jene hinter einem Regal versteckte Tür zu öffnen. Sein Erstaunen dürfte kaum geringer gewesen sein als das eines fündig gewordenen Archäologen.
Seit der Renovierung von 1995 sieht hier wieder alles so aus, als seien die Kumpels gerade in der Frühstückspause. Die Simulation ist tatsächlich perfekt: Die Betätigung des Notschalters bewirkt ein ohrenbetäubendes Geräusch, vom Grubentelefon aus kann angerufen werden, und an den Backsteinwänden hat Initiator Holl mithilfe von Teer Kohlenstaub befestigt, der auf ergiebige Adern schließen lässt.
Aus echtem Holz wiederum bestehen die Stützpfeiler der Konstruktion. Traditionell benutzte man nicht das Hartholz von Eichen und Buchen, sondern Fichtenstämme. Denn die langen Zellen der Fichte knacken, bevor sie brechen. So warnen sie vor einem drohenden Grubenunglück. Also: Gut die Ohren spitzen!
Adresse Albertus-Magnus-Platz | ÖPNV Bahn 9, Haltestelle Universität | Öffnungszeiten Der Stollen ist nicht frei zugänglich, aber hier findet man eine virtuelle Führung: www.barbarastollen.uni-koeln.de. | Tipp Seit Urzeiten gilt den Untertage-Kumpels Schnaps als ideales Bindemittel für den eingeatmeten Kohlenstaub. Empfehlenswert wäre also ein Gang auf die nahe Zülpicher Straße mit ihren zahllosen Kneipen.
8__ Die Belvederebrücke
Schöne Aussichten zwischen Wiese, Wald und Gewerbe
Wer hin und wieder den Militärring befährt, dem ist sie vielleicht schon einmal aufgefallen: eine leuchtend orange, schmale Stahlbrücke, die Müngersdorf mit Vogelsang verbindet. Sie entstand im Zusammenhang mit dem Gewerbe- und Landschaftspark Triotop, der auf das Kölner Bauunternehmen Friedrich Wassermann zurückgeht. Die Melange aus Biotop, Gartenkunst und hochwertigen Büroflächen ist rundweg sehenswert und durch Spazierwege erschlossen. Besonders geschäftig geht es hier allerdings nie zu, dafür liegt das Areal zu isoliert. Und dementsprechend selten wird auch die 2010 errichtete Fußgängerbrücke über die vierspurige Straße und die dreigleisige Bahntrasse benutzt.