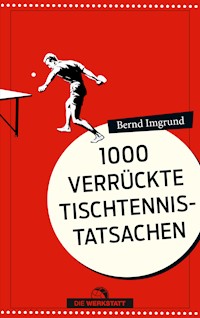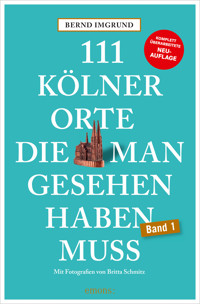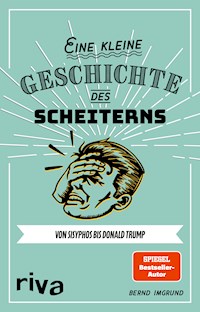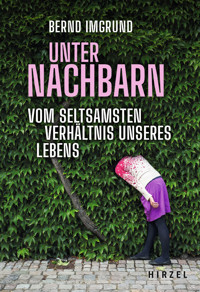
19,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: S. Hirzel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf gute Nachbarschaft! Warum das Zusammenleben manchmal gar nicht so einfach ist
Es gibt vieles im Leben, das wir (mehr oder weniger) frei wählen können: den Freundeskreis, den Arbeitsplatz, den Wohnort. Manche Gemeinschaften müssen wir jedoch nehmen, wie sie kommen: So können wir uns weder unsere Familie noch unsere Nachbarn aussuchen.
Warum dies nicht nur zum viel beschworenen idyllischen Zusammengehörigkeitsgefühl führt und welche Spannungen erzwungene soziale Beziehungen hervorrufen können: Davon handelt dieser spannende Essayband von Bernd Imgrund.
- Zwischen Nähe und Distanz: Wie funktioniert ein gutes Zusammenleben mit den Menschen von nebenan?
- Von der Antike bis heute: Verfeindete Nachbarorte und verschworene Dorfgemeinschaften – eine Kulturgeschichte
- Ist die Digitalisierung das Ende der Nachbarschaft? Wie das Internet die sozialen Beziehungen verändert
- Dorf versus Stadt, Alteingesessene versus Zugezogene: Spaltung der Gesellschaft?
- Gesellschaft und Gemeinschaft: Solidarität unter Nachbarn und ihre Bedeutung für das Gemeinwesen
Nahe und ferne Nachbarn: Zwischen Sympathie und Abgrenzung
Das Netzwerk Nachbarschaft in all seinen Facetten ist das Thema dieses Buches. Es beleuchtet ein Stück Sozialgeschichte, das jeder von uns aus eigener Erfahrung kennt: Wer hat nicht schon einmal mit seinem direkten Nachbarn gestritten oder sich über die Bewohner des angrenzenden Viertels lustig gemacht? Doch es sind keineswegs nur negative Aspekte, die nachbarschaftliche Verhältnisse prägen. Der Stolz auf den eigenen Kiez, die Hilfe innerhalb einer Dorfgemeinschaft: Die vielen Vorteile einer sozialen Gemeinschaft, ihre Bedeutung und ihre Darstellung in Kunst und Literatur haben ebenfalls Eingang in dieses Lesebuch gefunden.
Ein hintersinniges Geschenk für den Lieblingsnachbarn oder eine aufschlussreiche Lektüre, wenn es im Haus nebenan mal wieder drunter und drüber geht: Bernd Imgrund ist einem Phänomen auf den Grund gegangen, das uns alle angeht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bernd Imgrund
Unter Nachbarn
Vom seltsamsten Verhältnisunseres Lebens
Inhalt
Orientierungsmarken
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Donald Ducks ärgster Feind ist nicht sein Onkel Dagobert, sondern sein Nachbar, Herr Zorngiebel. Immer wieder verbeißen sich die beiden ineinander, es geht um Ruhestörung, falsch entsorgten Müll oder einen aufgeklaubten Geldschein. Als Donald die Nase endgültig voll hat, beschließt er umzuziehen. Unglücklicherweise hat sein Kontrahent dieselbe Idee, und es kommt, wie es kommen muss: Donald bezieht »das vorletzte Haus in der letzten Straße von Entenhausen«, nur um festzustellen, dass Zorngiebel schon wieder direkt nebenan wohnt.
Die Geschichte belustigt den Leser nicht zuletzt deshalb, weil sie eine tiefe, manchmal peinigende Wahrheit ausspricht: Seinen Nachbarn kann man nicht entkommen. Man wählt seine Arbeitsstelle (nun ja), den Sportverein, die Partei. Man sucht sich seine Freunde, die Chatgruppen, die Stammkneipe. Die Nachbarn jedoch, wie die Familie, hat man an der Backe – ob man will oder nicht.
Das Wort »Nachbar« stammt vom althochdeutschen »nahgibur« und bezeichnete ursprünglich den nächstwohnenden Bauern. Wie viel Nähe man zulässt, wie viel Distanz man hält, liegt nicht immer im eigenen Ermessen. Die Nachbarschaft ist ein Verhältnis, das austariert werden muss, es steckt in jedem von uns eben auch ein kleiner Zorngiebel. Nachbarn können miteinander über Kreuz liegen und sich das häusliche Leben zur Hölle machen. Aber es geht natürlich auch andersherum: Sie können uns ans Herz wachsen und zu Freunden werden. Die Sache mit uns und unseren Nahgiburen: ein weites Feld! Rainer Maria Rilke behauptet in seinem Malte Laurids Brigge: »Ich könnte einfach die Geschichte meiner Nachbaren schreiben; das wäre ein Lebenswerk.«
Da ist was dran.
Frühe Nachbarschaften
Am Anfang war der Mord
Folgt man der Bibel, so waren wir Menschen einst Nachbarn von Gott persönlich – da oben im Paradies. Aber das haben wir versiebt, genauer gesagt, wir haben´s ver-äppelt. Die ersten Nachbarn auf Erden waren dann die Brüder Kain und Abel. Jeder weiß, wie die Sache ausging: Bauer Kain erschlug den Hirten Abel. Schlechter hätte es wahrlich nicht losgehen können mit der Menschheit.
Das Thema Nachbarschaft genießt kein hohes Ansehen in der Altertumsforschung. Dass auch die antike Stadt ihre »Hoods« kannte, ist immerhin belegt. Feldforschungen in Pompeji und Herculaneum haben die Existenz sozialer Treffpunkte nachgewiesen. Geschäfte, Brunnen und Tempel, aber auch gemeinsame, gestaltete Innenhöfe boten Gelegenheit zum nachbarschaftlichen Austausch. Auch im antiken Rom, davon dürfen wir ausgehen, trafen sich die Nachbarskinder schon zum Murmeln, Verstecken und Nachlaufen, während die Eltern vor der Tür einen Wein tranken und übers Wetter schnackten.
Weil menschliche Gemeinschaft nie ohne Reibung funktioniert, halfen damals wie heute Normen und Gesetze dabei, den Frieden im Viertel zu wahren. Wer dagegen verstieß, musste etwa im Athen des 7. vorchristlichen Jahrhunderts mit ritualisierten Schandstrafen rechnen. Dazu gehörten vermeintlich milde Sanktionen wie Gespött und üble Nachrede, aber auch handfeste wie das Einschlagen der Tür und die Verwüstung des Hausstands. Als die antike Metropole im selben Jahrhundert in eine schwere soziale Krise geriet, berief man den Staatsmann und Lyriker Solon (640–560 v. Chr.) zum Schlichter. Er löste die Probleme nicht zuletzt durch die Abschaffung einer nachbarschaftlichen Unsitte: der Schuldsklaverei im verarmten Ackerbürgermilieu. Reiche Großgrundbesitzer hatten bis dato das Recht gehabt, den in ihrer Schuld stehenden Nachbarn zu versklaven, ja, ihn sogar über Athens Grenzen hinweg zu verkaufen.
Fluch und Segen
Schlimm ist der Nachbar ein Fluch, doch gut ein Segen vom Himmel. Dem ward Ehre zuteil, wem ward ein redlicher Nachbar.
Hesiod im 7. Jh. v. Chr.
Jenseits dessen blieben auch unter Solon die antiken Hierarchien und Mietverhältnisse unangetastet. Wohlhabende Bürger Roms wohnten in Palästen (domus) und mehrten ihren Reichtum durch die Vermietung kleiner, häufig von Handwerkern und Gastronomen betriebener Häuser (taberna). Mögen die verschiedenen Stände auch häufig nachbarlich nah beieinander gelebt haben, so blieben sie im öffentlichen Bewusstsein strikt getrennt. Der ansonsten so kluge Oberschichtler Cicero (106–43 v. Chr.) verstieg sich in seinem Katalog der Berufe gar zu einer pauschalen Schmähung des arbeitenden Volkes: »Alle Handwerker betätigen sich einer schmutzigen Kunst. Denn eine Werkstatt kann nichts Freies haben.«
Reihenbrauen und Weiberzechen
Auch für das Mittelalter und die frühe Neuzeit sind die Quellen zum Thema Nachbarschaft recht rar. Eine Tagung an der Universität Hamburg unter dem Motto »Nachbarschaft. Auf der Suche nach einer Sozialform in der Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit« kam 2023 zu dem Schluss: »Nahe am Hof, vielleicht präziser an der Burg, so berichten es die Artusromane, beginnt der Raum des Waldes, in dem es gute und falsche Wege, mal ein Zelt, mal eine Feenkönigin, mal einen Klausner oder eine Klausnerin, ganz bestimmt aber Drachen, Riesen und Räuber, nie hingegen Nachbarn gibt.« Nur selten auch geht es in den Epen und Gedichten der Zeit um das nachbarschaftliche Nebeneinander. Eher werden Heldentode und die hoffnungslose Minne eines Barden zum hübschen Burgfräulein verhandelt. Dennoch spielt das Mittelalter eine bedeutende Rolle bei der Herausbildung eines nachbarschaftlichen Rechtssystems. Denn während die Dorfgemeinschaft längst existierte, entstanden ab dem 12. Jahrhundert die ersten städtischen Siedlungen. Hier lebten die Menschen nicht mehr über Äcker und Weiden entfernt voneinander, sondern Wand an Wand. Nachbarn eröffneten sich in der Stadt Möglichkeiten gegenseitiger Hilfe, zugleich jedoch standen sie vor neuen Herausforderungen, die sich durch diese Nähe ergaben.
In seinem Standardwerk Betrifft: Nachbarschaft (1973) unterscheidet der Soziologe Bernd Hamm die lose Stadtgesellschaft von der engen Dorfgemeinschaft. Das Zusammenleben auf dem Land beruhte auf alltäglichen Notwendigkeiten und wurde durch soziale Normen geregelt. Man lebte nah an der Natur, von der eigenen Hände Arbeit und im Schulterschluss mit den Nachbarn (den Nahgiburen). Stand die Ernte an, wurde auf den Feldern gemeinsam gesenst und Heu gewendet. Galt es, einen neuen Dorfbrunnen zu bauen, packten alle mit an.
Die räumliche Nähe korrespondierte der kulturellen: Man teilte die Religion, feierte dieselben Feste und fürchtete dieselben Schicksalsschläge, wenn etwa das Wetter die Ernte zu verhageln drohte. Und wenn auch die Felder des einen Bauern etwas größer oder fruchtbarer als die des anderen sein mochten, so stand man sich in materieller Hinsicht doch mehr oder weniger gleich. Ständische Unterschiede beschränkten sich nach oben hin auf den adligen Landesherren und nach unten auf das besitzlose Hilfspersonal: die Knechte, Mägde und Wanderarbeiter.
In der Stadt hingegen lagen die Dinge ein wenig anders. Hier trafen verschiedene Stände und Kulturen aufeinander – wenn auch nicht in dem Maße wie heute. In seiner Untersuchung Nachbarschaft, Gemeinschaft und sozialer Raum kommt der Stadtforscher Eric Piltz zu dem Ergebnis, dass wir »bislang keinerlei Erkenntnisse darüber haben, wen die frühneuzeitlichen Stadtbewohner als Nachbarn betrachteten«. Hinweise darauf geben allenfalls städtische Verordnungen. Im spätmittelalterlichen Zürich waren Nachbarn verpflichtet, sich beim Ausbruch eines Feuers zu helfen. Dazu zählte laut Piltz jener Personenkreis, »der am selben Gassenabschnitt oder im selben Wachtteil (Viertel) wohnt, allerdings nicht weiter voneinander entfernt als drei bis fünf Häuser«.
Ohne Lärm und Laut
Nur eine schmale Wand ist zwischen uns,/ durch Zufall; denn es könnte sein:/ ein Rufen deines oder meines Munds –/ und sie bricht ein/ ganz ohne Lärm und Laut./ Aus deinen Bildern ist sie aufgebaut.
Rainer Maria Rilke: »Du, Nachbar Gott«, 1899
Vor allem aus Westfalen und dem Rheinland haben sich sogenannte »Nachbarschaftsbücher« erhalten. Sie basieren auf einer frühen Form eines Gemeinde- oder Stadtteilparlaments, das die Rechte und Pflichten der Mitglieder verhandelte. Sei es eine geplante Baumaßnahme, die Straßenerhaltung oder die Organisation von Hochzeiten und Beerdigungen: Das Nachbarschaftsbuch hielt fest, was wie zu tun war. Die Nachbarschaft der Kirchpforte in Andernach etwa wollte am 13. Juli 1634 ihr Engagement zur Verbesserung der Verteidigungsanlagen honoriert bekommen. Mitbürger aus der Korngasse wiederum beschwerten sich am 19. September 1624 über einen angeblich ungenehmigten und gefährlichen Ofenbau in ihrer Straße. Wer gegen die Satzung verstieß, musste, wie schon in der griechischen Antike, mit empfindlichen Sanktionen rechnen. Als Höchststrafe, so Piltz, »sahen die Statuten die Entnachbarung vor«. Dem Beschuldigten drohte kein echter räumlicher, aber ein unter Umständen massiver sozialer Ausschluss aus der Gemeinschaft. Reintegration war möglich, aber nicht umsonst. Ein entnachbarter Mitbürger aus Coesfeld etwa beglich seine Schuld gegenüber den Mitbürgern mit »einer halben Tonne doppeltem Bier«. Das klingt doch nach einer exzellenten Idee!
Bier war im Mittelalter und der frühen Neuzeit kein Luxus-, sondern ein Lebensmittel. Nicht zuletzt, weil das Wasser darin abgekocht war und somit keimfrei durch die Kehle rann. Relativ gut bezeugt sind deshalb auch entsprechende nachbarliche Bräuche unter Stadtbewohnern. Nicht nur durfte jeder Haushalt brauen, sondern er durfte auch Überschuss produzieren und an die Nachbarn verteilen – gegen einen Obolus, versteht sich. Im ermländischen Elbling, einer Gründung des Deutschordens im heutigen Polen, standen im Jahr 1417 22 Bäckern und 13 Fleischern sage und schreibe 65 Brauer gegenüber. Echte Kneipenräume existierten freilich in den seltensten Fällen. Die brauenden Bäuerinnen oder Handwerksfrauen luden einfach in ihre Küche.
Damit die Sache ein System bekam, wurde das private Brauen reglementiert. Nicht jeder durfte jederzeit ausschenken, stattdessen zapften die Nachbarn der Reihe nach. Wie in Deutschland nicht anders zu erwarten, wurde auch das Reihenbrauen mit bürokratischer Gründlichkeit organisiert. Damit es nie an Nachschub mangelte, sollten die städtischen Beauftragten »mit Ertheilung der Schankzettel nicht solange warten, bis diejenigen, an welchen der Schank im Viertel gewesen, das Bier bis auf den lezten Tropfen ausgeschenkt haben, sondern es müssen, wenn diese etwa noch ein Fass vorräthig haben, denen folgenden die Schankzettel ertheilet werden, um das Nachbrauen, welches sonst beim Ende des Schanks am stärksten zu geschehen pflegt, soviel möglich, zu verhüten«.
War das Fass angeschlagen, schickte man Ausrufer durch die Gassen – im Regelfall wohl die eigenen Kinder oder Knechte: »Hei, man hat ein gut jung Bier allererst aufgetan«, mochten sie etwa kundtun. Selbst Kaiser Rudolf von Habsburg (1218–1291) zeigte einst Einsatz. In Erfurt trat er mit schäumendem Krug vor die Tür eines befreundeten Brauers und deklamierte: »Wol in! Wol in! Eyn guet Bier! Dat hat Herre Siegfried von Bustede ufgetan!« Später dann warb das jeweils aktuelle Brau-Haus mit einen Aushang über der Tür. Das konnte zum Beispiel ein Besen, Kranz oder ein Strauß sein – Ursprung der bis heute existenten Besen-, Busch- oder Straußenwirtschaften.
Von der männlichen Obrigkeit geduldet wurden bestimmte weibliche Wein- oder Bierrunden, die sich zu festlichen Gelegenheiten daheim zusammenfanden. Sie bildeten jedoch eher die schmunzelnd tolerierten Ausnahmen von der Regel. So kennt man in Rheinland-Pfalz und Württemberg bis heute den mittelalterlichen Brauch des Weiberzechens: Einmal im Jahr wurden die Fronarbeiterinnen ins Rathaus geladen, um sich von Männern bedienen zu lassen. Ein Beispiel aus dem Örtchen Ochsenbach bei Ludwigsburg belegt, dass es dabei ordentlich zur Sache ging. So ist für das Jahr 1836 überliefert, dass 135 Frauen zusammen 126 Liter Wein und 135 Wecken konsumierten. Als der Gemeinderat die Weiberzeche 1798 abschaffen wollte, wusste frau sich zu wehren: »Einige Weiber«, liest man, »zogen mit Äxten in das Gemeindewäldchen und hieben eine der stärksten Eichen um, worauf die Weiber ihre Zeche wieder erhielten.«
Überregional bekannt war demgegenüber das sogenannte Kindbett- oder Kirchzechen. Es schloss sich an den ersten Gottesdienst einer Mutter nach dem Wochenbett an. Berücksichtigt man die hohe Todesrate von Frauen nach der Geburt, war dies tatsächlich ein existenzieller Anlass zur Freude. Nachbarinnen, Freundinnen und weibliche Verwandte kamen auf ein paar Schoppen Wein oder ein frisch gebrautes Fässchen Bier zusammen, um das Kind und die frischgebackene Mutter zu begießen. Vor dem Kaffee-, so lernen wir, war offenbar das nachbarschaftliche Bierkränzchen.
Dörfler und Städter
Warum Landluft (nicht) gesund ist und Stadtluft (nicht) frei macht
Die weiße und die schwarze Kuh
Ein ruhiger, schweigsamer Bauer hütete zwei Kühe, die auf einer Wiese grasten, und tat nichts anderes. Da kam ein Städter des Wegs, setzte sich neben ihn, schwieg anstandshalber einen Moment und fragte dann:
»Fressen die Kühe gut?«
»Welche von beiden?«, entgegnete der Bauer.
Da sagte der Städter, leicht aus der Fassung gebracht: »Die weiße.«
»Die weiße: ja«, antwortete der Bauer.
»Und die schwarze?«
»Die schwarze auch.«
Nach diesem ersten Wortwechsel schwiegen die beiden Männer eine ganze Weile und betrachteten die Hügel und das Dorf. Irgendwann jedoch wurde der Städter unruhig und fragte:
»Und geben sie viel Milch?«
»Welche von beiden?«, sagte der Bauer.
»Die weiße.«
»Die weiße: ja.«
»Und die schwarze?«
»Die schwarze auch.«
Wieder folgte eine lange Pause. Die Männer blickten sich nicht an, sondern lauschten dem Bach und den grasenden Kühen. Aber dann unterbrach der Städter die Stille:
»Warum fragst du mich eigentlich immer: ›Welche von beiden?‹«
»Weil«, antwortete der Bauer, »die weiße mir gehört.«
»Ach so«, entfuhr es dem Städter. Als er jedoch über diese Entgegnung nachdachte, wurde ihm ein wenig mulmig. Mit banger Vorahnung rang er sich schließlich zu einer letzten Frage durch:
»Und die schwarze? Gehört die auch dir?«
»Die schwarze auch.«
Das Gleichnis präsentiert uns ein gegensätzliches Paar: den stoischen Bauern und den ungeduldigen Städter. Die beiden stehen für die unterschiedlichen Lebensentwürfe ihres Umfelds. Auf dem Land gehe es ruhig zu, suggeriert die kleine Geschichte. Dort erledige man klaglos sein Tagwerk und mache nicht viele Worte darum. Durch die Stadt hingegen ziehe viel heiße Luft: Unablässig werde geschwätzt, Hektik bestimme den Alltag.
Die Klischees sind alt, doch im Kern treffen sie noch heute zu. Seit Urzeiten gilt die Stadt als Moloch voller Menschen, Lärm und Gefahren. Von Horaz (65–8 v. Chr.) stammt die Fabel von der Feld- und der Stadtmaus: Der Besuch in der Stadt wird für Erstere zum Trauma. Ein Hund bellt, sie leidet Todesangst und geht mit der Erkenntnis nach Hause: »Ich lobe mir mein kleines Loch im Walde! Da hab ich nichts zu fürchten, und kann, wiewohl´s nur magre Bissen gibt, mich doch in Ruh an meinen Wicken laben.«
Auch der Anstandspapst Adolf von Knigge (1752–1796) beschäftigte sich mit den Unterschieden von Stadt und Land. »Nächst den Personen deiner Familie bist du am ehesten deinen Nachbarn und Hausgenossen Rat, Tat und Hilfe schuldig«, schreibt er in seinem berühmten Benimmbuch. Und fährt fort: »In großen Städten pflegt man zu glauben, es gehöre zu dem guten Ton, nicht einmal zu wissen, wer mit uns in demselben Hause wohnt. Schämen würde ich mich, wenn es der Fall wäre, dass die Mietkutscher und Straßenbuben mich besser als meine Nachbarn kennten.«
Aber genau so scheint es gekommen zu sein. Laut Umfragen kennt kaum ein Städter den Bewohner direkt nebenan. Eine Studie der TU Darmstadt kommt zu dem Ergebnis, dass in Städten nur noch drei Prozent der Mieter nach dem Einzug bei ihren Nachbarn klingeln, um sich vorzustellen. Der alte Knigge wäre entsetzt über diese Zahlen, und tatsächlich zeitigen sie negative Folgen. Vereinzelung, Vereinsamung und Anonymität sind in Städten stärker ausgeprägt. Je dichter man aneinander lebt, desto beflissener geht man sich offenbar aus dem Weg.
Während man der Stadt soziale Isolierung attestiert, wird das Dorfleben idealisiert. Auch der Soziologe Ferdinand Tönnies (1855–1936), ein Pionier der Nachbarschaftsforschung, unterschied die ländliche Gemeinschaft von der städtischen Gesellschaft. Das dörfliche Zusammenleben zwischen Ackerbau und Viehzucht sei »das von Natur gegebene«, es laufe in festen, gleichförmigen Bahnen. In der städtischen Gesellschaft hingegen seien die Strukturen und Beziehungen so unüberschaubar, dass die Gemeinschaft der Menschen darüber verloren gehe.
Etwa zeitgleich behauptete Tönnies´ amerikanischer Kollege Charles Cooley (1864–1929) sogar, nachbarschaftliche Beziehungen könnten in Städten per se nicht entstehen. Die Denaturierung und Rationalisierung der Stadtgesellschaft töte alle emotionalen Bindungen ab. Cooleys Diagnose lässt sich leicht – und tausendfach – bestätigen. Traurige Berühmtheit erlangte 1964 der Mordfall Kitty Genovese. Die 29-jährige Bar-Angestellte wurde in der Nähe ihrer Wohnung in Queens/New York auf offener Straße erstochen. Zahlreiche Anwohner hörten ihre Schreie, aber niemand eilte ihr zur Hilfe. Sämtliche 38 befragten Nachbarn erklärten, man habe den Krach nicht ernst genommen, weil so etwas alltäglich vorkomme. Der Zeuge Karl Ross wiederum äußerte den entlarvenden, später berühmt gewordenen Satz: »I didn´t want to get involved« – »Ich wollte da nicht mit reingezogen werden.«
Keiner ist mehr Gangster
Alle zieh´n aufs Land, in die große Stadt nie wieder./Silbernes Besteck, goldener Retriever./Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster./Jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster.
Marteria: »Kids (2 Finger an den Kopf)«, 2014
Kitty Genoveses Schicksal wurde von den Medien als Beispiel für die Gefühlskälte der Metropolen herangezogen. In der Kriminalhistorie spricht man seitdem vom Genovese-Syndrom, zu Deutsch Zuschauereffekt. Damit gemeint ist das wiederkehrende Phänomen des nicht eingreifenden, nicht helfenden Augenzeugen einer kriminellen Handlung. In der Stadt mag viel kommuniziert werden. Aber im entscheidenden Moment, so lehrt uns das Syndrom, schaue man lieber weg. Dann ist man nicht dem Mitmenschen, sondern sich selbst der Nächste.
Dörfliche Idylle versus städtischer Dschungel
»Stadtluft macht frei!«, besagt ein alter Spruch. Er stammt aus dem Mittelalter, und der Hintergrund ist ernster, als der saloppe Ton vermuten lässt. Geht er doch zurück auf einen Rechtsgrundsatz, der in die Stadt entflohenen Leibeigenen die Freiheit zusichert, wenn ihr Grundherr sie nicht binnen eines Jahres zurückfordert. Metropolen bieten darüber hinaus weitere Vorteile. Etwa die Freiheit von der Kontrolle durch die Dorfgemeinschaft. Was auf dem Land eine Maus der anderen erzählt, geht im Großstadtdschungel oftmals unter. Die Stadt ermöglicht ein höheres Maß an Freiheit, an Individualität und damit auch an Diversität – sie ist bunter.
Selbst innerhalb von Familien kann jedes Mitglied seine eigene »Nachbarschaft« wählen – über den Freundeskreis, den Sportverein, den abendlichen Club oder die Chatgruppe. Im Dorf mag man zur Nachbarschaft verdammt sein. Weil in der Stadt jedoch jeder seinen eigenen Faden ins große Knäuel spinnt, wird räumliche Nachbarschaft zu einer bloßen Option. Wenn er mir passt, der Mensch von nebenan, schnack ich auch gern mal im Treppenhaus. Wenn nicht, dann eben nicht.
Ein Dorfidyll: Rotwangige Bauern und Bäuerinnen sitzen am Dorfbrunnen unter der Linde, die Kinder tanzen einen Reigen, und am Waldesrand röhrt der Hirsch ein Liedchen dazu. Aber wie weit ist es her damit? »Wenn ich eine Kuh sehe, muss ich kotzen«, formulierte es Ende der 1970er drastisch Mick Jones, der Gitarrist von The Clash. »Zurück zum Beton«, sangen zur gleichen Zeit die Deutschpunks von S. Y. P. H., und sie meinten damit: Wir sind Stadtkinder. Der deutsche Wald, dieser ganze erdbraune Mystikmüll kann uns mal. Wir lieben den Mief, der aus den U-Bahnschächten aufsteigt. Ein graffitibeschmiertes Hochhaus toppt jede verdammte Eiche – Pennerasyl statt Yggdrasil!
Mit Nachbarschaftsforscher Bernd Hamm könnte man auch darauf hinweisen, dass die »Naturnähe« auf dem Land weitgehend Illusion ist: »Gerade die Feldarbeit ist eine extreme Form der Natur-Kultivierung«, verbunden mit technischen Geräten und chemischen Hilfsmitteln. Und während Landhonig aus agrarischen Monokulturen hervorgeht, wird Stadthonig von zahlreichen verschiedenen Balkon- und Straßenrandblumen gespeist. Die Mär vom malerischen Landleben persifliert Rainald Grebe in seinem (sehr lustigen) Song Aufs Land von 2011: »Ich will ein Gehöft, ein Gehöft, Gehöft./Wo der Hirtenhund kläfft. (...) Kikeriki, der Hahn ist die Uhr./Ich will zurück zur Natur.« Aber als er es dann bezieht, dieses erträumte Gehöft, ist es ihm auch nicht recht. Denn da leben nicht nur Hahn und Hirtenhund, sondern eben auch die »Nahgiburen«: »Diese Dorfdeppen«, die »Bauern, diese Landbevölkerung./Alle fünf Minuten winkt hier einer durchs Fenster und will reden./Übers Wetter, übers Wetter, übers Wetter, über irgendein´ Scheiß.« Statt Ruhe und eine ungestörte Privatsphäre erfährt er den Terror der dörflichen Nachbarschaft: »Jeder weiß, was der andere macht, und schließen doch nicht die Türen ab./Die schließen hier die Türen nicht ab!«
Allein ist nicht gleich allein
Es ist einfach ein mehr so egozentriertes Alleinesein in einem Haus auf dem Land mit Feldern drumherum im Gegensatz zu dem Alleinesein in einer Wohnung mit einem Nachbarn hinter der Wand.
Judith Hermann, Schriftstellerin