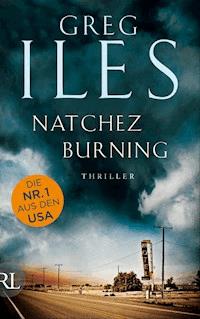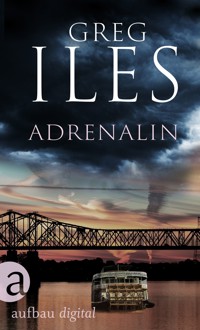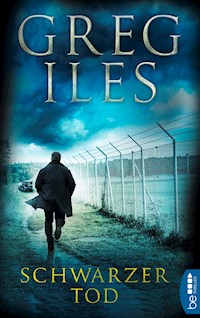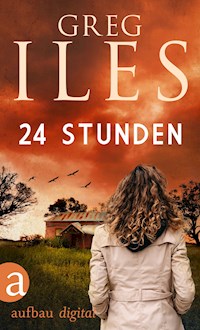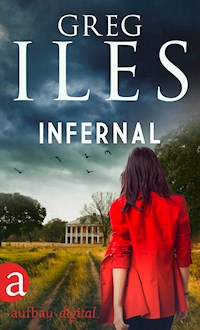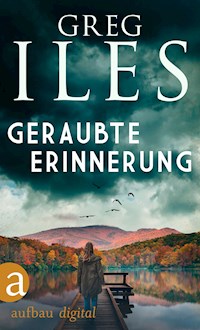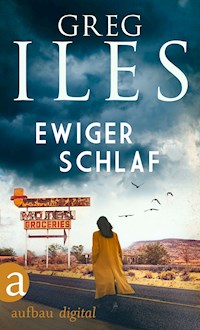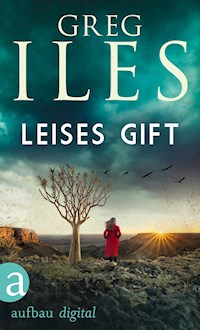8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Greg Iles Bestseller Thriller
- Sprache: Deutsch
Laurel lebt mit ihrem Mann Warren und ihren beiden Kindernein scheinbar perfektes Leben. Doch Laurel hat ein Problem: Sie ist schwanger, und zwar wahrscheinlich nicht von ihrem Ehemann. Eines Morgens stellt sie fest, dass Warren nicht neben ihr liegt. Er ist dabei, das Haus zu durchsuchen. Als Laurel später von der Arbeit heimkehrt, sitzt Warren auf dem Sofa, mit einem wilden Ausdruck im Gesicht. Vor ihm liegt ein Brief, den Laurel sorgsam versteckt hatte - ein Brief von ihrem Liebhaber. Und dann sieht sie den schwarzen Revolver in Warrens Hand. Doch Warren hat ein noch viel größeres Problem als die Untreue seiner Frau ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Laurel lebt mit ihrem Mann Warren und ihren beiden Kindernein scheinbar perfektes Leben. Doch Laurel hat ein Problem: Sie ist schwanger, und zwar wahrscheinlich nicht von ihrem Ehemann. Eines Morgens stellt sie fest, dass Warren nicht neben ihr liegt. Er ist dabei, das Haus zu durchsuchen. Als Laurel später von der Arbeit heimkehrt, sitzt Warren auf dem Sofa, mit einem wilden Ausdruck im Gesicht. Vor ihm liegt ein Brief, den Laurel sorgsam versteckt hatte - ein Brief von ihrem Liebhaber.
Und dann sieht sie den schwarzen Revolver in Warrens Hand ... Doch Warren hat ein noch viel größeres Problem als die Untreue seiner Frau ...
Über Greg Iles
Greg Iles wurde 1960 in Stuttgart geboren. Sein Vater leitete die medizinische Abteilung der US-Botschaft. Mit vier Jahren zog die Familie nach Natchez, Mississippi. Mit der »Frankly Scarlet Band«, bei der er Sänger und Gitarrist war, tourte er ein paar Jahre durch die USA. Mittlerweile erscheinen seine Bücher in 25 Ländern. Greg Iles lebt heute mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Natchez, Mississippi. Fünf Jahre hat er kein Buch herausgebracht, da er einen schweren Unfall hatte, nun liegen im Aufbau Taschenbuch seine Thriller „Natchez Burning“, „Die Toten von Natchez vor“, "Die Sünden von Natchez" und "Blackmail" vor.
Mehr zum Autor unter www.gregiles.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Greg Iles
12 Stunden Angst
Aus dem Amerikanischen von Axel Merz
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Epilog
Danksagungen
Impressum
Wer von diesem Thriller begeistert ist, liest auch ...
7
8
9
14
15
16
18
19
20
21
22
23
27
28
29
30
36
38
40
41
42
43
45
46
47
48
49
51
53
54
55
57
58
59
62
63
66
67
68
71
72
73
74
75
76
79
80
83
84
87
88
91
93
94
95
96
98
99
100
104
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
128
129
132
133
134
135
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
151
152
153
154
156
157
158
159
160
163
164
166
167
168
169
171
173
175
176
177
178
179
180
185
186
187
189
191
192
194
196
197
200
205
207
209
210
212
214
216
221
222
223
225
227
229
230
232
236
237
238
240
244
247
248
249
250
253
257
258
259
260
261
264
265
266
270
271
276
277
278
279
280
282
283
284
285
286
287
288
289
290
292
293
294
295
301
302
304
305
306
308
309
310
312
313
314
317
321
323
326
327
329
333
334
335
336
337
338
339
340
341
344
345
347
349
350
354
356
357
358
359
362
363
364
365
367
371
372
374
375
377
378
381
382
383
384
385
388
390
391
395
397
402
403
404
405
406
407
408
409
410
414
416
417
419
423
424
429
… Das endlich ist Bein von meinem Bein,und Fleisch von meinem Fleisch …
Genesis 2,23
1
Noch in der Dämmerwelt schwebend, die Schlaf und Wachsein trennt, schob Laurel eine Hand in den Spalt zwischen Bettgitter und Matratzenfedern und suchte nach dem Handy, ihrer Verbindung zum Leben. Das kalte Metall reizte ihren Tastsinn stark genug, dass sie erstarrte. Eine Millisekunde später war sie hellwach und drehte langsam den Kopf auf dem Kissen.
Die Bettseite ihres Ehemannes war leer. Es sah aus, als hätte Warren gar nicht neben ihr gelegen. Laurel widerstand dem Impuls, das Handy aufzuklappen und nachzusehen, ob sie eine SMS bekommen hatte. Stattdessen schob sie es zurück in sein Versteck, ehe sie sich aus dem Bett schwang und zur Schlafzimmertür huschte.
Der Flur lag verlassen da, doch sie hörte Geräusche aus dem Familienzimmer. Nicht den Lärm von Kindern, sondern etwas Anderes, Seltsames … merkwürdig dumpfe Schläge. Laurel eilte über den Flur und spähte durch die Tür. Auf der anderen Seite des offenen Raumes sah sie Warren in seinem Arbeitszimmer vor einer Wand aus Regalen. Ein halbes Dutzend medizinischer Lehrbücher lag zu seinen Füßen und auf dem roten Ledersofa neben ihm. Laurel beobachtete, wie er mit zornigen Bewegungen weitere Bücher aus den Regalen zog, sieben oder acht auf einmal, und sie auf die Couch warf. Sein kurzes rotblondes Haar stand wirr vom Kopf ab. Er schien die gleichen Sachen zu tragen wie gestern bei der Arbeit. Das bedeutete, er war vergangene Nacht tatsächlich nicht im Bett gewesen. An jedem anderen Tag hätte Laurel sich Sorgen darüber gemacht, doch heute schloss sie nur dankbar die Augen und eilte zurück ins Elternschlafzimmer.
Als sie das Bad betrat, schnürte Angst ihr die Kehle zu. Was sie jetzt tun musste, hatte sie seit Tagen vor sich hergeschoben, hatte vergeblich um Erlösung gebetet. Doch jetzt, nachdem sie beschlossen hatte, es hinter sich zu bringen, rebellierte irgendetwas in ihrem Innern. Der Verstand tut, was er kann, um unliebsame Realitäten zu verdrängen, ging es ihr durch den Kopf, oder sie wenigstens zu verschieben.
Laurel kniete sich vor das Waschbecken, griff in das Schränkchen und nahm eine Walgreens-Tüte heraus. Dann ging sie in die kleine Kabine, die die Toilette umschloss, verriegelte die Lattentür hinter sich, öffnete die Tüte und nahm eine Tamponschachtel heraus. In der Schachtel lag eine kleine Packung mit dem Aufdruck e.p.t., die Laurel am Nachmittag zuvor dort versteckt hatte. Mit zitternden Fingern zog sie eine Plastikhülle aus der Packung und riss sie auf. Sie nahm einen Teststab hervor, der dem ähnelte, der ihr nacktes Entsetzen bereitet hatte, als sie neunzehn Jahre alt gewesen war. Doch jetzt, in diesem Moment, war ihre Angst viel größer als damals, als sie ein unverheirateter, entdeckungsfreudiger Teenager war.
Laurel hielt sich den Teststab zwischen die Beine und versuchte zu urinieren, doch der Harn wollte nicht kommen. Mit einem Mal verharrte sie, lauschte. War da ein Geräusch gewesen? War jemand ins Bad gekommen? Eines der Kinder? Als sie kein Atmen und keine Schritte hörte, zwang sie ihren Verstand fort von der Gegenwart und zu dem Elternsprechtag, der für heute angesetzt war. Bei dem Gedanken an die ängstlichen, nervösen und auch zornigen Mütter, mit denen sie zu tun bekommen würde, rann ein warmer Schwall über ihre Hand. Sie zog das Teststäbchen aus dem Strahl, wischte sich die Hand mit Toilettenpapier ab und schloss die Augen, während sie zu Ende urinierte und zählte.
Laurel wünschte sich, sie hätte ihr geheimes Handy mit ins Bad genommen. Es war Wahnsinn, das Ding im Schlafzimmer liegen zu lassen, wo Warren im Haus war. Es war der pure Wahnsinn, das Handy überhaupt im Haus zu haben. Laurels Privathandy war ein zweites Motorola, identisch mit dem, das auf ihren Familienvertrag lief, jedoch mit einer anderen Karte, sodass Warren niemals eine Rechnung zu sehen bekam. Es war ein perfektes System geheimer Kommunikation – solange Warren nicht beide Handys zusammen sah. Trotz dieser Gefahr konnte Laurel die Vorstellung nicht länger ertragen, von ihrem geheimen Handy getrennt zu sein, auch wenn es in den vergangenen fünf Wochen keine einzige SMS mehr empfangen hatte.
Als ihr bewusst wurde, dass sie über dreißig hinaus gezählt hatte, öffnete sie die Augen. Das Teststäbchen besaß ein winziges, grün leuchtendes LCD-Display wie einer von diesen billigen Taschenrechnern. Es waren keine Verrenkungen mehr nötig, um anhand irgendwelcher Farbschattierungen zu erfahren, ob man geschwängert worden war. Vor ihren Augen stand in klar umrissenen blauen Buchstaben auf grauem Hintergrund:
SCHWANGER
Laurel starrte auf die Anzeige und hoffte, flehte, betete stumm, dass vor dem anderen Wort ein NICHT erschien. Es war ein kindischer Wunsch, denn sie hatte die Wahrheit auch ohne den Test längst geahnt: ihre empfindlichen Brüste zum Beispiel, und das Gefühl von Seekrankheit, das sie von ihrem zweiten Kind her kannte. Und doch wartete sie und hoffte, während ihr der Slogan der Herstellerfirma durch den Kopf ging: Gehen Sie auf Nummer sicher mit dem Error Proof Test! Laurel hatte diesen Slogan im Lauf der vergangenen Woche bestimmt zwanzig Mal gehört, wenn er während geistloser Sitcoms und dümmlicher Castingshows in den Werbepausen aus dem Fernseher plärrte und sie voller Seelenqual darauf gewartet hatte, dass ihre Periode einsetzte.
Als die Buchstaben auf dem winzigen Display sich nicht änderten, schüttelte sie das Teststäbchen, wie ihre Mutter es mit Fieberthermometern getan hatte, als Laurel klein gewesen war.
SCHWANGER!, schrien die Buchstaben. SCHWANGER! SCHWANGER! SCHWANGER!
Laurel atmete nicht. Sie hatte nicht mehr ausgeatmet, seit die Buchstaben erschienen waren. Hätte sie nicht auf der Toilette gesessen, wäre sie vielleicht in Ohnmacht gefallen; so aber sank sie nur gegen die Wand, während ihr der kalte Schweiß ausbrach. Als sie zu schluchzen begann, hörte es sich so fremd an, als wäre jemand anders in Tränen ausgebrochen.
»Mom?«, fragte Grant, ihr neun Jahre alter Sohn. »Bist du das?«
Laurel versuchte zu antworten, brachte aber kein Wort hervor. Als sie die zitternden Finger auf den Mund legte, strömten Tränen über ihre Wangen.
»Mom?«, fragte die Stimme hinter der Tür noch einmal. »Alles in Ordnung?«
Durch die Schlitze zwischen den Latten konnte sie Grants Silhouette sehen. Nein, Schatz, gar nichts ist in Ordnung. Ich verliere den Verstand, hier auf dem Klo.
»Dad!«, rief Grant, ohne sich vom Fleck zu rühren. »Ich glaube, Mom ist krank!«
Ich bin nicht krank, Baby. Ich sehe nur, wie die verdammte Welt in Scherben fällt …
»Mir geht es gut«, stieß Laurel hervor. »Alles okay. Hast du dir schon die Zähne geputzt?«
Schweigen. Angestrengtes Lauschen. Dann: »Du klingst so komisch, Mom.«
Laurel spürte, wie sie in den Überlebensmodus schaltete. Der Schock des positiven Schwangerschaftstests hatte eine heftige emotionale Erschütterung bewirkt – und von da an war es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu einer ausgewachsenen Dissoziation. Plötzlich wurde ihre Schwangerschaft zu einer Angelegenheit von akademischem Interesse, ein weiterer kleiner Faktor in der langen Liste von Betrügereien und Täuschungen. Elf Monate des Ehebruchs hatten Laurel in diesen schändlichen Künsten meisterhaft geschult. Die Ironie von alledem war niederschmetternd: Sie hatten ihre Affäre vor fünf Wochen beendet und seither keinen einzigen moralischen Fehltritt mehr begangen.
Und nun war sie schwanger.
Sie schob das Teststäbchen zurück in die Verpackung, legte sie sorgfältig wieder in die Tamponschachtel und stopfte die Schachtel in die Walgreens-Tüte. Nachdem sie die Tüte auf dem Boden hinter der Toilette versteckt hatte, betätigte sie die Wasserspülung und stand auf.
Grant wartete draußen vor der Tür. Er würde aufmerksam auf jedes verräterische Zeichen von Nervosität oder Sorge im Gesicht seiner Mutter achten. Laurel hatte diese wachsamen Augen im Lauf der letzten Monate viele Male gesehen, und jedes Mal hatten Schuldgefühle sie innerlich zerrissen. Grant wusste, dass seine Mutter von einem emotionalen Aufruhr geplagt wurde. Er wusste es besser als sein Vater, denn er war viel aufmerksamer, wenn es um solche Dinge ging.
Laurel wischte sich mit einem Papiertuch sorgfältig die Tränen ab; dann packte sie entschlossen den Türknauf und kämpfte gegen das Zittern ihrer Finger an. Routine, ermahnte sie sich. Routine ist deine Rettung. Spiel deine gewohnte Rolle, und niemand wird etwas merken.
Sie öffnete die Tür und lächelte. Grant stand in einem Tony-Hawk-T-Shirt vor ihr und starrte zu ihr hoch wie ein neunjähriger Verhörspezialist, der er schließlich auch war. Er hatte Laurels Augen im Gesicht seines Vaters, doch die Ähnlichkeit wurde von Tag zu Tag geringer. In den letzten Wochen und Monaten schien Grant sich mit der Geschwindigkeit eines schnell wachsenden Welpen zu verändern.
»Ist Beth schon wach?«, fragte Laurel. »Du weißt, dass wir noch mal über deine Rechtschreibung reden müssen, ehe wir fahren.«
Grant nickte, ohne den Blick von ihr zu nehmen. »Dein Gesicht ist ganz rot«, sagte er. Seine normalerweise melodische Stimme klang flach vor Misstrauen.
»Ich hab nach dem Aufstehen ein paar Sit-ups gemacht.«
Grant schürzte die Lippen, während er über ihre Worte nachdachte. »Crunches oder richtige?«
»Crunches.« Laurel nutzte sein Zögern, um sich an ihm vorbeizuschieben. Sie ging zu ihrem Schrank im Elternschlafzimmer, zog sich einen seidenen Morgenmantel über ihr Baumwollnachthemd und ging zur Küche. »Kannst du bitte nachsehen, ob Beth auf ist?«, rief sie Grant über die Schulter zu. »Ich mach uns schon mal Frühstück.«
»Dad ist so komisch«, sagte Grant mit schriller Stimme.
Laurel blieb abrupt stehen und drehte sich zu der kleinen Gestalt in der Schlafzimmertür um. Plötzlich hatte sie Angst. »Wie meinst du das?« Langsam ging sie zu ihrem Sohn zurück.
»Er schmeißt in seinem Büro mit Papieren um sich!«
Erst jetzt fiel Laurel wieder ein, dass sie Warren dabei beobachtet hatte, wie er Bücher aus den Regalen riss. »Das ist bestimmt wegen dieser Steuersache, von der wir dir erzählt haben. Da geht es um viel Geld, Schätzchen.«
»Was ist ein Audit?«
»Wenn die Regierung nachsieht, ob du alles Geld bezahlt hast, das du bezahlen musst.«
»Warum müsst ihr der Regierung Geld bezahlen?«
Laurel zwang sich zu einem Lächeln. »Damit sie Straßen und Brücken bauen kann … und die Armee bezahlen und so was. Wir haben uns doch schon mal darüber unterhalten, Schatz.«
Grant blickte skeptisch drein. »Dad sagt, sie nehmen euer Geld, damit faule Leute nicht arbeiten müssen. Und damit sie umsonst zum Doktor können. Die arbeitenden Leute bezahlen alles.«
Laurel konnte es nicht ausstehen, wenn Warren in Gegenwart der Kinder seiner professionellen Frustration Luft machte. Er verstand einfach nicht, wie sehr Grant und Beth sich alles zu Herzen nahmen. Oder er verstand es nur zu gut.
»Dad hat gesagt, er sucht irgendwas«, sagte Grant.
»Hat er das gesagt?«
»Ja. Ein Stück Papier. Ich hab ihm gesagt, dass ich ihm helfen will«, fuhr Grant mit verletzter Stimme fort, »aber er hat mich angeschrien.«
Laurel blinzelte verwirrt. Das klang gar nicht nach Warren. Andererseits sah es ihm genauso wenig ähnlich, in den Sachen von gestern die ganze Nacht aufzubleiben. Vielleicht war die Steuerprüfung schlimmer, als er ihr weiszumachen versucht hatte. Doch wie schlimm es auch sein mochte – es war nichts, verglichen mit ihrer Situation. Das war ein Desaster.
Sie kniete vor Grant nieder und küsste ihn auf die Stirn. »Hast du Christy gefüttert?«
»Jepp«, antwortete er mit offensichtlichem Stolz. Christy war der zunehmend übergewichtige Welsh Corgi der Kinder.
»Dann geh jetzt nachsehen, ob deine Schwester wach ist. Ich fange mit dem Frühstück an.«
Grant nickte, und Laurel erhob sich. »Ei mit Hut?«
Er lächelte seine Mutter zögernd an. »Zwei?«
»Na gut, zwei.«
Laurel wollte Warren an diesem Morgen nicht in die Augen sehen. An jedem anderen Tag standen die Chancen dafür bei siebzig Prozent. Die Hälfte der Zeit verließ er das Haus in aller Frühe, um zwischen zehn und siebzig Kilometer auf dem Rennrad zurückzulegen – ein Hobby, das einen großen Teil seiner Freizeit verschlang. Doch es war mehr als ein Hobby. Mit Anfang zwanzig war er als Fahrer der Kategorie Eins eingestuft worden und hatte die Angebote zweier renommierter Rennställe ausgeschlagen, Radprofi zu werden. Stattdessen hatte er sein Medizinstudium durchgezogen. Noch heute nahm er erfolgreich an Rennen der Kategorie Zwei teil, häufig gegen fünfzehn Jahre jüngere Konkurrenten. An Tagen, an denen er nicht trainierte, verließ er manchmal für seine morgendliche Runde im Krankenhaus sehr früh das Haus, während Laurel die Kinder für die Schule fertig machte.
Ihre Gedanken schweiften zu der Walgreens-Tüte im Schränkchen unter der Toilette. Die Chancen standen eins zu einer Million, dass Warren sie entdeckte, geschweige denn hineinschaute. Dennoch … manchmal lief das Wasser der Toilette grundlos und hörte erst wieder auf, wenn man am Griff des Druckspülers wackelte. Warren war zwanghaft in solchen Dingen. Was, wenn er die Ärmel hochkrempelte und sich daranmachte, den Spüler zu reparieren? Vielleicht schob er die Tüte aus dem Weg oder trat in seinem Zorn sogar danach …
Es sind die kleinen Dinge, die dich umbringen, hatte Danny zu Laurel gesagt – oft genug, dass es haften geblieben war. Und er sprach aus Erfahrung – nicht nur, was außereheliche Affären anging, sondern auch als ehemaliger Kampfflieger. Nach kurzem Nachdenken ging Laurel ins Bad, öffnete eines der Fenster, zog die Tüte hinter der Toilette hervor und warf sie hinaus. Sie beugte sich weit genug vor, sodass sie beobachten konnte, wie die Tüte in einem Gebüsch landete. Ehe sie sich auf den Weg zur Schule machte, würde sie die Tüte aufsammeln und sie unterwegs an einer Tankstelle in einen Müllcontainer werfen.
Als sie das Fenster schloss, ließ sie den Blick über den Garten schweifen, eine ausgedehnte, taufeuchte Landschaft aus sattgrünem Rasen und vereinzelten Pekannussbäumen, an denen sich bereits das erste Frühlingsgrün zeigte. Es war kaum damit zu rechnen, dass jemand ihre kleine Entsorgungsaktion beobachtet hatte – ihr Haus stand auf einem Grundstück von vierzigtausend Quadratmetern, und die nächsten Nachbarn auf dieser Seite, die Elfmans, wohnten fast zweihundert Meter entfernt, mit vielen Bäumen und Sträuchern dazwischen. Hin und wieder sah Laurel Mr. Elfman beim Rasenmähen an der Grundstücksgrenze, doch dazu war es heute noch zu früh.
Bevor die volle psychische Last der Schwangerschaft wieder in ihre Gedanken brechen konnte, zog Laurel eine schwarze, wadenfreie Hose und eine weiße Seidenbluse an und schminkte sich in Rekordzeit. Sie trug den Eyeliner auf, wobei ihr bewusst wurde, dass sie dem eigenen Blick genauso auswich wie dem ihres Mannes. Als sie zu einer letzten abschätzenden Musterung vom Spiegel zurücktrat, schlug eine Woge von Schuldgefühlen über ihr zusammen. Sie hatte zu vertuschen versucht, dass sie geweint hatte, und dabei zu viel Make-up aufgetragen. Das Gesicht, das ihr nun aus dem Spiegel entgegensah, gehörte dem Flittchen, als das viele Frauen sie betrachteten. Wegen ihres Aussehens schätzten sie Laurels Arbeit als Lehrerin gering, den Eifer, mit dem sie an schwierige Fälle heranging … einfach alles. An den meisten Tagen gab Laurel einen Dreck auf das, was andere Leute über sie dachten, besonders diese Weiber, die sich ständig die Mäuler über sie zerrissen. Heute jedoch hatte der Schwangerschaftstest beinahe jede an den Haaren herbeigezogene Lüge bestätigt, die diese Hexen über sie erzählten. Beinahe.
»Wie bin ich in diese Lage gekommen, verdammt?«, flüsterte Laurel ihrem Spiegelbild zu.
Die Rüge in den großen grünen Augen, die sie aus dem Spiegel anstarrten, sagte ihr alles.
Lass dir nichts anmerken, beschwor sie sich, ehe sie sich umwandte und den Flur hinuntereilte, um sich ihrer Familie und dem neuen Tag zu stellen.
Die Kinder waren fast mit dem Frühstück fertig, als Warren den Kopf aus seinem Arbeitszimmer steckte. Laurel hatte eben die Kasserolle abgewaschen und sich wieder der granitenen Theke zugewandt, wo die Kinder den letzten Rest von ihren Toasts aßen, als sie bemerkte, wie Warren sie aus tief eingesunkenen Augen von der Tür aus beobachtete. Er hatte sich nicht rasiert, und der Bartschatten auf Kinn und Wangen verlieh ihm eine ungewöhnlich intensive Ausstrahlung. Seine Augen blickten seltsam leer, doch auf seinem Gesicht spiegelte sich Zorn, den Laurel jedoch auf die bevorstehende Betriebsprüfung und Warrens Wut auf die Finanzbehörden zurückführte. Sie hob die Augenbrauen; es war eine stumme Frage, ob sie auf ein paar ungestörte Worte zu ihm ins Büro kommen sollte. Doch Warren schüttelte den Kopf.
»Wenn die Erde immer wärmer wird«, fragte Beth, die Sechsjährige, »wird das Meer dann eines Tages kochen, so wie die Eier im Topf?«
»Aber nein, Punkin«, versicherte Laurel ihrer Tochter. »Nur wird dann sehr viel Eis am Nord- und am Südpol schmelzen. Und weil dann auf der ganzen Welt das Wasser steigt, müssen die Menschen, die am Meer leben, ihre Häuser weiter weg vom Wasser bauen.«
»Genau genommen werden die Ozeane tatsächlich eines Tages kochen«, sagte Warren von der Tür her. Seine tiefe Stimme klang mühelos durch den großen Raum.
Beth legte die Stirn in Falten und drehte sich auf ihrem hohen Hocker zu ihrem Dad um.
»Die Sonne wird eines Tages zu einem gewaltigen Feuerball wachsen«, fuhr Warren fort. »Die Meere werden verdampfen wie Wasser auf einer heißen Herdplatte.«
»Ehrlich?«, fragte Beth, die Stimme erfüllt von Angst.
»Ja. Und dann …«
»Daddy redet von einer Zeit, die Millionen Jahre in der Zukunft liegt, Punkin«, warf Laurel ein, während sie sich fragte, was zur Hölle in Warren gefahren war, dass er Beth solche Dinge erzählte. Das Mädchen würde sich jetzt tagelang Sorgen machen. »Du braucht überhaupt keine Angst zu haben. Deine Ururururenkel sind schon tausend mal tausend Jahre tot, wenn das passiert. Also mach dir keine Gedanken.«
»Supernova!«, rief Grant. »So nennt man es doch, wenn ein Stern explodiert, stimmt’s?«
»Stimmt«, sagte Warren mit unübersehbarer Zufriedenheit.
»Cool!«, krähte Grant.
»Von solchen Dingen verstehen nur Jungs etwas«, sagte Laurel zu Beth. »Sogar das Ende der Welt hört sich in ihren Ohren cool an.«
Trotz ihres Dilemmas war Laurel versucht, Warren einen tadelnden Blick zuzuwerfen – was sie an einem gewöhnlichen Tag zweifellos getan hätte –, doch als sie aufsah, war er bereits wieder in seinem Büro verschwunden. Weitere dumpfe Geräusche verrieten, dass er noch immer nicht gefunden hatte, wonach er suchte. Normalerweise wäre sie zu ihm gegangen und hätte ihn gefragt, wonach er suchte, um ihm anschließend zu helfen – nicht jedoch heute.
Grant glitt von seinem Hocker und öffnete seinen Rucksack. Laurel bemerkte zufrieden, dass er ohne Aufforderung mit seinen Hausaufgaben begann. Beth ging zu einem Stuhl am Küchentisch und zog ihre Schuhe an. Sie mussten stets genau gleich fest gebunden sein, ein Ritual, das gelegentlich zu Anfällen von obsessiver Panik führte, doch an den meisten Tagen lief alles glatt.
Manchmal fühlte Laurel sich schuldig, wenn andere Mütter sich beschwerten, welch ein Alptraum es sei, die Kinder morgens für die Schule fertig zu machen. Ihre eigenen Kinder machten sich mehr oder weniger selbstständig fertig; ihre Routine war so verfestigt, dass Laurel sich manchmal fragte, ob sie und Warren insgeheim unterdrückte faschistische Neigungen hatten. Die Wahrheit lautete, dass der Umgang mit zwei normalen Sprösslingen für jemanden, der seine Tage damit verbrachte, geistig behinderte Kinder zu unterrichten, kaum der Rede wert war.
Soll ich ins Arbeitszimmer gehen?, überlegte Laurel erneut. Würde eine gute Ehefrau nicht genau das tun? Ihrer Besorgnis Ausdruck verleihen? Ihre Hilfe anbieten?
Doch Warren wollte nie Hilfe bei derartigen Dingen. Seine ärztliche Praxis war seine Angelegenheit und ging niemanden etwas an. Er war offensichtlich in die bevorstehende Steuerprüfung vertieft. Dennoch … dieser ungewöhnliche Blick eben hatte Laurel beunruhigt.
»Wir kommen zu spät, Mom«, riss Grant sie aus ihren Gedanken.
»Du hast recht«, pflichtete Laurel ihm bei, ohne einen Blick auf die Uhr zu werfen. »Also los.«
Sie half Beth, ihren Rucksack anzulegen; dann nahm sie ihren Notebook-Koffer und ihre Handtasche und ging zur Garagentür. Die Hand auf dem Knauf, warf sie einen Blick über die Schulter, halb in der Erwartung, dass Warren ihr hinterherstarrte, doch außer seinen Beinen war nichts von ihm zu sehen. Er war eine kleine Bibliotheksleiter hinaufgeklettert, um die oberen Reihen seiner maßgefertigten Regale zu durchsuchen, die bis unter die drei Meter hohe Decke reichten. Sie atmete erleichtert auf und führte die Kinder zu ihrem Acura.
Nachdem beide sich angeschnallt hatten, schlug Laurel sich verspielt an die Stirn. »Ich glaube, ich habe gestern Abend vergessen, den Rasensprenger auszudrehen.«
»Ich geh nachsehen!«, rief Grant und schnallte sich wieder los.
»Nein, ich gehe selbst«, sagte Laurel entschieden und stieg rasch aus dem Wagen.
Sie drückte auf den Knopf an der Wand und duckte sich unter dem sich lautlos öffnenden Garagentor hindurch, sobald es einen Meter über dem Boden war; dann lief sie um das Haus herum nach hinten. Sie würde die Walgreens-Tüte aus dem Strauch holen, in den Kofferraum werfen und im Lauf des Tages irgendwo entsorgen, entweder an einer Tankstelle oder bei einem Laden (genau wie sie es während der letzten elf Monate mit einer Karte zum Valentinstag, mit Rosen und mit ein paar Briefen gemacht hatte). Sie bahnte sich einen Weg zwischen den Büschen hindurch, als eine Frauenstimme rief: »Laurel? Hier drüben!«
Laurel erstarrte und drehte sich nach der Stimme um. Keine fünfundzwanzig Meter entfernt, fast unsichtbar hinter ein paar Buchsbäumen, kniete eine Frau mit einem Strohhut und leuchtend gelben Gummihandschuhen. Bonnie Elfman war um die siebzig, bewegte sich jedoch wie eine viel jüngere Frau. Aus irgendeinem Grund hatte sie diesen Morgen auserkoren, um den westlichen Rand ihres riesigen Grundstücks zu verschönern.
»Ich setze ein paar Kapuziner in dieses Beet, Laurel!«, rief Bonnie ihr zu. »Was machen Sie?«
Ich suche einen positiven Schwangerschaftstest, bevor mein Mann ihn findet. »Ich dachte, ich hätte den Rasensprenger angelassen«, rief Laurel zurück.
»Na, das würde Ihre Wasserrechnung ganz schön in die Höhe treiben«, sagte Bonnie, erhob sich und kam zu Laurel.
Laurel spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Und als wären ihre Sorgen nicht schon groß genug, kam nun auch Christy auf der verzweifelten Suche nach einem Spielpartner um die Hausecke geflitzt. Wenn Laurel jetzt die Tüte aus dem Strauch zog, würde der Welsh Corgi sie ihr womöglich aus der Hand reißen. Übertrieben besorgt blickte Laurel an ihrer eigenen Hecke entlang; dann winkte sie Mrs. Elfman zu. »Ich glaube, ich habe den Rasensprenger doch abgedreht. Ich muss mich beeilen, Bonnie. Die Kinder sitzen im Wagen und warten.«
»Ich schaue nach Ihrem Rasensprenger und drehe ihn notfalls ab«, versprach Bonnie.
Laurel schlug das Herz bis zum Hals. »Machen Sie sich keine Mühe, Bonnie. Ich dachte, ich hätte ihn hier draußen stehen lassen, aber eben ist mir eingefallen, dass ich ihn ins Gartenhaus zurückgebracht habe. Passen Sie lieber auf, dass Sie sich nicht überhitzen. Es ist schon sehr warm für April.«
»Keine Sorge, bald gibt’s Regen«, entgegnete Bonnie mit der Zuversicht eines alten Orakels. »Und es wird sich merklich abkühlen. Bis Sie von der Schule zurück sind, brauchen Sie eine Jacke.«
Laurel blickte hinauf zum strahlend blauen, wolkenlosen Himmel. »Wenn Sie meinen. Bis später dann.«
Bonnie schien wenig erfreut über Laurels hastigen Rückzug. Das alte Klatschmaul hätte lieber ein ausgiebiges Schwätzchen mit ihr gehalten. Laurel wusste aus alter Erfahrung, dass Bonnie Elfman genauso schnell Geschichten über sie weitererzählte, wie sie ihr Geschichten über andere anvertraute.
»Scheiße, Scheiße, Scheiße«, fluchte Laurel unterdrückt auf dem Rückweg zur Garage. Die Tüte musste bis nach der Schule warten. Christy trottete hinter ihr her – der Hund war also kein Problem. Doch Mrs. Elfman würde nicht so bald verschwinden. Laurel betete insgeheim, dass dieses neugierige alte Klatschmaul auf seinem Grundstück blieb, bis die Schule zu Ende war.
2
Laurel steuerte ihren Acura bis vor den Eingang der Schule, beugte sich zur Seite und küsste Beth auf die Wange. Mrs. Lacey hatte an diesem Morgen Türdienst und half Beth beim Aussteigen, während Grant vom Rücksitz sprang wie ein aus dem Zookäfig flüchtender Affe, um ins Schulgebäude zu flitzen und seine Freunde zu suchen.
Nachdem Mrs. Lacey Beth durch die Tür begleitet hatte, fuhr Laurel um das Schulgebäude herum und parkte auf ihrem reservierten Platz neben der Sonderschule. Es war ein kleines Backsteingebäude mit zwei Klassenzimmern, Gemeinschaftstoilette und einem Büro, doch es war besser als gar nichts – und die Athens Country Day hatte in den letzten fünfzig Jahren keinen Finger gerührt und keinen Cent lockergemacht. Erst die großzügige Schenkung eines einheimischen Geologen hatte den Bau der Schule ermöglicht. Der Mann hatte eine geistig behinderte Nichte in New Orleans und wusste um die Notwendigkeit solcher Einrichtungen.
Laurel blickte auf ihr Notebook und ihre Handtasche, die während der Fahrt zu Beth’ Füßen gelegen hatten, griff aber nicht danach. Der Motor des Wagens lief noch, und sie machte keine Anstalten, ihn abzustellen. Sie war nicht sicher, ob sie heute die Kraft aufbringen würde, den Tag durchzustehen. Ihre Schüler konnten schon anstrengend genug sein, doch heute war Elternsprechtag, und ihren ersten Termin hatte sie ausgerechnet mit der Frau ihres ehemaligen Liebhabers.
Die Aussicht, Starlette McDavitt gegenüberzutreten – die Ehefrau des Mannes, der sie vermutlich geschwängert hatte –, erschien Laurel fast unerträglich. Wäre Starlette nicht der erste Termin gewesen, hätte sie ihn abgesagt. Aber dafür war es zu spät.
Sie merkte erst, dass sie weinte, als sie die Tränen auf der Zunge schmeckte. Es lag nicht am bevorstehenden Treffen, wurde ihr bewusst. Es lag vielmehr daran, dass sie nicht mit Sicherheit wusste, wer der Vater des Kindes war. Die Chancen standen gut, dass es Danny war. Sie hatten ihre Affäre vor fünf Wochen beendet, doch in den drei Wochen davor – den drei Wochen nach Laurels letzter Periode – hatten sie sich wenigstens ein Dutzend Mal geliebt. Mit Warren hatte sie seit ihrer letzten Periode nur zweimal Geschlechtsverkehr gehabt – beide Male, nachdem sie und Danny ihre Affäre beendet hatten.
Außerdem nahm sie die Pille, verdammt! Ein zu achtundneunzig Prozent sicheres Verhütungsmittel. Wie konnte sie zu den unglücklichen zwei Prozent gehören, die es trotzdem erwischte? Sicher, sie hatte schon einige Male Pech gehabt im Leben, aber noch nie so großes Pech. Es musste an dem verdammten Rotavirus liegen. Irgendwie hatte Laurel sich im vergangenen Monat mit diesem Erreger infiziert, wegen dem bereits mehrere große Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne gestellt worden waren. CNN hatte berichtet, dass der Virus geradezu über das Land hinwegfege – kein besonders gelungener sprachlicher Vergleich, aber letztlich war es tatsächlich so: Von Küste zu Küste litten die Menschen an Brechdurchfall. Dabei verschwanden in drei bis fünf Tagen sämtliche durch die Antibabypille zugeführten Progestagene aus dem Körper der Erkrankten. Und da Laurel letzten Monat fast jeden zweiten Tag Sex gehabt hatte, war eine Empfängnis beinahe unausweichlich gewesen.
Laurel legte den Kopf aufs Lenkrad und ließ den Tränen freien Lauf. Sie hatte sich stets für eine starke Frau gehalten, doch nun hatten sich Schicksal und Zufall gegen sie verbündet – und als Dritte im Bunde kam die Dummheit hinzu. Es sah ganz danach aus, als müsse sie in einigen Monaten ein illegitimes Kind im Haushalt ihres Mannes großziehen.
Es war ein Gedanke, den sie nicht ertragen konnte.
In ihrem verzweifelten Bemühen, nicht an das bevorstehende Treffen mit Starlette zu denken, ging Laurel sämtliche Möglichkeiten durch. Wenn man für den Rest seines Lebens in einer Ehe ohne Liebe gefangen war, war ein Kind der Liebe der vielleicht einzige Anker zur Wirklichkeit. Zumindest zu dem Leben, das hätte sein können. Konnte sie den Rest ihres Lebens mit einer solchen Lüge verbringen? Im vergangenen Jahr war es ihr schon schwer genug gefallen, selbst bei kleinen Dingen zu lügen und die tausend winzigen Täuschungen hervorzubringen, die eine außereheliche Affäre erforderte. Und jede Lüge erzeugte die Notwendigkeit Dutzender weiterer – »Lügen und Nebenlügen« pflegte Danny sie zu nennen –, die wie die Köpfe einer sich endlos vermehrenden Hydra wuchsen. Trotzdem hatte Laurel alles versucht, den Schein der Normalität aufrechtzuerhalten, und sie war richtig gut darin geworden – so gut, dass die Lügen ganz von selbst kamen. Zwar spürte sie, wie die Unehrlichkeit ihre Seele zerfraß, und doch log sie weiter und weiter.
Aber was noch viel schlimmer war: Sie würde auch ihr ungeborenes Kind zur Lüge zwingen, vom ersten Tag seines Lebens an. Seine ganze Existenz wäre eine einzige Lüge. Und was wäre mit Warren? Er würde versuchen, das Baby zu lieben, aber würde er wirklich Liebe empfinden? Oder würde er etwas Fremdes in dem kleinen Eindringling spüren? Einen störenden Geruch? Eine genetische Dissonanz? Ein Erschauern bei der Berührung von Haut oder Haar? Zumal das Baby Warren nicht ähnlich sehen würde, es sei denn, durch puren Zufall.
Laurel kannte eine Frau namens Kelly Rowland, eine ehemalige Kommilitonin, die nach einem One-Night-Stand schwanger geworden war, obwohl sie sich erst kurz zuvor mit dem Jungen verlobt hatte, mit dem sie sich seit drei Jahren traf. Kellys Verlobter war ein guter, verlässlicher, wenngleich ein wenig nichtssagender Typ von durchschnittlicher Attraktivität und mit exzellenten finanziellen Aussichten gewesen. Kelly hatte mit beinahe religiösem Eifer darauf bestanden, dass er beim Sex stets Kondome benutzte; deshalb war es Laurel sehr merkwürdig erschienen, dass Kelly sich von einem breitschultrigen, dunkelhaarigen Footballspieler nach einer Kerzenlichtzeremonie für eine Kommilitonin nach allen Regeln der Kunst hatte durchvögeln lassen – ohne Kondom. Als Kelly erfuhr, dass sie schwanger war, hatte sie einfach ihren Hochzeitstermin vorverlegt, ihre eigene Kerzenlichtzeremonie veranstaltet und nie wieder zurückgeblickt. Das war nun dreizehn Jahre her, und Kelly war noch immer verheiratet und lebte mit ihrem Mann in Houston.
Was war die Alternative? Abtreibung? Laurel schüttelte den Kopf. Wie konnte sie das Kind des Mannes abtreiben, den sie über alles liebte? Und selbst wenn sie sich dazu überwinden konnte – wie sollte sie ihrem Mann klarmachen, dass sie eine Abtreibung wollte? Du kriegst die Abtreibung auch, ohne ihm zu verraten, dass du schwanger bist, sagte eine kalte Stimme. Mit Grauen dachte Laurel an den Spießrutenlauf zwischen protestierenden Abtreibungsgegnern hindurch, um anschließend allein im kalten Wartezimmer einer tristen Abtreibungsklinik zu sitzen. Sie musste wenigstens drei Bundesstaaten weit weg, um jede Möglichkeit auszuschließen, dass jemand sie erkannte. Doch selbst dann würde der Arzt möglicherweise …
Eine Faust klopfte neben Laurels Kopf an die Seitenscheibe.
Sie zuckte heftig zusammen, hob erschreckt den Blick und sah, wie Diane Rivers, die Klassenlehrerin der dritten Klasse, in offensichtlicher Besorgnis mit den Lippen Laurels Namen formte. Diane war eine Südstaaten-Schönheit mit üppigem Haar und einem Herzen aus Gold – wie eine Rückbesinnung auf die Generation von Laurels Mutter, obwohl Diane erst dreiundvierzig war. Sie machte eine kurbelnde Handbewegung: Laurel sollte die Seitenscheibe herunterlassen.
Laurel wischte sich mit der Schulter ihrer Bluse die Tränen ab und schmierte dabei Make-up auf die weiße Seide, ehe sie den Fensterheber betätigte. Das Glas versank mit leisem Surren in der Wagentür.
»Was ist los?«, fragte Diane. »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Sehe ich vielleicht so aus?, dachte Laurel mit einem Anflug von Zorn, der jedoch rasch verebbte: Hätte sie nicht die gleiche Frage gestellt, wenn sie jemanden weinend hinter dem Steuer eines Autos auf dem Parkplatz vorgefunden hätte?
»Ich fürchte, ich bekomme eine Migräne«, sagte Laurel.
»Sie Ärmste«, sagte Diane mitfühlend. »Dabei sind Sie so lange davon verschont geblieben.«
»Mehr als ein Jahr.« Länger, als ich mit Danny zusammen war.
»Glauben Sie denn, Sie schaffen die Elternsprechstunde? Wenn normaler Unterricht wäre, würde ich ja gerne die Vertretung übernehmen, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich den Eltern Ihrer Schüler sagen soll.«
»Es wird schon gehen«, erklärte Laurel, wobei sie sich zur Beifahrerseite beugte, um ihr Notebook und ihre Handtasche vom Wagenboden aufzuheben. »Manchmal kriege ich nur die Aura, und die Kopfschmerzen kommen gar nicht. Mein Arzt nennt es eine stille Migräne.«
Diane schüttelte den Kopf. »Also, ich weiß nicht. Sie haben nicht eine von den Spritzen dabei? Von diesem Schmerzmittel?«
»Imigran? Nein, es ist so lange her, dass ich meinen letzten Anfall hatte, dass ich die Spritzen nicht mehr ständig dabeihabe.«
Diane bedachte sie mit einem mütterlichtadelnden Blick.
»Ich weiß«, sagte Laurel und stieg mühsam aus dem Wagen. »Das war dumm von mir.«
»Sie sollten zu Warren in die Praxis gehen«, schlug Diane vor. »Lassen Sie sich diese Spritze geben. Wenn man schon mit einem Arzt verheiratet ist, sollte man hin und wieder den Nutzen daraus ziehen. Und Warren ist ein guter Arzt. Ich muss es wissen, schließlich ist er mein Hausarzt. Ich könnte die Stellung für Sie halten, bis Sie zurück sind. Meine Schüler wissen, dass ich ihnen das Fell über die Ohren ziehe, wenn sie sich danebenbenehmen.«
Beinahe hätte Laurel gelacht. Diane hatte einen Blick, der ungezogene Jungen auf hundert Schritte Entfernung paralysieren konnte. Laurel schloss den Acura ab und ging zum Schulgebäude. »Ich schaffe das schon, Diane. Notfalls kann ich ja immer noch zu meinem Mann.«
»Sie haben vor Schmerzen geschluchzt, Mädchen.«
»Nein, ich … ich war nur ein bisschen verzweifelt. Ich dachte, ich hätte das endlich hinter mir. Darum habe ich geweint. Die Realität kann manchmal wehtun.«
»Oh ja. Die Realität ist ein Miststück, nicht wahr?«, sagte Diane. Dann kicherte sie wie eine Frau in den 1950er Jahren, der versehentlich das Wort »Scheiße« über die Lippen gerutscht war.
An der Tür zum Klassengebäude drückte sie zum Abschied Laurels Handgelenk. Die Berührung hatte etwas Tröstendes, und Laurel verspürte das irrationale Verlangen, der älteren Frau ihr Herz auszuschütten. Doch sie sagte kein Wort. Diane konnte ihr in ihrer Zwangslage auch nicht helfen, selbst wenn sie zugehört hätte. Und sie würde bestimmt kein Mitgefühl haben für die verrückte Schlampe, die ihren Mann betrog und dumm genug war, sich dabei auch noch schwängern zu lassen. Noch einmal nickte Laurel der älteren Kollegin zu, um zu bekräftigen, dass ihr nichts fehlte; dann ging sie den kurzen Flur hinunter zu ihrer nicht zu überhörenden Förderklasse mit den im Überschwang ihrer morgendlichen Energie tobenden Kindern.
Nachdem eine Helferin mit den Kindern zum Spielplatz gegangen war, setzte Laurel sich an den runden Tisch, an dem sie ihre Elternsprechstunde zu halten pflegte. Hätte sie hinter einem Pult gesessen, hätte es manchen Eltern das Gefühl gegeben, belehrt zu werden; der runde Tisch jedoch ließ den Eindruck von Gleichrangigkeit und Partnerschaft entstehen. Laurel hatte elf lernbehinderte Kinder in ihrem Programm – beinahe zu viele angesichts der Tatsache, dass sie nur begrenzte Hilfe durch eine Assistentin hatte. Doch Athens Point war eine Kleinstadt, und die Eltern hatten nur wenige Möglichkeiten. Laurels Schüler zeigten ein breites Spektrum an Verhaltensauffälligkeiten, angefangen bei ADHS über krankhafte Aufsässigkeit bis hin zu mentaler Retardiertheit und Autismus. Mit einer so breit gefächerten Palette fertig zu werden war harte Arbeit, doch Laurel genoss die Herausforderung.
Um sicherzugehen, dass die Elternsprechstunden informativ und für beide Seiten so hilfreich waren wie nur möglich, machte Laurel während des Schuljahrs sorgfältig Notizen über jeden ihrer Schüler, doch keine Akte war detaillierter als die von Starlette McDavitts Sohn Michael.
Selbst wenn Laurel die Augen schloss, sah sie die einstige Schönheitskönigin aus Tennessee in ihrer neuesten Garderobe aus dem Versandhauskatalog ins Klassenzimmer rauschen, das wasserstoffblonde Haar perfekt frisiert, die Nägel makellos lackiert, der Bauch pathologisch dünn, die schicken Cowboystiefel (die inzwischen sicherlich passé sein mussten) auf Hochglanz poliert.
Laurels Abneigung gegen Starlette McDavitt hatte nicht erst während der Affäre mit Starlettes Mann begonnen, sondern schon bei ihrer ersten Begegnung, als deutlich wurde, dass Mrs. McDavitt ihren autistischen Sohn als Bürde betrachtete, die ein ungerechter Gott ihr aufgeladen hatte. Starlette hatte sich eine halbe Stunde lang darüber ausgelassen, dass manche Eltern behaupteten, Autismus würde durch Quecksilber in gesetzlich vorgeschriebenen Impfstoffen hervorgerufen. In ihrem tiefsten Innern jedoch war Starlette davon überzeugt, dass es eine göttliche Strafe war. Etwas so durch und durch Destruktives musste der Wille Gottes sein; sie glaubte fest daran. Und es war nicht notwendigerweise eine Strafe für etwas, das man selbst getan hatte. Es konnte eine Strafe sein für eine Sünde, die einer ihrer Ahnen begangen hatte – Vergewaltigung oder Inzest oder irgendetwas Düsteres, von dem man nichts ahnte. In weniger als einer Stunde war Laurel klar geworden, dass Michael McDavitts primäre Bezugsperson sein Vater Daniel war, fünfzehn Jahre älter als seine Frau.
Danny McDavitt war ein freundlicher Mann Ende vierzig. Er sah jünger aus, doch in seinen Augen lag eine stille Weisheit, die von beträchtlicher Erfahrung zeugte. Es dauerte nicht lange, bis Laurel herausfand, dass Danny ein Kriegsheld war, ein Einheimischer aus Athens Point, der seinen Geburtsort mit achtzehn verlassen hatte und wie der sprichwörtliche verlorene Sohn dreißig Jahre später heimgekehrt war. Während der ersten Wochen von Michaels Begutachtung hatte Laurel nicht mehr über ihn erfahren, als dass er im Golfkrieg als Helikopterpilot gedient hatte und inzwischen wegen mehrerer Verwundungen im Ruhestand war. Nun war er für eine lokale Fluggesellschaft tätig. Offenbar waren entweder das Fliegen oder die Kampferfahrung ein gutes Training für den Umgang mit lernbehinderten Kindern, denn in ihren neun Jahren Unterricht hatte Laurel noch nie einen Vater gesehen, der härter an seiner Beziehung zu seinem entwicklungsverzögerten Sohn gearbeitet hatte als Danny McDavitt.
Das Problem war seine Frau.
Das einzige Rätsel an Starlette McDavitt war, wieso Danny sie überhaupt geheiratet hatte. Dieser eine Schritt verriet eine krasse Fehleinschätzung, was völlig untypisch für Danny zu sein schien. Selbstverständlich war Laurel aufgefallen, dass selbst die intelligentesten Männer sich zum Narren machen konnten, wenn es um die Wahl ihrer Frauen ging. Sie waren wie kleine Jungen in der Eisdiele. Ich möchte etwas DAVON. Hmmm, lecker! Ich will noch mehr. Und schon bald kauften sie den ganzen Eimer, damit sie immer genug hatten. Doch hatten sie erst jeden Tag unbeschränkten Zugang zu ihrer Eiskrem, waren sie den Geschmack schnell leid. Die Eiskrem sah nicht einmal mehr so lecker aus wie hinter der kalten, funkelnden Glasscheibe.
Starlette sah appetitlich aus, zugegeben, und ihr Aussehen passte zu ihrem Namen. Sie war eine einstige Miss Knoxville oder so etwas, nicht ganz eine Miss Tennessee, aber doch viele Stufen höher als eine Sojabohnen-Königin. Doch bei aller Attraktivität verrieten ihre harten, bitteren Augen, dass sie im Leben bereits eine wichtige Lektion gelernt hatte: Siege bei Schönheitswettbewerben halfen einem Mädchen nur ein kurzes Stück auf der Straße des Lebens. Die eigentliche Ironie lag darin, dass in Starlettes Augen Laurel diejenige war, die in der Hochzeitslotterie das große Los gezogen hatte. Schließlich hatte sie einen Arzt geheiratet – sei dankbar für das, was dir geschenkt wurde, Honey, halt die Klappe und mach die Beine breit, wenn du weißt, was gut ist für dich.
Danny und Starlette hatten vor sieben Jahren geheiratet – ein Jahr, bevor Danny sich vom Dienst bei der Air Force in den Ruhestand verabschieden wollte. Es war für beide die erste Ehe. Danny hatte lange gewartet, um diesen Fehler zu begehen, doch das Warten hatte ihn nicht klüger gemacht, wie er Laurel verraten hatte. Nach neunzehn Jahren beim Militär war er nach Nashville geflogen, um ein Haus zu kaufen in der Erwartung, seinen Ruhestand als Songwriter zu verbringen, wovon er immer geträumt hatte. Schon bei der Air Force hatte er sich in Zeiten des Leerlaufs die Langeweile mit dem Schreiben von Songs vertrieben. Um seine Ersparnisse zu schonen, hatte er nach seinem Rückzug aus dem Militärdienst einen Job bei einem örtlichen Flugunternehmen angenommen, dessen Besitzer ein großer Bewunderer von Dannys Heldentaten war. Einer der Höhepunkte in Dannys Job bestand darin, Stars der Country Music kreuz und quer durch den Staat zu fliegen. Er hatte Starlette kennen gelernt, als sie für eine Maklerfirma gearbeitet und ihm ein paar Häuser in Franklin gezeigt hatte. Es waren nicht Dannys Songwriter-Ambitionen gewesen, die Starlette beeindruckt hatten – tatsächlich hatte sie bezweifelt, dass er sich in dieser Gegend überhaupt ein Haus leisten konnte. Doch sein Job als Pilot berühmter Countrystars besaß den Glamour, den zu finden Starlette in diese Stadt gekommen war. Danny hatte noch ein Jahr auf der Eglin Air Force Base in Florida zu absolvieren, um seine zwanzig Dienstjahre vollzumachen, doch schon bald pendelte er an jedem freien Wochenende nach Nashville, um seine Songs zu vermarkten und die Zeit mit Starlette zu verbringen. Als sie schwanger wurde, beschlossen sie zu heiraten, und sechs Monate später wurde ihre Tochter Jenny geboren, ein süßes, gesundes Mädchen.
Danny stand zwei Wochen vor dem Ruhestand, als das World Trade Center angegriffen wurde. Danach hatte er sich geweigert, in Rente zu gehen, trotz heftiger Proteste Starlettes. Doch sie musste nicht lange auf seine Heimkehr warten: Danny meldete sich für den Einsatz in Afghanistan, wurde aber schon drei Monate später abgeschossen. Es war reines Glück, dass er überlebte. Er nahm sich diesen Wink des Schicksals zu Herzen und kehrte mit seinen Entlassungspapieren nach Nashville zurück. Bald darauf verbrachte er seine Zeit damit, Stars der Country Music durch die Gegend zu fliegen, Songs zu verkaufen, mit seiner neuen Frau zu schlafen und seine Tochter großzuziehen. Das einzige Problem im Paradies bestand darin, dass er es bald leid wurde, fliegender Chauffeur zu sein. Die Jetset-Hillbillies gingen ihm immer mehr auf die Nerven. Einige waren nett; die meisten waren Arschlöcher. Waren Fans in der Nähe, gaben sie sich fröhlich und warmherzig, doch sobald sie in den Helikopter stiegen, schimpften sie lauthals auf die lästige Meute.
Nachdem Danny sechs Monate lang keinen Song verkauft hatte, war er so weit, alles hinzuwerfen. Er war nicht mehr in Mississippi gewesen außer zu Beerdigungen und einem Ehemaligentreffen der Highschool, doch seit er fünfundvierzig geworden war, verspürte er das unerklärliche Verlangen, in den Süden zurückzukehren. Als das nächste Mal einer der singenden Cowboymillionäre ein falsches Wort von sich gab, fuhr Danny ihm übers Maul – und das war’s dann. Es kostete ihn viel Überzeugungskraft, doch schließlich gelang es ihm, Starlette so weit zu bringen, dass sie seiner Heimatstadt eine Chance gab, unter der Bedingung, dass sie nach Tennessee zurückkehrten, falls es nicht klappte.
Laurel legte Michael McDavitts Akte zur Seite und zwang sich, nicht länger an Michaels Vater zu denken. Sie zog ihre Akte über Carl Mayer hervor, ihren schwierigsten Fall von ADHS, und versuchte sich auf die Worte und Zahlen auf den Seiten zu konzentrieren. Durchschnitt, Standard, Syndrom … ganz gleich, wie sehr sie sich bemühte, die Worte und Daten wollten sich nicht zu etwas Zusammenhängendem verbinden.
Warum sollten sie auch? In weniger als fünf Minuten würde sie einer Frau von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen, die sie fast ein ganzes Jahr lang betrogen hatte. Eine Frau, die sie nie gemocht hatte, vielleicht aus Sorge, als schlechte Mutter verurteilt zu werden. Es gab keine Möglichkeit, solche Einschätzungen zu vermeiden, doch Laurel bemühte sich stets, sich nichts davon anmerken zu lassen. Das Problem war, sie respektierte Starlette McDavitt nicht. Die meisten Mütter, mit denen Laurel arbeitete, waren Heilige, wenn es um ihre Kinder ging, Starlette jedoch befand sich am anderen Ende des Spektrums. Laurel glaubte nicht, dass sie eine Frau betrogen hätte, die sie respektierte, obwohl das vielleicht nur Wunschdenken war und ohnehin nichts brachte. Wie Danny oft genug gesagt hatte: Man wusste nie, wie man reagierte, bevor man nicht vom Leben selbst auf die Probe gestellt wurde.
Das leise Klopfen an der Tür hätte Laurel ein paar Sekunden Vorwarnung geben müssen, doch sie war so tief in Gedanken, dass sie völlig vergaß, welch großen Auftritt Starlette McDavitt stets hinlegte. Deshalb war Laurel völlig unvorbereitet, als plötzlich Danny das Klassenzimmer betrat. Und er sah aus wie ein Mann, der in einer Welt zwischen Leben und Tod schwebte.
3
»Es tut mir leid«, sagte Danny, als er hinter sich die Tür schloss. »Starlette wollte nicht kommen.«
»Warum nicht?« Laurel flüsterte beinahe.
Danny zuckte die Schultern und schüttelte den Kopf. Du weißt doch, wie sie ist, sagten seine Augen.
»Sie hat sich eine Ausrede einfallen lassen, nicht selbst zu erscheinen«, vermutete Laurel.
Danny nickte. »Ich musste eine Flugstunde absagen, um herzukommen.«
Laurel musterte ihn stumm. Sie hatte Danny seit mehr als einer Woche nicht gesehen, und selbst da war es nur ein flüchtiger Blick gewesen, als er den kleinen Michael in seinem alten Pick-up vor der Schule abgesetzt hatte. Erst jetzt spürte Laurel, wie tief es sie geschmerzt hatte, Danny nicht zu sehen. Ohne ihn fühlte sie sich leer und kraftlos, als hätte ein heimtückischer Virus sie befallen und ihr die Energie geraubt.
»Darf ich reinkommen?«, fragte er schüchtern.
Laurel nickte bloß, weil ihr ihm Augenblick die Worte fehlten.
Sie beobachtete, wie er zu den Reihen von Mini-Stühlen an der Rückwand des Klassenzimmers ging. Er will nicht an den Tisch, um mir Zeit zu geben, erkannte sie. Damit ich mich erholen kann. Danny bewegte sich mit geschmeidiger Leichtigkeit, obwohl er aussah, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen oder gegessen. Er war knapp über eins achtzig groß und besaß drahtige Muskeln und trotz seines Alters einen flachen Bauch. Mit seinem wettergegerbten Gesicht und der ganzjährigen Bräune sah er wie der Mann aus, der er war – ein Mann, der sein Leben selbst in die Hand nahm. Er war als Sohn eines Sprühfliegers aufgewachsen und mit einem Baseball-Stipendium ans College gegangen, hatte nach dem zweiten Semester jedoch aufgehört, um in die Air Force einzutreten, wo er die Eignungstests für die Pilotenausbildung bestand. Er war kein Schönling, doch die meisten Frauen, die Laurel kannte, empfanden ihn als attraktiv. Sein lockiges Haar war an den Schläfen grau, doch überall sonst noch dunkel, und er tönte es nicht nach. Doch was sie am meisten an ihm fesselte, waren seine Augen – grau, mit einer Spur von Blau darin, wie das Meer in nördlichen Breiten. Sie konnten weich oder hart sein, je nachdem, wie die Situation es erforderte. Laurel hatte sie meist weich erlebt und funkelnd, wenn er gelacht hatte, doch manchmal, wenn er von seiner Frau erzählte, wurden sie kalt und hart. Danny war in jeder Hinsicht ein ganzer Kerl, während die meisten anderen Männer, die Laurel kannte, den Eindruck alternder Collegeboys erweckten, die immer noch versuchten, sich in einer verwirrenden Welt zurechtzufinden.
Danny drehte einen der kleinen Stühle herum und setzte sich rittlings darauf, die Lehne zwischen sich und Laurel, als wollte er ihren neuen Status des Getrenntseins betonen. Er beobachtete sie vorsichtig aus graublauen Augen. »Ich hoffe, du bist jetzt nicht wütend«, begann er leise. »Ich wäre nicht gekommen, aber es hätte nicht gut ausgesehen, wenn nicht wenigstens einer von uns zur Sprechstunde gegangen wäre.«
»Ich … ich bin nicht wütend«, stammelte Laurel.
Er nickte, als verstünde er genau, was sie meinte.
Nachdem Laurel den Schock verdaut hatte, ihn hier zu sehen, stiegen zugleich Sehnsucht und Zorn in ihr auf und fochten einen erbitterten Kampf in ihrem Innern. Die Sehnsucht machte sie wütend, weil sie diesen Mann nicht haben konnte; zugleich ärgerte sie sich, weil ihr Verlangen von ihm entfacht worden war, ganz gleich, wie edelmütig seine Motive gewesen sein mochten. Danny nicht zu sehen war schlimm, doch ihn zu sehen war noch viel schlimmer. Das Allerschlimmste aber war, ihn zu sehen und ignoriert zu werden, wie es vergangenen Monat der Fall gewesen war. Keine versteckten Blicke, keine zufälligen Berührungen, kein Lächeln … nichts außer dem distanzierten Blick eines flüchtigen Bekannten.
In jenen wahnsinnigen Augenblicken schien der Hunger in ihr plötzlich unerträglich, als würde er sie verschlingen und nichts mehr übrig lassen. Von Danny ignoriert zu werden war, als existiere sie gar nicht. Es gelang ihr einfach nicht, sich einzureden, dass er genauso litt wie sie. Doch jetzt, als sie ihn anschaute, wusste sie, dass es doch so war.
»Wie konntest du nur herkommen?«, fragte sie leise.
Er drehte die Handflächen nach oben. »Ich war nicht stark genug, um wegzubleiben.«
Ehrlichkeit war immer eines seiner Prinzipien gewesen, und seine Antwort war niederschmetternd.
»Darf ich dich in den Armen halten?«, fragte er.
»Nein.«
»Weil Leute in der Nähe sind? Oder weil du es nicht möchtest?«
Sie blickte ihn an. »Es geht mir nicht gut, weil ich kein Essen bei mir behalten kann. Aber ich komme zurecht … so gerade. Bitte, lass uns über Michael reden und es hinter uns bringen. In fünfzehn Minuten wartet die nächste Mutter vor der Tür.«
Danny seufzte tief. »Du hast recht. Wir müssen wirklich über Michael reden. Er weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Er spürt, dass ich aufgewühlt bin. Wenn es mir nicht gut geht, geht es auch ihm nicht gut. Und ich denke, du kommst auch mit ins Spiel.«
»Du meinst …«
»Ja. Wenn du leidest, spürt er es. Und es ist ihm nicht egal. Du bist ihm ein ganzes Stück wichtiger als seine Mutter.«
Laurel wollte es abstreiten, doch sie hatte es schon selbst beobachtet. »Ich möchte nicht mehr, dass du so redest. Es hat ja doch keinen Sinn.«
Danny schaute nach rechts zur Wand, wo unbeholfene Fingermalereien an einem langen Brett hingen, das er im vergangenen Jahr dort angebracht hatte. Beim Bohren der Löcher hatte er Laurel gestanden, was ihm durch den Kopf gegangen war, als er die Bilder zum ersten Mal gesehen hatte: Dass die Kinder, von denen diese Bilder stammten, niemals Computer entwerfen, chirurgische Eingriffe durchführen oder Flugzeuge fliegen würden. Es war eine niederschmetternde Erkenntnis für ihn, doch er hatte sich damit auseinandergesetzt und war darüber hinweggekommen. Und wenngleich Laurels Schüler tatsächlich kaum jemals einen Helikopter fliegen würden, waren sie alle schon mitgeflogen: Danny hatte jedes der Kinder – mit freudiger Erlaubnis ihrer Eltern – auf spektakuläre Flüge über den Mississippi mitgenommen. Er hatte sogar einen Wettbewerb für sie veranstaltet, und der Gewinner hatte mit ihm zusammen an einem Ballonrennen teilnehmen dürfen – an einem Wochenende, als Dutzende von Heißluftballons den Himmel über dem sechzig Kilometer im Norden liegenden Natchez gefüllt hatten.
»Du hast abgenommen«, bemerkte Laurel »Zu viel.«
Er nickte. »Sieben Kilo in fünf Wochen.«
Seine leicht schleppende Stimme vermittelte Kompetenz – wie Sam Shepard als Chuck Yeager in Der Stoff, aus dem die Helden sind. Es war die Stimme eines Piloten, die einem sagte, dass alles unter Kontrolle war, und die einen darüber hinaus dazu brachte, es zu glauben. Laurel brauchte ihn nicht nach dem Grund für den Gewichtsverlust zu fragen: Man musste kein Arzt sein, um ein gebrochenes Herz zu diagnostizieren.
»Ich wünschte, ich dürfte dich in den Arm nehmen«, sagte Danny. »Brauchst du es denn gar nicht?«
Sie schloss die Augen. Du hast ja keine Ahnung … »Bitte lass uns bei Michael bleiben. Welche Veränderungen sind dir in seinem Verhalten aufgefallen?«
Während Danny antwortete, langsam und ausführlich, kritzelte Laurel auf dem Post-it-Block, der vor ihr auf dem Tisch lag. Von der Stelle, an der er saß, konnte Danny den Block nicht sehen; ihm wurde die Sicht von einem Stapel Bücher versperrt. Nachdem Laurel das erste gelbe Quadrat mit Kringeln und Spiralen vollgemalt hatte, riss sie es ab und fing mit dem nächsten an. Diesmal kritzelte sie nichts; sie schrieb nur ein einzelnes Wort in dicken fetten Großbuchstaben. SCHWANGER. Dann schrieb sie ICH BIN darüber. Sobald sie das zweite Wort geschrieben hatte, wurde ihr bewusst, dass sie vorhatte, Danny den Zettel auf dem Weg nach draußen zu geben. Sie würde es nicht laut aussprechen, nicht hier. Es gab keine Möglichkeit, eine Diskussion zu vermeiden, vielleicht sogar einen Streit. Die Notiz würde ihren Zweck erfüllen. Danny konnte sie auf dem Heimweg entsorgen, so, wie sie die hastig gekritzelten Botschaften entsorgt hatte, die er ihr an der Tür zum Klassenzimmer zugesteckt hatte. Oder wie die e.p.t.-Schachtel, die sie selbst am Nachmittag entsorgen würde. Wie all den Abfall, der sich bei einer außerehelichen Affäre nun mal anhäuft. Wie das Baby, das du in dir trägst, sagte eine böse Stimme in ihrem Kopf.
Das Dumme war, sie konnte nicht sicher sein, dass es Dannys Baby war. Sie wollte, dass es seins war, so absurd dieser Gedanke angesichts ihrer Situation auch sein mochte, doch sie wusste es nicht. Und ungeachtet dessen, was Kelly Rowland damals im College getan hatte – Laurel musste herausfinden, wer der Vater war. Nur eine DNA-Analyse konnte diese Frage klären. Sie war ziemlich sicher, dass man die DNA eines ungeborenen Kindes analysieren konnte, doch es würde eine Fruchtwasseruntersuchung erforderlich machen, die sie in dieser Stadt nicht vornehmen lassen konnte, wollte sie es vor Warren geheim halten. Außerdem benötigte sie eine DNA-Probe von Warren, die sie sich beschaffen musste, ohne dass er davon erfuhr. Vielleicht reichte ja schon Haar von seiner Bürste.
»Und? Was denkst du?«, riss Danny sie aus ihren Gedanken. »Du bist schließlich die Expertin.«
Zum ersten Mal hatte Laurel nicht zugehört, was Danny über seinen Sohn gesagt hatte. Seit mehr als einem Jahr war Michael der wichtigste Schüler in ihrer Klasse für sie gewesen. Es war unfair gegenüber den anderen, aber so war es nun mal. Sie liebte Danny, und weil Michael seinem Vater alles bedeutete, hatte sie den Jungen sehr nahe an sich herangelassen. Nicht, dass er wichtiger gewesen wäre als die anderen Kinder, doch bis vor fünf Wochen hatte Laurel geglaubt, sie würde eines Tages seine Stiefmutter sein, und das machte ihn zu etwas Besonderem.
»Du musst jetzt gehen, Danny«, sagte sie mit plötzlicher Entschlossenheit.
Er zog ein trauriges Gesicht. »Aber wir haben nicht miteinander geredet … nicht richtig.«
»Ich kann es nicht ändern. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Es geht nicht.«
»Es tut mir leid.«
»Das hilft mir nicht.«
Er erhob sich, und es war offensichtlich, dass nur die Kraft seines Willens ihn daran hinderte, zu ihr zu gehen und sie an sich zu ziehen. »Ich kann nicht ohne dich leben«, sagte er. »Ich dachte, ich könnte es, aber es bringt mich um.«
»Hast du das auch deiner Frau gesagt?«
»Mehr oder weniger.«
Nervosität, vermischt mit Hoffnung, erfasste Laurel. »Hast du ihr gesagt, wer ich bin?«
Danny leckte sich über die Lippen; dann schüttelte er betreten den Kopf.
»Ich verstehe. Hat sie ihre Meinung geändert, was das Sorgerecht für Michael angeht, falls du dich von ihr scheiden lässt?«
»Nein.«
»Dann haben wir keine …«
»Das musst du mir nicht sagen.«
Laurel sah ihm an, dass er die Schwäche hasste, die ihn hergeführt hatte, zumal er keine guten Neuigkeiten brachte. Nichts hatte sich geändert. Er schob die Hände in die Hosentaschen seiner Jeans und ging zur Tür. Wortlos riss Laurel das ICH-BIN-SCHWANGER-Post-it vom Block und faltete es zusammen. Als Danny die Tür fast erreicht hatte, stand sie auf.
»Schläfst du mit Starlette?«, fragte sie mit einer Stimme, so spröde wie berstendes Eis.
Danny blieb stehen; dann drehte er sich um. »Nein«, sagte er verwundert. »Hast du das geglaubt?«
Sie wollte mit den Schultern zucken, doch sie waren verkrampft vor Angst und Wut. Die Vorstellung, wie Danny mit Starlette schlief, hatte in der einsamen Dunkelheit vor dem Schlaf endlose Rollen pornographischen Films vor ihrem inneren Auge ablaufen lassen: Danny, der aus Verzweiflung, dass es Laurel nicht mehr gab, seine ehemalige Schönheitskönigin vögelte, nur um den Druck loszuwerden – und dabei erkannte, dass der Sex mit ihr gar nicht so übel war. Laurel war sicher, dass Starlette sich besonders ins Zeug legen würde, um Danny daran zu erinnern, warum er sie in erster Linie geheiratet hatte. Mitternächtliche Blowjobs waren ihre Spezialität. Laurel hatte es Danny eines Abends aus der Nase gezogen, nachdem er mehr Whisky getrunken hatte, als gut für ihn war. Offensichtlich pflegte Starlette zu warten, bis er tief und fest eingeschlafen war, ehe sie sich wie ein Sukkubus über ihn hermachte. Manchmal erwachte er erst im letzten Moment vor dem Orgasmus, und seine Miene, als er Laurel davon erzählte, verriet ihr nur allzu deutlich, wie sehr er dieses Ritual genoss. Einige Male hatte sie überlegt, es selbst zu versuchen, sich am Ende aber dagegen entschieden. Es war besser, nicht mit Starlette auf deren Spezialgebiet zu konkurrieren, und sich stattdessen auf eigene Tricks zu verlassen oder neue zu erfinden – was ihr auch gelungen war.
»Du und ich, wir sind auseinander«, sagte Laurel. »Starlette ist deine Frau. Da liegt es doch wohl nahe, dass du mit ihr schläfst.«
Danny schüttelte den Kopf. »Nein. Wie steht es mit dir und deinem Mann?«