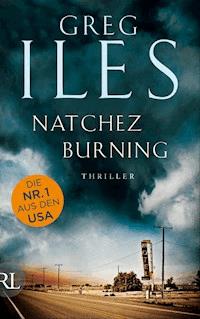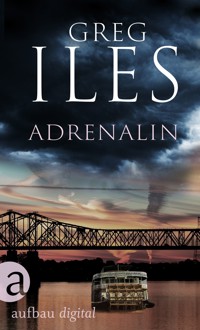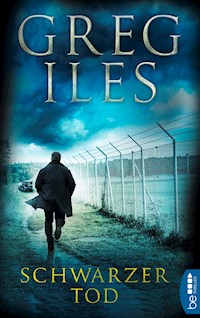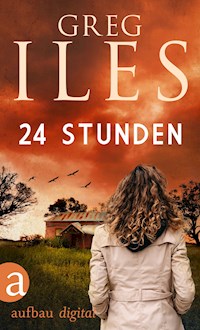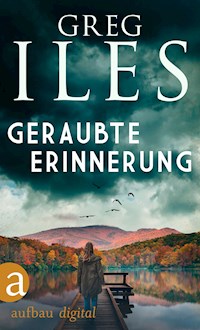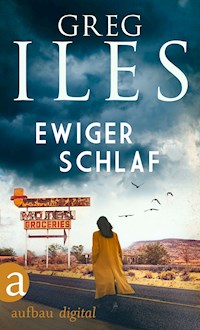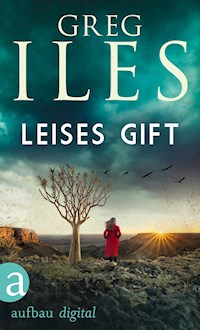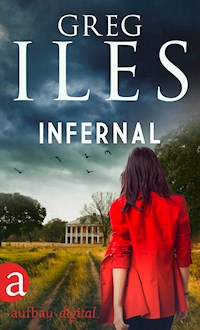
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Greg Iles Bestseller Thriller
- Sprache: Deutsch
Bei dem Besuch eines Kunstmuseums stellt die Fotojournalistin Jordan Glass verwirrt fest, dass andere Museumsbesucher sie neugierig anstarren. Nur wenige Augenblicke später entdeckt sie eine bizarre Sammlung von Gemälden eines unbekannten Künstlers, die in der Kunstwelt für Furore gesorgt haben. Die Bilderserie heißt "Die schlafenden Frauen", und zeigt verschiedene, angeblich schlafende Frauen nackt. Der Schlag trifft Jordan, als sie auf einem der Bilder ihr eigenes Gesicht erkennt - so, wie es die anderen Besucher offensichtlich auch getan haben. Doch Jordan weiß sofort, dass auf dem Bild nicht sie selbst, sondern ihre Zwillingsschwester abgebildet wurde. Jane verschwand vor einem Jahr spurlos und bis zu diesem Tag fehlt jedes Lebenszeichen von ihr. Ist das Bild der langersehnte Hinweis, was mit Jane geschehen ist? Und schlafen die Frauen auf dem Gemälde tatsächlich? Oder ist alles viel grausiger als gedacht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Informationen zum Buch
Bei dem Besuch eines Kunstmuseums stellt die Fotojournalistin Jordan Glass verwirrt fest, dass andere Museumsbesucher sie neugierig anstarren. Nur wenige Augenblicke später entdeckt sie eine bizarre Sammlung von Gemälden eines unbekannten Künstlers, die in der Kunstwelt für Furore gesorgt haben. Die Bilderserie heißt »Die schlafenden Frauen«, und zeigt verschiedene, angeblich schlafende Frauen nackt. Der Schlag trifft Jordan, als sie auf einem der Bilder ihr eigenes Gesicht erkennt – so, wie es die anderen Besucher offensichtlich auch getan haben. Doch Jordan weiß sofort, dass auf dem Bild nicht sie selbst, sondern ihre Zwillingsschwester abgebildet wurde. Jane verschwand vor einem Jahr spurlos und bis zu diesem Tag fehlt jedes Lebenszeichen von ihr. Ist das Bild der langersehnte Hinweis, was mit Jane geschehen ist? Und schlafen die Frauen auf dem Gemälde tatsächlich? Oder ist alles viel grausiger als gedacht?
Über Greg Iles
Greg Iles wurde 1960 in Stuttgart geboren. Sein Vater leitete die medizinische Abteilung der US-Botschaft. Mit vier Jahren zog die Familie nach Natchez, Mississippi. Mit der »Frankly Scarlet Band«, bei der er Sänger und Gitarrist war, tourte er ein paar Jahre durch die USA. Mittlerweile erscheinen seine Bücher in 25 Ländern. Greg Iles lebt heute mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Natchez, Mississippi. Fünf Jahre hat er kein Buch herausgebracht, da er einen schweren Unfall hatte, nun liegen im Aufbau Taschenbuch seine Thriller „Natchez Burning“, „Die Toten von Natchez vor“ und "Die Sünden von Natchez" vor.
Mehr zum Autor unter www.gregiles.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Greg Iles
Infernal
Ins Deutsche übertragen vonAxel Merz
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Danksagungen
Impressum
1
Ich habe aufgehört, Leute zu schießen, kurz nach dem Gewinn des Pulitzer. Das war vor sechs Monaten. Mit Menschen war ich schon immer begabt, aber sie haben mich auch fertig gemacht – und das, lange bevor ich den Preis erhielt. Trotzdem schoss ich weiter, auf einer blinden Suche, der ich mir nicht einmal bewusst war. Es fällt wahrscheinlich schwer, das zu glauben, doch der Pulitzer war für mich nicht der gleiche Meilenstein wie für die meisten anderen Fotografen. Mein Vater hat ihn zweimal gewonnen. Das erste Mal 1966 für eine Serie in McComb, Mississippi. Das zweite Mal 1972 für ein Bild von der kambodschanischen Grenze. Diese Auszeichnung hat er nie in Empfang genommen. Der belichtete Film wurde von amerikanischen Marines auf der falschen Seite des Mekong aus seiner Kamera gezogen. Die war alles, was sie fanden. Zwanzig Aufnahmen auf Tri-X brachten Licht in den Ablauf der Ereignisse. Mein Vater hatte den Motor seiner Nikon F2 auf fünf Bildern in der Sekunde stehen, als er die brutale Exekution einer weiblichen Gefangenen durch einen Soldaten der Roten Khmer schoss und anschließend das Gesicht des Henkers, während dessen Pistole auf den ebenso tapferen wie törichten Mann herumschwang, der die Kamera auf ihn gerichtet hielt. Ich war damals gerade zwölf Jahre alt und zehntausend Meilen weit entfernt, doch die Kugel traf mich mitten ins Herz.
Jonathan Glass war lange vor diesem Augenblick eine Legende, doch Ruhm ist kein Trost für ein einsames Kind. Ich habe meinen Vater nicht annähernd oft genug gesehen, als ich klein war, und in seine Fußstapfen zu treten war für mich eine Möglichkeit, ihn besser kennen zu lernen. Ich trage noch immer seine mit Kampfspuren übersäte Nikon mit mir herum. Ein Dinosaurier nach heutigen Maßstäben, doch mit ihr habe ich meinen Pulitzer gewonnen. Meinen Vater hätte es wahrscheinlich amüsiert, dass ich aus Sentimentalität seine alte Kamera benutze, doch ich weiß, was er zu meinem Preis gesagt hätte. Nicht schlecht, für eine Frau.
Und dann hätte er mich umarmt. Gott, wie sehr ich diese Umarmung vermisse. Sie verschlang mich völlig, wie die Umarmung eines großen Bären, und beschützte mich vor der Welt. Seit achtundzwanzig Jahren habe ich diese Arme nicht mehr gespürt, und doch sind sie mir noch genauso vertraut wie der Geruch des Olivenbaums, den er vor meinem Fenster pflanzte, als ich acht wurde. Damals betrachtete ich den Baum nicht als das großartige Geburtstagsgeschenk, doch später, nachdem mein Vater verschwunden war, erschien mir der süße Duft, der nachts durch mein offenes Fenster trieb, wie sein über mich wachender Geist. Es ist lange her, dass ich unter diesem Fenster geschlafen habe.
Für die meisten Fotografen bedeutet der Gewinn des Pulitzer Triumph und Bestätigung, den entscheidenden Durchbruch, den Punkt, an dem das Telefon zu läuten beginnt und die Traumjobs angeboten werden. Für mich war es der Haltepunkt. Ich hatte bereits zweimal den Capa Award gewonnen, der für Leute, die sich auskennen, der wichtigere von beiden Preisen ist. 1936 schoss Robert Capa das unvergängliche Foto eines spanischen Soldaten in dem Augenblick, als ihn die tödliche Kugel trifft, und Capas Name ist ein Synonym für Tapferkeit im Kugelhagel. Capa nahm sich in Europa, kurz nachdem er und Cartier-Bresson und zwei weitere Freunde Magnum Fotos gegründet hatten, meines damals noch jungen Vaters an. Drei Jahre später, 1954, trat Capa in einer Gegend, die zu dieser Zeit Französisch Indochina hieß, auf eine Landmine und gab damit das tragische Vorbild, dem auf die eine oder andere Weise mein Vater, Sean Flynn (Errols verwegener Sohn) und ungefähr dreißig weitere amerikanische Fotografen während der drei Jahrzehnte der Konflikte folgen sollten, die der Öffentlichkeit als Vietnamkrieg ein Begriff sind. Doch die Öffentlichkeit weiß entweder nichts vom Capa Award, oder sie schert sich nicht darum. Es ist der Pulitzer, den sie kennt, und das öffnet seinen Gewinnern die Türen.
Nachdem ich ihn hatte, trudelten neue Aufträge ein. Ich lehnte sie allesamt ab. Ich war neununddreißig Jahre alt, unverheiratet (wenngleich nicht ohne Möglichkeiten), und ich hatte, bereits fünf Jahre bevor ich den Pulitzer in mein Regal stellte, jenen mentalen Zustand erreicht, den man gemeinhin als »ausgebrannt« bezeichnet. Der Grund dafür ist simpel. Mein Job bestand im Grunde genommen aus nichts anderem als einer Dokumentation des grausigen Weges, den der Tod über die Welt nimmt. Tod kann natürlich sein, doch ich habe ihn meist als eine Manifestation des Bösen erlebt. Und wie andere Profis, die dieses Gesicht des Todes sehen – Cops, Soldaten, Priester, Ärzte –, altern Kriegsberichterstatter schneller als normale Menschen. Die Jahre zeigen sich nicht unbedingt äußerlich, doch man spürt sie tief in sich, im Mark und im Herzen. Sie ziehen dich auf eine Weise runter, die nur wenige außerhalb unserer kleinen Bruderschaft begreifen. Ich sage Bruderschaft, weil es kaum Frauen in diesem Job gibt. Warum, ist unschwer zu erraten. Wie Dickey Chappelle, eine Frau, die Kriegsschauplätze vom Zweiten Weltkrieg bis Vietnam fotografierte, einmal gesagt hat: Das ist kein Ort für das Feminine.
Und doch war es nichts von alldem, was mich aufhören ließ. Man kann über ein leichenübersätes Schlachtfeld gehen und auf ein kleines Kind stoßen, das auf seiner toten Mutter liegt, und spürt doch nicht einen Bruchteil dessen, was man spüren würde, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Der Tod hat mein Leben mit nahezu unerträglichem Verlust interpunktiert, und ich hasse ihn dafür. Der Tod ist mein schlimmster Feind. Hybris, vielleicht – doch damit kann ich leben. Als mein Vater die Kamera auf den mörderischen Roten Khmer richtete, muss er gewusst haben, dass er sein Leben verwirkt hatte. Er hat das Foto trotzdem geschossen. Er ist nicht aus Kambodscha zurückgekehrt. Das Bild jedoch kehrte zurück, und es hat eine Menge dazu beigetragen, die öffentliche Meinung über diesen Krieg zu ändern. Mein ganzes Leben lang habe ich nach diesem Vorbild gelebt, nach dem ungeschriebenen Kodex meines Vaters. Deswegen war auch niemand stärker erschüttert als ich selbst, als der Tod erneut über meine Familie kam. Und diesmal ließ mich die Begegnung zerbrechen.
Ich schleppte mich sieben Monate lang zur Arbeit und hatte zwischendurch einen kreativen Anfall, der mir den Pulitzer einbrachte, dann klappte ich auf einem Flughafen zusammen. Ich lag sechs Tage im Krankenhaus. Die Ärzte nannten es ein »posttraumatisches Stresssyndrom«. Ich fragte sie, ob sie für diese Diagnose eine Bezahlung erwarteten. Meine engsten Freunde – und mein Agent – sagten mir auf den Kopf zu, dass ich für eine Weile aufhören müsste zu arbeiten. Ich war der gleichen Meinung. Mein Problem war, ich wusste nicht wie. Setzen Sie mich an einen Strand in Tahiti, und im Geiste fotografiere ich, suche in den Augen von Passanten oder Kellnern nach dem Leben dahinter. Manchmal denke ich, dass ich selbst zur Kamera geworden bin, ein Instrument zur Aufzeichnung der Realität, und dass die komplizierten, teuren Apparate, die ich bei meiner Arbeit mit mir führe, nichts anderes sind als eine Verlängerung meines Verstandes und meiner Augen. Für mich gibt es kein Ausspannen. Solange ich die Augen offen habe, arbeite ich.
Glücklicherweise bot sich dann doch noch eine Lösung an. Mehrere New Yorker Verleger waren seit Jahren hinter mir her – ich sollte endlich ein Buch machen. Alle wollten das Gleiche: meine Kriegsbilder. Als ich nach meinem Zusammenbruch mit dem Rücken zur Wand stand, ging ich einen Handel mit dem Teufel ein. Als Gegenleistung dafür, dass ein Lektor bei Viking eine Anthologie mit meinen Arbeiten über den Krieg zusammenstellen durfte, nahm ich einen doppelten Vorschuss entgegen. Einen für die Anthologie, einen für das Buch meiner Träume. Das Buch meiner Träume kommt ohne Menschen daher. Ohne Gesichter jedenfalls. Nicht ein einziges Paar betäubter oder gehetzter Augen. Der Arbeitstitel lautet »Wetter«.
»Wetter« war es auch, was mich in jener Woche nach Hongkong führte. Ich war einige Monate zuvor dort gewesen, um den Monsun zu schießen, wie er über eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt rollt. Ich schoss den Victoria Harbour vom Peak und ich schoss den Peak von Central, und ich staunte über die verschiedenen Arten, wie Arme und Reiche Regenfälle ertrugen, die so stark und unerbittlich waren, dass manche »Langnase« in alkoholische Exzesse oder Schlimmeres getrieben worden wäre. Dieses Mal war Hongkong lediglich Zwischenstation auf dem Weg in das »richtige« China, auch wenn ich zwei Tage Aufenthalt eingeplant hatte, um meine Mappe über die Stadt zu vervollständigen. Doch am zweiten Tag fiel mein gesamtes Buchprojekt in sich zusammen. Es geschah ohne Vorwarnung und kam aus heiterem Himmel über mich. So wie alle wirklich wichtigen Dinge im Leben.
Ein Freund bei Reuters hatte mir den Tipp gegeben, unbedingt das Hongkong Museum of Art zu besuchen, um ein paar chinesische Aquarelle anzusehen. Er sagte, die alten chinesischen Maler hätten in ihren Bildern von der Natur eine nahezu perfekte Reinheit erreicht. Ich weiß überhaupt nichts über Kunst, doch ich dachte mir, dass die Aquarelle vielleicht einen Blick wert wären, und sei es nur wegen der Perspektive. Also bestieg ich am späten Nachmittag die altehrwürdige Star Ferry und setzte zur anderen Seite des Hafens über, nach Kowloon, um von dort aus zu Fuß zu gehen. Nach zwanzig Minuten im Museum war Perspektive das Letzte, was ich noch im Sinn gehabt hätte.
Der Wächter am Eingang war das erste Zeichen, doch ich interpretierte es völlig falsch. Als ich durch die Tür ging, öffneten sich seine Lippen ein wenig, und seine Augen wurden größer, dem Ausdruck von Begierde nicht unähnlich. Auch heute noch erwecke ich hin und wieder diese Reaktion bei Männern, doch ich hätte aufmerksamer sein müssen. In Hongkong bin ich ein kwailo, ein fremder Teufel, und meine Haare sind nicht blond, die Farbe, die chinesische Männer so sehr schätzen.
Das Nächste war die chinesische Matrone, bei der ich einen Walkman mitsamt Kopfhörer und der englischsprachigen Version der Audio-Museumsführung auslieh. Sie blickte lächelnd auf, um mir das Gewünschte zu überreichen – dann verschwanden ihre Zähne, und ihr Gesicht verlor merklich an Farbe. Ich wandte mich instinktiv um in der Erwartung, hinter mir einen finsteren Schläger zu sehen, doch ich war allein, nur meine hundertsechsundsiebzig Zentimeter, schlank, einigermaßen muskulös und alles andere als eine Bedrohung. Als ich sie fragte, was denn los wäre, schüttelte sie schweigend den Kopf und beschäftigte sich eifrig hinter ihrem Schalter. Mir liefen eiskalte Schauer über den Rücken. Ich schüttelte sie ab, setzte den ausgeliehenen Walkman auf und marschierte brüsk in Richtung Ausstellung davon, während eine Stimme, die klang wie die von Jeremy Irons, in sonorem, doch präzisem Englisch auf mich einredete.
Mein Freund bei Reuters hatte Recht. Die Aquarelle waren umwerfend. Einige waren beinahe tausend Jahre alt und trotzdem kaum verblasst. Die zart gepinselten Bilder vermittelten auf beeindruckende Weise die Bedeutungslosigkeit menschlicher Wesen, ohne sie in ihrer Umgebung zu entfremden. Der Hintergrund war nicht vom Thema des Bildes getrennt – oder vielleicht war die Lektion auch, dass es überhaupt keinen Hintergrund gibt. Während ich von Bild zu Bild wanderte, wich allmählich die innere Dunkelheit von mir, die mein ständiger Begleiter ist – genau so, wie es beim Hören bestimmter Musik geschieht. Doch die Erleichterung währte nur kurz. Als ich ein Gemälde betrachtete – einen Mann, der in einem Boot nicht unähnlich einer Cajun-Piroge über einen Fluss stakte –, bemerkte ich eine Chinesin zu meiner Linken. Ich nahm an, dass sie das gleiche Bild betrachten wollte wie ich, und trat einen Schritt nach rechts.
Sie bewegte sich nicht. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sie keine Besucherin war, sondern eine uniformierte Reinigungsfrau mit einem Staubwedel. Und sie stierte nicht das Gemälde an, als wäre sie zur Salzsäule erstarrt, sondern mich. Als ich mich ihr zuwandte, blinzelte sie zweimal und huschte hastig in die dunklen Nischen des angrenzenden Raums davon.
Ich ging zum nächsten Bild und fragte mich, was sie so an mir fasziniert haben mochte. Ich hatte nicht viel Zeit auf meine Haare oder das Make-up verschwendet, doch nachdem ich mein Spiegelbild in einer Vitrine überprüft hatte, kam ich zu dem Schluss, dass nichts an meinem Äußeren diesen Blick rechtfertigte.
Ich ging weiter in den nächsten Raum, in dem Arbeiten aus dem neunzehnten Jahrhundert ausgestellt waren – doch bevor ich auch nur ein Bild betrachten konnte, bemerkte ich, dass ich von einem weiteren uniformierten Museumsangestellten angestarrt wurde. Ich war ziemlich sicher, dass der Wächter am Eingang des Museums ihn über mich informiert hatte. Seine Augen verrieten eine Mischung aus Faszination und Furcht, und als ihm bewusst wurde, dass ich sein Starren erwiderte, zog er sich eilig hinter eine Säule zurück.
Fünfzehn Jahre früher hätte ich diese Art von Aufmerksamkeit als völlig normal empfunden. Verstohlene Blicke und merkwürdige Annäherungsversuche waren in Osteuropa und der alten Sowjetunion an der Tagesordnung gewesen. Doch das hier war das post-koloniale Hongkong und das einundzwanzigste Jahrhundert.
Einigermaßen aufgewühlt eilte ich durch die angrenzenden Ausstellungsräume, ohne den Gemälden mehr als flüchtige Blicke zu widmen. Falls ich Glück hatte und gleich ein Taxi fand, konnte ich noch rechtzeitig bei der Fähre und wieder in Happy Valley sein, um ein paar Sonnenuntergänge zu schießen, bevor mein Flieger nach Beijing ging. Ich bog in einen kurzen, mit Statuen gesäumten Korridor ein in der Hoffnung, eine Abkürzung zum Ausgang zu finden. Was ich stattdessen fand, war ein weiterer Ausstellungsraum, und dieser war voll mit Menschen.
Vor dem gewölbten Eingang zögerte ich und überlegte, was sie wohl alle hergeführt hatte. Die übrigen Räume des Museums waren praktisch verlassen. Waren die Bilder in diesem Raum so viel bedeutender als der Rest? Oder lief gerade irgendeine gesellschaftliche Veranstaltung? Es sah nicht danach aus. Die Besucher standen schweigend und für sich allein, während sie mit geradezu unheimlicher Konzentration die Bilder studierten. Über dem Bogen des Eingangs hing ein transparentes Schild mit chinesischen Piktogrammen und lateinischen Buchstaben. Es verkündete:
NACKTE FRAUEN IN RUHE
Unbekannter Künstler
Als ich wieder in den Raum sah, stellte ich fest, dass er nicht voller Menschen war – er war voller Männer. Warum ausschließlich Männer? Bei meinem letzten Besuch war ich eine ganze Woche in Hongkong gewesen, und mir war kein Mangel an Nacktheit aufgefallen – falls es das war, wonach sie gierten. Alle Männer im Raum waren Chinesen, und alle steckten in Geschäftsanzügen. Ich hatte den Eindruck, als wäre jeder Einzelne von ihnen einem unwiderstehlichen Zwang erlegen, von seinem Schreibtisch bei der Arbeit aufzuspringen, zu seinem Wagen zu rennen und zum Museum zu rasen, um einen Blick auf diese Gemälde zu werfen. Ich griff nach unten zu dem Walkman am Gürtel meiner Jeans und spulte die Kassette vor, bis der Sprecher bei der Beschreibung des Raums angekommen war.
»Nackte Frauen in Ruhe«, verkündete die Stimme in meinem Kopfhörer. »Diese provokative Ausstellung zeigt sieben Leinwände des unbekannten Künstlers, der die gemeinhin als ›Schlafende Frauen‹ bezeichnete Serie geschaffen hat. Die ›Schlafenden Frauen‹ sind ein Rätsel in der modernen Kunstwelt. Man weiß von neunzehn existierenden Gemälden, alle Öl auf Leinwand, und das erste erschien 1999 auf dem Markt. Über die neunzehn Gemälde hinweg ist ein Fortschritt von vagem Impressionismus hin zu einem verblüffenden Realismus zu erkennen; die jüngsten Werke sind in ihrer Akkuratesse beinahe fotografisch. Obwohl man anfänglich glaubte, dass sämtliche Bilder schlafende, nackte Frauen darstellen, ist diese Theorie inzwischen zumindest fragwürdig. Die frühen Gemälde sind so abstrakt, dass die Frage nicht mit Sicherheit beantwortet werden kann, doch die späteren Leinwände haben einen unbestimmten Verdacht unter asiatischen Sammlern erweckt. Sie glauben, dass die Frauen auf den Gemälden nicht schlafen, sondern tot sind. Aus diesem Grund hat der Kurator die Ausstellung ›Nackte Frauen in Ruhe‹ genannt und nicht ›Schlafende Frauen‹. Die vier Gemälde, die in den letzten sechs Monaten auf den Markt gekommen sind, haben Rekordpreise erzielt. Das letzte Werk mit dem einfachen Namen Nummer Neunzehn‹ wurde für die Summe von eins Komma zwei Millionen Pfund Sterling an den japanischen Geschäftsmann Hodai Takagi verkauft. Das Museum ist Mr Takagi zu tiefstem Dank verpflichtet, dass er drei seiner Leinwände für die gegenwärtige Ausstellung geliehen hat. Was den Künstler betrifft, so ist seine Identität weiterhin unbekannt. Seine Arbeiten sind exklusiv über Christopher Wingate, LLC, New York City, USA erhältlich.«
Ich spürte überraschende Beklemmungen, als ich auf der Schwelle zu diesem Raum voller Männer verharrte, schweigender Asiaten, die wie Statuen vor Bildern posierten, die ich von der Stelle, wo ich stand, noch nicht sehen konnte. Nackte Frauen, die möglicherweise nicht schliefen, sondern tot waren. Ich habe mehr tote Frauen gesehen als die meisten Morddezernate, viele davon nackt, die Kleidung von Artilleriegranaten weggefetzt, von Feuer verbrannt, von Soldaten heruntergerissen. Ich habe Hunderte von Fotos von ihren Leichen geschossen und methodisch meine eigenen Bilder vom Tod erschaffen. Und doch beunruhigte mich die Vorstellung von diesen Gemälden im nächsten Ausstellungsraum. Ich hatte meine Bilder erschaffen, um Ungeheuerlichkeiten aufzudecken, um sinnloses Abschlachten von Menschen aufzuhalten. Der Künstler hinter den Bildern im nächsten Raum hatte eine ganz andere Intention, so viel schien klar.
Ich atmete tief durch und betrat den Raum.
Mein Eintreten erzeugte Unruhe unter den Männern, wie ein fremder Fisch, der in einen Schwärm eindringt. Eine Frau – noch dazu eine Langnasenfrau! – bereitete ihnen ganz offensichtlich Unbehagen, fast, als schämten sie sich ihrer Anwesenheit in diesem Raum. Ich begegnete ihren verstohlenen Blicken mit Gleichgültigkeit und trat zu dem Bild mit den wenigsten Männern davor.
Nach den erbaulichen chinesischen Aquarellen war es ein Schock. Das Bild war typisch westlich: das Porträt einer nackten Frau in einer Badewanne. Einer Langnasenfrau, wie ich, doch zehn Jahre jünger. Vielleicht dreißig. Ihre Haltung – ein Arm hing schlaff über den Rand der Wanne – erinnerte mich an »Death of Marat«, ein Bild, das ich von dem Masterpiece-Brettspiel her kannte, das ich als Kind gespielt hatte. Doch die Perspektive war anders, von einem höheren Winkel auf das Modell herab, sodass Brüste und Schambein sichtbar waren. Ihre Augen waren geschlossen, und obwohl die Frau unbestreitbar friedlich wirkte, konnte ich nicht sagen, ob es der Frieden des Schlafes oder der des Todes war. Die Hautfarbe war nicht ganz natürlich, eher wie Marmor, und mich überkam fröstelnd das Gefühl, dass ich, wenn ich in das Bild greifen und sie umdrehen könnte, ihren Rücken voller Leichenflecke finden würde.
Ich spürte, wie sich die Männer hinter mir näher schoben, und ging zum nächsten Gemälde. Diesmal lag das weibliche Modell auf einem Bett aus Stroh, das wie auf einem Dreschboden auf Holzplanken ausgebreitet war. Die Augen standen offen und besaßen jenen stumpfen Glanz, den ich in viel zu vielen improvisierten Leichenschauhäusern und hastig ausgehobenen Gräbern gefunden hatte. Es stand außer Frage – diese Frau sollte tot aussehen. Was nicht bedeuten musste, dass sie tatsächlich tot war, doch wer auch immer sie gemalt hatte, wusste, wie der Tod aussah.
Erneut hörte ich Männer hinter mir. Scharrende Füße, raschelnde Seide, unregelmäßiger Atem. Versuchten sie etwa, meine Reaktion abzuschätzen auf diese abendländische Frau im verletzlichsten Zustand, in dem eine Frau sein kann? Obwohl – falls sie tot war, dann war sie rein technisch gesehen unverwundbar. Trotzdem erschien mir dieses Gaffen der fremden Männer auf ihren Körper wie eine letzte Beleidigung, die ultimative Demütigung. Wir bedecken Leichen aus dem gleichen Grund, aus dem wir hinter Mauern verschwinden, um unseren körperlichen Bedürfnissen nachzukommen; manche Dinge schreien nach Privatsphäre, und der Tod ist eines davon. Respekt ist angebracht, nicht vor dem Leichnam, sondern vor der Person, die darin gelebt hat.
Irgendjemand hatte zwei Millionen Dollar für ein Gemälde wie dieses bezahlt. Vielleicht sogar für genau dieses. Ein Mann, natürlich. Eine Frau würde dieses Bild nur gekauft haben, um es augenblicklich zu zerstören. Neunundneunzig von hundert jedenfalls. Ich schloss die Augen und sprach ein Gebet für die Frau auf dem Bild, für den Fall, dass sie tatsächlich tot war. Dann ging ich weiter.
Das nächste Bild hing von mir aus gesehen hinter einer schmalen Bank, die an der Wand stand. Es war kleiner als die übrigen, vielleicht sechzig mal neunzig Zentimeter, und hing hochkant. Zwei Männer standen davor, doch sie sahen nicht auf die Leinwand. Stattdessen starrten sie mich, als ich näher kam, mit offenen Mündern an wie Fische auf dem Trockenen, und ich stellte mir vor, dass ich, wenn ich ihre gestärkten weißen Hemdkrägen herunterzog, Kiemen finden würde. Keiner der beiden war größer als ich, und sie wichen hastig zurück und gaben den Platz vor dem Gemälde frei. Als ich mich dem Bild zuwandte, durchflutete eine alarmierende Hitzewelle meinen Körper, und ich hatte das Gefühl, als holte mich die Vergangenheit ein.
Diese Frau war ebenfalls nackt. Sie saß auf einer Fensterbank und hatte den Kopf und die Schulter gegen den Fensterflügel gelehnt. Ihre Haut leuchtete vom violetten Schein der auf- oder untergehenden Sonne. Sie hatte die Augen halb geöffnet, doch sie erinnerten mehr an die Glasaugen einer Puppe als an die einer lebendigen Frau. Ihr Körper war schlank und muskulös, ihre Hände lagen im Schoß, und ihre streng geschnittenen Haare fielen auf die Schultern wie ein dunkler Schleier. Obwohl sie mir von dem Augenblick an, als ich auf die Leinwand sah, gegenübergesessen hatte, überkam mich mit einem Mal das schreckliche Gefühl, als hätte sie sich just in dieser Sekunde zu mir gewandt und laut gesprochen. Der Geschmack von altem Metall schlich sich in meinen Mund, und mein Herz begann heftig zu klopfen. Was dort an der Wand hing, war kein Gemälde, sondern ein Spiegel. Das Gesicht, das mir von der Leinwand entgegenblickte, war mein eigenes. Der Körper ebenfalls: meine Füße, meine Hüften, meine Brüste, meine Schultern, mein Hals. Doch es waren die Augen, die mich festhielten, die toten Augen – sie hielten mich gepackt und schleuderten mich in einen Alptraum, dem zu entkommen ich Tausende von Meilen gereist war. Unvermittelt erfüllte lautes Chinesisch den Raum, doch ich verstand kein Wort. Meine Kehle war wie zugeschnürt, und ich konnte weder schreien noch atmen.
2
Dreizehn Monate zuvor hatte meine Zwillingsschwester Jane an einem heißen Sommermorgen ihr Haus in der St. Charles Avenue in New Orleans verlassen, um ihre täglichen drei Meilen durch den Garden District zu laufen. Ihre beiden kleinen Kinder warteten zusammen mit dem Kindermädchen zu Hause, zuerst friedlich, dann zunehmend ängstlicher, als die übliche Abwesenheit der Mutter länger dauerte als alles, woran sie sich erinnern konnten. Janes Ehemann Marc arbeitete in seliger Ahnungslosigkeit in seiner Kanzlei in der Stadtmitte. Nach neunzig Minuten rief das Kindermädchen in seinem Büro an.
Wohl wissend, dass einen Block jenseits des Garden District die unsicheren Gegenden anfingen, verließ Marc Lacour augenblicklich das Büro und fuhr auf der Suche nach seiner Frau durch die Straßen der Nachbarschaft. Er fuhr jeden einzelnen Block zwischen Jackson Avenue und Louisiana ein Dutzend Mal ab. Danach lief er sie zu Fuß ab. Er verließ den Garden District und befragte in den benachbarten Straßen jeden, dem er begegnete, jeden Schattenhocker, jeden Dosentreter, jeden Crackdealer und jeden Obdachlosen. Niemand hatte etwas von Jane gesehen oder gehört. Marc war ein bekannter Anwalt, und so rief er bei der Polizei an und nutzte seinen Einfluss, um eine massive Suche in die Wege zu leiten. Die Polizei fand nichts.
Ich war in Sarajewo, als Jane verschwand, und schoss eine Serie über die Auswirkungen des Krieges. Ich brauchte zweiundsiebzig Stunden, um nach New Orleans zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits das FBI auf der Bildfläche erschienen und hatte das Verschwinden meiner Schwester in einen weit größeren Fall eingegliedert, der im FBI-Jargon NOKIDS hieß, für »New Orleans Kidnappings«. Wie sich herausstellte, war Jane die fünfte in einer rasch wachsenden Gruppe verschwundener Frauen, ausnahmslos aus der Gegend von New Orleans. Nicht ein Leichnam war bisher gefunden worden, und so wurden die Frauen eingestuft als Opfer eines »Serienkidnappers«, wie das FBI es nannte. Es war eine Beschönigung der schlimmsten Sorte. Nicht ein Verwandter hatte eine Lösegeldforderung erhalten, und in den Augen eines jeden Cops, mit dem ich redete, sah ich die grimmige, unausgesprochene Wahrheit: Jede der verschwundenen Frauen war vermutlich tot. Doch ohne Beweise, ohne Tatorte, ohne Zeugen und ohne Leichen waren selbst die Beamten der berühmten Ermittlungs-Unterstützungs-Gruppe des FBI, der Investigative Support Unit in Quantico, machtlos. Die Spur war kalt. Und obwohl weitere Frauen verschwanden und dies noch immer tun, sind weder das FBI noch die Polizei von New Orleans bis heute auch nur einen Schritt weitergekommen, was das Schicksal meiner Schwester oder irgendeiner der anderen Frauen angeht.
Ich sollte eine Erklärung einschieben: Nicht ein einziges Mal seit dem Verschwinden meines Vaters in Kambodscha hatte ich das Gefühl, dass er wirklich tot war und diese Welt verlassen hatte, nicht einmal nach dem allerletzten Bild auf seinem Film, das die Pistole des Roten Khmer zeigt, die genau auf sein Gesicht zielt. Es geschehen immer wieder Wunder, besonders im Krieg. Aus diesem Grund habe ich in den vergangenen zwanzig Jahren Tausende von Dollars für Versuche ausgegeben, meinen Vater zu finden, genau wie viele andere Angehörige von im Vietnamkrieg verschollenen Soldaten. Ich habe meine Ersparnisse fürs Alter Trickbetrügern und Dieben förmlich in den Rachen gestopft, alles in der schwachen Hoffnung, dass eine Spur unter all den Hunderten sich als die richtige herausstellen könnte. Auf gewisse Weise war wohl auch meine Entscheidung, den Vorschuss des Verlegers anzunehmen, von der Möglichkeit bestimmt gewesen, bezahlt zu werden, während ich durch Asien trampend, mit einem Auge an der Kamera und einem Ohr am Boden, selbst nach meinem Vater suchte.
Mit Jane ist es etwas anderes. Bis meine Agentur mich endlich an einem Satellitentelefon in Sarajewo ausfindig gemacht hatte, war bereits eine unwiderrufliche Veränderung in mir vorgegangen. Als ich eine Straße überquerte, die einst von Heckenschützen verseucht war, wallte ein Nimbus aus Furcht in mir auf. Nicht die vertraute Furcht vor einer Kugel, die meinen Namen trug, sondern etwas viel Tieferes. Welche Energie auch immer meine Seele belebt, sie hörte einfach auf zu fließen, während ich rannte. Die Straße verschwand. Als wäre es neun Jahre früher, während der schlimmsten Zeit, als die Heckenschützen auf alles feuerten, was sich bewegte, lief ich blindlings in den dunklen Tunnel vor mir. Ein Kameramann von CNN zerrte mich hinter eine Mauer in der Annahme, ich hätte den Einschlag der mit einem Schalldämpfer abgefeuerten Kugel im Beton gesehen. Ich hatte nichts gesehen, doch einen Augenblick später, als die Straße wieder zurückkehrte, fühlte ich mich, als wäre die Kugel durch mich hindurchgegangen und hätte etwas mitgenommen, das kein Arzt mir jemals zurückgeben oder wieder in Ordnung bringen konnte.
Die Quantenphysik beschreibt so genannte »Zwillings-Partikel«, Photonen, die sich, obwohl sie räumlich meilenweit voneinander entfernt sind, genau gleich verhalten, wenn sie mit zwei Alternativen für ihre Bahn konfrontiert werden. Man glaubt heute, dass es eine unsichtbare Verbindung zwischen ihnen gibt, die sämtlichen bekannten physikalischen Gesetzen widerspricht und die ohne Rücksicht auf die Lichtgeschwindigkeit oder irgendeine andere bekannte Beschränkung funktioniert. Jane und ich waren auf diese Weise miteinander verbunden. Und von dem Augenblick an, in dem diese dunkle Furcht durch mein Herz pulsierte, spürte ich, dass mein Zwilling tot war. Zwölf Stunden später erhielt ich den Anruf.
Dreizehn Monate nach diesem Ereignis – vor zwei Stunden – spaziere ich in ein Museum und sehe ihr gemaltes Bild, nackt und im Tod – Ich bin nicht sicher, was unmittelbar danach geschah. Die Erde hörte nicht auf, sich zu drehen. Die Cäsiumatome in der Atomuhr von Boulder hörten nicht auf zu schwingen. Doch die Zeit im subjektiven Sinn – die Zeit, die mich ausmacht – hörte einfach auf. Ich wurde zu einem Vakuum in der Welt.
Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in der ersten Klasse an Bord einer Cathay Pacific 747 nach New York sitze. Ein pazifischer Sonnenuntergang erstrahlt in meinem Fenster, und die Vibrationen der vier großen Turbinen erzeugen winzige Wellen im Scotch auf dem Tablett vor mir. Das ist zwei Whiskys her, und ich habe noch immer neunzehn Stunden bis zur Landung. Meine Augen sind trocken und brennen, als wäre Sand darin. Ich bin leer geweint. Mein Verstand tastet sich zurück in Richtung Museum, doch irgendetwas ist im Weg. Ein Schatten. Ich hüte mich davor, die Erinnerung trotzdem heraufzuzwingen. In Afrika wurde ich einmal angeschossen, und von dem Augenblick, als die Kugel meine Schulter durchschlug, bis zu dem Zeitpunkt, als ich im Colonial Hotel wieder zur Besinnung kam und feststellte, dass ich von einem australischen Reporter versorgt wurde, dessen Vater Arzt war, war alles weg. Die fehlenden Ereignisse – eine hektische Tour im Jeep über eine befestigte Straße, das Bestechen eines Wachpostens an einem Kontrollpunkt (woran ich selbst teilgenommen habe) – kamen erst später wieder. Sie waren nicht verschwunden, sondern glatt aus meiner Erinnerung herausgefallen.
Genau wie im Museum. Doch hier, in der vertrauten Umgebung des Flugzeugs, mit der wohligen Wärme, die der dritte Scotch hervorruft, beginnen die Dinge zurückzukehren. Kurze, flüchtige Eindrücke zuerst, dann undeutliche Sequenzen, wie ein schlechtes Streaming Video. Ich stehe vor dem Gemälde einer nackten Frau, deren Gesicht bis hin zum letzten Detail mein eigenes ist, und meine Füße sind mit alptraumhafter Hartnäckigkeit am Boden angewurzelt. Die Männer, die sich hinter mir drängen, glauben offensichtlich, ich sei die Frau, die für das Bild an der Wand Modell gestanden hat. Sie schnattern unaufhörlich und rennen durcheinander wie Ameisen, deren Hügel mit Kerosin übergössen wurde. Sie sind verblüfft, weil ich lebendig bin, und wütend, weil ihre Fantasien über die »Schlafenden Frauen« ein Schwindel zu sein scheinen. Doch ich weiß Dinge, die sie nicht wissen. Ich sehe meine Schwester aus dem Haus in der St. Charles Avenue kommen, und wie Feuchtigkeit auf ihrer Haut kondensiert, noch bevor sie anfängt zu laufen. Drei Meilen sind ihr Ziel. Irgendwo im dschungelartigen Garden District setzt sie einen Fuß falsch und fällt in das gleiche Loch, in das 1972 mein Vater gefallen ist.
Und nun starrt sie mich aus leeren Augen an, von einer Leinwand herab, die so tief scheint wie ein Fenster zur Hölle. Nachdem ich Janes Tod innerlich akzeptiert, um sie getrauert und sie in meinem Herzen begraben habe, löst diese unerwartete Wiederauferstehung einen Sturm von Emotionen in mir aus. Doch irgendwo im chemischen Chaos meines Gehirns, im dunklen Auge des Hurrikans, funktioniert mein rationaler Verstand unbeirrt weiter. Wer auch immer dieses Bild gemalt hat, er muss meine Schwester gesehen haben, nachdem sie aus dem Garden District verschwand. Er muss wissen, was niemand sonst wissen kann: die Geschichte von Janes letzten Stunden, oder Minuten, oder Sekunden. Er hat ihre letzten Worte gehört. Er … Er? Wieso gehe ich davon aus, dass der unbekannte Künstler ein Mann ist?
Weil es mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Mann ist. Ich habe kein Verständnis für die Naomi Wolfs dieser Welt, doch statistische Tatsachen lassen sich nun einmal nicht leugnen. Es sind allein Männer, die diese obszönen Verbrechen begehen: Vergewaltigung, Mord an Fremden und das Pièce de Resistance, Serienmord. Es ist eine ausschließlich männliche Pathologie, die dahinter steckt: die Jagd, das Planen, die obsessiv gehegte Wut, die sich in komplexen Gewaltritualen entlädt. Ein Mann schwebt hinter diesen seltsamen Gemälden, wie ein Geist, und er besitzt Kenntnisse, die ich dringend brauche. Er allein kann mir geben, was ich im letzten Jahr entbehrt habe: Frieden.
Als ich in die gemalten Augen meiner Zwillingsschwester starre, keimt wilde Hoffnung in mir auf. Jane sieht tot aus auf dem Bild. Und der Audio-Führer des Museums äußert die Vermutung, dass dies für alle Frauen der Serie gilt. Doch trotz meiner Vorahnung in Sarajewo muss es eine Chance geben, dass Jane lediglich bewusstlos war, als ihr Bild gemalt wurde. Vielleicht stand sie unter Drogen, oder sie hat sich tot gestellt, wie wir es als Kinder getan haben. Wie lange dauert es, ein Bild wie dieses zu malen? Ein paar Stunden? Einen Tag? Eine Woche?
Ein besonders lauter Ausbruch von chinesischem Geschnatter durchbricht den Bann, in den mich das Bild gezogen hat. Ich werde der Tränen gewahr, die auf meinen Wangen kalt werden, und der fremden Hand auf meiner Schulter. Die Hand gehört einem der Bastarde, die hergekommen sind, um sich am Anblick nackter toter Frauen zu ergötzen. Ich habe das wilde Bedürfnis, die Leinwand herunterzureißen, um die Nacktheit und Blöße meiner Schwester vor diesen neugierigen Blicken zu schützen. Doch wenn ich ein Gemälde zerstöre, das Millionen von Dollar wert ist, lande ich im Gewahrsam der chinesischen Polizei – ein äußerst unangenehmer Umstand, bestenfalls.
Stattdessen renne ich los.
Ich renne, als wäre der Teufel hinter mir her, und halte erst an, als ich einen düsteren Raum erreiche, der mit alten, unter Glas gesicherten Dokumenten angefüllt ist. Es ist antike chinesische Poesie, handgemalt auf Papier, das so brüchig geworden ist wie die Flügel von Motten. Das einzige Licht kommt aus den Vitrinen selbst, und sie leuchten erst auf, wenn ich mich ihnen nähere. Meine Hände zittern, und als ich die Arme um meinen Leib schlinge, wird mir bewusst, dass mein restlicher Körper ebenfalls zittert. In der Dunkelheit sehe ich meine Mutter vor mir, wie sie sich in Oxford, Mississippi, langsam zu Tode trinkt. Ich sehe Janes Ehemann und ihre Kinder in New Orleans, wie sie sich nach Kräften bemühen, ohne Jane zu leben, auch wenn es ihnen alles andere als gut gelingt. Ich sehe die FBI-Agenten, die ich vor dreizehn Monaten kennen gelernt habe, ernste Männer mit guten Absichten und ohne die geringste Vorstellung, wie sie uns helfen könnten.
Als ich meine Laufbahn begann, habe ich Hunderte von Fotos an Verbrechensschauplätzen geschossen, doch mir war nie richtig bewusst, wie wichtig ein Leichnam für eine Morduntersuchung ist. Der Leichnam ist die Grundlage der gesamten Ermittlungen. Ohne Leichnam stehen die Ermittler vor einer Wand, die so leer ist wie ein unbelichteter Film. Das Bild im Ausstellungsraum des Museums ist nicht der Leichnam Janes, aber es ist vielleicht die heißeste Spur, die es jemals geben wird. Es ist ein Ausgangspunkt. Mit dieser Erkenntnis kommt eine weitere: Es gibt noch mehr Gemälde wie das von Jane. Nach den Worten des Audio-Führers insgesamt neunzehn. Neunzehn nackte Frauen, die schlafend oder tot porträtiert wurden. Soweit ich weiß, sind aus New Orleans nur elf verschwunden. Wer sind die anderen acht? Oder gibt es nur elf Frauen und erscheinen einige von ihnen auf mehr als einem Bild? Und was in Gottes Namen machen diese Bilder in Hongkong, auf der anderen Seite der Welt?
Stopp!, ruft eine Stimme in meinem Kopf. Die Stimme meines Vaters. Vergiss diese Fragen! Denk lieber an das, was du jetzt tun solltest!
Der Audio-Führer sagt, dass die Gemälde über einen New Yorker Händler namens Christopher Sowieso verkauft werden. Windham? Winwood? Wingate. Um ganz sicherzugehen, ziehe ich den Walkman von meinem Gürtel und ramme ihn in meine prall gefüllte Gürteltasche. Die Bewegung aktiviert eine Vitrinenbeleuchtung, und meine Augen schmerzen von der raschen Kontraktion meiner Pupillen. Während ich in den Schatten zurückgleite, wird mir das Offensichtliche bewusst. Wenn dieser Christopher Wingate in New York lebt, dann sind dort auch die Antworten zu finden. Nicht hier, nicht in diesem Museum. Im Büro des Kurators würde ich höchstens misstrauische Neugier erwecken. Ich brauche keine Polizei, ganz besonders keine kommunistische chinesische Polizei. Ich brauche das FBI. Die Investigative Support Unit. Doch das FBI ist zehntausend Meilen entfernt. Was würde die jungen Genies der forensischen Wissenschaften an diesem Museum interessieren? Die Gemälde natürlich. Die Gemälde kann ich nicht mitnehmen. Doch es gibt eine mögliche Alternative. In meiner Gürteltasche trage ich eine einfache Kleinbildkamera. Sie ist das fotojournalistische Äquivalent der Wadenhalfterpistole eines Cops – das Werkzeug, ohne das es einfach nicht geht. An dem einen Tag, an dem du sicher bist, keine Kamera zu benötigen, ereignet sich direkt vor deinen Augen eine weltbewegende Tragödie.
Beweg dich!, befiehlt die Stimme meines Vaters. Solange die Verwirrung anhält.
Den Weg zurück zum Ausstellungsraum habe ich rasch gefunden; ich folge lediglich dem Geräusch aufgeregter Unterhaltungen, die durch die leeren Räume hallen. Die Männer laufen immer noch durcheinander, und sie reden zweifellos über mich, die »Schlafende Frau«, die nicht schläft und ganz bestimmt nicht tot ist. Ohne jede Furcht nähere ich mich ihnen. Irgendwo zwischen dem Dokumentensaal und dieser Ausstellung mit dem Titel »Frauen in Ruhe« habe ich meine Schwester in ein dunkles Loch meiner Erinnerung geschoben und bin zu der Person geworden, die auf vier Kontinenten über Kriege berichtet hat – meines Vaters Tochter.
Bei meinem unerwarteten Wiederauftauchen drängen sich die Chinesen in dichten Gruppen zusammen. Ein Museumswächter befragt zwei von ihnen in dem Bemühen, herauszufinden, was geschehen ist. Dreist gehe ich an ihnen vorüber und schieße zwei Fotos von der Frau in der Badewanne. Der Blitz der kleinen Canon verursacht einen Schwall wütenden Chinesischs. Zielstrebig bewege ich mich durch den Raum und knipse zwei weitere Gemälde, bevor der Museumswächter mir in den Arm fällt. Ich wende mich ihm zu und nicke, als hätte ich verstanden, dann löse ich mich und gehe zu dem Bild von Jane. Ich schaffe ein weiteres Foto, bevor er mit seiner Pfeife um Hilfe ruft und mir erneut in den Arm fällt, diesmal mit beiden Händen. Manchmal kann man sich aus ähnlichen Situationen mit irgendeinem Sch … herauswinden. Dies ist keine davon. Falls ich immer noch hier stehe, wenn irgendein Verantwortlicher auftaucht, schaffe ich es niemals mitsamt meinem Film aus dem Museum. Ich versetze dem Wächter einen wohl gezielten Stoß mit dem Knie und renne zum zweiten Mal los, als sei der Teufel hinter mir her.
Erneut schrillt die Polizeipfeife, auch wenn es diesmal etwas weinerlicher klingt. Ich bremse rutschend auf dem gewachsten Boden, wende mich einer Feuertür zu und springe nach draußen, während hinter mir tausendfacher Alarm losgeht. Zum ersten Mal bin ich froh über die wimmelnden Menschenmassen von Hongkong; selbst eine Langnasenfrau kann innerhalb weniger Sekunden untertauchen. Dreihundert Meter weiter halte ich ein Taxi an, lasse mich aber nicht zur Star Ferry bringen – vielleicht hat mich jemand von Bord gehen sehen –, sondern durch den Tunnel unter dem Hafen hindurch in die City.
Wieder auf der Seite von Hongkong, rasen wir weiter zu meinem Hotel. Ich wohne im Peninsula; das ist zwar viel zu teuer für meine Verhältnisse, doch es hängen sentimentale Erinnerungen daran. Als Kind habe ich von meinem Vater mehrere Briefe aus ebendiesem Hotel erhalten. In meinem Zimmer angekommen, werfe ich meine Kleidung in meinen Koffer, packe meine Kameras in die Flightcases aus Aluminium und steige in ein anderes Taxi, das mich zum neuen Flughafen bringt. Ich will den chinesischen Luftraum hinter mir gelassen haben, bevor irgendein findiger Cop auf den Gedanken kommt, dass sie zwar vielleicht nicht meinen Namen, doch an der Museumswand ein perfektes Bild von mir hängen haben. Sie könnten innerhalb einer Stunde Flugblätter am Flughafen und in den Hotels verteilen. Ich bin nicht sicher, warum sie das tun sollten – ich habe schließlich kein Verbrechen begangen, außer einen Walkman zu stehlen –, doch ich wurde schon wegen kleinerer Vergehen verhaftet, und in der paranoiden Welt der Chinesen Hongkongs macht mich mein Verhalten in einem Museum mit Multi-Millionen-Dollar-Gemälden zu einer Bilderbuchkandidatin für eine vorläufige Festnahme.
Der Hongkong International Airport ist ein babylonisches Gewirr asiatischer Sprachen und hetzender Reisender. Ich habe eine Reservierung auf einem Air-China-Flug nach Beijing, doch die Maschine startet erst in drei Stunden. Auf den Departure-Tafeln entdecke ich einen Flug der Cathay Pacific nach New York, der in fünfunddreißig Minuten geht, mit einem Zwei-Stunden-Stopp auf dem Narita Airport in Tokio. Ich lege meinen abgegriffenen Reisepass auf den Schalter der Cathay und lasse mir von der Ticketverkäuferin den vollen Preis für einen Erste-Klasse-Flug abnehmen. Das Geld würde in den Staaten für einen schicken Gebrauchtwagen reichen, doch nach den Ereignissen im Museum kann ich unmöglich zwanzig Stunden lang Schulter an Schulter mit irgendeinem Computerverkäufer aus Raleigh sitzen. Dieser Gedanke führt zu einem weiteren, und ich frage die Ticketverkäuferin, ob sie mir einen Sitzplatz neben einer Frau geben kann. An diesem übelsten Tag von allen habe ich nicht die geringste Lust, angemacht zu werden, und zwanzig Stunden geben einem Typen jede Menge Zeit, eine Strategie nach der anderen auszuprobieren. Vergangenes Jahr hat mich doch tatsächlich irgendein betrunkener Idiot gefragt, ob ich mit ihm in der Toilette verschwinden und mich dem Mile High Club anschließen wolle. Ich antwortete, dass ich bereits Mitglied sei, was der Wahrheit entsprach. Ich bin vor neun Jahren beigetreten, mit meinem Verlobten im Frachtraum irgendwo über Namibia. Drei Tage später wurde er von
SWAPO-Guerillas gefangen genommen und totgeschlagen, was mich zum Mitglied in einem noch viel exklusiveren Club machte: dem der Inoffiziellen Witwen. Heute, mit vierzig, bin ich immer noch Single und immer noch Mitglied im Club. Die Cathay-Mitarbeiterin hinter dem Schalter lächelt wissend und kommt meiner Bitte nach.
Womit ich dort anlange, wo ich nun bin: drei Scotch intus und das Kurzzeitgedächtnis wieder voll da. Der Alkohol erfüllt gleich mehrere Funktionen; unter anderem dämpft er die Wogen der Trauer, die vom Grund meiner Seele aufwallen wollen. Doch neunzehn Stunden sind eine verdammt lange Zeit, um sich vor sich selbst zu verstecken. Ich habe einen Vorrat Xanax in meiner Gürteltasche, für die Nächte, in denen die offene Wunde des ungeklärten Schicksals meiner Schwester zu heftig pocht, um mich Schlaf finden zu lassen. Sie pocht auch jetzt, und es ist noch nicht einmal ganz dunkel. Bevor ich richtig nachgedacht habe, spüle ich drei Pillen mit einem Schluck Scotch herunter und nehme das Airfone aus meiner Armlehne.
Es ist das einzig Sinnvolle, was ich an Bord des Flugzeugs tun kann. Nachdem ich meine Visa ein paar Mal durchgezogen und mich durch die Verzeichnisdienste gekämpft habe, lande ich beim Operator der FBI Academy in Quantico, Virginia, der mich zu den Büros der Investigative Support Unit weiterverbindet. Die ISU ist in besseren Räumen untergebracht als früher, doch Daniel Baxter, der Leiter der Gruppe, mag die Bunkeratmosphäre der alten Tage, der Zeit, bevor zu viel Hollywood seine Gruppe zu einem Mythos gemacht hat, der eifrige junge Collegeabgänger zu Tausenden anzieht. Baxter muss inzwischen um die fünfzig sein, doch er ist ein schlanker, hungriger Fünfzigjähriger mit den Augen eines kampferfahrenen Soldaten. Diesen Eindruck hatte ich jedenfalls, als ich ihn das erste Mal sah. Ein Bursche aus den Mannschaftsdienstgraden, der auf dem Schlachtfeld zum Offizier befördert wurde – und niemand würde diese Beförderung jemals in Frage stellen. Baxters Erfolgsbilanz ist legendär in einem Krieg, in dem es nur wenige Siege und viele beinahe unerträgliche Niederlagen gibt. Beispielsweise meine Schwester und die zehn anderen verschwundenen Frauen. Baxters Truppe hat bei diesem Fall eine große Niete gezogen. Doch die bittere Tatsache bleibt – wenn eine bestimmte Sorte von Mist am Dampfen ist, dann gibt es niemanden außer Baxter, den man rufen könnte.
»Baxter?«, meldete sich eine durchdringende Baritonstimme.
»Hier ist Jordan Glass«, sage ich und bemühe mich nicht sonderlich erfolgreich, gegen meine schwere Zunge anzukämpfen. »Erinnern Sie sich an mich?«
»Sie sind schwer zu vergessen, Miss Glass.«
Ich nehme einen hastigen Schluck Scotch. »Vor etwas mehr als einer Stunde habe ich meine Schwester in Hongkong gesehen.«
Kurzes Schweigen am anderen Ende. »Haben Sie getrunken, Miss Glass?«
»Absolut. Aber ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Sie haben Ihre Schwester gesehen.«
»In Hongkong. Und nun sitze ich in einer 747 auf dem Weg nach New York.«
»Soll das heißen, Sie haben Ihre Schwester lebendig gesehen?«
»Nein.«
»Ich weiß nicht, ob ich Sie recht verstehe.«
Soweit ich dazu imstande bin, liefere ich Baxter eine präzise Zusammenfassung meiner Erlebnisse im Museum, dann warte ich auf seine Reaktion. Ich erwarte einen Ausdruck des Erstaunens. Vielleicht nicht gerade ein »Shazam« im Stil eines Gomer Pyle, aber wenigstens irgendetwas. Ich hätte es besser wissen müssen.
»Haben Sie eines der anderen Opfer aus New Orleans erkannt?«, fragt er.
»Nein. Aber ich habe die Bilder nach Nummer sechs nie gesehen.«
»Und Sie sind hundertprozentig sicher, dass das Gesicht auf diesem Gemälde das Gesicht Ihrer Schwester war?«
»Machen Sie Witze? Das ist mein Gesicht, Baxter. Mein Körper, nackt vor aller Augen.«
»Also schön … ich glaube Ihnen.«
»Haben Sie je von diesen Gemälden gehört?«
»Nein. Sobald unser Gespräch zu Ende ist, rede ich sofort mit unseren Kunstleuten. Und wir werden diesen Christopher Wingate unter die Lupe nehmen. Wann werden Sie in New York sein?«
»In neunzehn Stunden. Fünf Uhr nachmittags, New Yorker Zeit.«
»Versuchen Sie, im Flieger ein wenig zu schlafen. Ich werde Ihnen einen Anschlussflug vom JFK hierher buchen. Es wird ein E-Ticket sein, zeigen Sie einfach Ihren Pass oder Ihren Führerschein. Ich fahre nach Washington und treffe Sie im Hoover Building. Ich muss morgen sowieso dorthin, und für Sie ist es einfacher, als nach Quantico zu kommen. Ich schicke einen Agenten zum Reagan Airport, der Sie abholt. Haben Sie ein Problem damit?«
»Ja. Ich denke, Sie hätten es bei Washington National belassen sollen.«
»Miss Glass, ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Danke, bestens.«
»Sie klingen, als stünden Sie unter Schock.«
»Nichts, was eine medikamentöse Therapie nicht heilen könnte. Zusammen mit ein paar Schlucken von Schottlands Bestem.« Ein hysterisches Lachen kommt über meine Lippen. »Ich muss mich ein wenig beruhigen. Es war ein schwerer Tag für mich.«
»Ich verstehe. Aber beruhigen Sie sich nicht zu stark, hören Sie? Ich brauche Ihren scharfen Verstand.«
»Es ist immer wieder schön, gebraucht zu werden.« Ich unterbreche die Verbindung und lege das Airfone in die Armlehne zurück.
Vor dreizehn Monaten hast du mich nicht gebraucht, sage ich in Gedanken. Aber das war vor dreizehn Monaten. Inzwischen sehen die Dinge anders aus. Jetzt werden sie mich brauchen, bis sie die Bedeutung der Gemälde richtig eingeschätzt haben. Und dann werde ich erneut außen vor sein. Ausgeschlossen zu sein ist das Schlimmste, was einem Journalisten passieren kann – und für die Familie eines Opfers ist es die reinste Hölle. Besser, wenn ich jetzt nicht darüber nachdenke. Besser, wenn ich ein wenig schlafe. Ich lebe praktisch seit zwanzig Jahren in der Luft, und das Schlafen in Flugzeugen fiel mir nie schwer, bis Jane verschwunden ist. Seither brauche ich die Hilfe meiner kleinen Freunde.
Während sich der chemische Nebel über meine Augen legt, geht mir ein letzter kohärenter Gedanke durch den Kopf, und ich nehme das Airfone erneut aus der Lehne. Ich bin nicht mehr in der Verfassung, mich mit dem Verzeichnisdienst abzumühen, also schlage ich einen anderen Weg ein. Ron Epstein ist der Redakteur von Seite sechs der »New York Post«, und er kennt jeden in der Stadt. Wie Daniel Baxter ist er süchtig nach seiner Arbeit, was bedeutet, dass er trotz der frühen Tageszeit in New York im Augenblick wahrscheinlich in seinem Büro steckt. Als der Vermittler der Post mich in seine Abteilung durchstellt, meldet Ron sich am anderen Ende der Leitung.
»Ron? Hier ist Jordan Glass.«
»Jordan! Wo sind Sie?«
»Auf dem Weg nach New York.«
»Ich dachte, Sie wären irgendwo im Hinterland und würden Bilder von den Wolken machen oder etwas in der Art?«, kichert er.
»War ich auch.«
»Sie brauchen also etwas von mir. Sie rufen nie an, um einfach nur ein Schwätzchen zu halten.«
»Christopher Wingate. Schon mal gehört, den Namen?«
»Naturellement. Sehr chic, sehr cool. Er hat es geschafft, dass SoHo die Fünfzehnte Straße beneidet. Die alten Händler küssen ihm den Hintern, und je mehr sie es tun, desto mehr behandelt er sie wie Dreck. Jeder möchte Wingate als Agenten, doch er ist sehr wählerisch.«
»Was ist mit den ›Schlafenden Frauen‹?«
Ein bewunderndes Pfeifen. »Sie sind im Zirkel, wie? Nicht viele amerikanische Sammler wissen überhaupt von ihrer Existenz.«
»Ich will ihn treffen. Wingate, meine ich.«
»Um ihn zu fotografieren?«
»Ich will mit ihm reden.«
»Ich würde sagen, da müssen Sie sich hinten anstellen – aber vielleicht ist er ja neugierig genug, um mit Ihnen zu reden.«
»Können Sie mir seine Telefonnummer beschaffen?«
»Wenn ich es nicht kann, dann kann es niemand. Doch es wird eine Weile dauern. Seine Nummer steht in keinem Verzeichnis. Sie ist sehr exklusiv. Dieser Typ lässt ein Geschäft platzen, nur weil er den Käufer nicht mag. Kann ich Sie irgendwie erreichen?«
»Nein. Kann ich mich morgen wieder bei Ihnen melden? Ich muss eine Weile schlafen.«
»Bis morgen habe ich die Nummer.«
»Danke, Ron. Ich schulde Ihnen ein Essen bei Lutèce.«
»Lassen Sie mich das Lokal aussuchen, Süße, und wir haben einen Deal. Ich hoffe, Sie schlafen nicht allein. Ich kenne niemanden, der ein wenig Liebe nötiger hätte als Sie.«
Ich blicke mich in der Ersten Klasse um und mustere den zerknitterten Haufen von Geschäftsleuten. »Nein, ich bin nicht allein.«
»Gut. Dann also bis morgen.«
Der Nebel senkt sich inzwischen so rasch herab, dass ich das Airfone nur mühsam zurück in die Armlehne kriege. Gott sei Dank für Betäubungsmittel. Ich könnte es nicht ertragen, jetzt bei klarem Verstand zu bleiben. Wenn ich wieder aufwache, wird mir das Museum wie ein schlechter Traum erscheinen. Natürlich war es das nicht. Es war eine Tür. Eine Tür zu einer Welt, die ich wieder betreten muss, ob ich will oder nicht. Bin ich bereit dazu? »Sicher«, sage ich laut. »Ich war schon bei meiner Geburt bereit.« Doch tief in mir, unter der brüchigen Maske aus gespielter Tapferkeit, weiß ich, dass es eine Lüge ist.
3
Zwei Stunden bevor der Jet der Cathay Pacific in New York landet, kehre ich aus meinem drogeninduzierten Tiefschlaf zurück, stolpere in den Waschraum und zurück und bitte die Stewardess um ein heißes Handtuch. Dann rufe ich Ron Epstein an und erhalte die Nummer von Christopher Wingate. Es dauert eine Stunde, den Kunsthändler endlich an den Apparat zu bekommen. Ich hatte bereits befürchtet, dass ich die »Schlafenden Frauen« würde erwähnen müssen, um Wingates Aufmerksamkeit zu gewinnen, doch Epsteins Gefühl erweist sich als zutreffend. Wingate ist hinreichend neugierig auf meine bescheidene Berühmtheit, um mich ohne weitere Erklärungen nach Geschäftsschluss in seiner Galerie zu empfangen. Von seiner Stimme her ist er schwer einzuschätzen. Er redet mit einem affektierten Akzent, den ich nicht einordnen kann. Er erwähnt mein Buchprojekt, und ich schätze, er hofft, dass ich einen Galeristen suche, um meine Fotografien auf dem Kunstmarkt abzusetzen.
Mich allein mit Wingate zu treffen ist riskant, doch meine Arbeit war stets mit einem kalkulierten Risiko verbunden. Kriege zu fotografieren ist wie kommerzieller Fischfang vor der Küste von Alaska: Man fährt hinaus in dem Wissen, dass man vielleicht nicht zurückkehrt. Doch auf einem Fischerboot vor der Küste Alaskas sind es die Elemente, gegen die man kämpft, der Ozean und das Wetter. In einem Kriegsgebiet sind es die Menschen, die versuchen dich zu töten. Das Treffen mit Christopher Wingate könnte sehr wohl auf das Gleiche hinauslaufen. Ich muss davon ausgehen, dass er inzwischen von dem Vorfall im Museum gehört hat. Er wird meinen Namen nicht kennen, doch er wird wissen, dass die Frau, die für den Aufruhr in Hongkong verantwortlich war, ganz genau wie eine der »Schlafenden Frauen« ausgesehen hat. Weiß er auch, dass eine der »Schlafenden Frauen« aussieht wie die Fotografin Jordan Glass? Er kennt meinen Ruf, doch es ist unwahrscheinlich, dass er schon einmal ein Bild von mir gesehen hat. Ich wohne seit zwölf Jahren nicht mehr in New York, und damals waren meine Arbeiten längst nicht so bekannt wie heute. Die eigentliche Gefahr ergibt sich daraus, wie gut Wingate mit dem Maler der »Schlafenden Frauen« bekannt ist. Weiß er, dass die Modelle auf den Gemälden real sind? Dass sie als vermisst und wahrscheinlich tot gelten? Falls ja, dann ist er bereit, um ein Vermögen an Provisionen zu verdienen, die Augen vor den möglichen Morden zu verschließen. Wie gefährlich macht ihn das? Ich werde es erst wissen, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Eines ist sicher: Wenn ich zuerst nach Washington fliege und mit dem FBI rede, werden sie mich niemals zu Wingate lassen. Jede Information wird aus zweiter Hand zu mir kommen, genau wie damals, nachdem Jane verschwunden war.
Ich gehe durch den Zoll am JFK und rolle meinen Koffer zum Schalter von American Airlines, wo ich mein E-Ticket einsammle und mein Gepäck für den Flug aufgebe. Dann verlasse ich das Flughafengebäude und steige in ein Taxi. Ich lasse meine Kameras nur ungern allein nach Washington weiterfliegen, doch wenn ich heute Abend Daniel Baxter anrufe und ihm erzähle, dass ich krank geworden bin und meinen Flug verpasst habe, wird er mir auf diese Weise eher Glauben schenken.
Bevor ich nach Lower Manhattan fahre, lasse ich mich von dem Cabbie zu einem Pfandleiher in der neunundachtzigsten Straße bringen. Dort kaufe ich für fünfzig Dollar eine chemische Keule, die in meine Tasche passt. Ich würde lieber eine Pistole tragen, doch das Risiko ist einfach zu groß. Das NYPD nimmt Verstöße gegen das Waffengesetz sehr ernst.
Als das Taxi schließlich vor Wingates Galerie in der Fünfzehnten Straße hält, hat bereits die Dämmerung eingesetzt. Ich stehe vor einem Haus aus braunem Sandstein wie tausend andere in der Stadt, eingerahmt von einer Bar auf der einen und einer Videothek auf der anderen Seite. Die schicke Atmosphäre des Künstlerbezirks von Chelsea findet sich schätzungsweise in einem anderen Bereich des Stadtteils.
Ich bezahle den Taxifahrer und bitte ihn zu warten, dann steige ich aus und mustere den Eingang. An der Tür gibt es einen Summer, der ganz gewöhnlich aussieht, aber aller Wahrscheinlichkeit nach mit allen möglichen Sicherheitsmechanismen verbunden ist. Ich setze eine Sonnenbrille auf, als ich mich nähere, für den Fall, dass es eine Videokamera gibt.
Es gibt eine. Ich betätige den Summer und warte.
»Wer sind Sie?«, erkundigt sich die gleiche, nicht einzuordnende Stimme, die ich von meinem Anruf her kenne.
»Jordan Glass.«
»Einen Augenblick bitte.«
Der Summer summt, das Schloss entriegelt sich, und ich ziehe die Tür auf. Das Erdgeschoss der Galerie liegt im Halbdunkel der Neonröhren im ersten Stock, die durch das Treppenhaus leuchten. Durch meine Sonnenbrille kann ich nicht viel erkennen, doch die Ausstattung erscheint mir höchst spärlich für eine angesagte New Yorker Kunstgalerie. Der Boden besteht aus gebleichten Dielen, die Wände sind weiß. Die Gemälde sehen größtenteils modern aus, oder jedenfalls entsprechen sie meiner Vorstellung von modern. Jede Menge greller Farben, angeordnet in asymmetrischen Mustern, mit denen ich nichts anfangen kann. Man hat mich eine Künstlerin genannt – puristische Fotojournalisten haben mich während gegnerischer Angriffe so genannt –, doch das qualifiziert mich längst nicht als Kunstsachverständige. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich Kunst erkennen würde, wenn ich sie sehe.
»Gefällt Ihnen dieser Lucian Freud?«, fragt die gleiche Stimme, die ich draußen aus dem Lautsprecher gehört habe.
Ein Mann steht auf dem Treppenabsatz, wo die Eisentreppe eine Biegung um hundertachtzig Grad macht« Mitten in einer Säule aus Licht, als wäre er plötzlich dort materialisiert. Er ist drahtig und wird bereits kahl, doch das kompensiert er mit einem kurz geschorenen schwarzen Stoppelbart. In seiner schwarzen Jeans mit dem T-Shirt und der Lederjacke sieht er aus wie die Mafiaschläger, die ich vor ein paar Jahren in Moskau gesehen habe: ein leicht unterernährtes, hungriges Raubtier, insbesondere um die Augen und den Mund herum.
»Eigentlich nicht, nein«, gestehe ich mit einem raschen Blick auf das Gemälde, das mir am nächsten hängt. »Sollte er?«
»Sollte hat damit überhaupt nichts zu tun. Obwohl das Bild wahrscheinlich eine bessere Chance hätte, Sie zu beeindrucken, wenn Sie die Sonnenbrille absetzen würden.«
»Es würde mir trotzdem nicht besser gefallen. Ich bin nicht hergekommen, um mir dieses Bild anzusehen.«
»Und weswegen sind Sie hergekommen?«
»Wegen Ihnen, das heißt, falls Sie Christopher Wingate sind.«
Er winkt mich herbei, dann wendet er sich um und steigt die Treppe hinauf. Ich folge ihm.
»Tragen Sie abends immer eine Sonnenbrille?«, fragt er über die Schulter.
»Warum? Spricht etwas dagegen?«
»Es sieht so nach Julia Roberts aus.«
»Dann haben Julia Roberts und ich tatsächlich etwas gemeinsam.«
Wingate kichert. Er ist barfuss, und seine bleichen, schmutzigen Fersen scheinen die Treppe hinauf zu schweben. Er geht am ersten Stock vorbei, in dem Skulpturen untergebracht sind, und steigt weiter in Richtung zweites Obergeschoss. Hier wohnt er offensichtlich. Alles sieht dänisch aus, klare Linien und skandinavische Hölzer, und es riecht nach frischem Kaffee. In der Mitte des Raums steht eine große, unvernagelte Holzkiste mit Verpackungsmaterial, das über die Ränder quillt. Auf dem Deckel liegen ein Klauenhammer und eine Reihe Nägel. Wingate legt Besitz ergreifend die Hand auf die Kiste, als er an ihr vorbeigeht. Sie reicht ihm bis zur Schulter.
»Was ist in der Kiste?«
»Ein Gemälde. Bitte nehmen Sie doch Platz.«
Ich deute auf die Kiste. »Sie arbeiten hier oben? Es sieht aus wie Ihre Wohnung.«
»Es ist ein besonderes Gemälde. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass ich es zu Gesicht bekomme. Ich möchte mich an ihm erfreuen, solange ich kann. Möchten Sie einen Espresso? Cappuccino? Ich wollte mir gerade einen machen.«
»Cappuccino.«
»Gut.« Er geht zu einer Maschine aus blauer Emaille auf einer Theke hinter ihm und beginnt zu hantieren. Während er mir den Rücken zuwendet, trete ich zu der offenen Kiste. Im Innern ruht ein schwerer, goldener Rahmen. Ich spähe in das Dunkel zwischen Kistenwand und Rahmen; ich kann nicht viel erkennen, doch was ich sehe, ist genug: der Oberkörper und der Kopf einer nackten Frau. Ihre Augen sind offen und starren merkwürdig friedvoll ins Leere. Wingate ist noch immer mit den Bechern zugange, als ich von der Kiste zurücktrete.
»Und welcher Tatsache verdanke ich dieses Vergnügen?«, fragt er die Wand.
»Ich habe Gutes über Sie gehört. Man sagt, Sie wären ein äußerst wählerischer Verkäufer.«
»Ich verkaufe nicht an Dummköpfe.« Mit einer schwungvollen Bewegung gibt er geschäumte Milch auf den Kaffee. »Es sei denn, sie wissen, dass sie Dummköpfe sind. Das ist etwas anderes. Wenn jemand zu mir kommt und sagt: ›Mein Freund, ich weiß überhaupt nichts über Kunst, aber ich würde gerne anfangen zu sammeln. Würden Sie mich beraten?‹, dann helfe ich dieser Person selbstverständlich.« Ein weiteres Zischen von Wasserdampf in Milch. »Doch diese anmaßenden weißen protestantischen Angelsachsen bringen mich zum Kotzen. Sie haben Kunstkritik an der Yale studiert, oder ihre Frauen haben an der Vassar einen Kursus über die Meister der Renaissance absolviert. Sie wissen alles – wofür brauchen sie da mich? Als Aushängeschild, wie? Sollen sie mir den Buckel runterrutschen. Mein Ruf steht nicht zum Verkauf«
»Nicht für Dummköpfe jedenfalls.«
Er wendet sich grinsend um und bietet mir eine dampfende Tasse an. »Ich mag Ihren Akzent. Sie kommen aus South Carolina?«
»Nicht einmal aus der Nähe«, antworte ich und trete einen Schritt vor, um die Tasse entgegenzunehmen.
»Aber aus dem Süden. Woher?«
»Aus dem Magnolien-Staat.«
Er sieht mich verblüfft an. »Louisiana?«
»Das ist das Sportlerparadies. Ich stamme aus der Heimat von William Faulkner und Elvis Presley.«
»Georgia?«
Ich bin definitiv in New York, denke ich. »Mississippi, Mr Wingate.«