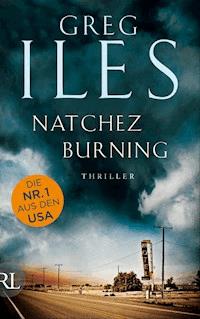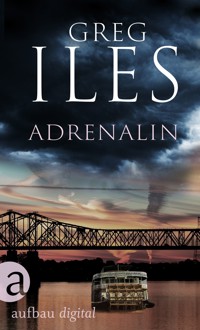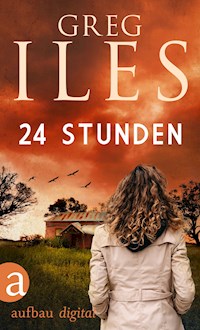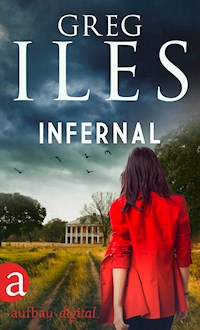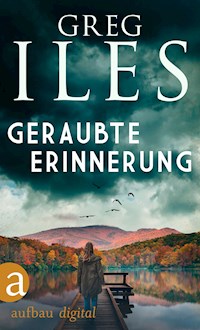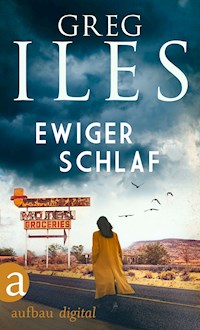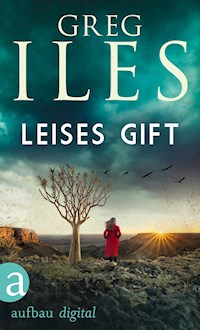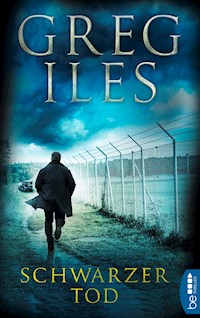
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein dunkler Plan in einer noch dunkleren Zeit ...
Im Januar 1944 halten vier Menschen das Schicksal der Welt in ihren Händen: ein amerikanischer Arzt, eine deutsche Krankenschwester, ein zionistischer Attentäter und eine junge jüdische Witwe. Im Auftrag des britischen Premierministers Winston Churchill sollen sie eine Mission erfüllen, die ihnen allen den Tod bringen kann.
In einem Gefangenenlager in Mecklenburg arbeiten die Deutschen fieberhaft an der Herstellung von Giftgas, dessen Einsatz den Krieg entscheiden soll. Die Briten verfügen ebenfalls über diese Wunderwaffe, und Churchills Plan ist einfach - aber auch perfide: Die vier Auserwählten sollen das britische Giftgas in dem deutschen Lager freisetzen und die Pläne der Nazis zunichtemachen - ohne Rücksicht auf die zumeist jüdischen Gefangenen ...
Spannung pur - ein fesselnder historischer Thriller von Greg Iles und laut Autor sein bestes Buch!
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 910
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Epilog
Nachwort
Weitere Titel des Autors
Unter Verschluss
Adrenalin
@E.R.O.S.
12 Stunden Angst
Über dieses Buch
Ein dunkler Plan in einer noch dunkleren Zeit …
Im Januar 1944 halten vier Menschen das Schicksal der Welt in ihren Händen: ein amerikanischer Arzt, eine deutsche Krankenschwester, ein zionistischer Attentäter und eine junge jüdische Witwe. Im Auftrag des britischen Premierministers Winston Churchill sollen sie eine Mission erfüllen, die ihnen allen den Tod bringen kann.
In einem Gefangenenlager in Mecklenburg arbeiten die Deutschen fieberhaft an der Herstellung von Giftgas, dessen Einsatz den Krieg entscheiden soll. Die Briten verfügen ebenfalls über diese Wunderwaffe, und Churchills Plan ist einfach – aber auch perfide: Die vier Auserwählten sollen das britische Giftgas in dem deutschen Lager freisetzen und die Pläne der Nazis zunichtemachen – ohne Rücksicht auf die zumeist jüdischen Gefangenen …
Spannung pur – ein fesselnder historischer Thriller von Greg Iles und laut Autor sein bestes Buch!
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Greg Iles wurde in Deutschland geboren, da sein Vater damals die medizinische Abteilung der Amerikanischen Botschaft leitete. Er verbrachte seine Jugend in Natchez, Mississippi. 1983 beendete er sein Studium an der University of Mississippi. Danach trat Greg Iles zunächst als Profi-Musiker auf, bevor er sich der Schriftstellerei widmete. Seine Bücher erscheinen inzwischen in 25 Ländern. Der überaus produktive Autor pflegt außerdem eine Leidenschaft für Filme. Der Autor lebt mit Frau und zwei Kindern in Natchez, Mississippi.
Greg Iles
Schwarzer Tod
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Wolfgang Thon
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1995 by Greg Iles
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Black Cross
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Dutton, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2015/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © oraziopuccio/AdobeStock; carstenbrandt/iStock; Jewelsy/iStock; © Silas Manhood
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1028-2
be-ebooks.de
lesejury.de
FürBetty Thornhill Ilesundalle Frauen und Männer,die ihr Leben für den Kampfder Alliierten geopfert haben.
Danksagung
Vielen Dank an Natasha Kern, eine »Super«agentin im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielen Dank auch an Elaine Koster, eine Verlegerin, die den Mumm hat zuzulassen, dass ihre Autoren die Regeln verletzen.
Mein besonderer Dank gilt John Grisham.
Und Edward Stackler, einem großartigen Lektor und Meister des POV!
Für ihre Hilfe bei den Recherchen bedanke ich mich bei:
Schottland: Colin Maclean und Beryl Austin; London: Folly Marland, Stuart Hamilton und dem Imperial War Museum, Peters Simkins; Washington D.C.: David Kasmier; Portland OR: Oriana Green, Novato CA: Dale Wilson.
Medizinische Ratgeber: Jerry Iles, M.D., Michael Bourland, M.D., Noah Archer, M.D., Barry Tillman, M.D., David Steckler, M.D.
Elektronik: Marlon Copeland, Howard Wooten.
Sprachen: Toos S. Nooijen, Jean-Claude Coulerez, Susan Callon, Christof Schauwecker, Gloria Glickstein Brame.
8th US Air Force: Austin Ingels, Donald Toye.
Judaica: Jerry Gross, Louis DeVries, Ronald E. Stackler.
Schottische Politik: Diana Gabaldon.
Vielen Dank an Jeff Walker für seine teuflischen Plottips.
Vielen Dank auch an Geoff Iles für seinen brüderlichen Rat.
Ruhm gebührt auch den Profis bei Dutton/Signet.
Korrekturleser: Betty Iles, Courtney Aldridge, Mary Lou England.
Das »Wir-halten-deine-Bessenheit-aus«-Committee: Carri und Madeline.
Für alle Fehler übernehme ich allein die Verantwortung.
Es gibt einen geheimnisvollen Zyklus in der menschlichen Geschichte.
Manchen Generationen ist viel gegeben.
Von anderen Generationen wird viel erwartet.
Diese Generation hat ein Rendezvous mit dem Schicksal.
Franklin Delano Roosevelt
1
Es ist merkwürdig, wie oft der Tod eher einen Anfang denn ein Ende markiert. Wir kennen Menschen seit zehn, zwanzig Jahren oder länger. Wir sehen sie jeden Tag. Wir reden, lachen und streiten mit ihnen; wir glauben zu wissen, wer sie sind.
Dann sterben sie.
Im Tod nehmen die Eindrücke, die man im Laufe eines ganzen Lebens bekommen hat, endgültig Gestalt an. Die Bilder werden schärfer. Neue Tatsachen kommen ans Licht. Safes werden geöffnet, Testamente verlesen. Aus der Distanz erkennen wir endgültig, dass die Menschen, die wir zu kennen glaubten, in Wirklichkeit ganz anders waren, als wir sie uns vorgestellt hatten. Und je näher wir ihnen gestanden haben, desto schockierender ist diese Erkenntnis.
So war es bei meinem Großvater. Er starb eines gewaltsamen Todes, und das in aller Öffentlichkeit. Die Umstände waren so außergewöhnlich, dass darüber dreißig Sekunden lang landesweit in den Abendnachrichten berichtet wurde. Es geschah letzten Dienstag in einem Rettungshubschrauber, der von Fairplay, Georgia, der kleinen Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin, in das Emory University Hospital in Atlanta unterwegs war. Dort arbeite ich als Arzt in der Notaufnahme. Mein Großvater ist im Schwesternzimmer zusammengebrochen, während er gerade seine Visite im Krankenhaus von Fairplay machte. Tapfer hat er den schrecklichen Schmerz im unteren Rückenbereich ignoriert und sich von einer Schwester Blut abnehmen lassen. Nachdem man ihm die Werte gesagt hatte, hat er eine korrekte Diagnose gestellt, nämlich eine geplatzte, krankhaft erweiterte Hauptschlagader. Ihm war klar, dass er ohne eine sofortige Notoperation sterben würde.
Mithilfe zweier Schwestern konnte er gerade noch so lange telefonieren, um den MedStar Hubschrauber aus dem vierzig Meilen entfernten Atlanta zu alarmieren. Meine Großmutter bestand darauf, an seiner Seite zu bleiben, und der Pilot hat zögernd nachgegeben. Normalerweise ist das nicht erlaubt, aber in der Medizinergemeinde von Georgia kannte so ziemlich jeder meinen Großvater: einen ruhigen, doch ungeheuer hoch angesehenen Lungenspezialisten. Außerdem war meine Großmutter keine Frau, der Männer zu widersprechen wagten. Niemals.
Zwanzig Minuten später ist der Hubschrauber auf einer ruhigen Straße in einer Vorstadt von Atlanta aufgeschlagen. Das war vor vier Tagen, doch man weiß noch immer nichts über die Absturzursache. Es war wohl eines dieser verrückten Dinge, glaube ich. Sie nennen das gern Pilotenfehler. Mir ist es jedoch wirklich egal, wessen Fehler es gewesen ist, und ich will auch niemanden vor Gericht zerren. So eine Familie sind wir nicht oder vielmehr waren wir nicht.
Der Tod meiner Großeltern hat mich besonders hart getroffen, weil sie mich seit meinem fünften Lebensjahr aufgezogen haben. Meine Eltern sind bei einem Autounfall in den 70er-Jahren ums Leben gekommen. Ich habe wohl ein mehr als gerüttelt Maß an Tragödien miterlebt. Und es geht immer weiter. Jeden Tag und jede Nacht ist die Unfallambulanz voll davon, und sie hinterlassen eine Spur von Blut, Kokain, Whiskyatem, verbrannter Haut und toten Kindern. So ist das Leben. Ich schreibe das nieder, um die Geschehnisse bei der Beerdigung besser erklären zu können. Oder genauer: wegen der Menschen, die ich bei der Beisetzung kennengelernt habe. Denn dort, an diesem Ort des Todes, ist endlich das Geheimnis gelüftet worden, das mein Großvater sein Leben lang gehütet hat.
Die für unsere kleine Stadt recht umfangreiche Trauergemeinde, die hauptsächlich aus Protestanten bestand, kehrte bereits zu der langen Schlange aus dunklen Lincolns und meist helleren japanischen Fahrzeugen zurück. Ich stand auf der Grasnarbe neben den Gräbern, zwei Löchern, die nebeneinanderlagen und nach frisch aufgeworfener Erde rochen. Zwei Totengräber warteten darauf, die silbrig glänzenden Kisten mit Erde zu bedecken. Sie schienen es nicht besonders eilig zu haben. Beide waren sicherlich schon einmal Patienten meines Großvaters gewesen. Einer von ihnen, ein drahtiger Bursche namens Crenshaw, war sogar von ihm zur Welt gebracht worden; das behauptete er jedenfalls.
»Solche Ärzte wie Ihren Großvater gibt es heute nicht mehr, Mark«, erklärte er. »Oder Doktor, sollte ich wohl besser sagen.« Er lächelte. »Ich kann mich an den Titel einfach nicht so richtig gewöhnen. Ich will Sie nicht beleidigen, aber ich erinnere mich noch daran, wie ich Sie hier draußen um Mitternacht mit dem Clark-Mädchen erwischt habe.«
Ich erwiderte sein Lächeln. Die Erinnerung gefiel mir. Und außerdem kann ich mich auch nicht an den Titel gewöhnen. Doktor McConnell. Ich weiß, dass ich einen Doktor habe, einen sehr guten sogar, aber wenn ich neben meinem Großvater stehe, oder vielmehr stand, dann habe ich mich immer mehr wie ein Lehrling gefühlt: ein kluger, aber unerfahrener Student im Schatten seines Meisters. Daran dachte ich gerade, als jemand von hinten an meinem Jackettärmel zupfte.
»Guten Tag, Rabbi«, sagte der Totengräber und nickte jemandem hinter mir zu.
»Shalom, Mr. Crenshaw«, erwiderte eine tiefe, weise klingende Stimme. Ich drehte mich um. Hinter mir stand ein onkelhafter alter Mann mit schlohweißem Haar und einer Jarmulke auf dem Kopf. Mit funkelnden Augen musterte er mich von Kopf bis Fuß. »Wirklich das Ebenbild«, sagte er ruhig. »Obwohl Sie ein wenig kräftiger sind als Mac.«
»Das sind die Gene meiner Großmutter«, erwiderte ich. Dass ich nicht wusste, wer der Mann war, war mir ein wenig unangenehm.
»Sehr richtig«, antwortete der alte Mann. »Sehr richtig. Und außerdem war sie auch eine wunderschöne Frau.«
Plötzlich wusste ich, woher ich ihn kannte. »Rabbi Leibowitz, nicht wahr?«
Der alte Mann lächelte. »Sie haben ein gutes Gedächtnis, Doktor. Es ist schon lange her, dass Sie mich aus der Nähe gesehen haben.«
Die Stimme des alten Mannes besaß einen heiseren, melodischen Klang, als wenn die Ecken und Kanten von den Jahren gemessener Rede abgeschliffen worden wären. Ich nickte. Die Totengräber traten von einem Fuß auf den anderen.
»Nun«, sagte ich, »es wird wohl allmählich Zeit …«
»Ich nehme die Schaufel«, sagte Rabbi Leibowitz zu Crenshaw.
»Aber Rabbi, Sie sollten sich so eine schwere Arbeit nicht mehr zumuten.«
Der Rabbi nahm dem verblüfften Totengräber die Schaufel aus der Hand und stieß sie in den weichen Erdhaufen. »Diese Arbeit gebührt dem Freund eines Mannes und seiner Familie«, sagte er. »Doktor?« Er sah mich an.
Ich nahm dem zweiten Gräber die Schaufel ab und folgte dem Beispiel des Rabbi.
»Schönen Tag, Mark.« Crenshaw war leicht verstimmt und trottete mit seinem Kollegen zu dem verbeulten Pickup, der in angemessener Entfernung wartete.
Ich schaufelte mit regelmäßigen Bewegungen Erde in das Grab meiner Großmutter, während Rabbi Leibowitz sich Großvaters Grab annahm. Es war heiß, ein typischer heißer Georgia-Sommertag, und ich schwitzte bald aus allen Poren. Als sich das Grab langsam füllte und die Erde mir fast bis zu den Füßen reichte, stellte ich etwas überrascht fest, dass dieses Schaufeln besser war als irgendetwas anderes, seit ich vom Tod meiner Großeltern erfahren hatte. Und es tröstete mich weit mehr als alles, was mir die Leute gesagt hatten. Verblüfft bemerkte ich, dass der alte Mann mit seiner Arbeit nur wenig hinter mir zurückstand. Ich riss mich zusammen und schaufelte weiter.
Schließlich war ich mit dem Grab meiner Großmutter fertig und ging zu Rabbi Leibowitz, um ihm zu helfen. Zusammen füllten wir das Grab meines Großvaters innerhalb weniger Minuten. Der Rabbi legte die Schaufel auf den Boden hinter sich, drehte sich zum Grab um und begann, leise zu beten. Ich blieb schweigend stehen und hielt die Schaufel fest, bis er fertig war. Dann gingen wir wie in gegenseitigem Einverständnis zu der schmalen, asphaltierten Straße, wo ich meinen schwarzen Saab geparkt hatte.
Weit und breit waren keine anderen Wagen mehr zu sehen. Der Friedhof lag gute anderthalb Meilen von der Stadt entfernt. »Sind Sie den ganzen Weg hier heraus zu Fuß gegangen, Rabbi?«
»Ein guter Christ hat mich mitgenommen«, antwortete er. »Und ich hatte gehofft, dass ich vielleicht mit Ihnen zurückfahren könnte.«
Diese Bitte kam etwas plötzlich, ich willigte aber trotzdem ein. »Sicher, es würde mich freuen.«
Ich öffnete ihm die Beifahrertür, ging dann um den Wagen herum und setzte mich hinters Steuer. Der schwedische Motor brummte geschmeidig. »Wohin?«, fragte ich. »Wohnen Sie immer noch gegenüber der Synagoge?«
»Ja. Aber ich hatte eigentlich daran gedacht, dem Haus Ihrer Großeltern einen Besuch abzustatten. Wohnen Sie nicht dort, wenn Sie in der Stadt sind?«
»Doch«, gab ich zu. »Das tue ich.« Ich sah ihn neugierig an. Dann empfand ich ein Gefühl des Wiedererkennens. Solche Situationen hatte ich schon vorher erlebt. Manche Leute fühlen sich einfach nicht wohl, wenn sie ernste medizinische Symptome in einer Arztpraxis beschreiben müssen. »Wollen Sie mir etwas mitteilen, Rabbi?«, fragte ich bedächtig. »Brauchen Sie ärztlichen Rat?«
»Nein, nein, mir geht es ganz gut für mein Alter – Gott sei Dank. Aber es gibt tatsächlich etwas, worüber ich gern mit Ihnen sprechen würde, Mark. Etwas, das Ihr Großvater Ihnen wohl erzählen wollte … irgendwann. Ich vermute, dass er nicht mehr rechtzeitig dazu gekommen ist.«
»Wovon reden Sie?«
»Über das, was Ihr Großvater im Krieg getan hat, Mark. Haben Sie jemals darüber gesprochen?«
Ich spürte, wie ich errötete. »Nein. Er hat niemals über die Vergangenheit gesprochen. ›Ich habe meine Pflicht getan, als es erforderlich gewesen ist‹ war alles, was ich je aus ihm herausbekommen konnte.«
»Das sieht ihm ähnlich.«
»Er hat auch niemals mit meiner Großmutter darüber gesprochen«, beichtete ich zu meiner eigenen Überraschung. »Sie hat es mir erzählt, und … es hat sie verletzt. Es war wie ein … ein Loch in unserem Leben. Ein kleines vielleicht, aber trotzdem: Es war da. Ein dunkler Fleck, verstehen Sie?«
Rabbi Leibowitz nickte. »Ein sehr dunkler Fleck sogar, und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass jemand für Sie ein bisschen Licht darauf wirft.«
Eine Viertelstunde später standen wir im Arbeitszimmer des großelterlichen Hauses. In diesem weitläufigen, mit Schindeln verschalten Landhaus waren drei Generationen von Ärzten aufgewachsen. Wir standen vor dem stählernen, feuersicheren Safe, in dem mein Großvater immer seine persönlichen Unterlagen aufbewahrt hatte.
»Kennen Sie die Kombination?«, fragte der Rabbi.
Ich schüttelte den Kopf. Er griff in seine Gesäßtasche, zog seine Brieftasche hervor und kramte darin herum, bis er gefunden hatte, was er suchte. Eine kleine weiße Visitenkarte, die meines Großvaters. Der Rabbi las einige Zahlen von der Rückseite ab und sah mich anschließend erwartungsvoll an.
»Hören Sie, Rabbi …« Mir wurde allmählich unbehaglich. »Ich weiß nicht genau, was wir hier wollen. Ich meine, ich weiß, dass Sie und meine Großeltern miteinander bekannt waren, aber ich wusste nicht, dass Sie sich so nahestanden. Und ehrlich gesagt glaube ich kaum, dass irgendetwas in diesem Safe Sie etwas angehen könnte.« Ich hielt inne. »Es sei denn … Hat er der Synagoge etwas in seinem Testament hinterlassen? Ist es das?«
Leibowitz kicherte. »Sie sind ein misstrauischer Mensch, Mark, genau wie Ihr Großvater. Nein, das hier hat nichts mit Geld zu tun. Um ehrlich zu sein, bezweifle ich, dass Mac viel hinterlassen hat. Bis auf seine Lebensversicherung; aber die beläuft sich nur auf etwa 50 000 Dollar, glaube ich. Er hat den größten Teil seines Geldes verschenkt.«
Ich blickte ihn von der Seite her an. »Woher wissen Sie das alles?«
»Ihr Großvater und ich waren mehr als nur Bekannte, Mark. Wir waren enge Freunde. Und von dem Geld weiß ich, weil er viel davon der Synagoge gespendet hat. Er glaubte, dass Sie nach erfolgreichem Medizinstudium auf eigenen Beinen stehen könnten, genauso wie er davon ausging, dass Ihre Großmutter allein zurechtkommen würde, falls er zufällig als Erster sterben würde. Natürlich gehört ihm dieses Haus. Das bekommen Sie. Und was das Geld anging, das er mir gegeben hat: Es war für verfolgte Juden bestimmt, die versuchten, Israel zu erreichen.« Leibowitz drehte seine schwieligen Handflächen nach oben. »Das alles hat seine Wurzeln im Krieg, Mark. Es hängt mit dem zusammen, was Ihr Großvater im Krieg getan hat. Wenn Sie diesen Safe öffnen, wird Ihnen alles sehr viel klarer werden.«
Man konnte dieser vernünftigen, aufrichtigen Stimme nur schwer widersprechen. »Einverstanden.« Ich wusste zwar, dass ich manipuliert wurde, aber seltsamerweise konnte ich mich nicht dagegen wehren. »Lesen Sie die Kombination noch einmal vor.«
Während Leibowitz las, drehte ich das Schloss, bis ich ein deutliches Klick hörte; dann zog ich die schwere Tür auf. Ganz vorn lag ein großer Stapel Papiere. Genau, was ich erwartet hatte. Es schien sich um Besitzurkunden zu handeln: über die beiden Autos, das Haus und Belege über eine uralte Hypothek.
»Sehen Sie eine Schachtel?«, fragte der Rabbi. »Sie müsste ziemlich flach sein und nicht sehr groß.«
Sorgfältig durchsuchte ich die Unterlagen. Natürlich. Am Boden des Papierstapels stieß ich mit den Fingern gegen eine flache Holzschachtel. Ich nahm sie aus dem Safe. Sie bestand aus einfachem Kiefernholz und maß etwa zwölf Zentimeter im Quadrat. Ich hatte sie noch nie gesehen.
»Öffnen Sie sie«, befahl Leibowitz.
Ich warf ihm einen Blick über die Schulter zu, drehte mich wieder um und hob den Deckel an. Das polierte Metall glänzte im Licht.
»Was ist das?«
»Das Victoria-Kreuz. Es ist der begehrteste Orden des Britischen Empires. Haben Sie davon gehört?«
»Das Victoria-Kreuz … Hat das nicht Michael Caine in dem Film Zulu verliehen bekommen?«
Leibowitz schüttelte langsam den Kopf. »Fernsehen«, murmelte er. »Ja, das Victoria-Kreuz wurde einer Handvoll Engländern verliehen, die eine übermächtige Zulu-Armee am Rorke’s Drift in Südafrika zurückgeschlagen haben.«
Vorsichtig hob ich das Kreuz aus seiner Schachtel und betrachtete es im Licht. Es bestand aus Bronze und hing an einem roten Band. Im Mittelpunkt des Kreuzes befand sich ein Löwe, der auf einer Krone thronte, und darunter waren in einer Schriftrolle die Worte eingraviert: FÜRTAPFERKEIT.
Rabbi Leibowitz’ Worte schienen sich an eine kleine Versammlung zu richten, als er fortfuhr. »Die Liste der Empfänger des Victoria-Kreuzes besteht aus den berühmtesten Namen der britischen Militärgeschichte, Mark, und offiziell haben nur 1350 Menschen diese Ehrung je empfangen, seit Königin Victoria diesen Orden 1856 eingeführt hat. Aber es gibt noch eine Liste, eine sehr viel kürzere Liste, die nur der König und der Premierminister kennen. Es ist die Geheime Liste, und auf ihr befinden sich die Namen all jener Personen, die beispiellose Tapferkeit im Angesicht des Feindes gezeigt haben, aber deren Taten von so heikler Natur waren, dass sie niemals enthüllt werden dürfen.« Er holte tief Luft. »Der Name Ihres Großvaters steht auf dieser Liste, Mark.«
Ich fuhr erstaunt herum. »Sie scherzen wohl! Er hat mir gegenüber so etwas nie erwähnt!«
Der alte Rabbi lächelte geduldig. »Das war die Bedingung, die mit der Verleihung einherging. Der Orden durfte niemals in der Öffentlichkeit getragen werden. Ich nehme an, dass dieses geheime Kreuz verliehen wurde, damit in dunkler Nacht, lange nachdem der Ruhm verblasst war, Männer wie Ihr Großvater etwas hatten, was sie daran erinnerte, dass ihre … ihre Opfer anerkannt wurden.« Leibowitz wirkte nachdenklich. »Trotzdem erfordert es eine besondere Persönlichkeit, einen solchen Ruhm geheim zu halten.«
»Großvater war kein Egomane«, stimmte ich ihm zu. »Aber er war auch nicht sonderlich bescheiden. Er hat niemals die Meriten versteckt, die er sich verdient hat.«
Leibowitz seufzte traurig. »Mac hat diese Ehre ebenfalls verdient, doch er war nicht gerade stolz auf das, was er dafür getan hat. Er hat den Krieg immerhin aus Gewissensgründen abgelehnt.«
»Das wusste ich nicht.«
»Mark, vor langer Zeit ist Ihr Großvater zu mir gekommen, um mit mir über etwas zu sprechen, was ihn zutiefst beunruhigte. Er hatte mit seinem Pastor darüber gesprochen, aber er meinte, dieser Mann hätte nicht wirklich begriffen, über was er redete. Der Pastor hat Mac nur gesagt, er wäre ein Held und hätte keinen Grund, sich für das zu schämen, was er getan hatte. Mac hat eine Weile allein mit sich gerungen und ist schließlich zu mir gekommen.«
»Warum ausgerechnet zu Ihnen?«
»Weil ich ein Jude bin. Er dachte wohl, dass ich ihm einen besonderen Blickwinkel des Problems vermitteln und ihm helfen könnte, seine Seele zu erleichtern.«
Ich schluckte. »Und? Haben Sie das getan?«
»Ich habe mein Bestes gegeben. Wirklich. Und zwar einige Jahre lang. Er war dankbar für meine Bemühungen. Aber ich habe nie wirklich Erfolg gehabt. Ihr Großvater hat seine Bürde mit ins Grab genommen.«
»Na gut, dann sollten Sie es mir aber jetzt endlich erzählen. Was hat er denn so Schreckliches getan? Und wann hat er es getan? Er hat mir gesagt, dass er den Krieg in England verbracht habe.«
Leibowitz blickte in eine unbestimmte Ferne. »Er hat die meiste Zeit des Krieges in England verbracht, das stimmt, und in Oxford geforscht. Aber in nur zwei kurzen Wochen ist Ihr Großvater ziemlich weit gereist, und seine Reise hat ihn letztlich zu einem Ort geführt, der der Hölle auf Erden sehr ähnlich gewesen sein muss.«
»Und wo soll das gewesen sein?«
Leibowitz’ Miene wurde hart. »Zu einem Ort namens Totenhausen, in der Nähe der Recknitz, in Norddeutschland. Und wann Mac dort gewesen ist, das erfahren Sie, wenn Sie das Kreuz umdrehen.«
Ich gehorchte. Auf der Rückseite waren die Worte eingraviert:
Mark Cameron McConnell, M. D.15. Februar 1944
»Das ist das Datum, an dem diese tapfere Tat stattgefunden hat«, murmelte Leibowitz. »Vor fünfzig Jahren hat Ihr Großvater etwas so Heroisches, so Einzigartiges getan, dass ihm eine Ehre zuteilwurde, der sich außer ihm nur ein einziger anderer Nichtbrite rühmen kann. Dieser andere Ordensträger war ebenfalls Amerikaner.«
»Wer?«
Der Rabbi richtete sich auf, so gut es ihm mit seinem alterssteifen Rücken gelingen wollte. »Der Unbekannte Soldat.«
Ich hatte einen Kloß im Hals. »Das kann ich nicht glauben«, sagte ich heiser. »Das ist das Ungewöhnlichste, was ich jemals gehört habe. Und auch gesehen«, fügte ich hinzu und hielt das Kreuz am Band hoch. Irgendwie kam es mir so schwerer vor, als wenn ich es in der Hand hielt.
»Sie werden noch etwas viel Ungewöhnlicheres sehen«, erklärte Leibowitz. »Etwas Einzigartiges.«
Mir zog sich vor lauter Erwartung der Hals zusammen.
»Sehen Sie unter der Polsterung der Schachtel nach. Es müsste noch dort sein.«
Ich reichte Rabbi Leibowitz das Kreuz und hob dann vorsichtig das Leinentuch hoch, das auf dem Boden der Schachtel lag. Darunter befand sich ein ausgefranstes Wollstück mit Schottenmuster. Fragend blickte ich zu meinem Gegenüber.
»Machen Sie nur weiter«, ermunterte mich Leibowitz.
Unter dem Stoff kam eine Fotografie zum Vorschein. Es war ein Schwarz-Weiß-Foto, dessen Kontraste so stark waren, dass es wie eines der alten Staublochfotos aus dem Life-Magazin wirkte. Es zeigte eine Halbporträtaufnahme einer schlanken jungen Frau. Sie trug ein einfaches Baumwollkleid, und sie stand ein bisschen ungelenk vor dunklen Holzbrettern. Ihr schulterlanges Haar war blond und glatt, und schien vor dem Hintergrund des unbehandelten dunklen Holzes zu glänzen. Sorgenfalten zeigten sich um ihren Mund herum, doch es waren die Augen, die ihr Gesicht beherrschten – Augen, die so dunkel waren wie das Holz hinter ihr. Ich schätzte sie auf etwa dreißig.
»Wer ist das?«, fragte ich. »Sie ist … Ich weiß nicht. Sie ist nicht direkt schön, aber sehr … lebendig. Ist das meine Großmutter? Als sie noch jünger war, meine ich.«
Rabbi Leibowitz winkte ungeduldig ab. »Alles zu seiner Zeit. Sehen Sie unter der Fotografie nach.«
Das tat ich und förderte ein sorgfältig gefaltetes Blatt Papier zutage. Es war zerknittert und vom Alter vergilbt. Ich begann, es auseinanderzufalten.
»Vorsichtig.«
»Ist das die Belobigung zu dem Orden?«, fragte ich, während ich behutsam das Papier entfaltete.
»Nein, es ist etwas vollkommen anderes.«
Mittlerweile hatte ich es geöffnet. Die handgeschriebenen blauen Buchstaben waren fast gänzlich verblasst, als wenn die Notiz versehentlich in eine Waschmaschine geraten wäre; doch einige Worte waren noch immer lesbar. Ich las sie mit merkwürdiger Verwunderung.
Auf meinen Schultern lasten diese Toten.
W.
»Ich kann es kaum lesen. Was bedeutet es? Und wer ist ›W‹?«
»Sie können die Schrift kaum lesen, Mark, weil sie 1944 vom eiskalten Wasser der Recknitz verwaschen worden ist. Was diese Notiz bedeutet, kann man nur erklären, wenn man Ihnen eine andere, verwickelte und äußerst entsetzliche Geschichte erzählt. Und das ›W‹, wie der Autor dieses Briefs sich so geheimnisvoll beschreibt, steht für Winston Churchill.«
»Churchill!«
»Ja.« Der alte Rabbi lächelte eigenwillig. »Und deswegen hängt natürlich eine Geschichte daran.«
»Meine Güte.«
»Haben Sie zufällig einen Brandy griffbereit?«, fragte Leibowitz.
Ich holte die Flasche.
»In meinen Augen trägt Churchill die ganze Verantwortung.«
Der alte Rabbi hatte es sich in einem Lederohrensessel bequem gemacht, eine Häkeldecke über die Beine gelegt und schwenkte das Brandyglas in der Hand. »Sie wissen natürlich, dass Mac zunächst als Rhodes-Stipendiat nach England ging. Das war 1930, ein Jahr nach dem Börsenkrach. Er blieb zwei Jahre und wurde dann aufgefordert, noch ein drittes Jahr zu bleiben und sich dort zu immatrikulieren. Eine hohe Ehre. Nach seinem Abschluss kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück. Ich bin sicher, dass er seine ›Englische Periode‹ für abgeschlossen hielt. Aber er sollte sich irren.
1938 beendete er sein Medizinstudium und schaffte es irgendwie, auch noch einen Abschluss in Chemie während seiner Assistenzarztzeit zu machen. Mittlerweile schrieben wir 1940. Er stieg in die Praxis eines Freundes seines Vaters ein; doch er hatte sich kaum eingerichtet, als er einen Anruf aus Oxford bekam. Sein alter Tutor erzählte ihm, dass einer von Churchills wissenschaftlichen Beratern von einigen Monografien beeindruckt gewesen sei, die Mac über chemische Kriegsführung während des Ersten Weltkriegs geschrieben hatte. Sie wollten, dass er einem britischen Team beitrat, das an der Entwicklung von Giftgas arbeitete. Amerika war zwar noch nicht in den Krieg eingetreten, aber Mac wusste, was auf dem Spiel stand. Englands Schicksal hing an einem seidenen Faden.«
»An so viel erinnere ich mich noch«, erwiderte ich. »Er ist nur unter der Bedingung gegangen, dass man ihn ausschließlich für Verteidigungsmaßnahmen einsetzen würde.«
»Ja. Das war ziemlich naiv, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall hat er Ihre Großmutter nach England mitgenommen. Sie gerieten mitten in die Schlacht um England. Es war nicht leicht, aber er überredete Susan, wieder in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Hitler gelang es zwar niemals, in England einzufallen, doch da war es schon zu spät. Sie waren während der Operation getrennt.
»Fünfzig Jahre«, fuhr Leibowitz leise fort. Er hielt inne, als wäre er in Gedanken verloren. »Ich nehme an, das kommt Ihnen wie eine Ewigkeit vor, aber versuchen Sie trotzdem, sich diese Zeit vorzustellen. Mitten im Winter, Januar 1944. Die ganze Welt, einschließlich der Deutschen, wusste, dass die Alliierten im Frühling in Westeuropa einmarschieren würden. Die einzige Frage war, wo die Invasion stattfinden würde. Eisenhower war gerade zum Oberbefehlshaber der Operation ›Overlord‹ ernannt worden. Churchill …«
»Entschuldigen Sie, Rabbi«, unterbrach ich ihn. »Ich will nicht respektlos erscheinen, aber mich beschleicht das Gefühl, dass Sie mir die lange Version der Geschichte erzählen.«
Er lächelte mit einer Geduld, die er im Umgang mit hyperaktiven Kindern gelernt haben musste. »Haben Sie einen dringenden Termin?«
»Nein, aber ich bin neugierig auf die Geschichte meines Großvaters, nicht auf die von Churchill oder Eisenhower.«
»Mark, wenn ich Ihnen einfach nur das Ende dieser Geschichte erzählen würde, dann würden Sie mir nicht glauben. Das meine ich ernst. Sie können nicht begreifen, was ich Ihnen sagen werde, ohne zu wissen, was dazu geführt hat. Verstehen Sie das?«
Ich nickte und versuchte, meine Ungeduld zu unterdrücken.
»Nein«, widersprach Leibowitz leidenschaftlich. »Das tun Sie nicht. Das Schlimmste, was Sie jemals in Ihrem Leben gesehen haben, alle üblen Dinge zusammengenommen, Kindesmissbrauch, Vergewaltigung, selbst Mord, all dies ist nichts im Vergleich zu dem, was ich Ihnen erzählen werde. Es ist eine Geschichte, deren Grausamkeit jedwede Vorstellungskraft übersteigt. Es ist eine Geschichte über Frauen und Männer, deren Heldenmut seinesgleichen sucht.« Er hob einen klauenartig gekrümmten Finger und sprach plötzlich sehr leise. »Nachdem Sie diese Geschichte gehört haben, wird Ihr Leben nie wieder so sein wie früher.«
»Das sind eine Menge Vorschusslorbeeren, Rabbi.«
Er trank einen Schluck Brandy. »Ich habe keine Kinder, Doktor. Wissen Sie, warum nicht?«
»Tja. Ich nehme an, Sie wollten keine. Oder Sie oder Ihre Frau sind sterilisiert worden.«
»Ich bin sterilisiert worden«, gab Leibowitz zu. »Mit sechzehn wurde ich von einigen deutschen Ärzten aufgefordert, mich auf eine Bank zu setzen und ein Formular auszufüllen. Das dauerte etwa eine Viertelstunde. Während dieser fünfzehn Minuten beschossen sie meine Hoden von drei Seiten mit hoch dosierten Röntgenstrahlen. Zwei Wochen später retteten ein jüdischer Chirurg und seine Frau mir das Leben, als sie mich in ihrer Küche kastrierten.«
Meine Hände fühlten sich plötzlich kalt an. »Waren Sie … in den Lagern?«
»Nein. Ich bin nach Schweden entkommen, zusammen mit dem Chirurgen und seiner Frau; doch ich habe meine ungeborenen Kinder zurückgelassen.«
Darauf wusste ich nichts zu sagen.
»Das ist das erste Mal, dass ich es einem Christen erzählt habe«, bemerkte Leibowitz.
»Ich bin kein Christ, Rabbi.«
Er sah mich aus zusammengekniffenen Augen heraus an. »Wissen Sie vielleicht etwas, das ich nicht weiß? Ein Jude sind Sie auch nicht.«
»Ich bin gar nichts. Agnostiker trifft es wohl am ehesten. Ein professioneller Zweifler.«
Leibowitz musterte mich lange, und auf seinem runzligen Gesicht zeichneten sich Gefühle ab, die ich nicht zu deuten vermochte. »Das sagt sich leicht für jemanden, der so wenig durchgemacht hat.«
»Ich habe meinen Teil an Leid gesehen und einiges auch schon gelindert.«
Der Rabbi vollführte eine typisch europäische Handbewegung, die so viel auf einmal zu sagen schien. »Doktor, Sie haben noch nicht einmal über den Rand des Abgrunds geblickt.«
Leibowitz legte die Hand auf die Augen und verharrte so fast eine Minute vollkommen regungslos. Er schien herausfinden zu wollen, ob er überhaupt die Stärke besaß, diese Geschichte zu erzählen. Gerade als ich etwas sagen wollte, ließ er die Hand sinken und fragte: »Sind Sie jetzt bereit zuzuhören, Mark? Oder möchten Sie die Dinge so lassen, wie sie sind?«
Ich blickte auf das Victoria-Kreuz, betrachtete die verblichene Notiz, den Schottenstoff und das Bild der Frau. »Sie haben mich am Haken«, erklärte ich. »Aber warten Sie noch einen Augenblick.«
Ich ging ins Schlafzimmer meines Großvaters und holte den kleinen Kassettenrekorder, auf den er seine medizinischen Tabellen diktiert hatte, sowie einen Stapel Mikrokassetten. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich das aufnehme?«, fragte ich und stellte das Diktiergerät auf den Tisch. »Wenn diese Geschichte so wichtig ist, sollte sie vielleicht dokumentiert werden.«
»Sie hätte schon vor langer Zeit erzählt werden sollen«, antwortete Leibowitz zustimmend. »Aber Mac wollte nichts davon wissen. Er sagte, es würde die menschliche Geschichte kein Stück ändern, ob man dies hier wüsste oder nicht. Darin habe ich ihm widersprochen. Es ist schon lange überfällig, diese Geschichte ans Licht zu bringen.«
Ich sah aus dem Fenster. »Es wird langsam dunkel, Rabbi.«
Er seufzte. »Dann machen wir eben die Nacht zum Tag.«
»Darf ich Ihnen einen kleinen Rat geben? Redaktionell gesprochen?«
»Ach. Sind Sie jetzt Redakteur?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich habe ein paar Artikel verfasst. Eigentlich spiele ich mit dem Gedanken, an meinen freien Wochenenden einen Roman zu schreiben: einen medizinischen Thriller. Aber vielleicht habe ich hier eine andere Geschichte gefunden, die sich zu erzählen lohnt. Sei’s drum, hier ist mein Rat: Sie können ihn annehmen oder ignorieren. Dieses ›Stellen-Sie-sich-die-Szene-vor‹- und ›Ich-nehme-an‹-Geschwafel: Vergessen Sie’s. Erzählen Sie die Geschichte einfach so, wie Sie glauben, dass sie sich ereignet hat. Als wären Sie dabei gewesen wie eine Fliege an der Wand.«
Nach einer Weile nickte Leibowitz. »Ich glaube, das schaffe ich«, erklärte er. Er schenkte sich einen zweiten Brandy ein, lehnte sich dann in dem Lederarmsessel zurück und hob das Glas.
»Auf den tapfersten Mann, den ich jemals kennengelernt habe.«
2
Oxford University, England, 1944
Lautlos hob Mark McConnell das lange Ruder aus den Fluten des Cherwell Rivers und ließ es wieder hineinklatschen. Wasser spritzte auf den Rücken der Lederjacke seines Bruders, der auf dem vorderen Sitz des schmalen Holzboots hockte.
»Du verdammter Mistkerl!« David wirbelte herum und hätte das Boot dadurch beinahe zum Kentern gebracht. Er tauchte seine behandschuhte Hand ins Wasser und bespritzte seinen Bruder mit Wasser und Eis.
»Hör auf!«, rief Mark. »Wenn du so weitermachst, versenkst du uns noch!«
»Gibst du auf?« Wieder tauchte David die Hand ins Wasser.
»Ich erkläre einen vorübergehenden Waffenstillstand – aus medizinischen Gründen.«
»Hühnerkacke!«
Mark wedelte mit dem Ruder. »Ich habe hier die größere Feuerkraft.«
»Na gut, einverstanden. Waffenstillstand.« David nahm die Hand aus dem Wasser und beugte sich wieder über den Bug des schmalen Bootes, das sich knirschend in die nächste Biegung des vereisten Flusses schob. Er war der kleinere der beiden Brüder und besaß die Statur eines Läufers: Sprinterbeine, eine schmale Taille und breite, muskulöse Schultern. Sein blondes Haar, das vorstehende Kinn und die klaren blauen Augen vervollständigten seine Norman-Rockwell-Erscheinung. Während Mark ihn skeptisch beobachtete, ließ er sich auf die Bank des Bootes zurücksinken, lehnte sich nach hinten, legte den Kopf in die Hände und schloss die Augen.
Mark wandte seine Aufmerksamkeit dem Fluss vor ihnen zu. Die kahlen Zweige der Bäume an beiden Ufern waren so dicht mit Eiszapfen besetzt, dass einige Zweige beinahe den Schnee berührten, der die Weiden unter ihnen bedeckte. »Das ist verrückt«, sagte er und spritzte David einen letzten Gruß eiskalter Tropfen ins Gesicht. Aber er meinte es nicht so. Wenn sein jüngerer Bruder nicht vom Stützpunkt der 8th Air Force in Deenethorpe hierhergefahren wäre, dann wäre dieser Winter in Oxford genauso gewesen wie jeder andere auch: wie eine öde, vierzehnstündige Wochenschau, durch die beschlagenen Fenster eines Laboratoriums betrachtet. Regen, der zu Schneeregen wurde, um sich dann wieder in Regen zurückzuverwandeln, welcher in breiten, grauen Schleiern auf die gepflasterten Höfe der Colleges prasselte, die Bodleian-Bibliothek wie ein Leichentuch verhüllte und den eher trägen Cherwell und die Themse zu reißenden Strömen anschwellen ließ.
»So ist das Leben«, murmelte David. »Genauso stellen wir uns euch Eierköpfe vor, wenn wir unterwegs sind. Ihr lebt wie die Maden im Speck und schippert mit dem Boot auf eurem blöden Unicampus herum. Wir riskieren jeden Tag unseren Arsch, während ihr Taugenichtse hier herumhockt, und angeblich den Krieg mit euren kleinen grauen Zellen gewinnt.«
»Du meinst, wir staken auf unserem blöden Unicampus herum.«
David öffnete ein Auge, sah seinen Bruder an und schnaubte verächtlich. »Meine Güte, du klingst mit jedem Jahr mehr wie ein Brite. Wenn du Mom anrufen würdest, würde sie dich nicht mehr wiedererkennen.«
Mark betrachtete das Gesicht seines jüngeren Bruders. Es tat gut, ihn wiederzusehen, und zwar nicht nur, weil sich ihm dadurch eine willkommene Entschuldigung bot, dem Labor für einen Nachmittag zu entfliehen. Mark brauchte den Kontakt zu anderen Menschen. An diesem Ort, wo es so viel Kameradschaft gab, war er praktisch ein Ausgestoßener. Seit einiger Zeit musste er gegen das starke Verlangen ankämpfen, sich im Bus an eine mitleidige Seele zu wenden und einfach draufloszureden. Doch wenn er seinen Bruder ansah, einen Captain der Air Force, der immer wieder auf lebensgefährliche Bombenflüge über Deutschland ging, fragte er sich, ob er das Recht hatte, David auch noch mit seinen persönlichen Sorgen zu belasten.
»Ich glaube, meine Finger sind erfroren«, knurrte Mark, während der Kahn durch das schwarze Wasser glitt. »Hundert Pfund für einen Außenbordmotor.«
Er hatte sich schon einmal aufgerafft, mit David über dieses Problem zu sprechen; das war vor drei Wochen gewesen, am Weihnachtstag, aber ein Bombereinsatz in letzter Sekunde hatte ihre Pläne zunichtegemacht, den Tag gemeinsam zu verbringen. Seitdem war schon wieder fast ein ganzer Monat verstrichen. So war es die letzten vier Jahre immer gewesen. Die Zeit floss dahin wie der Fluss bei Hochwasser. Wieder war ein weiteres Weihnachtsfest vorbei und ein weiteres neues Jahr angebrochen: das Jahr 1944. Mark konnte es kaum fassen. Vier Jahre in diesem Hafen aus Sandsteinkreuzgängen und Türmchen, während draußen die Welt mit unerbittlicher Wut in Stücke gerissen wurde.
»He!«, rief David. Er hatte noch immer die Augen geschlossen. »Wie sind denn die Mädels hier so?«
»Was meinst du damit?«
Diesmal öffnete David beide Augen und verrenkte sich fast den Hals, um seinen Bruder ansehen zu können. »Was ich damit meine? Haben vier Jahre ohne Susan deinen Lümmel genauso verkümmern lassen wie dein Hirn? Ich spreche von den englischen Ladys. Wir müssen schließlich unserer Rolle entsprechen.«
»Unserer Rolle?«
»Überbezahlt, übererotisiert und hier drüben, schon vergessen? Verdammt, ich weiß, dass du Susan liebst. Ich kenne eine Menge Jungs, die sich wahnsinnig nach ihren Frauen sehnen. Aber vier Jahre! Du kannst doch nicht jeden wachen Augenblick eingesperrt in deiner Frankensteinkammer verbringen!«
»Genau das mache ich«, erwiderte Mark gelassen.
»Mensch, ich würde dir ja was von meinen Abenteuern erzählen, wenn ich nicht Angst hätte, dass du dann heute Nacht nicht schlafen könntest.«
Mark stieß die Stange in den Grund des Flusses. Es war ein Fehler gewesen, Susan nach Hause zu schicken; doch damals, angesichts einer drohenden deutschen Invasion, hätte das jeder Mann getan, der noch einigermaßen bei Verstand war. Trotzdem hatte Mark es satt, für seine Fehleinschätzung ständig zahlen zu müssen. Er war schon länger auf der falschen Seite des Atlantiks als jeder andere Amerikaner, den er kannte.
»Zum Teufel damit«, sagte er. Als sie die Flussbiegung vor dem St. Hildas College erreichten, lenkte er den Kahn an eine steile Uferböschung in der Nähe von Christ Church Meadow. Beim Aufprall des Bootes auf dem Strand wurde David förmlich aus dem Kahn katapultiert, doch er landete mit der elastischen Eleganz eines Athleten.
»Genehmigen wir uns ein Bier!«, schlug David vor. »Trinkt ihr Eierköpfe denn gar nichts? Welcher Blödmann hatte überhaupt die Idee?«
Mark musste lachen. Er kletterte aus dem Kahn. »Tatsache ist, dass ich ein paar Burschen kenne, die jederzeit und liebend gern bereit wären, gegen dich in einem Trinkwettbewerb mit einem Getränk deiner Wahl anzutreten.«
»Burschen?« David starrte seinen Bruder an. »Hast du wirklich Burschen gesagt, Mark? Wir müssen dich sofort wieder in die Staaten zurückbringen, alter Knabe. Und zwar nach Georgia. Du klingst wie der große Gatsby.«
»Ich spiele nur die passende Rolle zu deinem Tom Buchanan.«
David stöhnte. »Wir sollten besser gleich zu Whiskey übergehen. Ein bisschen Kentucky-Bourbon wird dir diesen britischen Akzent schon aus der Kehle spülen.«
»Leider gibt es hier in Oxford keine Vorräte des Golds von Kentucky, Schlaumeier.«
David grinste. »Deshalb habe ich einen halben Liter mitgebracht. Hat mich dreißig Mäuse auf dem Schwarzmarkt gekostet. Dieses affektierte britische Gesöff würde ich noch nicht mal trinken, wenn ich am Verdursten wäre.«
Schweigend überquerten sie Christ Church Meadow. David trank einige kräftige Schlucke aus der Flasche, die er in seiner Fliegertasche verstaut hatte. Mark hingegen lehnte die wiederholten Angebote seines Bruders ab, ebenfalls einen Schluck Whiskey zu trinken. Ihm wäre es lieber gewesen, wenn David ebenfalls nüchtern und klar geblieben wäre, aber daran konnte er nichts ändern.
Wenn sie so nebeneinander hergingen, traten die Unterschiede zwischen den beiden Brüdern deutlicher zutage. David war untersetzt und kräftig, Mark hingegen groß und schlank. Er besaß den Körperbau eines Langstreckenläufers, bewegte sich mit geschmeidigen, langen Schritten, und sein Gang strahlte eine Sicherheit aus, die er sich durch jahrelanges Training und viele Querfeldein-Hindernisrennen angeeignet hatte. Seine großen Hände zierten lange, schlanke Finger. Es seien Chirurgenhände, hatte sein Vater immer stolz verkündet, dabei war Mark damals noch ein Kind gewesen. David hatte die strahlenden blauen Augen ihrer Mutter geerbt; Marks waren dunkelbraun – ein weiteres Vermächtnis seines Vaters. Und während David schnell lächelte oder einen Hieb austeilte, ließ sich Mark meist nur den nachdenklichen Blick eines Mannes entlocken, der alle Seiten eines Themas sorgfältig abwägt, bevor er handelt.
Mark entschied sich für das Welsh Pony in der George Street. In dem Pub war zwar abends eine Menge los, aber man wurde auch in Ruhe gelassen, wenn man wollte. Mark ging nach oben an eine der beiden Hauptbars und bestellte zwei Bier, die sie dann an einen Tisch mitnehmen konnten. Anschließend führte er David in die hinteren Räume des Pubs. Bevor er sein Glas auch nur halb geleert hatte, fiel ihm auf, dass David wohl schon eine Menge Whiskey intus hatte; das Stout fiel da nicht weiter auf. Trotzdem wirkte er verblüffend nüchtern. Darin ähnelte er ihrem Vater, wenn er auch sonst nichts von ihm hatte.
»Was beschäftigt dich eigentlich so, Mac?«, fragte David plötzlich. »Ich habe schon den ganzen Tag das Gefühl, dass du etwas sagen willst, es dir aber verkneifst. Du benimmst dich wie ein altes Opossum, das um eine Mülltonne herumschleicht. Das macht mich verrückt. Rück endlich raus damit!«
Mark lehnte sich auf dem massiven Eichenstuhl zurück und trank einen kräftigen Schluck. »David, was ist das für ein Gefühl, eine deutsche Stadt zu bombardieren?«
»Was meinst du damit?« David richtete sich auf. Er war verwirrt. »Willst du damit sagen, dass ich Angst hätte?«
»Nein. Ich meinte, wie es sich anfühlt, die Bomben abzuwerfen. Wie fühlt es sich an, eine Fünfhundertpfundbombe nach der anderen über einer Stadt auszuklinken, von der du weißt, dass sie voller Frauen und Kinder ist?«
»Nun, ich werfe sie ja gar nicht ab. Das macht der Bombenschütze. Ich fliege nur die Maschine.«
»So machst du das also. Du distanzierst dich davon. Mental, meine ich.«
David warf seinem Bruder einen scharfen Blick zu. »Jesus, lass uns bloß nicht damit anfangen, okay? Reicht es nicht, dass ich mir den ganzen Mist von Dad anhören musste, als ich mich freiwillig gemeldet habe? Willst du jetzt seine Rolle übernehmen, weil er tot ist?« Er machte eine weit ausholende Armbewegung, die den gesamten Pub und die verschneite Gasse draußen vor dem Fenster mit einbezog. »Du sitzt hier in deinem kleinen Land von Oz und spielst Planspielchen mit anderen Eierköpfen. Da verliert man rasch den Kontakt zur Realität und vergisst, warum man sich überhaupt in diesem Krieg engagiert.«
Mark hob die Hand. »Ich weiß, dass wir die Nazis aufhalten müssen, David. Aber wir zerstören einfach so viel.«
»Aufwachen, Mac! Wir haben 1944! Wir reden hier von dem verfluchten Hitler!«
»Das ist mir klar. Aber fällt dir nicht auf, wie man Hitler benutzt, um jede alliierte Aktion zu rechtfertigen, jedes alliierte Opfer? Flächenbombardement. Himmelfahrtkommandos. Die Politiker benehmen sich, als wäre Hitler vollkommen ausgewachsen der Stirn des Zeus entsprungen. Hätten die Verantwortlichen vor zehn Jahren ein Gewissen gehabt, dann hätten sie diesen Wahnsinnigen aufhalten können.«
»Hätte, wäre, wenn«, knurrte David. »Willkommen in der Wirklichkeit. Hitler hat sich das selbst zuzuschreiben. Er bekommt nur, was er verdient.«
»Ja, das stimmt. Aber müssen wir eine ganze Kultur vernichten, um einen einzigen Mann aufzuhalten? Wollen wir ein ganzes Land ausradieren, um eine Epidemie zu stoppen?«
David wirkte plötzlich sehr verärgert. »Du meinst die Deutschen? Ich will dir mal was über dieses nette Volk erzählen: Ich hatte einen Kumpel, Chuck Wilson, okay? Seine B17 ist in der Nähe von Würzburg abgestürzt, nach dem zweiten Angriff auf Schweinfurt. Der Pilot kam dabei ums Leben, aber Chuck und zwei andere Jungs haben es geschafft, aus der Maschine rauszukommen. Einer wurde gefangen genommen, und der andere wurde von der Resistance über Frankreich herausgeschmuggelt. Aber Chuck wurde von irgendwelchen deutschen Zivilisten geschnappt.« David kippte einen doppelten Bourbon hinunter und fiel dann plötzlich in brütendes Schweigen.
»Und?«
»Sie haben ihn gelyncht.«
Mark spürte, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten. »Sie haben was?«
»Sie haben ihn am nächsten Baum aufgeknüpft, verdammt!«
»Ich dachte, die Deutschen würden gefangene Piloten gut behandeln. Jedenfalls an der Westfront.«
»Die regulären Krauts tun das auch. Aber die SS ist keine reguläre Truppe, und die deutschen Zivilisten hassen unseren Mut.«
»Woher weißt du das mit der Lynchjustiz?«
»Der Bursche, der durchgekommen ist, hat alles gesehen. Und willst du auch noch das Schlimmste hören? Während diese Zivilisten Chuck aufgehängt haben, ist eine Kompanie Waffen-SS in einem Lastwagen vorgefahren. Sie saßen da, haben gelacht und geraucht, während diese Mistkerle ihn aufgeknüpft haben. Dann sind sie weggefahren. Dabei muss ich an diesen Farbigen denken, den sie damals auf der Bascombe-Farm gehängt haben. Der Mob behauptete, er habe ein weißes Mädchen vergewaltigt, weißt du noch? Aber es gab keine Beweise, und genauso wenig gab es ein Verfahren. Erinnerst du dich noch daran, was Onkel Marty gesagt hat? Der Sheriff und der Deputy hätten danebengestanden und einfach nur zugesehen.«
David ballte die linke Hand zur Faust und öffnete sie wieder, während er einen weiteren Schluck Bourbon hinunterkippte. »Der Bursche, der gesehen hat, wie sie Chuck aufgehängt haben, sagte, es wären genauso viele Frauen wie Männer da gewesen. Und eine Frau sei sogar hochgesprungen und hätte sich an seine Füße gehängt, während er dort oben gependelt hätte.«
»Ich verstehe, was du meinst.« Mark lehnte sich zurück und trank einen Schluck Bier. »Hier oben verliert man rasch aus den Augen, wie persönlich ein Krieg sein kann. Wir erleben den Hass nicht.«
»So ist es, Kumpel. Du solltest mal einen Angriff mit uns fliegen. Nur einmal. Während du dir die Eier abfrierst, versuchst du, daran zu denken, unter deiner Atemmaske Luft zu holen, und du weißt, dass du dir irgendetwas abfrierst, wenn du deine Haut länger als zehn Sekunden entblößt. Und während des ganzes Fluges verfluchst du dich ständig für jeden Sonntagsgottesdienst, den du geschwänzt hast.«
Mark dachte an das Angebot, das er kürzlich einem schottischen Brigadegeneral gemacht hatte. In einem Wutanfall hatte er damit gedroht, das Labor zu verlassen und sich zum Frontdienst zu melden. »Vielleicht sollte ich ja dem realen Krieg etwas näherrücken«, sagte er im ruhigen Ton. »Was sind meine Überzeugungen schon wert, wenn ich gar nicht weiß, was ein Krieg wirklich ist? Ich könnte mich zu einem Frontlazarett in Italien versetzen lassen …«
David knallte die Whiskeyflasche auf den Tisch, streckte die Hand aus und presste den Arm seines Bruders auf das vernarbte Holz. Ein paar Gäste sahen in ihre Richtung, doch ein Blick von David reichte, um ihre Neugier im Keim zu ersticken. »Wenn du das versuchst, breche ich dir deine verdammten Beine!«, knurrte er. »Und versuch es erst gar nicht hinter meinem Rücken. Ich krieg es raus.«
Die Vehemenz seines Bruders erstaunte Mark.
»Es ist mir todernst, Mac. Noch nicht einmal in der Nähe eines Schlachtfeldes wird es dir gefallen. Selbst aus einer Höhe von fünf Meilen kann ich dir sagen, dass dort die Hölle auf Erden herrscht. Hast du mich verstanden?«
»Laut und deutlich«, antwortete Mark. Ihn beunruhigte das Gefühl, seinen Bruder zum ersten Mal so zu sehen, wie er wirklich war. Der David, an den er sich erinnerte, ein forscher, unbezwingbarer junger Athlet, war vom Krieg zu einem abgehärmten jungenhaften Mann mit den durchdringenden Augen eines Neurochirurgen verwandelt worden.
»David«, flüsterte Mark plötzlich in drängendem Tonfall. Er spürte, wie ihm bei dem Gedanken an sein folgendes Geständnis das Blut ins Gesicht schoss. »Ich muss mit dir reden.« Er konnte nicht aufhören. Die Worte, mit denen er im gleichen Moment das Gesetz brach, da er sie aussprach, strömten einfach so aus seinem Mund. »Die Briten bedrängen mich, an einem besonderen Projekt für sie zu arbeiten. Sie wollen, dass ich es leite. Es ist eine Art Waffe, die bisher noch nicht eingesetzt wurde. Das heißt … Es ist nicht die ganze Wahrheit. Sie ist schon früher verwendet worden, aber nicht so, und damals hatte sie auch nicht das Potenzial für solch ein Gemetzel …«
David packte ihn am Arm. »Wow! Moment mal! Wovon redest du da eigentlich?«
Mark sah sich verstohlen im Pub um. Das Stimmengewirr um sie herum schien zu genügen, ihr Gespräch zu überdecken. Er beugte sich über den Tisch. »Eine Geheimwaffe, David. Das ist kein Scherz. Es ist wie in diesen Filmen. Ein verfluchter Albtraum.«
»Eine Geheimwaffe?«
»Sag ich doch. Es handelt sich um etwas, das nur minimal gelenkt werden kann. Sie tötet unterschiedslos Männer, Frauen, Kinder und Tiere. Ohne Ausnahme. Sie würden zu Tausenden sterben.«
»Und die Briten wollen, dass du dieses Projekt leitest?«
»Richtig.«
David lächelte verblüfft. »Junge, da haben sie aber den Bock zum Gärtner gemacht.«
Mark nickte. »Sie glauben aber, dass ich der Richtige bin.«
»Und um was für eine Waffe handelt es sich dabei? Ich verstehe nicht, wie sie vernichtender oder unterschiedsloser töten könnte als ein Luftangriff mit tausend Bombern.«
Abermals sah sich Mark gründlich im Pub um. »Tut sie aber. Es ist keine Bombe. Nicht mal eine dieser Superbomben, von denen du vermutlich auch schon gehört hast. Es ist etwas … so etwas wie das, was Dad verwundet hat.«
David zuckte zurück. Auf seinem Gesicht zeigte sich noch nicht einmal mehr ein Hauch von Zynismus. »Du meinst Gas? Giftgas?«
Mark nickte.
»Scheiße. In diesem Krieg hat bisher keine Seite Gas eingesetzt. Selbst die Nazis erinnern sich noch an die Schützengräben vom letzten Krieg. Es gibt doch Verträge, die das verbieten, oder?«
»Die Genfer Konvention. Aber dafür interessiert sich keiner. Die Vereinigten Staaten haben sie nicht mal unterzeichnet.«
»Himmel. Was für ein Gas ist das denn? Senfgas?«
Marks Lachen besaß einen beinahe hysterischen Unterton. »David, niemand kennt die schreckliche Wirkung von Senfgas besser als wir beide. Aber dieses Gas, von dem ich spreche, ist tausendmal schlimmer. Tausendmal schlimmer! Man kann es nicht sehen; man braucht es nicht einmal einzuatmen. Aber Bruderherz, es wird dich umbringen. Genauso wie ein Kobrabiss wirkt es auf das Gehirn.«
David war nachdenklich geworden. »Ich nehme an, dass du mir davon nichts erzählen darfst?«
»Absolut gar nichts.«
»Na gut … Am besten fängst du wohl von vorne an.«
3
Mark ließ seinen Blick über die Gäste schweifen, deren Zahl allmählich abnahm. Von denen, die blieben, kannte er mehr als die Hälfte. Zwei von ihnen waren Professoren, die ebenfalls an Waffenprogrammen arbeiteten. Mit gesenkter Stimme fuhr er fort.
»Vor einem Monat«, begann er, »hat man mir eine kleine Menge einer farblosen Flüssigkeit namens Sarin ins Labor gebracht. Ich sollte es testen. Normalerweise bekomme ich meine Proben von irgendwelchen namenlosen Zivilisten, doch diesmal war es anders. Das Sarin wurde mir von einem schottischen Brigadegeneral namens Duff Smith gebracht. Er ist ein alter, einarmiger Haudegen, der mich seit Jahren bedrängt, doch endlich chemische Kampfstoffe zu entwickeln. General Smith wollte eine sofortige Einschätzung der tödlichen Wirkung von Sarin, und sobald ich das Ergebnis hätte, sollte ich versuchen, einen wirksamen Gasfilter dagegen zu entwickeln. Nur reicht im Falle von Sarin keine Maske. Man braucht einen Ganzkörperschutz.«
David wirkte nachdenklich. »Ist das ein deutsches Gas? Oder haben die Alliierten das Zeug ausgebrütet?«
»Das wollte mir Smith nicht sagen. Aber er hat mir eingeschärft, besondere Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Himmel, wie recht er hatte. So etwas wie Sarin habe ich noch nie gesehen. Es tötet, indem es das zentrale Nervensystem lahmlegt. Meine Experimente haben ergeben, dass es die Wirkung von Phosgen um das Dreißigfache übertrifft.«
David wirkte nicht sonderlich beeindruckt.
»Weißt du, was das bedeutet, David? Phosgen war im letzten Krieg das Gas mit der tödlichsten Wirkung. Aber im Vergleich zu Sarin ist es … nichts. Schon ein Zehntel Milligramm Sarin, ein Tropfen von der Größe eines Sandkorns, würde dich in weniger als einer Minute töten. Selbst in tödlicher Konzentration ist es unsichtbar, und es durchdringt die menschliche Haut. Es geht einfach durch die Haut.«
David kaute auf einem unsichtbaren Etwas herum. »Ich verstehe, worauf du hinauswillst. Sprich weiter.«
»Letzte Woche hat mir General Smith einen weiteren Besuch abgestattet. Diesmal hat er mich gefragt, was ich sagen würde, wenn ich erführe, dass Sarin ein deutsches Giftgas sei und dass die Alliierten nichts Vergleichbares in ihrem Arsenal hätten. Er wollte wissen, was ich tun würde, um alliierte Städte zu schützen. Ich habe ehrlich geantwortet. Nichts. Die Einwohner einer Stadt vor Sarin zu schützen ist unmöglich. Es wirkt nicht wie ein schwerer Bombenangriff. So schlimm die auch sein mögen: Die Menschen können aus den Luftschutzbunkern kommen, wenn der Angriff vorbei ist. Aber je nach Wetterlage kann Sarin tagelang in den Straßen liegen bleiben und alles überziehen; Bürgersteige, Fenster, Gras, Nahrungsmittel.«
»Okay«, meinte David. »Und was ist dann passiert?«
»Smith hat gestanden, dass Sarin ein deutsches Giftgas ist. Die Probe sei ›aus dem Herzen des Deutschen Reichs‹ gestohlen worden, wie er sich ausdrückte. Und dann hat er mir gesagt, dass ich mich irre. Ich könnte doch etwas tun, um unsere Städte zu schützen.«
»Und das wäre?«
»Ich könnte ein genauso tödliches Gas entwickeln, damit Hitler nicht wagen würde, Sarin einzusetzen.«
David nickte zögernd. »Wenn er die Wahrheit über Sarin gesagt hat, dann klingt das wie die einzige Möglichkeit. Ich verstehe dein Problem nicht.«
Mark starrte ihn fassungslos an. »Du verstehst das nicht? Himmel, gerade du solltest es doch kapieren.«
»Hör zu … Ich will nicht schon wieder diese Pazifismusdiskussion führen. Ich dachte, du hättest das endlich für dich geklärt. Zum Kuckuck, du arbeitest schließlich seit 1940 für die Briten!«
»Aber nur in Einrichtungen, die der Verteidigung dienen, das weißt du genau.«
David blähte die Wangen. »Um dir die Wahrheit zu sagen: Dieser Unterschied war mir nie besonders einsichtig. Entweder arbeitest du in Kriegseinrichtungen oder nicht.«
»Da gibt es einen großen Unterschied, David, glaub es mir. Selbst im liberalen Oxford bin ich offiziell ein Aussätziger.«
»Sei froh, dass du in Oxford bist. Auf meinem Air Force Stützpunkt würden sie die Scheiße aus dir rausprügeln!«
Mark rieb sich die Stirn. »Sieh mal, ich verstehe ja die Logik der Abschreckung. Aber es hat noch nie eine solche Waffe gegeben. Noch nie!« Erleichtert bemerkte er, wie die beiden Professoren den Pub verließen. »David, ich werde dir jetzt etwas erzählen, was kaum jemand weiß und über das wir noch nie diskutiert haben. Bis vor etwa einem Monat war Giftgas die humanste Waffe der Welt.«
»Was?«
»Es ist die Wahrheit. Trotz der Qualen der Verletzungen und dem Entsetzen, das chemische Waffen hervorrufen, waren vierundneunzig Prozent aller Männer, die im Großen Krieg mit Giftgas in Kontakt kamen, nach neun Wochen wieder einsatzbereit. Neun Wochen, David. Die Sterblichkeitsrate für Giftgas liegt irgendwo bei zwei Prozent. Hingegen liegt die Sterblichkeitsrate von Schuss- und Granatverletzungen bei fünfundzwanzig Prozent. Das ist zehnmal so hoch. Schmerzlich ist nur die Tatsache, dass unser Vater eine Ausnahme war.«
Verwirrt runzelte David die Stirn. »Was willst du mir damit sagen, Mark?«
»Ich versuche dir zu erklären, dass meine Abneigung gegen chemische Kriegsführung bis zur Erfindung von Sarin vor allem auf dem Entsetzen basierte, das sie bei den Soldaten hervorrief, und den psychologischen Nachwirkungen, die eine Verwundung durch Giftgas nach sich zog. Zahlen sagen nicht immer die Wahrheit, schon gar nicht, wenn es um menschliche Schmerzen geht. Aber mit Sarin hat die chemische Kriegführung ein völlig neues Stadium erreicht. Wir sprechen von einer Waffe, die eine viermal so hohe Sterblichkeitsrate besitzt wie Schuss- oder Granatverletzungen. Sarin ist hundertprozentig tödlich. Es wird alles Leben töten, das es berührt. Ich würde lieber mit einem Gewehr an die Front gehen, als etwas zu entwickeln, das so verheerend ist.«
Davids ganze Körperhaltung drückte seinen Widerwillen aus, sich auf dieses Thema einzulassen. »Ich habe geschworen, nie wieder mit dir darüber zu streiten. Es ist dieselbe Debatte, die ich immer mit Dad geführt habe. Die Bergpredigt gegen Maschinengewehre. Gandhi gegen Hitler. Passiver Widerstand nutzt gegen Deutschland nichts, Mark. Die Nazis scheißen einfach drauf! Wenn du ihnen die andere Wange hinhältst, schlitzen diese Mistkerle sie dir auf. Verdammt, es waren schließlich die Deutschen, denen Dad seine Verletzung zu verdanken hatte!«
»Sprich leiser!«
»Ja, ja, Jesus! Die Richtung, die dieses Gespräch eingeschlagen hat, gefällt mir überhaupt nicht.« Nachdenklich kratzte sich der junge Pilot das stoppelige Kinn. »Okay, gut … Hör mir einfach eine Minute zu. Zu Hause nennen dich alle Mac, stimmt’s? Das war schon immer so.«
»Was hat das damit zu tun?«
»Hör einfach nur zu. Mich nennen alle David, richtig? Oder Dave, oder Slick. Warum glaubst du wohl, nennen dich alle Mac?«
Mark zuckte mit den Schultern. »Ich war der Ältere.«
»Falsch. Sie haben dich so genannt, weil du dich genauso wie Dad benommen hast, als er ein Kind war.«
Mark rutschte auf seinem Stuhl herum. »Schon möglich.«
»Was heißt hier ›schon möglich‹? Du weißt, dass ich recht habe. Aber was du nicht weißt, oder was du einfach nicht wissen willst, ist, dass du dich immer noch wie Dad benimmst.«
Mark richtete sich kerzengerade auf.
»Unser Vater, der große Arzt, hat die meiste Zeit seines Lebens in unserem Haus verbracht und sich versteckt.«
»Meine Güte, er war schließlich blind!«
»Nein, das war er nicht«, widersprach David hitzig. »Seine Augen waren verletzt, aber er hat gesehen, was er sehen wollte.«
Mark wandte den Blick ab, widersprach jedoch nicht.
»Der Himmel weiß, wie schrecklich sein Gesicht ausgesehen hat, aber er hätte es nicht verstecken müssen. Als ich noch ein Kind war, dachte ich, er müsste es tun; doch er musste gar nichts. Die Leute hätten sich an ihn gewöhnen können. An seine Narben.«
Mark schloss die Augen, doch in seinen Gedanken wurde das Bild dadurch nur umso klarer. Er sah einen gebrochenen Mann auf dem Sofa liegen, dessen Gesicht und Hals zum größten Teil von ätzenden Giften entstellt worden war, die über seinen halben Körper geflossen und ihm sogar in die Lungen gedrungen waren. Als Junge hatte Mark zugesehen, wie seine Mutter feuchte Tücher auf die Augen des Mannes gepresst hatte, um die Tränen aufzusaugen, die unkontrollierbar aus den zerstörten Schleimhäuten gelaufen waren. Wenn sie sicher gewesen war, dass sein Vater schlief, war sie in die Küche gegangen und hatte leise geweint.
»Mom konnte sich nie daran gewöhnen«, sagte er ruhig.
»Du hast recht«, bestätigte David. »Aber sein Gesicht war nicht der Grund. Es waren die Narben in seinem Inneren, mit denen sie nicht fertigwurde. Verstehst du mich? Dad war ein staatlich beglaubigter Kriegsheld. Er hätte in ganz Amerika mit vor Stolz geschwellter Brust herumlaufen können. Aber das tat er nicht. Und weißt du auch weshalb, Doktor McConnell? Weil er zu viel gegrübelt hat. Genau wie du. Er hat versucht, das Gewicht dieser ganzen verdammten Scheißwelt auf seine Schultern zu nehmen. Als ich in die Air Force eingetreten bin, hat er damit gedroht, mich zu enterben. Und das auf seinem Sterbebett. Doch schon lange vorher hat er dir so viel Angst vor dem Krieg eingeimpft, dass er dein ganzes Leben damit geprägt hat.« David wischte sich über die Stirn. »Sieh mal, ich will dir nicht vorschreiben, was du tun sollst. Du bist schließlich das Genie in dieser Familie.«
»Nun hör aber auf, David!«
»Verdammt, lass diesen scheinheiligen Quatsch! Ich war acht Jahre nach dir auf der Schule, und die Lehrer haben mich immer noch mit deinem Namen angesprochen, klar? Ich bin Flieger, kein Philosoph; doch das eine weiß ich: Wenn Ikes Invasion endlich losgeht und unsere Jungs diese französische Küste stürmen, dann wird es echt schlimm. Wirklich schlimm. Kerle, die noch jünger sind als ich, werden befestigte Maschinengewehrnester stürmen. Betonbunker. Sie werden da drüben sterben wie die Fliegen. Und jetzt erzählst du mir auch noch, dass sie dieses Sarin-Zeug haben. Wenn du der Bursche bist, der Hitler davon abhalten kann, es zu benutzen, oder der eine Abwehr dagegen erfindet oder uns zumindest die Möglichkeit gibt, genauso hart zurückzuschlagen … Na ja, du könntest dir den Mund fusselig reden, um die Jungs davon zu überzeugen, dass es richtig ist, gar nichts zu unternehmen. Sie werden dich dafür einen Verräter schimpfen.«
Mark zuckte unwillkürlich zusammen. »Das weiß ich. Aber was du nicht verstehst, ist, dass es dagegen keine Abwehr gibt. Die Kleidung, die einen Mann gegen Sarin schützt, müsste luftdicht sein und verdammt schwer. Ein Soldat könnte darin vielleicht eine Stunde kämpfen, höchstens zwei. Unsere Jungs wollen ja nicht mal die normalen Gasmasken im Kampf tragen, weil sie ein bisschen unbequem sind. In Ganzkörperanzügen könnten sie niemals einen befestigten Strand erobern.«
»Was willst du mir damit sagen? Wir sind erledigt, lasst uns in Deckung gehen und warten, bis wir alle nur noch Wiener Schnitzel essen?«
»Nein. Sieh mal, wenn Sarin ein deutsches Gas ist, hat Hitler es bis jetzt noch nicht eingesetzt. Vielleicht wird er es auch gar nicht tun. Ich sage nur, ich möchte nicht der Mann sein, der das Armageddon ermöglicht. Diesen Job überlasse ich lieber jemand anderem.«
David zwinkerte ein paarmal mit den Augen und versuchte, das Zifferblatt seiner Uhr zu erkennen. »Ich glaube, ich werde heute Nacht noch nach Deenethorpe zurückfahren.«
Mark griff über die Tischplatte hinweg und drückte seinem Bruder den Arm. »Mach das nicht, David. Ich hätte dieses verdammte Thema gar nicht erst anschneiden sollen.«
»Das ist nicht der Grund. Es ist einfach nur … Ich bin diese verdammte Sache so leid. All die Jungs, die von den Einsätzen nicht zurückgekommen sind. Ich habe vor zwei Monaten aufgehört, Freundschaften zu schließen, Mark. Es lohnt sich nicht.«
Jetzt bemerkte Mark, dass der Bourbon allmählich Wirkung zeigte.
»Ich denke viel über dich nach, weißt du das?«, fragte David leise. »Wenn ich fühle, wie die Bomben aus dem Bauch von Shady Lady fallen, und die Flak gegen die Wände hämmert, dann denke ich, dass wenigstens mein Bruder das nicht mit ansehen muss. Wenigstens er wird wieder nach Hause kommen. Er verdient es auch. Er hat immer versucht, das Richtige zu tun, ein guter Sohn zu sein, und er war seiner Frau treu. Und jetzt muss ich feststellen, dass du mit diesem Zeug hantierst …« David senkte den Blick, als versuche er, etwas Winziges in der Mitte des Tisches zu erkennen. »Ich bemühe mich, nicht allzu viel an Dad zu denken. Aber du bist wirklich wie er. Ich meine auch im Guten. Vielleicht hast du recht. Und vielleicht lag er auch richtig. Ich will nur einfach heute Abend nicht weiter darüber nachdenken, und wenn ich hierbleibe, bleibt mir nichts anderes übrig.«
»Ich verstehe.«