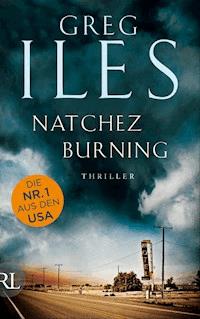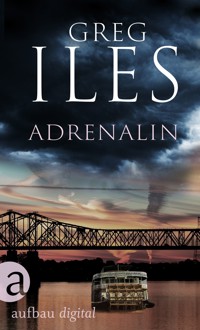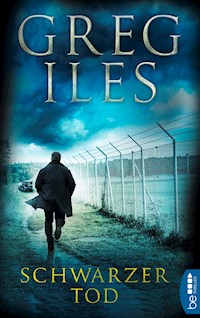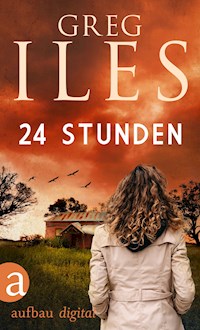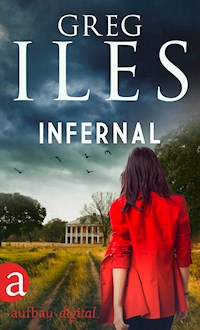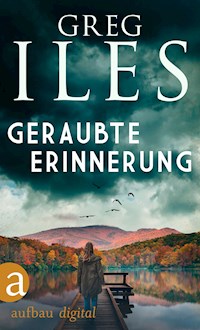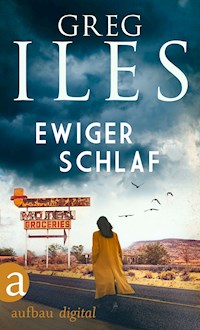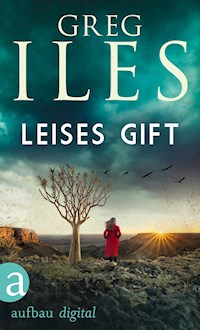9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: World War 2 Series
- Sprache: Deutsch
1987 stirbt Adolf Hitlers rechte Hand im Berliner Gefängnis Spandau. Doch mit dem Tod von Rudolf Heß beginnt das größte Rätsel der Nachkriegszeit: Wurde Heß ermordet? Und wenn ja, von wem? Durch Zufall gerät der deutsche Polizist Hannes Apfel an den Schlüssel zu diesem Geheimnis: das Tagebuch von Heß! Und plötzlich verwandelt sich Westberlin in einen Hexenkessel, in dem nichts so ist, wie es scheint. Secret Service, KGB und CIA versuchen verzweifelt, die Spandauer Papiere in die Finger zu bekommen, um eine Katastrophe zu verhindern. Doch welches Geheimnis enthalten die Dokumente? Und warum geht die mysteriöse Organisation Phoenix über Leichen, um sie zu finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Spandau Phoenix
Prolog
10. Mai 1941
1. Kapitel
Westberlin, 1987
2. Kapitel
Sowjetischer Sektor: Ostberlin, DDR
Britischer Sektor: Westberlin
Französischer Sektor: Westberlin
Pretoria, Republik Südafrika
3. Kapitel
Britischer Sektor: Westberlin
4. Kapitel
Amerikanischer Sektor: Westberlin
MI5‐Hauptquartier: Charles Street, London, England
Lützenstraße 30, Westberlin
5. Kapitel
Polizei‐Abschnitt 53
6. Kapitel
Lützenstraße 30, Britischer Sektor: Westberlin
Polizei‐Abschnitt 53, Amerikanischer Sektor: Westberlin
7. Kapitel
Britischer Sektor: Westberlin
MI5‐Hauptquartier: Charles Street, London, England
Lützenstraße 30
Europa‐Center, Breitscheidplatz: Westberlin
Bismarckstraße
8. Kapitel
Lützenstraße, Westberlin
Bezirk Tiergarten, Britischer Sektor: Westberlin
Lietzenseepark, Britischer Sektor
Südafrikanischer Luftraum: 100 km nordöstlich von Pretoria
9. Kapitel
Goethestraße, Britischer Sektor: Westberlin
10. Kapitel
Polizei‐Abschnitt 53, Amerikanischer Sektor: Westberlin
Prinzenstraße, Westberlin
11. Kapitel
Polizei‐Abschnitt 53: Westberlin
Tiergarten, Britischer Sektor: Westberlin
12. Kapitel
Velpke, Niedersachsen, BRD: nahe der ostdeutschen Grenze
Das nördliche Transvaal, Republik Südafrika
Flugplatz Tegel, Britischer Sektor: Westberlin
13. Kapitel
In der Nähe von Wolfsburg, BRD
MI5‐Hauptquartier: Charles Street, London, England
14. Kapitel
Tiergarten, Kriminalpolizei, Amerikanischer Sektor: Westberlin
Natterman‐Hütte: in der Nähe von Wolfsburg, BRD
15. Kapitel
Sowjetischer Sektor: Ostberlin, DDR
Natterman‐Hütte: In der Nähe von Wolfsburg, BRD
16. Kapitel
Ostberlin, Sowjetischer Sektor: DDR
KGB‐Hauptquartier: Ost‐Berlin, Sowjetischer Sektor, DDR
Natterman‐Hütte: In der Nähe von Wolfsburg, BRD
Hauptquartier der U.S. Army: Westberlin
Hauptquartier des MI5: Charles Street, London, England
17. Kapitel
Natterman‐Hütte: In der Nähe von Wolfsburg, BRD
Kontrollpunkt Sonnenallee: Amerikanischer Sektor, Westberlin
18. Kapitel
Ostberlin, Sowjetischer Sektor: DDR
Lützenstraße 30, Britischer Sektor: Westberlin
Haslemere, Surrey, England
19. Kapitel
Zähringerstraße, Britischer Sektor: Westberlin
Lufthansa‐Flug 417: Luftraum Korsika
Autobahn E 35: Frankfurt, BRD
20. Kapitel
Der Berghof: die Bayerischen Alpen, 7. Januar 1941
21. Kapitel
Berchtesgaden, Bayerische Alpen, 7. Januar 1941
22. Kapitel
Zwei Monate später …
Danksagung
Über den Autor
Spandau Phoenix
Buch eins
Von Greg Iles
Aus dem Englischen von Franca Tödter und Ulrike Koch
Prolog
»Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat.«
– Napoleon Bonaparte
10. Mai 1941
Die Nordsee war ungewöhnlich ruhig an diesem milden Frühlingsabend. Schon bald würde die Dunkelheit über einen rauchenden, zerbrochenen Kontinent hereinbrechen, der unter dem Schock des Krieges litt. Von den blutigen Dünen Dünkirchens bis hin zu den bombenzerstörten Straßen Warschaus. Von der eisigen Spitze Norwegens bis hin zu den verlassenen Stränden des Mittelmeers – Europa war versklavt. Nur England, belagert und allein, stand gegen die geballten Armeen von Hitlers Wehrmacht, und heute Nacht sollte London fallen. Durch Feuer.
Um 18:00 Uhr Greenwich-Zeit würde die größte Ansammlung von Bombern der Luftwaffe ihre Wut auf die schutzlose Stadt loslassen und über 300 Hektar der britischen Hauptstadt würden zu existieren aufhören. Tausende von Brandbomben würden auf Zivilisten und Soldaten gleichermaßen niederregnen, nur knapp die St. Paul’s Cathedral verfehlen und die Houses of Parliament zerstören. Der Angriff auf London würde als der schlimmste des gesamten Krieges in die Geschichte eingehen – eine Massenvernichtung.
Und doch war all das – die Planung, die Opfer, die gigantische Zerstörung – nur die Rauchwolke eines Varieté-Magiers. Ein spektakuläres Ablenkungsmanöver, das die Augen der Welt von einer Mission ablenken sollte, die so gewagt und komplex war, dass sie über Generationen hinweg unverständlich bleiben würde. Der Mann hinter diesem genialen Plan war Adolf Hitler, und heute Abend würde er, ohne dass es nur ein einziges Mitglied seines Generalstabs wüsste, vom Berghof aus die ehrgeizigste militärische Großtat seines Lebens unternehmen.
Er hatte schon vorher Wunder vollbracht – der Blitzkrieg in Polen, das Vordringen in die »unpassierbaren« Ardennen – aber dies würde die Krönung seines Siegeszuges sein. Es würde ihn endlich über Alexander, Cäsar und Napoleon erheben. Mit einem überwältigenden Schlag würde er das Gleichgewicht der Kriegsmächte auf den Kopf stellen, seinen Todfeind in einen Verbündeten verwandeln und seinen jetzigen Verbündeten ins Verderben stürzen. Um erfolgreich zu sein, musste er ins Herz Großbritanniens vordringen, aber nicht mit Bomben oder Raketen. Heute Abend brauchte er Präzision, und er hatte seine Waffen entsprechend gewählt: Verrat, Schwäche, Neid, Fanatismus – die vernichtendsten Kräfte, über die der Mensch verfügte. All das waren vertraute Werkzeuge in Hitlers Hand, und alle waren an ihrem Platz.
Aber solche Kräfte waren unberechenbar. Verräter lebten in Angst vor Entdeckung, Agenten fürchteten ihre Gefangennahme. Fanatiker explodierten ohne Vorwarnung, und schwache Männer neigten zum Verrat. Hitler wusste, dass jemand vor Ort sein musste, um solche Ressourcen effektiv zu nutzen. Derjenige musste den Agenten beruhigen, den Fanatiker anweisen, dem Verräter die Hand und dem Feigling die Waffe an den Kopf halten. Aber wer konnte eine solche Mission durchführen? Wer konnte gleichermaßen Vertrauen und Angst erwecken? Hitler kannte einen solchen Mann. Er war ein Soldat, ein Mann von achtundvierzig Jahren, ein Pilot. Und er war bereits in der Luft.
600 Meter über Amsterdam pflügte der Messerschmitt Bf-110 Zerstörer durch eine niedrige Decke aus Kumuluswolken und brach in den klaren Himmel über der glitzernden Nordsee ein. Die Nachmittagssonne blitzte auf den silbernen Flügeln des Jagdflugzeugs und ließ die schwarz lackierten Kreuze aufleuchten, die die Menschen in ganz Europa in Angst und Schrecken versetzten.
Im Cockpit atmete der Pilot erleichtert auf. Die letzten 650 Kilometer war er eine anstrengende, stark eingeschränkte Route geflogen und hatte mehrmals die Höhe gewechselt, um innerhalb der von der Luftwaffe vorgeschriebenen Sicherheitskorridore zu bleiben. Hitlers persönlicher Pilot Hans Bahr hatte ihm mit der verschlüsselten Karte, die er bei sich trug, auch eine Warnung mitgegeben. Bahr hatte geflüstert, dass die Sicherheitskorridore nicht zum Vergnügen täglich geändert wurden. Da britische Spitfires regelmäßig Hermann Görings »undurchdringlichen« Luftverteidigungswall durchdrangen, war die Gefahr real und Vorsichtsmaßnahmen notwendig.
Der Pilot lächelte grimmig. Feindliche Jagdflugzeuge waren heute Nachmittag seine geringste Sorge. Wenn er den nächsten Schritt seiner Mission nicht perfekt ausführte, würde ihn eine Staffel Messerschmitts und nicht Spitfires ins Meer schießen. Jeden Moment erwarteten die Fluglotsen der Luftwaffe, dass er nach Deutschland zurückkehrte, wie er es schon ein Dutzend Mal zuvor getan hatte. Wenn er den von Willi Messerschmitt persönlich geliehenen Jäger testgeflogen hatte und dann nach Hause zu Frau und Kind, zu seinem privilegierten Leben, zurückkehren würde. Aber dieses Mal wollte er nicht umkehren.
Als er die Fluggeschwindigkeit mit seiner Uhr verglich, schätzte er den Punkt, an dem er von den Radarschirmen der Luftwaffe auf der niederländischen Insel Terschelling verschwinden würde. Er hatte die niederländische Küste um 15:28 Uhr erreicht. Jetzt war es 15:40 Uhr. Bei einer Geschwindigkeit von 350 Kilometern pro Stunde hätte er bereits 70 Kilometer der Nordsee hinter sich gelassen. Er wusste, dass das deutsche Radar seinem britischen Pendant nicht gewachsen war, aber er würde noch drei Minuten warten, um sicherzugehen. Heute Nacht durfte nichts dem Zufall überlassen werden. Nichts.
Der Pilot zitterte in seinem pelzgefütterten Lederanzug. So viel hing von seiner Mission ab: das Schicksal Englands und Deutschlands, vielleicht sogar der ganzen Welt. Das war genug, um jeden Mann zum Zittern zu bringen. Und Russland, dieses riesige, barbarische Land, das vom Krebsgeschwür des Kommunismus befallen war – der alte Feind seines Vaterlandes. Wenn er heute Abend Erfolg hatte, würde Russland endlich unter dem Hakenkreuz knien!
Der Pilot betätigte den Steuerknüppel, ließ die linke Tragfläche der Messerschmitt absinken und schaute durch die dicke Glashaube nach unten. Fast war es so weit. Er schaute auf seine Uhr und zählte.
Fünf.
Vier.
Drei.
Zwei.
Eins.
Jetzt!
Wie ein stählerner Falke stürzte er auf das Meer zu und raste mit 650 Kilometern pro Stunde hinab. Im letzten Moment riss er den Steuerknüppel nach hinten und glitt über die Wellenkämme, während er nach Norden in Richtung Aalborg stürmte, dem wichtigsten Luftwaffenstützpunkt in Dänemark. Sein spektakuläres Rennen hatte begonnen.
Die Messerschmitt kämpfte sich durch die schwere Luft auf Meereshöhe und verbrauchte Treibstoff, als wäre dieser Wasser, aber die Hauptsorge des Piloten war jetzt die Geheimhaltung. Und das Landesignal zu finden, erinnerte er sich. Zwei Dutzend Trainingsflüge hatten ihn mit dem Flugzeug vertraut gemacht, und dennoch war der Abstecher nach Dänemark unerwartet gewesen. So weit nördlich war er noch nie ohne Sichtkontakt geflogen. Er hatte keine Angst, aber er hätte sich deutlich besser gefühlt, wenn er steuerbords schon die Fjorde Dänemarks gesehen hätte.
Es war schon lange her, dass der Pilot getötet hatte. Die Schlachten des Großen Krieges erschienen ihm jetzt so vage. Er hatte sicherlich Hunderte von Schüssen im Zorn abgefeuert, aber man war sich des Tötens nie wirklich bewusst. Jedenfalls nicht, bis die Angriffe kamen – die schrecklichen, blutigen, heldenhaft verrückten Angriffe von Fleisch gegen Stahl. Beinahe wäre er getötet worden – daran erinnerte er sich noch genau – durch eine Kugel in der linken Lunge, eine von drei Wunden, die er sich während des Kampfes im berühmten List-Regiment zugezogen hatte. Aber er hatte überlebt, das war die Hauptsache. Die Toten in den feindlichen Schützengräben … Wen interessierten sie schon?
Heute Nacht würde er töten. Er würde keine andere Wahl haben. Routiniert überprüfte er die beiden Kompasse, die an seinem linken Oberschenkel befestigt waren, und nahm eine umsichtige Peilung vor.
Dann richtete er seinen Blick schnell wieder auf den Horizontkreisel. So nah an der Meeresoberfläche spielte das Wasser dem Verstand gerne Streiche. Hunderte von erfahrenen Piloten waren in die Wellen gerauscht, weil ihre Konzentration für ein paar Augenblicke nachgelassen hatte. Nur noch sechs Minuten bis Aalborg, dachte er nervös. Warum es riskieren? Er stieg auf 300 Meter, fing die Maschine ab und reckte den Hals, um das Meer unter sich zu betrachten. Es war ruhig und verschwand vor ihm mit der sanften Wölbung der Erde. Außer … dort … genau vor ihm. Die Küstenlinie mit ihren zahlreichen Sunden tauchte auf …
Dänemark!
Er hatte es geschafft!
Beflügelt von einem heißen Adrenalinstoß suchte er die Wolken nach Jagdpatrouillen ab. Sollte ihn eine entdecken, so beschloss er, würde er abwarten, seinen Kurs beibehalten und so tun, als wäre er ein Nachzügler eines vorausgegangenen Angriffs. Das harte, leere Nordland blitzte unter ihm auf. Sein Ziel war ein kleiner Nebenstreifen, kurz vor dem Luftwaffenstützpunkt Aalborg. Aber wo war sie? Die Landebahn und seine spezielle Fracht, die auf ihn wartete … wo?
300 Meter unter ihm leuchtete plötzlich der rote Blitz der Eisenbahnfackeln in parallelen Linien zu seiner Linken auf. Das Signal! Ein einzelnes grünes Leuchtfeuer zeigte die korrekte Anflugrichtung. Der Pilot kreiste weit, bis er eine 180-Grad-Drehung vollzogen hatte, und begann dann, die Messerschmitt einzupendeln. Der Streifen war kurz – kein Spielraum für Fehler. Höhenmesser null. Mit angehaltenem Atem tastete er vorsichtig nach der Landebahn.
Nichts …
Nichts …
Bumm!
Die Räder setzten hart auf dem Beton auf. Das Flugzeug wurde durch den Aufprall durchgeschüttelt, kam aber schnell wieder zur Ruhe. Der Pilot schaltete die Triebwerke ab und rollte, bis er dreißig Meter hinter den letzten beiden Fackeln zum Stehen kam.
Bevor er seinen Sicherheitsgurt öffnen konnte, schoben zwei Mitglieder des Bodenpersonals die Kabinenhaube über seinen Kopf zurück. Wortlos halfen sie ihm mit den Gurten und zogen ihn aus dem Cockpit. Ihre raue Vertrautheit erschreckte ihn, aber er ließ es über sich ergehen. Für sie war er nur ein weiterer Pilot – vielleicht auf einer etwas ungewöhnlichen Mission, die er allein von einem praktisch verlassenen Streifen südlich des Stützpunkts aus flog –, aber trotzdem nur ein Pilot. Hätte er seinen Fliegerhelm und die Schutzbrille abgenommen, hätten die Männer eine ganz andere Haltung eingenommen und ihn sicher nicht angefasst, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Das Gesicht des Piloten war jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Deutschland bekannt – und Millionen in ganz Europa und sogar auf der ganzen Welt.
Ohne ein Wort zu sagen, ging er ein Stück von der Landebahn weg und öffnete seinen Fliegeranzug, um sich zu erleichtern. Er sah, dass nur zwei Flugmechaniker anwesend waren, und die waren gut instruiert worden. Von einem ramponierten Tankwagen aus pumpte einer den Treibstoff in das Flugzeug, während der andere sich mit speziellen Armaturen unter dem linken Flügel der Messerschmitt beschäftigte. Der Pilot überprüfte die kleine Landebahn. Eine alte Windfahne, ein Haufen Schrott aus der Vorkriegszeit und ein paar Meter weiter eine kleine Holzhütte, in der wahrscheinlich einmal Werkzeug untergebracht gewesen war.
Ich wette, sie beherbergt jetzt etwas ganz anderes, dachte er. Er schloss seinen Anzug und ging langsam auf die scheinbar menschenleere Hütte zu, wobei er auf jedes Zeichen fremder Anwesenheit achtete. Die glatte schwarze Motorhaube eines Daimlers ragte hinter dem baufälligen Gebäude hervor und glänzte wie bei einem Leichenwagen. Der Pilot schlich um die Hütte herum und spähte durch die Windschutzscheibe des Wagens. Er war leer. Er erinnerte sich an seine Anweisungen und wickelte sich ein langes Fliegertuch um die untere Hälfte seines Gesichts. Es erschwerte ihm das Atmen, aber in Kombination mit seinem Fliegerhelm blieben nur seine Augen sichtbar. Ohne anzuklopfen, betrat er die Hütte.
Dunkelheit hüllte das Innere ein, aber die stinkende Luft war von menschlicher Präsenz geprägt. Jemand zündete eine Laterne an, und der Raum wurde langsam sichtbar. Ein Sturmbandführer in der schicken schwarzen Uniform von Himmlers SS stand weniger als einen Meter vom Piloten entfernt. Anders als die meisten seiner Art war dieser Vertreter von Himmlers Eliteeinheit von kräftiger Statur. Er schien eher an die Annehmlichkeiten eines weichen Quartiers wie Paris gewöhnt zu sein als an ein Kampfgebiet. Hinter ihm saß ein dünnerer Mann in einem ledernen Fliegeranzug starr auf einem Holzstuhl, dessen gerade Rückenlehne ihm kaum Spielraum ließ. Wie der Pilot hatte auch er sein Gesicht mit einem Tuch verdeckt. Seine Augen huschten nervös zwischen dem Neuankömmling und dem SS-Mann hin und her.
»Genau pünktlich«, sagte der Sturmbandführer und schaute auf seine Uhr. »Ich bin Sturmbandführer Horst Berger.«
Der Pilot nickte, nannte aber keinen Namen.
»Etwas zu trinken?« Eine Flasche erschien aus den Schatten. »Schnaps? Cognac?«
Mein Gott, dachte der Pilot. Führt der Idiot etwa eine ganze Bar in seinem Auto mit sich? Er schüttelte nachdrücklich den Kopf und wies mit dem Daumen auf die halb geöffnete Tür. »Ich kümmere mich um die Vorbereitungen.«
»Unsinn«, antwortete Sturmbandführer Berger und wies die Idee mit einem Schwenker seiner Flasche zurück. »Die Techniker schaffen das schon. Sie gehören zu den besten von Aalborg. Es ist eine Schande, wirklich.«
Das ist es, dachte der Pilot. Aber ich glaube nicht, dass du dich besonders darüber aufregst. Ich glaube, du genießt das alles.
»Ich gehe zurück zum Flugzeug«, murmelte er.
Der Mann auf dem Holzstuhl stand langsam auf.
»Was glauben Sie, wo Sie hingehen?«, bellte Sturmbandführer Berger, aber der Mann ignorierte ihn. »Ach, so ist das also«, murmelte Berger. Er knöpfte seinen Kragen zu und folgte den beiden aus der Hütte.
»Wissen sie von den Abwurftanks?«, fragte der Pilot, als Berger aufgeholt hatte.
»Ja.«
»Die 900-Liter?«
»Sicher. Schauen Sie, sie passen sie gerade an.«
Berger hatte Recht. Auf der anderen Seite des Flugzeugs befestigten zwei Mechaniker den ersten von zwei eiförmigen Zusatztreibstoffbehältern an den stumpfen Flügeln der Messerschmitt. Als sie damit fertig waren, wechselten sie auf die ihnen zugewandte Seite des Flugzeugs.
»Überprüft noch einmal die Andockstellen!«, rief der Pilot.
Der Chefmechaniker nickte und machte sich gleich an die Arbeit.
Der Pilot wandte sich an Sturmbandführer Berger.
»Ich hatte eine Idee«, sagte er. »Als ich oben in der Luft war.«
Der SS-Mann runzelte die Stirn. »Welche Idee?«
»Ich will, dass sie meine Waffen einfetten, bevor wir abheben.«
»Was meinen Sie damit? Ich versichere Ihnen, dass die Waffen in einwandfreiem Zustand sind.«
»Nein, ich will, dass sie die Läufe mit Fett füllen.«
Hinter Sturmbandführer Berger trat der andere Mann im Fluganzug zur Seite und schaute den Piloten neugierig an.
»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein«, wandte Berger ein. Er drehte sich um. »Sagen Sie es ihm«, beklagte er sich, doch der Mann im Fluganzug neigte nur den Kopf zur Seite.
»Aber das ist Selbstmord!« Sturmbandführer Berger protestierte lautstark. »Eine zufällige Begegnung mit einer britischen Patrouille und …« Er schüttelte den Kopf. »Nein, das kann ich einfach nicht zulassen. Wenn Sie abgeschossen werden, könnte meine Karriere eine sehr unangenehme Wendung nehmen!«
Deine Karriere ist schon vorbei, dachte der Pilot grimmig.
»Schmiert die Geschütze!«, rief er den Besatzungsmitgliedern zu, die die leeren Abwurftanks montiert hatten und nun eilig Treibstoff hineinpumpten. Der Chefmechaniker stand am Heck des Tanklasters und versuchte zu entscheiden, welcher der beiden Männer, die die Befehle gaben, wirklich das Sagen hatte. Er kannte Sturmbandführer Berger aus Aalborg, aber irgendetwas an dem großen, maskierten Piloten deutete auf eine gefährlichere Autorität hin.
»Das können Sie nicht tun!«, protestierte Sturmbandführer Berger. »Hören Sie auf damit! Ich habe hier das Kommando!«
Der Chefmechaniker schloss den Treibstoffschlauch und starrte die drei Männer am Rand der Landebahn an. Langsam und bestimmt deutete der Pilot mit einem langen Arm auf den Mann unter der Tragfläche und schrie durch sein Tuch: »Sie da! Schmieren Sie meine Geschütze! Das ist ein direkter Befehl!«
Der Chefmechaniker reagierte auf den Klang der Autorität. Er kletterte auf den Tankwagen, um eine Fettpresse aus seinem Werkzeugkasten zu holen.
Sturmbandführer Berger legte eine zitternde Hand auf die Schmeisser-Maschinenpistole an seinem Gürtel. »Ich glaube, Sie haben den Verstand verloren«, sagte er leise. »Nehmen Sie den Befehl sofort zurück oder ich stelle Sie unter Arrest!«
Mit einem Blick zurück zu den Technikern, die gerade damit beschäftigt waren, den Zwanzig-Millimeter-Lauf der Messerschmitt mit schwerem schwarzem Fett zu füllen, griff der Pilot nach seinem Tuch und wickelte es langsam ab. Als sein Gesicht sichtbar wurde, ging der SS-Mann mit vor Schreck geweiteten Augen einen Schritt zurück. Hinter ihm schluckte der Mann im Fluganzug schwer und wandte sich ab.
Das Gesicht des Piloten war dunkel, düster, mit tiefliegenden Augen unter buschigen schwarzen Brauen, die sich in der Mitte fast trafen. Sein gebieterischer Blick strahlte Befehlsgewalt aus. »Nehmen Sie die Hand von der Pistole!«, sagte er leise, aber bestimmt.
Einige Augenblicke lang stand Sturmbandführer Berger still wie ein Stein. Dann ließ er langsam seine Hand aus dem Griff der Schmeisser gleiten. »Jawohl, Herr … Herr Reichsminister.«
»Jetzt, Herr Major! Und machen Sie sich an die Arbeit! Los!«
Plötzlich war Sturmbandführer Berger voller Tatendrang. Mit klopfendem Herzen eilte er auf die Messerschmitt zu, sein Gesicht war heiß und kribbelte vor Angst. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Er hatte gerade gedroht, den stellvertretenden Führer des Deutschen Reichs – Rudolf Heß – unter Arrest zu stellen! Benommen befahl er den Männern, die Geschütze schneller einzufetten. Während sie dem nachkamen, behelligte er sie mit Fragen zu ihrer bisherigen Wartung. Waren die Andockstellen ordentlich? Würden sich die Abwurftanks an den Flügeln ordnungsgemäß entriegeln, nachdem sie geleert waren?
Am Rande der Landebahn drehte sich Heß zu dem Mann im Fluganzug um. »Kommen Sie näher«, sagte er.
Der Mann machte einen zögerlichen Schritt nach vorne und stand dann stramm. »Sie verstehen, was ich vorhabe?«, fragte Heß.
Der Mann nickte langsam, aber zustimmend.
»Ich weiß, dass es gefährlich ist, aber wir sollten dieses Risiko eingehen. Unter bestimmten Umständen könnte es den Unterschied über Sieg oder Niederlage ausmachen.«
Wieder nickte der Mann. Auch er war Pilot und hatte schon viel mehr Einsätze geflogen als der Mann, der so plötzlich das Kommando übernommen hatte. Er verstand die Logik: Ein Flugzeug, das angeblich auf einer Friedensmission war, würde mit deaktivierten Waffen viel überzeugender wirken. Aber auch wenn er es nicht verstanden hätte, wäre er nicht in der Position gewesen zu widersprechen.
»Es ist lange her, Hauptmann«, sagte Heß und benutzte den Rang anstelle eines Namens.
Der Hauptmann nickte. Über ihm rauschten zwei Messerschmitts aus Aalborg vorbei, die nach Süden auf Patrouille flogen.
»Es ist ein großes Opfer, das Sie für Ihr Land gebracht haben, Hauptmann. Sie und Männer wie Sie haben jede Normalität aufgegeben, damit Männer wie ich den Krieg in relativer Sicherheit führen können. Das ist eine große Last, nicht wahr?«
Der Hauptmann dachte flüchtig an seine Frau und sein Kind. Er hatte sie seit über drei Jahren nicht mehr gesehen und fragte sich nun, ob er sie jemals wieder treffen würde. Er nickte langsam.
»Sobald wir im Flugzeug sind«, sagte Heß, »werde ich Ihr Gesicht nicht mehr sehen können. Zeigen Sie es mir jetzt.«
Als der Hauptmann nach dem Ende seines Schals griff, kam Sturmbandführer Berger zurückgeeilt, um ihnen zu sagen, dass das Flugzeug fast fertig war. Die beiden Piloten, von dem mysteriösen Akt, in dem sie beide die Hauptrolle spielten, gefesselt, hörten ihn nicht einmal. Der Anblick, der sich dem SS-Mann hier bot, traf ihn wie ein Schlag in die Magengegend. Er stieß seinen gesamten Atem aus und verstand plötzlich, dass er gleich sterben würde. Vor ihm standen zwei Männer mit demselben Gesicht und schüttelten sich die Hände! Und was für ein Gesicht! Sturmbandführer Berger fühlte sich, als wäre er in ein Spiegelkabinett gestolpert, in dem sich offenbar nur die gefährlichen Menschen vervielfältigten.
Die Piloten hielten sich einen langen Moment an den Händen. Ihre Augen waren schwer von dem Wissen, dass ihrer beider Leben heute Abend über fremdem Boden im Cockpit eines unbewaffneten Jagdflugzeugs enden könnte.
»Mein Gott«, krächzte Berger.
Keiner der beiden Piloten schenkte ihm Aufmerksamkeit.
»Wie lange ist es her, Hauptmann?«, fragte Heß.
»Seit Dessau, Herr Reichsminister.«
Heß murmelte: »Sie sehen dünner aus. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist geradezu zermürbend.« Dann schroff: »Ist das Flugzeug bereit, Berger?«
»Ich … ich glaube schon, Herr –«
»Dann auf an Ihre Arbeit!«
»Jawohl, Herr Reichsminister!« Sturmbandführer Berger drehte sich um und marschierte auf die Besatzungsmitglieder zu, die jetzt unsicher vor dem Tankwagen standen und auf die Erlaubnis warteten, nach Aalborg zurückzukehren. Im Gehen löste Berger mit einer Hand den Verschluss seiner Schmeisser.
»Alles fertig?«, rief er.
»Jawohl, Herr Sturmbandführer«, antwortete der Chefmechaniker.
»Gut, gut. Treten Sie bitte vom Wagen zurück.« Berger hob den gedrungenen Lauf seiner Schmeisser.
»Aber … Sturmbandführer, was machen Sie denn da? Was haben wir getan?«
»Einen großen Dienst für Ihr Vaterland«, sagte der SS-Mann. »Und jetzt weg vom Wagen!«
Die Mechaniker sahen sich an. Wie erstarrt. Wie verängstigtes Wild. Endlich dämmerte ihnen, warum Sturmbandführer Berger zögerte. Er wusste offensichtlich etwas über die Flüchtigkeit von Flugzeugtreibstoffdämpfen. Der Chefmechaniker trat näher an den Lkw heran und faltete seine ölverschmierten Hände flehend zusammen. »Bitte, Sturmbandführer, ich habe eine Familie …«
Dann war es vorbei. Sturmbandführer Berger machte drei Schritte rückwärts und feuerte eine anhaltende Salve aus der Schmeisser ab. Heß schrie eine Warnung, aber es war zu spät. Wenn man die Schmeisser geschickt einsetzte, konnte sie eine präzise Waffe sein, aber Sturmbandführer Bergers Fähigkeiten waren begrenzt. Von einer zwölfschüssigen Salve trafen nur vier Kugeln die Mechaniker. Der Rest durchschlug die rostige Hülle des Tanklasters wie Papier.
Die Explosion schleuderte Sturmbandführer Berger einen halben Meter von seinem Platz weg. Heß und der Hauptmann hatten sich instinktiv auf den Beton gestürzt. Jetzt lagen sie auf dem Bauch und schirmten ihre Augen vor der Hitze ab. Als Heß schließlich aufblickte, sah er Sturmbandführer Berger, der sich als Silhouette von den Flammen abhob und stolz durch eine schwarze Rauchwolke auf sie zu stolperte.
»Was sagt man dazu!«, rief der SS-Mann und blickte zurück auf das Inferno. »Keine Beweise mehr!«
»Idiot!«, rief Heß. »In fünf Minuten wird eine Patrouille aus Aalborg hier sein, um das zu untersuchen!«
Berger grinste. »Lassen Sie mich das machen, Herr Reichsminister! Die SS weiß, wie man mit der Luftwaffe umgeht!«
Heß war erleichtert. Berger machte es ihm einfach. Dummheit war etwas, womit er keine Geduld hatte. »Es tut mir leid, Sturmbandführer«, sagte er und sah dem SS-Mann streng ins Gesicht. »Das kann ich nicht zulassen.«
Wie eine Kobra, die einen Vogel hypnotisiert, fixierte Heß Berger mit seinen dunklen, tiefliegenden Augen. Wie selbstverständlich zog er eine Walther-Automatik aus der Vordertasche seines Fliegeranzugs und zog den Schlitten zurück. Der Mund des dicken SS-Mannes öffnete sich langsam, seine Hände hingen schlaff an seinen Seiten, die Schmeisser nutzlos an seinem Gürtel befestigt.
»Aber warum?«, fragte er leise. »Warum ich?«
»Es hat etwas mit Reinhard Heydrich zu tun, glaube ich.«
Bergers Augen wurden groß, dann schlossen sie sich. Sein Kopf sank auf seinen Dienstrock.
»Für das Vaterland«, sagte Heß leise. Er drückte ab.
Der Hauptmann sprang auf, als er den Schuss der Walther hörte. Sturmbandführer Bergers Körper zuckte zweimal auf dem Boden, dann lag er still.
»Nehmen Sie seine Schmeisser und alles an Munition, was Sie finden können«, befahl Heß. »Überprüfen Sie den Daimler.«
»Jawohl, Herr Reichsminister!«
Die nächsten Minuten waren ein einziges Durcheinander, an das sich beide Männer für den Rest ihres Lebens deutlich erinnern würden. Sie durchsuchten die Leiche nach Munition, durchsuchten das Auto, überprüften die Abwurftanks des Flugzeugs, legten ihre Fallschirme an, zündeten die beiden Motoren, drehten das Flugzeug auf dem alten, rissigen Beton. Beide Männer führten instinktiv Aufgaben aus, die sie tausendmal in ihrem Kopf geprobt hatten, wobei die Anspannung durch das Wissen verstärkt wurde, dass jeden Moment eine bewaffnete Patrouille aus Aalborg eintreffen könnte.
Bevor sie das Flugzeug bestiegen, tauschten sie persönliche Gegenstände aus. Heß nahm schnell, aber sorgfältig die vereinbarten Gegenstände heraus. Drei Kompasse, eine Leica-Kamera, seine Armbanduhr, einige Fotos, eine Schachtel mit verschiedenen Drogen und anschließend die feine goldene Erkennungskette, die alle Mitglieder von Hitlers innerem Kreis trugen. Er überreichte sie dem Hauptmann mit einer kurzen Erklärung für jede einzelne: »Meine, die meiner Frau und meines Sohnes …«
Der Mann, der diese Gegenstände erhielt, kannte ihre Geschichte bereits, aber er schwieg. Vielleicht, so dachte er, spricht der Reichsminister zum Abschied von all den vertrauten Dingen, die er heute Abend verlieren könnte. Der Hauptmann konnte dieses Gefühl gut verstehen.
Selbst diese seltsame und ergreifende Zeremonie ging in dem betäubenden Rausch aus Angst und Adrenalin unter, der den Start begleitete, und keiner der beiden Männer sprach mehr, bis sie sich 64 Kilometer entfernt über der Nordsee befanden und auf ihr Ziel zusteuerten. Wie der Plan es vorsah, hatte Heß das Steuer an den Hauptmann übergeben. Heß saß nun auf dem Sitz des Funkers und blickte auf die beiden Heckflossen des Jägers. Die beiden Männer nannten keine Namen – nur ihre Dienstgrade – und beschränkten ihre Unterhaltung auf den Ablauf der Mission.
»Reichweite?«, fragte der Hauptmann und neigte seinen Kopf zum Rücksitz.
»2000 Kilometer mit den 900-Liter-Tanks«, antwortete Heß.
»Nein, ich meinte die Entfernung zum Ziel.«
»Die Insel oder das Schloss?«
»Die Insel.«
»1080 Kilometer.«
In der nächsten Stunde stellte der Hauptmann keine weiteren Fragen. Er starrte auf die immer dunkler werdende See hinunter und dachte an seine Familie. Heß studierte einen Stapel Papiere in seinem Schoß. Karten, Fotos und Mini-Biografien, die er heimlich aus den SS-Akten im Keller der Prinz-Albrecht-Straße kopiert hatte. Unablässig ging er jedes Detail durch und stellte sich vor, was bei der Landung auf ihn zukommen könnte. 160 Kilometer vor der englischen Küste begann er, den Piloten in seinen Pflichten zu unterweisen.
»Wie viel wurde Ihnen erzählt, Hauptmann?«
»Eine Menge. Zu viel, denke ich.«
»Sehen Sie das zusätzliche Funkgerät zu Ihrer Rechten?«
»Ja.«
»Können Sie es bedienen?«
»Ja.«
»Wenn alles gut geht, müssen Sie sich nur noch ein paar Dinge merken. Erstens: die Abwurftanks. Was immer auch passiert, Sie werfen sie ins Meer. Dasselbe gilt für das zusätzliche Funkgerät. Wenn meine Zeit um ist, natürlich. Vierzig Minuten ist das Zeitlimit, vergessen Sie das nicht. Vierzig Minuten.«
»Vierzig Minuten warte ich.«
»Wenn Sie meine Nachricht nicht innerhalb dieser Zeit erhalten haben, ist die Mission gescheitert. In diesem Fall …«
Der Pilot atmete scharf ein. Leise, aber hörbar. Heß wusste, was dieses Geräusch verursachte – die unauslöschliche Angst vor dem Tod. Er spürte sie auch. Aber für ihn war es etwas anderes. Er kannte den Wert der Mission, den unschätzbaren strategischen Vorteil, der den möglichen Verlust von zwei Menschenleben gering erscheinen ließ. Wie der Mann im Pilotensitz hatte auch Heß eine Familie – eine Frau und einen kleinen Sohn. Aber für einen Mann in seiner Position – einen Mann, der dem Führer so nahestand – waren diese Dinge ein Luxus, bei dem klar war, dass man ihn jeden Moment verlieren konnte. Für ihn war der Tod einfach ein Hindernis auf dem Weg zum Erfolg, das um jeden Preis umgangen werden musste. Aber für den Mann im Pilotensessel …
»Hauptmann?«, sagte Heß, fast sanft.
»Herr Reichsminister?«
»Ich weiß, wovor Sie jetzt Angst haben. Ich weiß es wirklich. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Verstehen Sie mich? Viel Schlimmeres.«
Die Antwort des Piloten war ein heiseres, hohles Glucksen. Heß beschloss, dass Mitgefühl nicht der richtige Motivator für diesen Mann war. Als er das nächste Mal sprach, strotzte seine Stimme vor Zuversicht. »Es hat keinen Sinn, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, Hauptmann. Der Plan ist einwandfrei. Das Wichtigste ist: Haben Sie sich vorbereitet?«
»Ich habe mich vorbereitet!« Der Hauptmann war sichtlich erleichtert, über etwas anderes reden zu können. »Mein Gott, so ein eisenharter SS-Brigadeführer hat mich zwei Tage lang in die Mangel genommen.«
»Wahrscheinlich Schellenberg.«
»Wer?«
»Schon gut, Hauptmann. Besser, Sie wissen es nicht.«
Stille erfüllte das Cockpit, während der Pilot an das Schicksal dachte, das ihn erwartete, wenn sein besonderer Passagier versagen sollte. »Herr Reichsminister?«, fragte er nach einer Weile.
»Ja?«
»Wie schätzen Sie Ihre Erfolgschancen ein?«
»Es liegt nicht in meinen Händen, Hauptmann, also wäre es dumm zu raten. Es liegt jetzt in den Händen der Briten.« Mein Rat ist, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, dachte Heß bitter. Die Bankiers des Führers taten dies schon seit Januar. »Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Teil der Mission«, sagte er. »Und um Himmels willen, springen Sie aus einer Höhe ab, die ausreicht, um das Flugzeug zu zerstören. Es ist nichts, was die Briten nicht schon gesehen haben, aber es gibt keinen Grund, es ihnen zum Geschenk zu machen. Sobald Sie meine Nachricht erhalten haben, springen Sie einfach ab und warten, bis ich Sie befreien kann. Das sollte nicht länger als ein paar Tage dauern. Wenn Sie die Nachricht nicht erhalten …«
Verdammt! Heß fluchte im Stillen. Es lässt sich einfach nicht vermeiden. Seine nächsten Worte hatten die spröde Schärfe eines Befehls. »Wenn Sie meine Nachricht nicht erhalten, Hauptmann, wissen Sie, was zu tun ist.«
»Jawohl«, murmelte der Pilot und hoffte, dass er zuversichtlicher klang, als er sich fühlte. Er war sich der kleinen, klebrigen Zyanidkapsel, die auf seine Brust geklebt war, auf erschreckende Weise bewusst. Er fragte sich, ob er diese Sache überhaupt durchziehen konnte, die alle außer ihm als normales Geschäft ansahen.
»Hören Sie mir zu, Hauptmann«, sagte Heß ernsthaft. »Sie wissen, warum Ihre Teilnahme notwendig ist. Der britische Geheimdienst weiß, dass ich nach England kommen werde …«
Heß redete weiter und versuchte, die Leere zu füllen, die dem Piloten zu viel Zeit zum Nachdenken ließ. Hier oben, weit entfernt von Deutschland, erschien das Konzept der Pflicht viel abstrakter, als wenn man von der allgegenwärtigen Ordnung der Armee und der SS umgeben war. Der Hauptmann schien solide zu sein – und Heydrich hatte sich für ihn verbürgt –, aber wenn er genug Zeit hatte, über seine Position nachzudenken, könnte er alles tun. Welcher vernünftige Mensch wollte schon sterben?
»Drosseln Sie das Tempo!«, befahl Heß und seine Stimme wurde schneller. »Bleiben Sie bei 180.« Die Kilometer waren vor der Nase der Messerschmitt dahingeschmolzen. Sie befanden sich nun nur noch 95 Kilometer vor der schottischen Küste. An einem klaren Abend wie diesem würden die Radarstationen der RAF jeden Moment die Reflexionen des Jagdflugzeugs einfangen. Heß zog seinen Fallschirmgurt fest, legte seine Karten beiseite und lehnte sich zurück.
»Bleiben Sie hoch und sicher!«, rief er in Richtung Kabinenhaube. »Sehen Sie zu, dass sie uns kommen sehen!«
»Wo springen Sie?«
»Wir sollten einen Ort namens Holy Island erreichen. Dort werde ich abspringen. Bleiben Sie ein paar Kilometer über dem Festland, dann setzen Sie zum Sturzflug an und rasen wie der Teufel! Sie werden wahrscheinlich ein ganzes Geschwader abkommandieren, sobald sie merken, womit sie es zu tun haben!«
»Jawohl«, bestätigte der Pilot. »Herr Reichsminister?«
»Was gibt’s?«
»Sind Sie schon mal Fallschirm gesprungen?«
»Nein. Noch nie.«
Ein ironisches Lachen durchbrach das Dröhnen der Zwillingstriebwerke.
»Was ist so lustig, Hauptmann?«
»Ich bin auch noch nie gesprungen! Das ist eine ziemlich wichtige Tatsache, die bei der Planung dieser Mission übersehen wurde, meinen Sie nicht?«
Heß erlaubte sich ein schiefes Lächeln. »Vielleicht wurde diese Tatsache berücksichtigt, Hauptmann. Manche Leute rechnen vielleicht sogar damit.«
»Oh … mein Gott.«
»Es ist zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben nicht genug Treibstoff, um es zurück nach Deutschland zu schaffen, selbst wenn wir es wollten!«
»Was?«, rief der Pilot aus. »Aber die Abwurftanks –«
»Sind leer!«, sagte Heß. »Oder werden es bald sein!«
Der Pilot spürte, wie sein Magen einen Salto machte. Noch bevor er die Bedeutung der Worte seines Passagiers entschlüsseln konnte, erblickte er unter sich Land.
»Herr Reichsminister! Die Insel! Ich sehe sie!«
Aus 665 Metern Entfernung war Holy Island ein winziger Fleck, der nur durch ein schmales helles Band vom Festland getrennt war. »Und … ein Leuchtsignal. Ich sehe das Leuchtsignal!«
»Grün oder rot?«, fragte Heß mit angespannter Miene.
»Rot!«
»Die Kabinenhaube, Hauptmann! Los!«
Gemeinsam kämpften die beiden Männer darum, das schwere Glas zurückzuschieben. Der Fallschirmsprung aus einer Messerschmitt war nicht üblich – er war eine reine Notmaßnahme – und einige Flieger waren bei diesem Versuch gestorben.
»Schieben!«, rief der Pilot.
Mit aller Kraft drückten die beiden Männer ihre Körper gegen die durchsichtige Haube des Cockpits. Ihre angespannten Muskeln zitterten vor Schmerz, bis der Rahmen plötzlich nachgab und in der offenen Position einrastete. Der Lärm im Cockpit war ohrenbetäubend. Die Triebwerke heulten auf. Der Wind war ein schreiendes, lebendiges Wesen, das darum kämpfte, die Männer aus ihrer winzigen Stahlröhre zu reißen. Über all dem schrie der Pilot: »Es ist so weit, Herr Reichsminister! Los! Los!«
Plötzlich schaute Heß in seinen Schoß. Leer.
Er hatte vergessen, seine Papiere wegzuwerfen! Keine Spur von ihnen im Cockpit. Sie mussten in dem Moment herausgesaugt worden sein, als sich die Kabinenhaube geöffnet hatte. Er betete, dass sie ihren Weg ins Meer gefunden hatten und nicht auf die Insel unter ihm.
»Springen Sie, Herr Reichsminister!«
Heß kämpfte sich in die Hocke und stellte sich den tödlichen Heckflossen des Jagdbombers. Die Zeit für Nettigkeiten war vorbei. Er griff hinter sich und riss den Kopf des Piloten zurück.
»Hauptmann!«, rief er. »Heydrich hat die Abwurftanks nur angebracht, um sicherzugehen, dass Sie es bis hierher schaffen! Sie sind leer! Egal, was passiert, Sie können nicht umkehren! Sie haben keine andere Wahl, als sich an ihre Befehle zu halten! Wenn ich Erfolg habe, sind Ihre Taten völlig egal! Aber wenn ich versage, können Sie auf keinen Fall umkehren! Sie kennen den Preis des Scheiterns – Sippenhaft! Vergessen Sie das nie! Sippenhaft bindet uns beide! Und jetzt ziehen Sie hoch! Geben Sie mir etwas Zug!«
Die Nase der Messerschmitt kippte nach oben und schuf für einen Moment einen kleinen Raum, der vor dem Wind geschützt war. Mit einem trotzigen Schrei stürzte sich Heß nach oben und nach hinten. Ungeübt zog er die Reißleine, sobald er aus dem Flugzeug gesprungen war. Die eng gefaltete Seide riss mit einem lauten Geräusch auf und verwandelte sich in einen weichen weißen Pilz, der träge durch den Nebel auf die schottische Erde herabsank.
Fluchend kämpfte der Pilot darum, die Kabinenhaube zu sichern. Ohne Hilfe war es doppelt so schwierig, aber die letzten Worte von Heß hatten ihn bis ins Mark erschüttert. Nur eine gewölbte Glasscheibe trennte ihn jetzt noch von dem schrecklichen Schicksal, das ihm auferlegt worden war. Mit der verzweifelten Kraft eines zum Tode Verurteilten schlug er die Haube zu.
Er ließ seinen linken Flügel sinken und blickte nach hinten. Da war der Fallschirm, leise, weit entfernt und friedlich. Abgesehen von einer katastrophalen Landung würde der Reichsminister zumindest seine Mission sicher beginnen. Es ermutigte den Piloten zu wissen, dass ein Amateur das Flugzeug tatsächlich mit dem Fallschirm verlassen konnte, aber etwas in seinem Inneren ließ ihn vor Angst zurückschrecken.
Sie hatten ihn ausgetrickst! Die Bastarde hatten ihn in eine Selbstmordmission gelockt, indem sie ihm vorgegaukelt hatten, es gäbe einen Ausweg! Nach all seiner Ausbildung hatten sie ihm nicht einmal zugetraut, seine Befehle auszuführen! Leere Zusatztanks. Diese Schweine! Sie wussten, dass er nach dem Absprung von Heß die alleinige Kontrolle über das Flugzeug haben würde, und sie hatten dafür gesorgt, dass er nicht genug Treibstoff haben würde, um umzukehren, falls die Mission schiefgehen würde. Und als ob das noch nicht genug wäre … Heß hatte ihm mit Sippenhaft gedroht!
Sippenhaft! Das Wort ließ den Piloten kurz nach Luft schnappen. Er hatte Geschichten über diese ultimative Strafe der Nazis für Verrat gehört, aber er hatte sie nicht wirklich geglaubt. Die Sippenhaft besagte, dass nicht nur das Leben des Verräters, sondern das Leben seiner gesamten Familie verwirkt war, wenn das Urteil gegen ihn gefällt wurde. Kinder, Eltern, Alte und Kranke – niemand wurde verschont. Es gab keine Berufung, und das Urteil wurde schnell vollstreckt, sobald es gefällt war. Mit einem gutturalen Schrei verfluchte der Pilot Gott dafür, dass er ihm das Gesicht eines anderen Menschen gegeben hatte. In diesem Moment wurde ihm bewusst, dass dies ein endgültigeres Todesurteil war als ein Tumor im Gehirn. Er verzog den Mund zu einem grimmigen Lächeln und stürzte das Flugzeug in einen rasanten Sturzflug, den er erst beendete, als die felsige schottische Erde die Nase seines Flugzeugs zu zerschmettern drohte. Dann – so wie Heß es vorgeschlagen hatte – raste er wie der Teufel und beschleunigte den Zerstörer auf 550 Kilometer pro Stunde über die niedrigen Steindörfer und Felder. Unter anderen Umständen wäre der aufregende Flug über dem Boden ein berauschendes Erlebnis gewesen. Doch heute Abend fühlte es sich an wie ein Wettlauf mit dem Tod.
Und das war es auch. Eine patrouillierende Boulton Paul Defiant hatte auf einen Alarmruf aus der RAF-Überwachungszentrale in Inverness geantwortet. Der Messerschmitt-Pilot hatte sie nicht einmal gesehen. Achtlos stürmte er wie eine Banshee über die dunkle Insel, fünf Meter über der Erde. Durch den enormen Geschwindigkeitsvorteil hängte die zweimotorige Messerschmitt den verfolgenden britischen Jäger ab wie ein jagender Falke einen Sperling.
In der Ferne erhob sich der Dungavel Hill. Höhe: 458 Meter. Die Information ratterte durch das Gehirn des Piloten wie ein Laufband. »Da ist es«, murmelte er und erspähte die Silhouette von Schloss Dungavel. »Mein Teil dieser wahnsinnigen Mission.« Die Burg blitzte unter seinem Rumpf auf. Mit einer Hand prüfte er das Funkgerät neben seinem rechten Knie. Es funktionierte. Bitte melden Sie sich, dachte er. Bitte …
Er hörte nichts. Nicht einmal ein Rauschen. Mit zitternden Händen berührte er den Steuerknüppel und hüpfte über eine Reihe von Bäumen, die eine Schafsweide teilten.
Er sah Felder … eine Straße … noch mehr Bäume … dann die Stadt Kilmarnock, die sich dunkel entlang der Straße erstreckte. Er sauste weiter. Ein Nebelfeld, dann das Meer!
Wie ein schwarzer Pfeil schoss er über die Westküste Schottlands und stieg schnell auf. Zu seiner Linken erblickte er sein Ziel, einen riesigen Felsen, der 120 Meter in den Himmel ragte und blass im Mondlicht leuchtete. Wie von einem Magneten angezogen blieben seine Augen auf dem winzigen Zifferblatt seiner neu erworbenen Uhr haften. Schon dreißig Minuten und kein Signal. In zehn Minuten würde sein Schicksal besiegelt sein. Wenn Sie in vierzig Minuten kein Signal empfangen, Hauptmann, werden Sie aufs Meer hinausfliegen und Ihre Zyanidkapsel schlucken … Er fragte sich, ob er bereits tot wäre, wenn sein Flugzeug in die eisigen Tiefen des Nordatlantiks stürzte.
Gott im Himmel!, schrie sein Verstand. Welcher verrückte Bastard hat sich das ausgedacht? Aber er wusste es – Reinhard Heydrich, der verrückteste Bastard von allen. Sich gegen die Panik wehrend, machte er eine weite Kurve nach Süden und flog parallel zur Küste, in der Hoffnung, dass das Signal von Heß kommen würde. Sein Blick wanderte über die Instrumententafel. Höhenmesser, Fluggeschwindigkeit, Kompass, Treibstoff – die Tanks! Ohne nach unten zu schauen, betätigte er einen Hebel neben seinem Sitz. Zwei Zusatztreibstofftanks purzelten durch die Dunkelheit nach unten. Einer würde am nächsten Tag von einem britischen Fischerboot leer aus der Clyde-Mündung geborgen werden.
Das Funkgerät blieb stumm. Er überprüfte es erneut. Es funktionierte immer noch. Seine Uhr zeigte neununddreißig Minuten an. Seine Kehle wurde trocken. Sechzig Sekunden bis zur Stunde null. Sechzig Sekunden bis zum Selbstmord. Bitte sehr, mein Herr, ein Zyanidcocktail für den Ruhm des Reiches!, dachte er zynisch. Zum letzten Mal blickte der Pilot sehnsüchtig auf den dunklen Spiegel des Meeres hinunter. Seine linke Hand kroch in seinen Fluganzug und berührte die Zyanidkapsel, die an seine Brust geklebt war. Dann kam ihm mit erschreckender Klarheit ein Bild seiner Frau und seiner Tochter in den Sinn.
»Das ist nicht fair!«, rief er verzweifelt. »Es trifft immer den kleinen Mann, der sich opfern soll!«
In einem heftigen Anfall von Schrecken und Empörung riss der Pilot den Steuerknüppel nach Backbord und steuerte den brüllenden Jäger zurück ins Landesinnere. Seine tränenerfüllten Augen durchdrangen den schottischen Nebel und suchten nach den Orientierungspunkten, die er in Dänemark so lange studiert hatte. Ihn überlief ein Schauder der Hoffnung, als er die ersten Eisenbahnschienen erspähte, die wie Quecksilber in der Nacht leuchteten. Vielleicht kommt das Signal noch, dachte er verzweifelt. Aber er wusste es besser. Seine Augen suchten die Erde nach seinem zweiten Orientierungspunkt ab – einem kleinen See südlich von Schloss Dungavel. Da …
Die Messerschmitt raste über das Wasser. Wie ein Trugbild tauchte das kleine Dorf Eaglesham vor ihm auf. Das Jagdflugzeug donnerte über die Dächer und drehte sich in einem hohen, steigenden Kreis über Schloss Dungavel. Er hatte es geschafft! Wie eine intravenöse Morphiumdosis fühlte der Pilot einen plötzlichen Rausch, eine wilde Freude, die ihn überkam. Entfacht durch die Nähe des Todes, hatte sein Überlebensinstinkt tief in seinem Gehirn einen Schalter umgelegt. Er hatte nur noch einen Gedanken – überleben! In einer Höhe von 200 Metern begann der Alptraum. Da er niemanden hatte, der das Flugzeug während des Sprungs steuerte, beschloss der Pilot, die Triebwerke als Sicherheitsmaßnahme abzuschalten. Nur ein Motor spielte mit. Der andere, dessen Zylinder durch den langen Flug von Aalborg noch glühend heiß waren, zündete weiterhin das Treibstoffgemisch. Er drosselte das Gas, bis das Triebwerk abstarb, und verlor damit wertvolle Sekunden, dann riss er die Kabinenhaube auf.
Er kam nicht aus dem Cockpit heraus! Wie eine unsichtbare eiserne Hand drückte ihn der Wind an die Rückwand. Verzweifelt versuchte er, einen Looping zu machen, in der Hoffnung, beim Umkippen des Flugzeugs herauszufallen, aber die Zentrifugalkraft hielt ihn unerbittlich in seinem Sitz fest. Als genug Blut aus seinem Gehirn herausgedrückt worden war, wurde er ohnmächtig.
Ohne irgendetwas um sich herum wahrzunehmen, raste der Pilot der Vergessenheit entgegen.
Als er wieder zu sich kam, stand das Flugzeug auf seinem Heck und hing regungslos in der Luft. In einer Millisekunde würde es als zwei Tonnen Stahlschrott in die Tiefe stürzen.
Mit einer mächtigen Kniebeuge sprang er ab.
Während er fiel, überschlugen sich in seinem Gehirn die Bilder vom Fallschirm des Reichsministers, wie er sich im sterbenden Licht geöffnet hatte und friedlich einer Mission entgegenschwebt war, die inzwischen gescheitert war. Sein eigener Fallschirm schnappte mit einem Ruck auf. In der Ferne sah er einen Funkenregen. Die Messerschmitt war auf den Boden aufgeschlagen.
Als er auf dem Boden aufkam, brach er sich den linken Knöchel, aber das aufsteigende Adrenalin schirmte seinen Verstand gegen den Schmerz ab. Alarmrufe hallten aus der Dunkelheit.
Mühsam befreite er sich aus dem Gurtzeug und überblickte im Mondlicht den kleinen Bauernhof am Rande des Feldes, auf dem er gelandet war. Noch bevor er sich umsehen konnte, tauchte ein Mann aus der Dunkelheit auf. Er war Vormann der Feldarbeiter der Farm, ein Mann namens David McLean. Vorsichtig näherte sich der Schotte und fragte den Piloten nach seinem Namen. Der Pilot hatte Mühe, seinen betäubten Verstand zu klären, und suchte nach seinem Decknamen. Als ihm dieser einfiel, musste er fast laut lachen. Verwirrt nannte er dem Mann stattdessen seinen richtigen Namen. Was soll’s?, dachte er. In Deutschland gibt es mich doch gar nicht mehr. Dafür hat Heydrich gesorgt.
»Bist du Deutscher?«, fragte der Schotte.
»Ja«, antwortete der Pilot auf Englisch.
Irgendwo zwischen den dunklen Hügeln explodierte schließlich die Messerschmitt und erhellte den Himmel mit einem kurzen Blitz.
»Sind da noch mehr?«, fragte der Schotte nervös. »Aus dem Flugzeug?«
Der Pilot blinzelte und versuchte, die Ungeheuerlichkeit dessen, was er getan hatte – und was ihm befohlen worden war –, zu begreifen. Die Zyanidkapsel lag noch immer wie eine Viper auf seiner Brust. »Nein«, sagte er fest. »Ich bin allein geflogen.«
Der Schotte schien dies bereitwillig zu akzeptieren.
»Ich will zum Schloss Dungavel«, sagte der Pilot. Irgendwie konnte oder wollte er in seiner Verwirrung seine ursprüngliche Mission nicht aufgeben.
»Ich habe eine wichtige Nachricht für den Duke of Hamilton«, fügte er feierlich hinzu.
»Bist du bewaffnet?« McLeans Stimme war verhalten.
»Nein. Ich habe keine Waffe.«
Der Bauer starrte einfach nur. Eine schrille Stimme aus der Dunkelheit durchbrach schließlich die angespannte Stille. »Was ist passiert? Wer ist da draußen?«
»Ein Deutscher ist gelandet!«, antwortete McLean. »Holt ein paar Soldaten.«
Und so begann ein seltsames Schauspiel unsicherer Gastfreundschaft, das fast dreißig Stunden andauern sollte. Vom bescheidenen Wohnzimmer der McLeans, wo dem Piloten Tee auf dem besten Porzellan der Familie angeboten wurde, bis hin zur Hütte der Bürgerwehr in Busby nannte er weiterhin den Namen, den er dem Vormann bei der Landung gegeben hatte – seinen eigenen. Es war offensichtlich, dass niemand wusste, was man von ihm halten sollte. Irgendwie, irgendwo war etwas schiefgelaufen. Der Pilot hatte erwartet, in einem Kordon von Geheimdienstoffizieren zu landen. Stattdessen war er von einem verwirrten Bauern empfangen worden. Wo waren die streng dreinblickenden jungen Agenten des MI5? Mehrmals wiederholte er seine Bitte, zum Duke of Hamilton gebracht zu werden, aber von dem kahlen Raum in Busby wurde er mit einem Armeelaster in die Maryhill Barracks in Glasgow gebracht.
In Maryhill brannte sich der Schmerz seines gebrochenen Knöchels schließlich durch seinen Schock. Als er seinen Gastgebern davon erzählte, brachten sie ihn in das Militärkrankenhaus in Buchanan Castle, etwa 32 Kilometer südlich von Glasgow. Dort traf, fast dreißig Stunden nachdem die unbewaffnete Messerschmitt die schottische Küste überquert hatte, endlich der Duke of Hamilton ein, um den Piloten zur Rede zu stellen.
Douglas Hamilton sah so jung und schneidig aus wie auf dem Foto in seiner SS-Akte. Als Anführer des schottischen Hochadels, RAF-Flügelkommandant und berühmter Flieger stand Hamilton dem großgewachsenen Deutschen selbstbewusst gegenüber und erwartete eine Erklärung. Der Pilot stand nervös da, bereit, sich der Gnade des Dukes hinzugeben. Doch er zögerte. Was würde passieren, wenn er das tat? Es war möglich, dass es einfach nur eine Funkstörung gegeben hatte und dass Heß doch noch seine geheime Mission ausführte, was auch immer das war. Heydrich könnte ihm die Schuld geben, wenn Heß’ Mission scheiterte. Und dann würde natürlich auch seine Familie sterben. Er könnte seine Familie wahrscheinlich retten, indem er wie befohlen Selbstmord beginge, doch dann hätte sein Kind keinen Vater mehr. Der Pilot studierte das Gesicht des Dukes. Hamilton hatte Rudolf Heß bei der Berliner Olympiade kurz getroffen, das wusste er. Was sah der Duke jetzt? In der Erwartung, in Ketten gelegt zu werden, bat der Pilot den Offizier, der den Duke begleitete, sich aus dem Raum zurückzuziehen. Als er gegangen war, machte der Pilot einen Schritt auf Hamilton zu, sagte aber nichts.
Der Duke starrte verblüfft. Auch wenn sich sein Verstand dagegen sträubte, der erste Keim des Erkennens hatte sich in sein Gehirn gepflanzt. Die hochmütige Haltung, das dunkle, stark gebräunte Patriziergesicht … Hamilton traute seinen Augen kaum. Und obwohl der Duke versuchte, sein Erstaunen zu verbergen, nahm der Pilot alles in einem einzigen Augenblick wahr. Die schwindelmachende Hoffnung eines Verurteilten, dessen Begnadigung plötzlich möglich erscheint, durchströmte ihn. Mein Gott!, dachte er. Es könnte immer noch klappen! Und warum nicht? Dafür habe ich doch so lang trainiert!
Der Duke wartete. Ohne weiter zu zögern – ob aus Mut oder Feigheit, war ihm nicht bewusst –, gab der Pilot den jahrzehntelang geschulten Befehlsgehorsam auf.
»Ich bin Reichsminister Rudolf Heß«, sagte er steif. »Stellvertretender Führer des Deutschen Reiches, Vorsitzender der NSDAP.«
Der Duke verharrte in seiner klassischen britischen Zurückhaltung. »Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt«, sagte er schließlich.
Hamilton hatte sich um Skepsis bemüht, aber in seinen Augen erkannte der Pilot eine ganz andere Reaktion – keinen Unglauben, sondern Schock. Schock darüber, dass Adolf Hitlers Stellvertreter – der wohl zweitmächtigste Mann in Nazi-Deutschland – jetzt in einem Lazarett im Herzen Großbritanniens vor ihm stand! Dieser Schock war das eigentliche Zeichen für Hamiltons Akzeptanz!
Ich bin Reichsminister Rudolf Heß! Mit einem einzigen Atemzug hatte sich der verängstigte Pilot in den wichtigsten Kriegsgefangenen Englands verwandelt. Sein Verstand taumelte, trunken vom Aufschub der Katastrophe. Er dachte nicht mehr an den Mann, der vor ihm mit dem Fallschirm aus der Messerschmitt gesprungen war. Das Signal von Heß war nicht gekommen, aber das wusste niemand sonst. Niemand außer Heß, und der war wahrscheinlich schon tot. Der Pilot konnte immer behaupten, dass er ein verzerrtes Signal erhalten hatte und dann einfach seinen Auftrag wie befohlen fortgesetzt hatte. Niemand konnte ihm das Scheitern von Heß’ Mission in die Schuhe schieben. Erleichtert schloss der Pilot seine Augen. Zur Hölle mit der Sippenhaft! Niemand würde seine Familie töten, ohne ihm eine Chance zu geben, sich zu erklären. Als er dieses Risiko einging – die einzige Chance, die er sah, um zu überleben –, löste der verzweifelte Hauptmann unwissentlich die bizarrste Verschwörung des Zweiten Weltkriegs aus. Und hundert Kilometer weiter östlich war, lebend oder tot, der echte Rudolf Heß – ein Mann mit genug Geheimnissen in seinem Kopf, um einen katastrophalen Bürgerkrieg in England auszulösen – wie vom Erdboden verschluckt worden.
Der Duke of Hamilton blieb während des kurzen Gesprächs skeptisch, aber bevor er das Krankenhaus verließ, ordnete er an, dass der Gefangene an einen geheimen Ort gebracht und doppelt bewacht werden sollte.
1. Kapitel
»Wer als Verleumder umhergeht, gibt Geheimnisse preis, der Verlässliche behält eine Sache für sich.«
– Bibel, Buch der Sprüche, Kapitel 11, Vers 13
Westberlin, 1987
Die Abrissbirne schwang langsam über den schneebedeckten Hof und schlug in das letzte Gebäude auf dem Gefängnisgelände ein, wobei Ziegelsteine wie moosbewachsene Mörsergranaten durch die Luft flogen. Das Gefängnis Spandau, die brütende Festung aus rotem Backstein, die über ein Jahrhundert lang gestanden und in den letzten vierzig Jahren die berüchtigtsten Kriegsverbrecher beherbergt hatte, wurde an einem einzigen Tag dem Erdboden gleichgemacht.
Der letzte Häftling der Festungshaftanstalt, Rudolf Heß, war tot. Er hatte erst vor vier Wochen Selbstmord begangen und damit die westdeutsche Regierung von der Last von zwei Millionen D-Mark befreit, die sie jedes Jahr für die isolierte Gefangenschaft des alten Nazis zahlte. In einem seltenen Akt der Solidarität hatten sich Frankreich, Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion – die ehemaligen Alliierten, die Spandau im monatlichen Wechsel bewachten – darauf geeinigt, das Gefängnis so schnell wie möglich zu zerstören, um zu verhindern, dass es zu einem Schrein für neonazistische Fanatiker wurde. Den ganzen Tag über hatten sich Menschenmassen in der Kälte versammelt, um den Abriss zu beobachten. Da Spandau im britischen Sektor Berlins lag, war es Aufgabe der Royal Engineers, diese gewaltige Aufgabe zu bewerkstelligen. Zuerst brachte ein Sprengstoffteam das Hauptgebäude wie ein Kartenhaus zum Einsturz. Und nachdem sich der Staub im Schnee gelegt hatte, rückten Planierraupen und Abrisskräne an. Sie pulverisierten das Mauerwerk des Gefängnisses, zerlegten das eiserne Skelett und türmten die Überreste zu riesigen Trümmerhaufen auf, die Berlinern eines bestimmten Alters nur allzu bekannt vorkamen.
In diesem Jahr wurde Berlin 750 Jahre alt. Zur Feier des historischen Jubiläums wurden überall in der Stadt massive Bau- und Restaurierungsprojekte durchgeführt. Doch die Berliner wussten, dass sich diese düstere Festung nie wieder erheben würde. Jahrelang waren sie an ihr vorbeigegangen und hatten kaum einen Gedanken an dieses letzte, hartnäckige Symbol verschwendet. Ein Symbol für etwas, das im Glanze von Glasnost uralt wirkte. Doch jetzt, wo die furchterregenden Zinnen der Festungshaftanstalt das Bild der Wilhelmstraße nicht mehr verdunkelten, hielten sie inne, um über die Geister dieses Ortes nachzudenken.
In der Abenddämmerung stand nur noch das Heizwerk des Gefängnisses, dessen Schornstein sich deutlich von den grauen Wolken abhob. Ein Abrisskran zog seine gigantische Betonkugel zurück. Der Schornstein zitterte, als würde er auf den letzten Schlag warten. Die Kugel schwang in ihrem langsamen Bogen und schlug dann ein wie eine Bombe. Der Schornstein zerbarst und eine Wolke aus Ziegelsteinen und Staub überschüttete das, was nur wenige Minuten zuvor noch die Gefängnisküche gewesen war. Ein schriller Jubel durchbrach das Geräusch der schweren Dieselmotoren. Er kam von jenseits des abgesperrten Geländes. Der Jubel galt nicht der Auslöschung der Festungshaftanstalt, sondern war vielmehr ein spontaner Ausdruck der Ehrfurcht der Menschen vor dem Anblick der groß angelegten Zerstörung. Irritiert von den Zuschauern forderte ein französischer Corporal mit einer Geste einige deutsche Polizisten auf, ihm zu helfen, die Menschenmenge aufzulösen. Versierte Handzeichen überbrückten schnell die Sprachbarriere und die Berliner Polizei machte sich mit der für sie typischen Effizienz an die Arbeit.
»Achtung!«, brüllten sie. »Gehen Sie nach Hause! Verschwinden Sie! Dieser Bereich ist deutlich als gefährlich gekennzeichnet! Gehen Sie weiter! Es ist zu kalt zum Gaffen! Hier gibt es nichts als Ziegel und Schutt!«
Diese Bemühungen überzeugten die üblichen Neugierigen, mit einer unalltäglichen Geschichte nach Hause zu gehen, die sie beim Abendessen erzählen konnten. Aber andere ließen sich nicht so leicht verscheuchen. Mehrere alte Männer verweilten auf der belebten Straße, ihr Atem dampfte in der Kälte. Einige täuschten Langeweile vor, andere starrten offen auf das zerstörte Gefängnis oder warfen verstohlene Blicke auf die, die zurückgeblieben waren. Ein hartnäckiger Haufen junger Männer – wegen ihrer rituell kahlgeschorenen Köpfe »Skinheads« genannt – schwankte zum beleuchteten Gefängnistor und rief den britischen Truppen Nazi-Parolen zu.
Sie blieben nicht unbemerkt. Jeder Passant, der mehr als nur ein zufälliges Interesse an der Abrissaktion gezeigt hatte, wurde heute fotografiert. Im Inneren des Anhängers, in dem die Abrissarbeiten koordiniert wurden, machte ein russischer Jefrejtor sorgfältig zwei Teleobjektivaufnahmen von jeder Person, die nach dem Einrücken der deutschen Polizei noch in dem Block war. Innerhalb einer Stunde würden diese Fotos ihren Weg in die KGB-Kasernen in Ostberlin finden, wo sie vervielfältigt, in eine riesige Datenbank abgelegt und über das gewaltige nachrichtendienstliche Netz verteilt werden würden. Geheimdienstagenten, jüdische Fanatiker, radikale Journalisten, überlebende Nazis. Jede exotische Spezies wurde akribisch identifiziert und katalogisiert, und alle Fotos von Unbekannten wurden an die ostdeutsche Geheimpolizei – die berüchtigte Stasi – übergeben, um sie manuell mit ihren Dateien abzugleichen.
Diese Schritte würden unbezahlbare Computerzeit und viele Arbeitsstunden der Ostdeutschen verschlingen, aber Moskau machte es nichts aus, darum zu bitten. Die Zerstörung des Gefängnisses Spandau war für das KGB alles andere als Routine. Lawrenti Beria selbst, der Chef des brutalen NKWD unter Stalin, hatte eine spezielle Direktive an die nachfolgenden Chefs der Tscheka weitergegeben, in der er die Bedeutung der Spandauer Insassen für ungelöste Fälle festlegte. Und an diesem Abend – vierunddreißig Jahre nach Berias Tod durch ein Erschießungskommando – war nur noch einer dieser Fälle offen. Rudolf Heß. Der jetzige KGB-Chef hatte nicht die Absicht, es dabei zu belassen.
Ein Stück weiter oben in der Wilhelmstraße hockte eine Gestalt, die noch wachsamer war als die Russen, regungslos auf einer niedrigen Backsteinmauer und beobachtete, wie die Deutschen die Straße räumten. Der als Arbeiter gekleidete fast Siebzigjährige hatte das markante Gesicht eines Falken und starrte mit leuchtenden, unbewegten Augen. Er brauchte keine Kamera. Sein Gehirn registrierte sofort jedes Gesicht, das auf der Straße auftauchte, und stellte Assoziationen und Verbindungen her, wie es kein Computer je könnte.
Sein Name war Jonas Stern. Zwölf Jahre lang hatte Stern den Staat Israel nicht verlassen. Tatsächlich wusste niemand, dass er jetzt in Deutschland war. Aber gestern hatte er aus eigener Tasche gezahlt, um in dieses Land zu reisen, das er abgrundtief hasste. Natürlich hatte er vom Abriss der Festungsstrafanstalt Spandaus gewusst, alle wussten davon. Aber etwas Tiefgreifenderes hatte ihn hierhergezogen. Vor drei Tagen, während er Wasser vom Kibbuz-Brunnen zu seiner kleinen Hütte am Rande der Negev-Wüste getragen hatte, war etwas Dunkles aus seinem Inneren aufgestiegen und hatte ihn an diesen Ort getrieben. Stern hatte sich nicht gewehrt. Solche Vorahnungen kamen selten, und die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass man sie nicht ignorieren durfte.
Als er sah, wie das ummauerte Gefängnis zu Staub zermahlen wurde, spürte er, wie sich Triumph und Schuldgefühle in seiner Brust bekämpften. Er kannte Männer und Frauen, die auf ihrem Weg in die Todesfabriken von Mauthausen und Birkenau durch Haftanstalt Spandau gegangen waren. Ein Teil von ihm wünschte sich, dass das Gefängnis stehen bliebe, als Mahnmal für diese Seelen und für die Strafe, die ihre Mörder erhalten hatten.
Bestrafung, dachte er, aber keine Gerechtigkeit. Niemals Gerechtigkeit.
Stern griff in eine abgenutzte Ledertasche an seiner Seite und holte eine Orange heraus. Er schälte sie, während er den Abriss beobachtete. Das Licht war fast verschwunden. In der Ferne fuhr ein riesiger gelber Kran zu schnell über den Gefängnishof zurück. Stern verkrampfte sich, als die Steinplatten wie brüchige Knochen knackten.
Zehn Minuten später kamen die mechanischen Ungetüme mit lautem Gekreische zum Stehen. Während der ranghöchste britische Offizier seinen Entlassungsbefehl erteilte, rumpelte ein blassgelber Berliner Stadtbus auf das Gefängnis zu, dessen Scheinwerfer durch den sanft fallenden Schnee schnitten. In dem Moment, in dem er anhielt, strömten zwei Dutzend Soldaten in verschiedenen Uniformen in den dunkler werdenden Gefängnishof und teilten sich in vier Sechser-Gruppen auf. Diese Soldaten stellten einen Kompromiss dar, der typisch für die absurde Viermächte-Verwaltung von Spandau war. Die normalen einmonatigen Wachtouren wurden nach einem Dienstplan abgewickelt und verliefen meist reibungslos. Aber die Zerstörung des Gefängnisses hatte, wie jede vorangegangene Unterbrechung der Routine, Chaos gebracht. Zuerst hatten sich die Sowjets geweigert, den deutschen Polizeischutz des Gefängnisses zu akzeptieren. Dann – weil keine alliierte Nation einem ihrer »Verbündeten« zutraute, die Ruinen des Gefängnisses allein zu bewachen – beschlossen sie, dass sie es alle tun würden, mit einer kleinen Abordnung der Westberliner Polizei, um den Schein zu wahren. Während also die Royal Engineers in den Bus stiegen, verteilten die Unteroffiziere der vier Wachmannschaften ihre Männer auf dem Gelände.
In der Nähe des zerstörten Gefängnistors gab ein schwarzer amerikanischer Master Sergeant seiner Truppe eine letzte Anweisung: »Okay, meine Herren. Jeder hat seine Sektorkarte, richtig?«
»Sir!«, bellte seine Truppe unisono.
»Dann hört zu. Wir sind hier nicht am Tor der Basis, verstanden? Die Deutschen kümmern sich um das Außengelände – wir das Innere. Unser Befehl lautet, diese Ruine zu bewachen. Angeblich, wie der Captian sagt. Eigentlich sind wir hier, um die Russen zu beobachten. Sie beobachten uns, wir beobachten sie. Eigentlich wie immer, oder? Nur dass diese Iwans wahrscheinlich keine Soldaten sind, kapiert? Wahrscheinlich GRU, vielleicht sogar KGB. Also behaltet eure Helme auf und eure Glubscher offen. Noch Fragen?«
»Wie lange dauert der Auftrag, Serge?«
»Diese Patrouille dauert zwölf Stunden, Chapman, von sechs bis sechs. Wenn du dann noch wach bist – und das solltest du sein –, kannst du zurück in dein warmes Plätzchen in der Bendlerstraße gehen.« Als das Lachen verstummte, grinste der Sergeant und bellte: »Verteilt euch, meine Herren! Der Feind ist bereits in Stellung.«
Als die sechs Amerikaner auf den Hof ausschwärmten, hielt ein grün-weißer VW-Bus mit der Aufschrift POLIZEI auf der Straße vor dem Gefängnis. Er wartete auf eine Lücke im Verkehr, fuhr dann über den Bordstein und kam vor dem Anhänger für die Koordination zum Stehen. Sofort sprangen sechs Männer in den staubgrünen Uniformen der Westberliner Polizei heraus und stellten sich zwischen dem Bus und dem Anhänger auf.
Dieter Hauer, der verantwortliche Polizeikommissar des Polizeikontingents, kletterte vom Fahrersitz und trat um den Wagen herum. Er hatte ein markantes Gesicht mit einem kräftigen Kiefer und einem vollen militärischen Schnurrbart. Seine klaren grauen Augen schweiften einmal über den zerstörten Gefängnisplatz. In der Dämmerung fiel ihm auf, dass die Regenjacken der alliierten Soldaten den Eindruck erweckten, dass sie alle der gleichen Armee angehörten. Doch Hauer wusste es besser. Diese jungen Männer waren ein Ausbund an Nervosität und Misstrauen, bereit, beim kleinsten Anlass zu explodieren
Hauer indessen war das Inbild eines »Bullen«. Selbst mit seinen fünfundfünfzig Jahren strahlte sein kräftiger, massiver Körper genug Autorität aus, um dreißig Jahre jüngere Männer einzuschüchtern. Gegen die Kälte trug er weder Handschuhe noch Helm oder Mütze, und anders als die Rekruten in seiner Einheit vermuteten, war dies kein bloßes Angeben, um sie zu beeindrucken. Diejenigen, die ihn kannten, wussten, dass er eine fast übernatürliche Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse besaß, seien sie nun von der Natur oder vom Menschen verursacht. Hauer rief: »Achtung!«, als er um den Bus herum kam. Unter dem grellen Scheinwerferlicht des Kommandowagens formierten sich seine Beamten zu einer engstehenden Einheit.