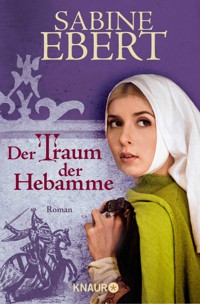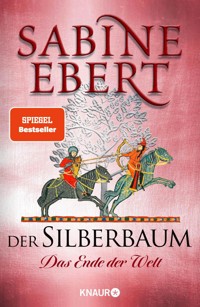Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sabine Ebert begann aus Passion für sächsische und deutsche Geschichte historische Romane zu schreiben, die allesamt zu Bestsellern wurden. Eigens für die Arbeit an ihrem Roman über die Völkerschlacht und die Fortsetzung zog sie nach Leipzig und wurde in der Messestadt schnell heimisch. In Sabine Eberts neuem Roman befinden wir uns in Deutschland nach der Völkerschlacht bei Leipzig: Napoleon ist geschlagen, aber noch lange nicht besiegt. Niemand ahnt, dass es mehr als anderthalb Jahre bis zu seiner endgültigen Niederlage 1815 bei Waterloo dauern wird. Statt des erhofften Friedens kommt immer größeres Elend über viele deutsche Städte. Die fliehende Grande Armée zieht eine Spur aus Blut, Hunger, Verwüstung und Krankheit durch das Land. Auch die junge Henriette, die nach Leipzig ging, um Verwundeten zu helfen, muss die Stadt verlassen und Hals über Kopf heiraten, um zu überleben. Als in Wien nach zynischem Schacher endlich Frieden geschlossen wird, ist Europa neu geordnet – aber unter blutigen Opfern. In bewegenden Szenen beleuchtet Sabine Ebert die kaum bekannte Zeit zwischen Völkerschlacht und Waterloo, die für viele deutsche Städte von unglaublicher Dramatik war. Dafür hat die Bestsellerautorin über Jahre hinweg Tausende Seiten Originalquellen studiert und eng mit Historikern und Militärs zusammengearbeitet. Entstanden ist etwas Großartiges und Seltenes: Geschichte, die unter die Haut geht!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sabine Ebert
1815 – Blutfrieden
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschland im Herbst 1813: Als Napoleon in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen wird, ist er noch lange nicht besiegt, und niemand ahnt, dass es mehr als anderthalb Jahre dauern soll, bis er 1815 bei Waterloo endgültig bezwungen wird. Statt des erhofften Friedens kommt immer größeres Elend über viele deutsche Städte. Die fliehende Grande Armée zieht eine Spur aus Blut, Hunger, Verwüstung und Krankheit durch das Land. Auch die junge Henriette, die nach Leipzig ging, um Verwundeten zu helfen, muss die Stadt verlassen und Hals über Kopf heiraten, um zu überleben. Als in Wien nach zynischem Schacher endlich Frieden geschlossen wird, ist Europa neu geordnet – aber unter blutigen Opfern. In bewegenden Szenen beleuchtet Sabine Ebert die kaum bekannte Zeit zwischen Völkerschlacht und Waterloo, die für viele deutsche Städte von unglaublicher Dramatik war. Dafür hat die Bestsellerautorin über Jahre hinweg Tausende Seiten Originalquellen studiert und eng mit Historikern und Militärs zusammengearbeitet. Entstanden ist etwas Großartiges und Seltenes: Geschichte, die unter die Haut geht!
Inhaltsübersicht
Karte: Europa nach dem Wiener Kongress
Karte: Vormarsch der Alliierten
Motto
Prolog
ERSTER TEIL
Der Irrtum des Königs
Der Preis des Sieges
Bekenntnisse
Siegesparade
Kaiser, König, Kronprinz
Blutige Hände
Rachepläne
Abschied
Der geschlagene König
Der alte General
Drei Briefe aus Pegau
Drei Briefe aus Halle
Verlierer und Sieger
Aufruhr
Auf dem Sprung
Der Morgen nach der Schlacht
Leben und Sterben nach der Schlacht
Familienstreit
Der Kaiser zieht über die Saale
»Marschall Vorwärts«
Über die Unstrut
Kriegsbeute
Husarenstück
Nie geschehen
Ein König reist in Gefangenschaft
Ein König feiert, ein Kaiser räumt auf
ZWEITER TEIL
Noch eine Stadt im Chaos
Kommandowechsel
Ein Befehl, ein Geheimnis, ein Brief
Ermahnungen
Junge Leutnants
Blind
Königliche Ankunft in Berlin
Der Zorn des Dr. Reil
Höflichkeiten unter Brüdern
Eingeschlossen
Kalter Wind
Drei Briefe für Felix
Zwei Eskadrons gegen die Grande Armée
Verhängnisvoller Irrtum
Nächtliche Razzia
Bitteres Ende
Totensonntag
Die Festung an der Elbe
Die letzte Hoffnung
Truppeninspektion
Drei Briefe für Maximilian
Warten auf den Sturm
Stadt in Flammen
Eine Habsburgerin rettet Dresden
Entscheidungen
Geständnisse
Feldhochzeit
Licht in der Dunkelheit
Schicksalstage
Ein Begräbnis, ein Wortbruch und ein Ball
Eine Einladung zum Tee
Ein Ball von umstrittener Pracht
Ein König wacht auf
Drei Briefe nach Frankfurt
Schutt und Asche
Heiß und kalt
Taktische Spiele
DRITTER TEIL
Hoffnung, Trauer und dünnes Eis
Ein Gespräch über das Töten
Aufruhr
Kriegsweihnacht
Das Unmögliche
Fannur und Sidyka
Kriegsrat am Rhein
Die Avantgarde setzt über
Die Brücke
Die geteilte Stadt
Zwölf Uhr mittags
Zwei Schauspiele, zwei Enthüllungen und eine Entscheidung
Eklat im Salon
Eine Prinzessin von Preußen
Feldpost
Sturm auf Paris
Blutpreis
Paradeordnung
Bittere Pflichten
Champs-Élysées
Sieg oder Tod
Fürst Metternichs romantische Intrige
Die Wege trennen sich
Ungewissheit
Übergabeverhandlungen
Eine Familie bangt, eine Stadt jubelt, und ein König zieht um
Vermisst
Eklat zu Königs Geburtstag
Victoria
Odyssee
Herztöne
Drei Gräber
VIERTER TEIL
Eröffnungstaktiken
Gedenken ein Jahr danach
Friedensweihnacht
Ziellos
Ein Gespräch im Hause Gerlach
Brandherde
Kriegsgetöse, Marktgeschacher
Ausgeflogen
Mobilmachung
Abgelehnt
Der Krieg und die Musen
Unruhiger März
Seine Kaiserliche Majestät kehrt zurück
Die neue Armee ist die alte Armee
Taktische Spiele
Es glüht ein stilles Feuer
Das Feuer schwelt längst
Meuterei
Standgericht
Zwei Anklagen gegen zwei Könige
Ereignisreiche Tage
Ein Tag, zwei Schlachten
Soldatenvermächtnis
Waterloo
Das Ende
Was bleibt?
Vermächtnis
Nachwort
Danksagung
Dramatis Personae
Frankreich/Grande Armée
Frankreich, zivil
Sachsen
Erfurt
Kaub am Rhein
Preußen
Russland
Österreich
Großbritannien
Sonstige
Glossar
Karte: Der Feldzug 1814/1815
»Haben grandiosen Sieg errungen! Feind vernichtend geschlagen.«
Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, während der Siegesparade in Leipzig am 19. Oktober 1813
»Ich sorge dafür, dass der Weg nach Westen frei gehalten wird.«
Franz I., Kaiser von Österreich, in einem geheimen Brief an seinen Schwiegersohn Napoleon vom 17. Oktober 1813
»Ich komme wieder! Im Frühjahr kehre ich mit zweihundertfünfzigtausend Mann über den Rhein zurück.«
Napoleon Bonaparte auf dem Rückzug nach der Niederlage von Leipzig am 19. Oktober 1813
»In Leipzig fand ich ungefähr zwanzigtausend verwundete und kranke Krieger aller Nationen. Die zügelloseste Phantasie ist nicht imstande, sich ein Bild des Jammers in so grellen Farben auszumalen, wie ich es vorfand.«
Johann Christian Reil, Arzt, an den Freiherrn vom Stein am 26. Oktober 1813
»Die Leichen lagen in Haufen zu Hunderten aufgetürmt.«
Johann Daniel Ahlemann, Totengräber von Leipzig
»Der König von Preußen wird König von Preußen und Sachsen sein, wie ich Kaiser von Russland und König von Polen sein werde.«
Zar Alexander von Russland 1814 auf dem Wiener Kongress
Prolog
Drei Tage nach der mörderischen Schlacht rannte eine Frau über den Leipziger Marktplatz und schrie gellend: »Sie schlagen die verwundeten Franzosen tot, sie schlagen die Schwerverletzten tot!«
Die Menschen erstarrten.
Da schritt ein kräftiger Mann auf sie zu und presste seine Hand auf ihren Mund.
»Sei ruhig, gute Frau!«, sagte er mit tiefer Stimme. »Niemand erschlägt niemanden. Niemand könnte je einen solchen Befehl erteilen, niemand wird es je bestätigen, und niemand spricht darüber. Sie erlösen die, denen sonst furchtbare Qualen bis zu ihrem unvermeidlichen Tod bevorstünden. Ein Akt der Gnade in schlimmster Not. Doch es ist nie geschehen, verstehst du? Nun geh nach Hause und schweig still wie wir alle!«
Und dann an alle: »Das hier gerade ist nie geschehen.«
ERSTER TEIL
NACH DER SCHLACHT
Der Irrtum des Königs
Leipzig, Quartier des sächsischen Königs am Markt im Apelschen Haus, 19. Oktober 1813
Stocksteif mit weißer Perücke, in rot-gelber Galauniform mit silbernen Epauletten, beäugte der König von Sachsen die Siegesparade der Alliierten auf dem Leipziger Marktplatz durchs Fenster und verstand die Welt nicht mehr.
Wieso ritt nicht er dort an der Seite des Zaren, des Kaisers von Österreich und des preußischen Königs und ließ sich mit ihnen vom Volk feiern? Von seinem Volk, wohlgemerkt! Dem seine Abwesenheit nicht einmal aufzufallen schien.
Kein einziger Ruf nach ihm erscholl in all dem Jubel, kein entrüsteter Aufschrei der Sachsen, wo denn ihr geliebter König bliebe! War er seinem Volk in fast fünfzigjähriger Regentschaft nicht immer ein guter Vater gewesen? Den Weisen nannten sie ihn, den Gerechten. Hatten ihn nicht auch die Leipziger stets inbrünstig gefeiert?
Doch jetzt jubelten sie den Österreichern und Russen zu, sogar den Preußen und den wilden Reiterstämmen, die der Zar aus den entlegensten Gegenden seines Reiches mitgebracht hatte.
Weder rief sein Volk nach ihm, noch kam ein Gesandter der alliierten Herrscher, um sich alleruntertänigst für das Versehen zu entschuldigen und ihn umgehend an die Seite der Majestäten zu bitten. Unfassbar!
Nein, Friedrich August von Sachsen, ein Mann von dreiundsechzig Jahren, verstand das alles nicht.
Seine Kopfhaut juckte und brannte unter der Perücke, Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn, das Atmen fiel ihm immer schwerer in dem eng geschlossenen Uniformrock mit den großen Orden.
Als einzige Erleichterung gestattete er sich, kurz mit dem Finger unter den hohen Stehkragen zu fahren, um sich etwas Luft zu verschaffen und das lästige Kratzen der Gold- und Silberstickereien am Kinn zu lindern. Wenigstens für einen Augenblick. Einen Knopf zu öffnen oder das seidene Halstuch zu lockern kam nicht in Frage.
Er war ein König!
In dem prächtigsten Raum des Apelschen Hauses weilten außer ihm mehr als ein Dutzend Personen: seine Gemahlin, seine Tochter, die engsten Berater, Bedienstete. Doch niemand sagte ein Wort, solange er sich nicht regte. Und so starrte Friedrich August von Sachsen weiter durch das Erkerfenster der Beletage und versuchte, die Welt zu verstehen, die ihm gerade vollends entglitt.
Die Alliierten konnten ihm doch nicht ernsthaft vorwerfen, dass er aus der Not heraus ein Bündnis mit Napoleon eingegangen war. Das hatten sie doch alle getan, bis sie sich früher oder später daraus lösen konnten! Und er hatte sich eben heute Morgen aus diesem Bündnis gelöst, vor exakt vier Stunden!
Neun Uhr früh war es, die Russen, Preußen und Österreicher bereiteten schon den Sturm auf die Stadt vor, da stand er mit Napoleon Bonaparte an diesem Fenster und lehnte heldenhaft dessen Aufforderung ab, ihn bei seinem geordneten Rückzug nach Erfurt zu begleiten.
Seinen treuesten Verbündeten wolle er in Sicherheit wissen, schmeichelte Bonaparte. Außerdem sei es für Sachsens Herrscher besser, bei den Verhandlungen mit den Alliierten an der Seite des Kaisers der Franzosen zu stehen. Schließlich verfüge er, Napoleon, selbst nach der misslich verlaufenen Leipziger Schlacht immer noch über eine furchtgebietende Armee.
Dass von geordnetem Rückzug keine Rede sein konnte, sah der König sogar vom Fenster aus. Leipzig war zum Inbegriff des Chaos geworden. Zehntausende Soldaten der Grande Armée versuchten verzweifelt, durch die von Menschen, Pferden, Trainwagen und Geschützen verstopften Straßen zu entkommen – vergeblich.
Deshalb hatte er mit vor Pathos zitternder Stimme geantwortet: »Mein Platz ist bei meinem Volke.«
Seine wahren Gründe für diese Entscheidung angesichts von dreihunderttausend Mann feindlicher Truppen, die Leipzig jeden Moment im Sturm einnehmen konnten, behielt Napoleons »treuester Verbündeter« für sich.
Friedrich August von Sachsen war nie auf einem Schlachtfeld gewesen. Das überließ er seinen Militärs. Doch dass die Grande Armée hier in Leipzig eine vernichtende Niederlage erleiden würde, war spätestens seit gestern Abend klar, als für die Alliierten weitere einhunderttausend Mann Verstärkung eintrafen. Napoleon hatte die Situation längst erkannt und schon vorletzte Nacht sein wertvollstes Gepäck und die ersten seiner Eliteeinheiten aus der Stadt abziehen lassen.
Bis gestern hatte der sächsische König noch fest an den Sieg Napoleons geglaubt. Doch nun musste er sich schleunigst von ihm lossagen und die Alliierten überzeugen, dass er auf ihrer Seite stand.
Schließlich war der größte Teil seiner Armee gestern zu den Verbündeten übergelaufen! Zwar ohne Erlaubnis ihres Königs und zu seiner maßlosen Enttäuschung. Aber diesen Seitenwechsel konnte er als Argument zu seiner und zu Sachsens Rettung anführen.
Erleichtert beobachtete er vom Fenster aus, wie der Kaiser, bevor er mit einem Pulk von Marschällen und Generälen davonritt, dem Sächsischen Leibgrenadierregiment zum Abschied zurief: »Behütet euren König gut!«
Wenig später musste die königliche Familie ins Kellergewölbe flüchten. Kugelhagel, Kanonendonner, Rauchwolken und durchdringende Schreie kündeten vom Vorrücken der Alliierten. Beobachter meldeten, dass die ersten feindlichen Truppen durchs Hallesche und Grimmaische Tor in die Stadt einzudringen versuchten. Gegen Mittag ließ eine gewaltige Explosion die Fensterscheiben klirren.
»Euer Königliche Majestät, die Elsterbrücke ist zerstört, der letzte Ausweg aus der Stadt!«, berichtete atemlos der Generaladjutant von Bose, den der König als Beobachter auf dem Turm der Thomaskirche postiert hatte. »Damit sind dreißigtausend französische Soldaten in Leipzig eingeschlossen!«
Die Militärs im Raum zogen angesichts dieser Schreckensnachricht scharf die Luft ein, denn sie verhieß ein fürchterliches Blutbad – und weitere tausende Verwundete und Gefangene, für die es weder Proviant noch ärztliche Hilfe gab.
»Die Alliierten haben die Stadt eingenommen«, fuhr, immer noch schwer atmend, der Generaladjutant fort. »Die Kaiserlichen und Königlichen Majestäten werden gleich auf den Markt reiten, wo sich das Volk sammelt, um sie zu bejubeln.«
Mit einem Blick befahl der König den Kammerdiener zu sich, um sich die letzten Körnchen Staub und Mörtel von der Uniform bürsten zu lassen, die im Kellergewölbe während des Beschusses auf ihn herabgerieselt waren.
Beklommen lauschte er auf den Lärm von draußen: Schüsse, Schreie, Waffenklirren, qualvoll wiehernde Pferde.
Dann folgte ein Moment gespenstischer Stille, der dem König einen eiskalten Schauer über den Rücken jagte. Rasch bekreuzigte er sich.
Und plötzlich Jubelschreie, tausendstimmige Hochrufe auf die Befreier. Auf Zar Alexander, auf Blücher, auf König Friedrich Wilhelm von Preußen, auf Kaiser Franz von Österreich und Kronprinz Karl Johann von Schweden. Sie mussten also schon ganz in der Nähe sein.
Der König straffte sich, bat in Gedanken um Gottes Beistand und trat vor die Tür des Apelschen Hauses.
Sein Leibgrenadierbataillon hielt Wache vor dem Quartier der königlichen Familie. Es war gestern von Napoleon persönlich herkommandiert worden. Weniger aus Sorge um den König, sondern um die Peinlichkeit zu verhindern, dass auch noch die sächsischen Garden zum Feind überliefen.
Auf Kommando des Majors von Dreßler erwiesen die Leibgrenadiere ihrem König die Ehrenbezeugung. Zögernd trat der Monarch einen Schritt vor.
Über dem Markt hing der beißende Geruch von Schießpulver, hinzu kam eine abstoßende Mischung von anderen Ausdünstungen: Blut, Verwesung, Exkremente.
Angewidert ließ sich der König ein Riechfläschchen geben.
Aus dem Augenwinkel konnte er erkennen, dass sich polnische Offiziere neben seinem Regiment aufreihten. Da Napoleon die Stadt verlassen hatte und sich das Gerücht wie ein Lauffeuer verbreitete, Fürst Poniatowski sei bei der Sprengung der Elsterbrücke gefallen, unterstellten sie sich direkt seinem Kommando als Herzog von Warschau.
Friedrich August sah den Kronprinzen von Schweden auf sich zureiten. Erleichtert atmete er auf und verlangte nach seinem Pferd. Dieser Mann war einmal Marschall von Frankreich gewesen, er würde ihn zur Siegesparade holen!
Karl Johann von Schweden, mit bürgerlichem Namen Bernadotte, begrüßte den im Eingang des Hauses stehenden sächsischen König mit einem höflichen Nicken.
Das Anschwellen des Jubels veranlasste den schwedischen Thronfolger, sich umzudrehen. Als er den Zaren und den preußischen König sah, wendete er seinen Schimmel und folgte ihnen. Nun ritt Kaiser Franz von Österreich an die Seite von Alexander und Friedrich Wilhelm. Erneut flammte euphorischer Jubel auf.
Und ich?, fragte sich Friedrich August fassungslos. Wieso bitten sie mich nicht zu sich? Hätte ich ihnen etwa entgegengehen sollen? Zu Fuß? Während sie zu Pferde sitzen? Nein, das wäre zu entwürdigend.
Ich bin ein König!
Ratlos verharrte der sächsische Monarch. Doch da ihn tatsächlich niemand zur Siegesparade einlud, entschloss er sich, wieder über die prachtvoll geschwungene Treppe hinauf in die Beletage zu steigen. Keiner der Herrscher hatte ihn auch nur eines Blickes gewürdigt. Starr schauten sie an ihm vorbei, als wäre er Luft.
Sie werden jemanden schicken, der mich zu ihnen bittet, dachte er unablässig. Etwas anderes war für ihn völlig unvorstellbar.
Der Preis des Sieges
Leipzig, Thomaskirche, 19. Oktober 1813
Benommen blinzelte der junge preußische Premierleutnant Maximilian Trepte in das Innere der Thomaskirche. Es war, als würde er durch die schwere Holztür eine andere, düstere Welt betreten.
Draußen strahlte die Sonne; das schien wie ein Wunder nach den Stürmen und eisigen Regenschauern der letzten Tage. Als wollten auch die himmlischen Mächte der Siegesparade Glanz verleihen, die keine zweihundert Schritt von ihm entfernt stattfand.
Auf dem Marktplatz jubelten tausende Menschen, Wildfremde lagen sich in den Armen, weil sie noch lebten und ihre Stadt noch stand. Hübsche Mädchen warfen abgekämpften Männern in zerrissenen Uniformen Herbstblumen und Kränze aus Eichenlaub zu. Und für diesen Augenblick des Triumphes schienen auch die Soldaten alle Qualen und Schrecknisse des Krieges vergessen zu haben: den Hunger, die Strapazen der endlosen Märsche, den Tod ihrer Gefährten, die Furcht, als Nächster von einer Kugel verwundet oder getötet, von einem Säbel verstümmelt oder einem Bajonett durchstochen zu werden.
Sie hatten gesiegt in einer viertägigen Schlacht nie da gewesenen Ausmaßes, mit mehr als einer halben Million Kämpfern. Sie hatten den gefürchtetsten Feldherrn ihrer Zeit in die Flucht getrieben.
An der Tür konnte Maximilian Trepte noch die Hochrufe und die Musik vom Marktplatz hören. Doch im nächsten Atemzug wurden sie aufgesogen von dem Grauen in der Kirche, die Leipzigs Hauptlazarett geworden war.
Der beißende Gestank nach Fäulnis, Blut, Erbrochenem und Exkrementen war die erste, alle Sinne betäubende Wahrnehmung an diesem Ort. Dann kamen die Schmerzensschreie, Flüche und verzweifelten Rufe um Hilfe. Doch erst nachdem sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, bot sich ihm das ganze Ausmaß des Elends dar.
Auf dem nackten, eiskalten Boden lagen Sterbende dicht gedrängt nebeneinander, fast alles Franzosen, Polen oder Rheinbündler: mit blutigen Verbänden oder offenen Wunden, Verstümmelungen jeder Art, ausgezehrt, vor Kälte zitternd oder im Fieber glühend, vor Schmerz wimmernd oder laut stöhnend.
Maximilian Trepte kannte die katastrophalen Zustände in den Lazaretten dieses Menschen verschlingenden, nicht enden wollenden Krieges. Er war selbst im Frühjahr schwer verwundet worden und dem Tod nur knapp entronnen. Dieses hier gehörte zu den schlimmsten aller Lazarette, und der Anblick entsetzte ihn.
Vorsichtig half er dem verletzten Offizier zu Boden, den er hergebracht hatte, und rief laut durch das Kirchenschiff: »Wie viele Verwundete können Sie aufnehmen?«
Suchend schaute er sich nach einem Arzt um.
Da traf ihn wie ein Blitzschlag der Anblick eines vertrauten Gesichtes keine zehn Schritte entfernt. Eines, das er hier nie erwartet hätte.
Sie war es wirklich, direkt vor ihm: Henriette Gerlach, die er gut behütet bei ihren Verwandten in Freiberg wähnte!
Jene Henriette, die ihm im Mai das Leben gerettet hatte, die ihm auf seine Bitte eine Haarsträhne als Zeichen ihrer Zuneigung sandte. Deren Bild er seitdem immer wieder in Gedanken heraufbeschwor, damit es ihn in den dunkelsten Momenten des Krieges mit Licht erfüllte.
Dort kniete sie inmitten der Sterbenden, mit blutverschmierten Händen, noch zerbrechlicher als bei ihrer ersten Begegnung, tränenüberströmt. Und auf ihren Schoß gebettet der Kopf eines toten französischen Lieutenants.
Wieso ist sie hier? In der Stadt, um die bis eben noch die schrecklichste Schlacht seit Menschengedenken tobte?, fragte sich Maximilian entsetzt.
Und sein nächster, zorniger Gedanke: Wieso weint sie um diesen toten Franzosen? Um einen Feind!
Auch Henriette zuckte zusammen, als sie erkannte, wer vor ihr stand: Maximilian Trepte, der junge preußische Offizier, der ihr Herz berührt hatte, während sie ihn nach einer schweren Verwundung pflegte. Über dessen unerwartete Briefe aus dem Feld sie sich so freute, dass sie sie immer noch bei sich trug, obwohl sie fast ohne Habe nach Leipzig geflüchtet war. Der versprochen hatte, sie nach dem Krieg auf einen Ball zu führen.
Doch darauf durfte sie nicht mehr hoffen. Sie war verloren, ganz gleich was die Zukunft nach dem Sieg der Preußen, Russen, Österreicher, Schweden und Briten bringen mochte. Sie hatte ihre Unschuld verloren und galt damit nicht mehr als ehrbar. Gefallene Mädchen wurden aus dem Haus gejagt, wenn sich der Skandal nicht verheimlichen ließ. Sie würde eine Ausgestoßene sein, falls sich das herumsprach, und die gesellschaftliche Ächtung würde auch die Familie ihres Oheims treffen, die sie und ihren Bruder Franz nach dem Tod ihrer Eltern bei sich aufgenommen hatte. Um das zu verhindern, ging sie lieber freiwillig – mitten hinein in das größte Chaos des Krieges, wo niemand sich um ihr Schicksal scherte.
Und nun war auch noch Étienne tot, unter ihren Händen verblutet. Étienne de Trousteau, dessen ungeborenes Kind sie vor vier Tagen verloren und den sie sterbend unter den Verwundeten vor der Kirche gefunden hatte. Sie konnte nicht mehr tun, als ihm in seinen letzten Minuten etwas Trost zu spenden.
Behutsam ließ sie seinen Kopf zu Boden sinken und schlug den Mantel eines toten Marinegardisten über Étiennes blutigem Körper zusammen. Als wäre es ein Leichentuch. Dann wischte sie sich mit dem Ärmel die Tränen vom Gesicht und erhob sich mit klammen, hölzernen Bewegungen.
Der preußische Premierleutnant Trepte war nicht ihretwegen gekommen. Er hatte nach der Lage im Lazarett gefragt und brachte einen verwundeten Offizier.
Also nahm sie alle Kraft zusammen und ging ihm entgegen, vorsichtig zwischen den Verwundeten und Todgeweihten hindurchbalancierend, um auf niemanden zu treten.
Mager sieht sie aus, völlig erschöpft, dachte Maximilian bedrückt. Sein Zorn verflog und wich tiefem Mitgefühl. Bei ihrer Begegnung im Mai hatten ihn ihre klugen grünen Augen fasziniert. Jetzt war ihr Blick erloschen. Sie wirkte nicht mehr zerbrechlich, sondern zerbrochen.
Was trieb sie nur hierher?, fragte er sich voller Sorge. Wo und wie lebt sie? Ihr Kleid war zu dünn für diese Kälte, aus dem flüchtig zum Knoten hochgesteckten, hellbraunen Haar lösten sich Strähnen. Kein unverheiratetes Mädchen aus gutem Hause gehörte allein irgendwohin, schon gar nicht an den Austragungsort einer Schlacht. Hatte ihr Oheim und Vormund, ein Freiberger Buchdrucker, sie etwa nach Leipzig verheiratet?
Oder hing ihre unerwartete Anwesenheit an diesem düsteren Ort mit dem toten französischen Lieutenant zusammen?
Im Freiberger Lazarett, beim schnellen Rückzug der Alliierten Anfang Mai, hatte Maximilian Trepte erlebt, wie aufopfernd Henriette für ihn und seine verwundeten Kameraden sorgte. Schon dafür liebte er sie, denn der Anblick schlimmster Kriegsverletzungen war ganz sicher nichts, das man einem siebzehnjährigen Mädchen aus behütetem Haus zumuten sollte. Und noch mehr liebte er sie für den Mut, bei ihnen auszuharren, bis die letzten Verwundeten evakuiert waren, obwohl die Feinde schon durch eines der Tore in die Stadt eindrangen.
Doch die Verzweiflung und Innigkeit, mit der sie den toten Franzosen gehalten hatte, ließen ihn argwöhnen, dass sie mehr als nur Fürsorge mit jenem Lieutenant verband.
Henriette ging Maximilian entgegen, ohne durch die geringste Regung zu verraten, dass sie ihn erkannte. Vielleicht erinnert er sich nicht mehr an mich, hoffte sie.
Er sah noch genau so aus, wie sie sein Bild immer wieder in Gedanken heraufbeschworen hatte; groß, schlank, dunkelhaarig, entschlossen, in der Uniform eines Preußischen Garderegiments.
»Der Erste Wundarzt wird Ihnen sagen, wie viele Ihrer Männer wir aufnehmen können«, brachte sie mit spröder Stimme heraus, noch während sie zwischen den Sterbenden hindurchstieg. Sie wies hinter sich zu dem Tisch, an dem ein Mann im blutbefleckten Kittel jemanden operierte, einen polnischen Ulanen der Uniform nach.
»Einen Augenblick, Herr Leutnant!«, rief der Wundarzt, der nur kurz zu ihnen sah. »Ich komme, sobald ich die Kugel entfernt habe. Man hätte diesen Lancier gar nicht erst herbringen sollen, er wird nicht überleben!«, rügte er seine Helfer.
Hilflos zog Henriette die Schultern hoch.
»Es sterben fast alle, die hier sind«, erklärte sie Maximilian. »Wir haben kein Brot, kein Lagerstroh, keine Medikamente und vor allem nichts zum Verbinden.«
Sie kniete sich neben den verwundeten preußischen Offizier, den der Premierleutnant gegen eine Säule gelehnt hatte. Er mochte Mitte vierzig sein, mit schweißnassem braunem Haar und totenbleich. Sein Stiefelschaft war zerfetzt, Blut rann aus mehreren Wunden. Ein großes, unregelmäßig geformtes Metallstück hatte sich ihm tief in den Unterschenkel gebohrt, dicht unter seinem Knie saßen noch weitere Splitter. Henriette schnitt das Leder auf, um die Wunden zu begutachten.
»Unser Stabskapitän von Wilhelmsen. Es erwischte ihn, als wir in Probstheida unter Beschuss standen. Der Feldchirurg ist selbst verletzt, und die Helfer wollten amputieren«, erklärte Maximilian Trepte. »Aber wir brauchen diesen Mann. Deshalb erhielt ich Erlaubnis, in Leipzig einen Arzt …«
»Er verliert zu viel Blut!«, unterbrach ihn Henriette alarmiert. »Haben Sie Leinen? Rasch, sonst verblutet er!«
Ohne Zögern holte Maximilian sein zweites Hemd aus dem Tornister und riss es in Streifen.
Bis zu diesem Moment hatte Henriette durch nichts gezeigt, dass sie einander kannten, dass sie etwas miteinander verband. Doch beim Anblick des Hemdes flackerte etwas über ihr Gesicht.
Das bewies ihm: Sie erinnerte sich genau. Dieses Hemd hatte sie selbst geflickt, während er in Freiberg mit dem Tod rang. Ein Bajonett war unterhalb des Schlüsselbeins durch seinen Körper gedrungen. Sie hatte nicht nur die Wunde gepflegt und das Fieber bekämpft, sondern auch die aufgeschlitzte Stelle in seinem Hemd ausgebessert.
»Bitte tun Sie, was Sie können, um ihn zu retten, Mademoiselle Gerlach!«, drängte er. »Vorigen Monat fiel sein einziger Sohn. Die Familie soll nicht noch den Vater verlieren.«
Als Maximilian sie beim Namen nannte, beugte sich Henriette tief über die Wunde. Jetzt war endgültig die Gelegenheit vorbei, so zu tun, als seien sie einander nie begegnet. Der preußische Leutnant würde Fragen haben, berechtigte Fragen, und wenn sie darauf antwortete, würde er sich voller Verachtung von ihr abwenden.
»Ich brauche mehr Licht!«, sagte sie.
Rasch stand er auf und holte eine Kerze, die einige Schritte entfernt auf einem Schemel brannte.
»Blei aus Kirchenfenstern«, erklärte Maximilian verbittert. »Wir standen auf dem Südlichen Schlachtfeld in Probstheida unter Beschuss. Als den Gegnern die Munition knapp wurde, zerschlugen sie die Kirchenfenster und beschossen uns mit Kartätschenladungen aus den zerhackten Bleirahmen.«
Vorsichtig erfühlte Henriette mit den Fingerspitzen den Sitz des größten Metallteils und versuchte, es zu lockern. Dann stellte sie die Kerze ab und rollte hastig die Leinenstreifen zusammen, die Maximilian ihr gegeben hatte.
Sie deutete auf Krug und Becher neben dem Schemel. »Stützen Sie ihn und geben Sie ihm zu trinken. Jetzt legen Sie ihn auf den Boden und halten sein Bein fest. Die Wunde wird weiter aufreißen, wenn ich dieses grässliche Ding herausziehe. Drücken Sie die Wundränder sofort zusammen, damit er nicht noch mehr Blut verliert! Um die kleineren Splitter kümmere ich mich später.«
Sie verständigten sich mit einem Blick, und sie zog erst vorsichtig, dann mit einem Ruck das fingerlange Stück Blei heraus. Ein Schwall Blut schoss aus der Wunde, aber Maximilian befolgte ihre Anweisung, und Henriette legte rasch einen festen Verband an.
»Trinken Sie, Sie müssen viel trinken!«, drängte Jette den Stabskapitän, während sie das Ende des Leinenstreifens in der Mitte zerriss und mit beiden Zipfeln den Verband zuknotete.
Maximilian richtete den Verwundeten auf und flößte ihm Wasser ein. Henriette begann, die kleineren Splitter mit einer Pinzette herauszuziehen, tief über das zerfetzte Bein gebeugt. So konnte sie die Regungen auf ihrem Gesicht verbergen.
Wehmütig dachte Maximilian an ihre erste Begegnung im Frühjahr.
Heute erschienen ihm die Zeiten unwirklich, als sie auf dem Feldzug noch die Wäsche gewaschen und genug zu essen bekamen. Sein im Sommer aus den besten Männern verschiedener Truppenteile formiertes 2. Preußisches Garderegiment zu Fuß war noch nicht einmal mit einheitlichen Uniformen ausgestattet. Und hatte er Henriette nicht prahlerisch versprochen, sie auf einen Ball zu führen?
Der Sieg über Napoleon war mit dem heutigen Tag zwar so gut wie errungen, der größte Teil des Landes befreit. Doch nicht einmal ein Narr könnte jetzt von einem Ball träumen. Sachsen war ausgeplündert, kaum eine Krume Brot ließ sich noch auftreiben für die hunderttausenden Soldaten rund um Leipzig, ob Sieger oder Gefangene. Und niemand wusste, wohin mit den zehntausenden Verwundeten.
Das brachte ihn wieder auf seinen zweiten Auftrag.
Zwei Helfer trugen gerade den operierten und nun toten polnischen Ulanen in den hinteren Teil des Kirchenschiffs. Da Henriette im Moment keine Hilfe brauchte, stand er auf und ging dem Chirurgen entgegen, der gleichzeitig auf ihn zukam.
»Doktor Multon, Erster Wundarzt von Leipzig«, stellte sich der hochgewachsene Mann in blutbeflecktem Kittel vor, der müde und übernächtigt aussah wie vermutlich alle Ärzte in diesen Tagen.
»Premierleutnant Trepte vom 2. Preußischen Garderegiment zu Fuß«, erwiderte Maximilian. »Ich soll erkunden, wie viele Verwundete Sie hier aufnehmen können.«
»Also haben die Alliierten die Franzosen endgültig aus der Stadt getrieben? Ist es vorbei?«
»Für Leipzig. Napoleon ist geflohen, wir verfolgen ihn. Es sind noch tausende seiner Soldaten in der Stadt. Aber sie haben sich ergeben.«
Dr. Multon atmete auf. »Wir sind sehr froh über Ihren Sieg. Und dankbar, dass Leipzig noch steht. Wir tun, was wir können, um zu helfen. Doch schauen Sie sich um, Herr Premierleutnant! Es mangelt an allem!«
Resigniert schwenkte er den Arm durch den Raum. »So sieht es derzeit in sämtlichen Leipziger Lazaretten aus: überfüllt, ohne Brot und ohne Medizin. Und es kommen immer mehr Blessierte. Zu Hunderten! Aus Mangel an Ärzten amputieren schon die Badergesellen.«
Multon ballte die blutverschmierten Hände vor Hilflosigkeit zu Fäusten und ließ sie wieder sinken. »Wir können nicht einmal mehr Totenscheine ausstellen. Alles Papier ist aufgebraucht, und den Lazarettschreiber hat das Nervenfieber niedergestreckt. Schicken Sie Männer und Fuhrwerke, damit wir die Toten schneller fortschaffen können! Dann wird Platz für Ihre Verwundeten. Brot und Lagerstroh werden Sie vermutlich auch nicht beschaffen können, aber wenigstens Leinen?«, bat er. »Wir haben nichts mehr zum Verbinden. Das Nervenfieber grassiert. Je eher Sie die Verletzten von hier fortschaffen, nachdem sie operiert sind, umso weniger Gefahr besteht, dass sie sich anstecken.«
»Ich werde im Hauptquartier berichten, damit Abhilfe geschaffen wird«, versprach Trepte. Sie wussten beide, dass nach vier blutigen Schlachttagen mit mehr als einer halben Million Beteiligten in einem kahl geplünderten Land keine Wunder zu erwarten waren.
Dr. Multon wollte wieder an seine Arbeit gehen, doch Maximilian hielt ihn zurück.
»In Probstheida, wo unser Regiment stand, entdeckten wir gestern ein Lazarett voller Franzosen im schlimmsten Zustand. Wir versuchten, ihnen zu helfen, soweit es uns möglich war. Können Sie etwas für diese Männer tun?«
Die Miene des Arztes verschloss sich.
»Wenn sich in Probstheida niemand dafür findet – ich kann hier weder jemanden entbehren noch diese Leute holen lassen. Die Aussichten, dass auch nur einer von ihnen den Transport übersteht, sind äußerst gering und der Aufwand nicht vertretbar angesichts dessen, was wir hier zu tun haben.«
Es war auch nicht nötig. Noch während sie darüber sprachen, ging genau dieses Lazarett in Flammen auf. Franzosen und Preußen starben Seite an Seite unter größten Qualen.
Der Arzt entschuldigte sich und ging zurück zu dem Tisch, auf den die Helfer inzwischen einen blutjungen Infanteristen gehievt hatten. Fast noch ein Kind, dem Alter und der Kleidung nach einer der »Marie-Louisen«, Napoleons letztes Aufgebot.
»Ich muss Ihr Bein amputieren, wenn Sie überleben wollen«, eröffnete der Arzt ihm auf Französisch. Der Junge schrie und weinte, er flehte verzweifelt, ihm sein Bein zu lassen. Und dann brüllte er gellend vor Schmerz. Kaum volljährig, von nun an ein Krüppel. Falls er überhaupt durchkam.
Maximilian wandte sich ab und ging zurück zu Henriette.
Er hockte sich neben sie und den nun leblos wirkenden Stabsoffizier. Henriettes Hand lag an der Halsschlagader des Verwundeten, ihre Miene wirkte besorgt. Im Dämmerlicht der Kirche ließ sich nicht erkennen, ob sich sein Brustkorb noch hob und senkte.
»Wird er diesen Tag überleben?«, fragte Maximilian alarmiert.
»Er stirbt, wenn er hierbleibt«, antwortete sie und zuckte so hilflos mit den Schultern wie bei ihren ersten Worten.
»Sie sterben doch alle! Wenn nicht an ihren Verletzungen oder am Wundbrand oder vor Kälte und Hunger, dann am Nervenfieber.« Ihre Stimme wurde immer verzweifelter.
»Unsere Feldlazarette sind hoffnungslos überfüllt«, erwiderte Maximilian. »Und mein Regiment zieht heute noch weiter, um den fliehenden Feind zu verfolgen.«
Nachdenklich starrte Henriette zur Tür. Dann holte sie tief Luft und sagte zögernd: »Sie könnten die Witwe, bei der ich untergekommen bin, bitten, ihn bei sich aufzunehmen. Ein verwundeter preußischer Stabsoffizier als Einquartierung ist ihr sicher lieber als zwei Dutzend Kosaken.«
Wie vom Donner gerührt sah Maximilian sie an.
Dann beugte er sich jäh vor und platzte heraus, fast drohend: »Sie wohnen hier nicht bei Verwandten? Sind Sie etwa trotz der gewaltigen Truppenaufmärsche allein nach Leipzig gereist? Ohne Ihren Vormund oder einen anderen Beschützer?«
Henriette senkte den Kopf.
»Ich bin allein hier. Um in den Lazaretten zu helfen.«
»Das ist unverantwortlich!«, rief der Premierleutnant bestürzt. »Wer hat Sie auf so eine gefährliche Reise geschickt, durch Kriegsgebiet, zwischen all den Truppen hindurch? Wusste er nicht, dass er damit Ihr Leben und Ihren guten Ruf aufs Spiel setzt?«
Bekenntnisse
Leipzig, Thomaskirche, 19. Oktober 1813
Ich ging freiwillig, um meine Verwandten vor Schaden zu bewahren«, gestand Henriette leise. Um meine Schuld zu sühnen und zu sterben, hätte sie ehrlicherweise hinzufügen müssen.
»Ich hatte einen Schutzbrief. Und Geleit bis Leipzig. Preußisches Geleit«, sagte sie stattdessen, als sie seine finstere Miene sah. »Ich wusste, die hiesige Lazarettverwaltung würde dringend Helfer brauchen.«
»Aber ein unverheiratetes Mädchen!«, beharrte Maximilian fassungslos. »Im Zentrum des Krieges – allein! Wie konnten Sie so etwas Unerhörtes tun?«
Weil sie schwieg, sah er ihr in die Augen und fragte ruhig: »Was ist passiert?«
Henriette senkte den Blick und verknotete die Hände.
»Ich … habe Schuld auf mich geladen. In Weißenfels, wo meine Familie lebte, erschlug ich einen Plünderer, der über mich hergefallen war, einen Franzosen. Deshalb floh ich nach Freiberg. Aber dort konnte ich auch nicht bleiben … wegen einer anderen Schuld …«
Sie zögerte und rang nach Worten. »Das hier«, nun wies sie mit dem Kopf zu den Sterbenden, »ist meine Sühne. Ich glaubte, wenn ich hundert Leben rette, könnte ich damit vielleicht jenes eine aufwiegen, das ich nahm. Doch ich habe mich geirrt.«
Maximilian vermochte sich die Szene genau vorzustellen.
Die im Frühjahr neu eingezogenen Soldaten der Grande Armée plünderten rücksichtslos, und ihre Offiziere ließen sie gewähren, weil die reguläre Versorgung des Heeres zusammengebrochen war. Es grenzte an ein Wunder, dass Henriette lebte, dass der Angreifer sie nicht erschlagen hatte. »Henriette, es war Notwehr, Sie wären sonst tot!«, beschwor er sie. »Lassen Sie sich dadurch nicht jetzt noch Ihr Leben zerstören!«
»Wer getötet hat, dessen Leben ist zerstört«, widersprach sie schroff.
»Der Krieg zwingt uns alle zu Dingen, zu denen wir in Friedenszeiten nicht fähig wären. Um noch Schlimmeres zu verhindern«, widersprach er und wischte ihr sanft mit der Fingerkuppe eine Träne aus dem Augenwinkel. Sie selbst konnte es nicht tun, Hände und Ärmel waren blutverschmiert. Deshalb ließ sie die unerlaubt vertrauliche Berührung zu.
»Ich weiß, dass Sie ein barmherziger Mensch sind, voller Mitgefühl für andere. Sie sind unfähig, etwas zu tun, wofür Sie den Tod verdienen.«
Wenn du wüsstest!, dachte Henriette bitter. Ich habe einen Feind in mein Bett gelassen. Deinen Feind! Was würdest du wohl dazu sagen?
»Sie haben hier zu viel Elend gesehen«, fuhr Maximilian unbeirrbar fort. Er deutete auf die Sterbenden um sie herum – einen Korporal mit verbranntem Gesicht, einen jungen Soldaten, dem beide Beine amputiert worden waren, einen Offizier mit klaffender Bauchwunde.
»Doch der Krieg ist gewonnen, also fassen Sie Hoffnung! Auch wenn es noch eine Weile dauern mag, bis wieder normale Zustände herrschen. Es kommen bessere Zeiten. Und sobald Friede geschlossen ist, löse ich mein Versprechen ein. Dann führe ich Sie auf einen Ball und spaziere mit Ihnen durch die Gärten von Sanssouci.«
Henriette lachte bitter auf.
»Ich war auf einem Ball! Im August, am Ende des Waffenstillstands, zur Feier von Napoleons Geburtstag. Ausgerechnet an jenem Tag, an dem ich Ihren letzten Brief erhielt und mich die Sorge fast zerriss, ob Sie unversehrt bleiben, wenn die Kämpfe wieder beginnen. Ich wollte nicht auf dieses Fest. Doch mein Oheim durfte sich nicht verweigern, er hätte seine Existenz aufs Spiel gesetzt. So musste ich mit den Franzosen tanzen …«
Maximilians Freude darüber, dass sie sich um ihn gesorgt hatte, erlosch jäh.
»Mit jenem Franzosen?«
Fragend sah er in die Richtung des toten Premier-Lieutenants, um den sie geweint hatte, als er die Kirche betrat.
Henriette nickte mit erstarrten Zügen.
»Haben Sie ihn geliebt?«
»Wie könnte ich ihn lieben, da er ein Feind war? Er wurde ins Haus meines Vormundes einquartiert. Doch er verhielt sich stets höflich mir gegenüber. Er war noch so jung … So viele junge Männer sind gestorben in diesem Krieg. Es sterben doch alle um mich herum!«
Nicht aus Liebe hatte sie Étienne in ihr Bett gelassen in jener Nacht, bevor er erneut in den Krieg zog. Nicht aus Verlangen oder Unkeuschheit. Es war Mitleid. Mitleid mit all den vielen jungen Männern, die zum Sterben geschickt wurden.
Sie hatte Étienne in die Arme geschlossen, weil er den sicheren Tod vor Augen sah. Und mit ihm in Gedanken all jene, denen das gleiche Los drohte – auch Maximilian.
Dadurch hatte sie gegen alle Regeln verstoßen und die Hoffnung auf ein normales Leben verspielt.
»Sie können unmöglich allein in Leipzig bleiben!«, beharrte Maximilian. Das war undenkbar für ein ehrbares Mädchen.
»Meine Eltern sind tot, und ich weiß nicht, ob unser Haus in Weißenfels noch steht.«
»Dorthin können Sie nicht!«, fiel ihr Maximilian ins Wort. »Über Weißenfels zieht sich Napoleon mit dem Rest seiner Armee zurück, dort wird spätestens morgen hart gekämpft werden.«
»Ginge ich nach Freiberg zurück, würde ich die Familie meines Vormundes ruinieren. Andere Verwandte habe ich nicht«, zählte sie müde auf. »In den hiesigen Lazaretten werden noch lange Helfer gebraucht. Dort fragt niemand nach dem Woher und Wohin.«
Erneut lachte sie trocken auf. »Wen kümmert es auch? Schauen Sie sich doch um!«
Mit ausgestrecktem Arm wies sie durch das Kirchenschiff. »Sehen Sie dieses Leid und die vielen Toten dort draußen auf den Straßen! Und das soll nicht das Ende aller Tage sein?«
Fast die gleichen Worte hatte Henriette vor ihrem Aufbruch aus Freiberg Felix Zeidler vorgehalten, einem einst schüchternen Bergstudenten. Felix hatte sich zu den preußischen Freiwilligen gemeldet; er begleitete sie auf ihrer heimlichen Flucht nach Leipzig, als er nach auskurierter Verwundung wieder zu den Truppen ging. Ob er wohl noch lebte? Wie wahrscheinlich war das angesichts der vielen Toten der letzten Tage?
Jäh begriff Maximilian: Henriette wollte sterben. Viele Ärzte und Pfleger starben derzeit am Nervenfieber.
Das werde ich nicht zulassen!, dachte er bestürzt.
Doch was konnte er tun, um ihr zu helfen? Viel Zeit blieb nicht, sein Regiment war schon Richtung Pegau abkommandiert. Er hatte sich nur kurz entfernen dürfen, um den Stabskapitän zu einem Arzt zu bringen und das Hauptlazarett auf weitere Verwundete vorzubereiten.
Maximilian erhob sich.
»Mademoiselle Henriette, ich muss noch einen Auftrag ausführen. Aber ich komme gleich wieder«, versprach er und legte so viel Zuversicht in seine Stimme, wie er nur konnte.
Er war schon an der Tür, hörte wieder die jubelnde Menge und die Musik auf dem Markt, als sie seinen Namen rief.
»Ich bin sehr froh, dass Sie noch leben«, sagte sie mit dem traurigsten Lächeln, das er je gesehen hatte. »Jeden Tag habe ich für Sie gebetet.«
»Und ich trage immer noch Ihre Haarlocke bei mir, hier im Tschako«, entgegnete er und tippte an die Kopfbedeckung. »Sie hat mir Glück gebracht.«
Siegesparade
Leipzig, 19. Oktober 1813
Mühsam kämpfte sich der Stadtschreiber Artur Reinhold Münchow durch die wogende Menge, um zum Rathaus zu gelangen. Normalerweise genügte seine Respekt gebietende Erscheinung in grauem Reitmantel und gleichfarbigem Zylinder, damit die Menschen ihm Platz machten. Schließlich war er eine stadtbekannte Persönlichkeit. Doch heute schubsten und drängelten die Leipziger so rücksichtslos, dass selbst der hochgewachsene Münchow Mühe hatte durchzukommen. Eine dicke Frau rammte ihm so heftig den Ellbogen in die Seite, dass er schmerzhaft das Gesicht verzog, und schrie gellend dicht an seinem rechten Ohr: »Hoch lebe Blücher!«
Im ersten Moment fürchtete der Schreiber, er würde ertauben.
Doch die Sorge verflog rasch, als er jemanden von hinten mit befehlsgewohnter Stimme nach sich rufen hörte.
Er ließ die Meute an sich vorbeiströmen und wandte sich um. Staunend sah er auf den in bestes Tuch gekleideten Mann um die vierzig.
Münchow zog den Hut und verbeugte sich, was weniger elegant als gewohnt ausfiel, da ihn schon wieder jemand anrempelte.
»Herr Hofrat, ganz zu Ihren Diensten!«
Vor ihm stand einer der einflussreichsten Männer Leipzigs: Siegfried August Mahlmann, Hofrat, Dichter und Pächter der Leipziger Zeitung, der bedeutendsten Zeitung Sachsens und auch der einzigen, die über politische Ereignisse schreiben durfte – unter Zensur, versteht sich.
Des Krieges wegen waren jedoch gestern und heute keine Ausgaben erschienen, ein ganz außergewöhnliches Vorkommnis in der Geschichte dieser Zeitung.
»Herr Stadtschreiber, verhelfen Sie mir zu einem guten Platz, von dem ich alles sehen kann!«, forderte Mahlmann gebieterisch. »Vielleicht dort?« Er wies auf den Balkon, der den Turm an der Front des Leipziger Rathauses an drei Seiten umlief.
Artur Reinhold Münchow hatte diesen Standort auch für sich ausgewählt und angesteuert, um möglichst viel von der Siegesparade zu sehen, ohne von der Menge niedergetrampelt zu werden.
»Gehen wir über den Naschmarkt ins Rathaus, Herr Hofrat, sonst werden wir noch überrannt«, schlug er vor.
Ein Dutzend Schritte entfernt entdeckte der Schreiber eine weitere stadtbekannte Person.
»Herr Kaufmann Hußel!«, rief er über den Lärm der Militärkapellen und der tosenden Menschenmenge hinweg und schwenkte seinen Arm, um auf sich aufmerksam zu machen.
Der Gerufene wandte sich um und wäre dabei fast ausgerutscht, denn das Pflaster war mit einer schmierigen Schicht aus Blut, Pferdeäpfeln und Unrat bedeckt. Der Zusammenprall mit einem kräftigen Mann in der Kleidung eines Sänftenträgers bewahrte ihn vor dem Sturz und seinen Hut davor, in den Schmutz zu fallen.
Erstaunt und überaus höflich begrüßte Ludwig Hußel, Kaufmann mit Hang zur Literatur, zuerst den Hofrat, dann den Stadtschreiber.
»Sie werden doch auch diesen historischen Moment für die Nachwelt festhalten wollen. Begleiten Sie uns auf den Rathausturm, dann sehen Sie alles!«, schlug Münchow vor.
Der Stadtschreiber gedachte nicht, den Hofrat zu fragen, ob ihm diese Gesellschaft recht sei. Immerhin war er es als Angestellter des Magistrats, der ihnen Zutritt zu diesem Aussichtspunkt gewähren konnte. So wie Mahlmann als Zeitungsredakteur und er als Stadtschreiber besaß seiner Ansicht nach auch Hußel ein Anrecht darauf, das denkwürdige Ereignis genau mitverfolgen zu können.
Ludwig Hußel hatte in den letzten Monaten als Chronist für die Nachwelt zusammengetragen, was sich in Leipzig an Außergewöhnlichem ereignete, und keine Gefahr dabei gescheut. Deshalb war der eifrige Kriegsberichterstatter auch hocherfreut über dieses Angebot.
Artur Reinhold Münchow bahnte den Weg, Mahlmann schritt würdevoll hinterher, bemüht, in keinen der Pferdeäpfel zu treten, die tausende Militärpferde hinterlassen hatten, und Hußel schwebte fast vor Freude über diese unerwartete Gelegenheit.
Was für ein schicksalhafter Tag, dieser Dienstag! Natürlich zuallererst wegen des Sieges der Alliierten und weil Leipzig noch stand, worauf heute Morgen niemand hätte wetten wollen. Bis sich die ersten Landwehrverbände und Kosaken durchs Grimmaische Tor kämpften, war Ludwig Hußel trotz des Kugelhagels und der herabstürzenden Dachziegel durch die Stadt gelaufen, um nichts zu verpassen.
Dann hatte ihn der Bankier und Geheime Rat Frege – ein vornehmer Herr, noch reicher und mächtiger als Mahlmann – aufgefordert, den Schutz eines Hauses zu suchen. Der berühmte Frege lud ihn sogar ein, vom Balkon seines prächtigen Hauses in der Katharinenstraße zuzusehen, wie die Alliierten in die Stadt strömten und sich die eingeschlossenen Franzosen, Polen und Rheinbündler nach kurzem, aber sehr blutigem Kampf ergaben.
Dann aber hielt den literarisch ambitionierten Kaufmann nichts mehr im Haus des reichen Bankiers; er musste wieder hinaus auf die Straßen, um alles aus nächster Nähe zu sehen und der Nachwelt berichten zu können. Auch wenn er dabei sein Leben riskierte.
Im Frühjahr hatte er sich furchtlos den auf dem Leipziger Markt biwakierenden Kalmücken und Baschkiren genähert, über die die unheimlichsten Gerüchte kursierten, und fand sie bei näherer Betrachtung recht umgänglich. Im Juni, beim Angriff der Kosaken unter Woronzow und einer Abteilung Lützower auf Leipzig, hatte er sich an den Stadtwachen vorbeigemogelt, um am Ort der Kämpfe zu sein, wo ihm die Kugeln nur so um die Ohren pfiffen. Vor fünf Tagen stand er bei Wind und Wetter draußen am Hochgericht, um zu sehen, wie der gerade in Leipzig eingetroffene Napoleon Befehle für die von allen erwartete Schlacht erteilte – auch wenn sie erst zwei Tage später begann.
Was sie alle seitdem durchleben mussten, er mittendrin, würde schwer in Worte zu fassen sein. So unermesslich war das Grauen.
Noch vor weniger als einer Stunde hatte er – vorsichtig Deckung suchend – gesehen, wie sich Alliierte mit Franzosen und Rheinbündlern in einigen Vierteln einen blutigen Häuserkampf lieferten, wie Menschen aus dem vierten Stock geworfen wurden. Vom Fleischerplatz her klangen immer noch Schüsse. Was dort vorging, mochte er sich lieber nicht vorstellen. Es hieß, am Halleschen und Grimmaischen Tor habe es furchtbare Gemetzel gegeben, ein regelrechtes Abschlachten.
Doch Leipzig stand noch, er lebte und war unversehrt.
Jetzt wollte er den großen Moment auf sich wirken lassen, von dem die Menschen noch in hundert Jahren reden würden. Und er war dabei, als Augenzeuge!
Was für eine glückliche Fügung, dass er auf Münchow getroffen war. Oder der auf ihn. Denn in den letzten Minuten hatte er nichts sehen können außer drängelnden Menschen und weißen Tüchern, die aus den Fenstern geschwenkt wurden.
Die drei Männer – jeder auf seine Art Chronist des Geschehens – gelangten nicht ohne Schwierigkeiten und nur unter Einsatz der Ellbogen über den Naschmarkt zu der Treppe ins Rathaus hinauf. Artur Reinhold Münchow hatte sich den Schlüssel schon vom Ratsdiener geholt und öffnete die Tür, die hinaus zu dem Balkon in Höhe des ersten Stockwerkes führte.
Erleichtert, dem Gedränge entkommen zu sein und endlich etwas sehen zu können, stellten sich die drei stadtbekannten Persönlichkeiten nebeneinander. Jeder von ihnen ließ das denkwürdige Bild auf sich wirken, das vermutlich noch Dutzende Maler auf Papier und Leinwand bringen würden, ohne dabei gewesen zu sein.
Ordentlich in Reih und Glied, doch in völlig abgerissenen Uniformen, säumten tausende Soldaten und Offiziere den Marktplatz. Dahinter drängten sich die jubelnden Leipziger.
»Wann hat Leipzig je solch eine Menschenmenge auf dem Markt erlebt?«, fragte der aufgewühlte Ludwig Hußel rhetorisch.
»Diesen Sommer, als Napoleon hier seine Truppen inspizierte«, erinnerte Hofrat Mahlmann bissig.
Das war wirklich ein ebenso denk- wie merkwürdiger Tag gewesen. Allein mit seiner Präsenz hatte es der Kaiser der Franzosen geschafft, die ihm fast durchweg feindlich gesinnten Leipziger für sich zu begeistern. Heute allerdings würde ihm das nicht mehr gelingen. Er hatte die Stadt an den Rand des Abgrunds gebracht.
»Der Herzog von Padua soll verhaftet sein«, wusste Hußel nicht ohne Schadenfreude zu berichten. Dieser Arrighi, der französische Militärkommandant, ein Verwandter Napoleons, hatte sich durch Härte und exorbitante Geldforderungen bei den Leipzigern verhasst gemacht.
»Dazu noch ein halbes Dutzend anderer Generäle. Marschall Augereau soll verwundet sein, und Gerüchten zufolge ist Fürst Poniatowski bei der Sprengung der Elsterbrücke gefallen«, erzählte Hußel ohne Atempause. »Tapferer Mann, schade um ihn! Ich sah mit eigenen Augen, wie sich Stadtkommandant Bertrand der russischen Generalität ergab. Schade auch um ihn; er hatte Verständnis für die Bürgerschaft, ganz im Gegensatz zu Arrighi!«
»Gouverneur Arrighi hat sich heute Morgen aus dem Staub gemacht, durch die Hintertür, so dass Markgraf Wilhelm von Baden das Kommando übernehmen musste«, fiel Mahlmann ihm erneut ins Wort. Auch er besaß seine Quellen, dafür musste er nicht durch die Stadt streunen wie Hußel.
»Ist ihm aber nicht gelungen, sie haben ihn geschnappt!«, frohlockte Hußel grinsend.
In diesem Punkt teilte der Zeitungspächter seine Häme, denn Arrighi hatte ihn aus nichtigem Anlass in Festungshaft geschickt.
»Der Markgraf von Baden kapitulierte, nachdem die Stadttore durchbrochen waren, und übergab Leipzig an die Alliierten«, wusste der Stadtschreiber Münchow beizusteuern.
Doch seine Worte gingen in dem frenetischen Lärm unter, der einsetzte, als sich an der Frontseite des Marktes, vor dem Apelschen Haus, drei Reiter aus der Menge lösten, in etwas Abstand gefolgt von einem vierten und einer Kavalkade prächtig uniformierter Generäle.
»Da kommen sie!«
Vor Aufregung überschlug sich Hußels Stimme. »Zar Alexander! Kaiser Franz! Friedrich Wilhelm von Preußen! Dicht hinter ihnen Kronprinz Karl Johann …«
Sie tragen einfache Offiziersuniformen, keine große Gala, konstatierte Mahlmann, ganz Reporter, in Gedanken schon am Text arbeitend, während er die Aufgeregtheit seines Nebenmannes ignorierte.
»Und da, alle unsere Helden!«, jubelte Hußel weiter. »Ich erkenne Blücher, das dort muss Feldmarschall Fürst Schwarzenberg sein … und der von schmaler Statur, ist das General von Bülow, der Retter von Berlin?«
Er beugte sich vor, kniff die Augen ein wenig zusammen, um besser zu sehen, und zog schließlich ein Opernglas aus der ledernen Tasche hervor, die er wie seinen Augapfel hütete.
Nun schwoll der Lärm dermaßen an, dass selbst Hußels euphorische Stimme nicht mehr dagegen ankam.
»Hurra!« und »Vivat!« erschollen immer wieder aus tausenden Kehlen, und es war, als läge das Publikum im Wettstreit miteinander, auf welcher Seite des Marktes die Hochrufe lauter und feuriger geschrien wurden.
Artur Reinhold Münchow sog die Szene mit allen Einzelheiten in sich auf, um sie nie wieder zu vergessen.
Das musste er auch, denn er war Stadtschreiber, doch er hatte kein Papier mehr. Jedes einzelne Blatt seines Oktavheftes hatte er vorhin einem Mädchen gegeben, das in der Thomaskirche Verwundete verband. Zum Schluss sogar die Ratsprotokolle. Es gab im Hauptlazarett kein Leinen mehr, deshalb versuchte sie, sich mit den Seiten zu behelfen, um einen jungen französischen Offizier vor dem Verbluten zu bewahren.
»Wann können Sie schon einmal mit Papier Leben retten?«, hatte sie ihn angefleht, als er zögerte. Und so gab er Blatt für Blatt der kostbaren Aufzeichnungen her. Jetzt fühlte er sich hin- und hergerissen zwischen schlechtem Gewissen und Stolz.
Wie viele werden noch sterben?, fragte er sich. Nach allem, was er wusste, waren noch dreißigtausend Mann der Grande Armée in der Stadt, Gefangene, die meisten verwundet oder vom Nervenfieber niedergestreckt. Wer soll sie pflegen, wie sollen wir sie satt kriegen?
Die Menschen hier haben allen Grund zu jubeln, dachte er angesichts der völlig aus dem Häuschen geratenen Menge. Denn heute haben sie überlebt. Heute hat die Stadt überlebt.
Doch was wird morgen? In Gedanken überschlug der Schreiber die Reserven an Mehl, die der Magistrat angelegt hatte; gutes Mehl, sorgfältig gelagert.
Das reicht nicht für zwei- oder dreihunderttausend Mann, die zusätzlich verköstigt werden müssen, selbst wenn die Alliierten rasch weiterziehen. Wir haben den Typhus und die Ruhr in der Stadt. Wir wissen nicht, wohin mit all den Toten. Und wer sie überhaupt beerdigen soll. Alle Obstbäume rund um die Stadt sind abgeholzt, das Vieh geschlachtet. Der Winter naht. Eine Hungersnot ist unausweichlich.
Dann rief er sich zur Ordnung. Der Rat wird Vorsorge treffen! Und es hätte durchaus sein können, dass in Leipzig kein Stein mehr auf dem anderen stand.
Vor dem Sturm auf eine besetzte Stadt war es üblich, den Angriff durch massiven Artilleriebeschuss einzuleiten. Aber auf eine Kanonade mit Brandgeschossen hatten die Alliierten verzichtet und die Stadt zu Fuß eingenommen, auch wenn sie das höhere Verluste kostete.
»Stimmt es, dass Napoleon den gesamten Ranstädter Weg in die Luft sprengen und niederbrennen wollte, aber ein paar Sänftenträger das Gedränge nutzten, um die Wagen mit dem Pech umzukippen?«, fragte Hußel.
Münchow bestätigte. Er selbst hatte diesen Sabotageakt vorgeschlagen.
»Gehen Sie bloß nicht dorthin – Leichen über Leichen, der ganze Fluss ist voll! In den Vorstädten ist alles voller Toter, schauderhaft! Der schöne Richtersche Garten … der Reichelsche Garten … eigentlich alle Gärten um die Stadt … schauderhaft!« Ludwig Hußel schüttelte es bei der Erinnerung, während die Menschen wenige Meter unter ihnen immer noch jubelten.
»Der Postillion Gabler führte Napoleon und seine Suite eine Stunde lang hin und her durch die Stadt, aber alle Tore waren verschlossen«, fuhr er fort. »Da hielten ein paar Dummköpfe Wache am Barfüßertor, die den Kaiser nicht erkannten! Jedenfalls sind wir ihn nun los, den Bonaparte, Gott sei es gedankt.«
»Seine Sappeure hätten das Tor leicht einschlagen können«, widersprach Hofrat Mahlmann. »Der Kaiser wollte noch einmal zurück, um mit Marschall Poniatowski zu reden.«
Zweifelnd zog Hußel die Augenbrauen hoch, doch dann konterte er einfach mit der nächsten Anekdote.
»In Auerbachs Keller sitzt der Landsteuereintreiber Wichmann und erzählt, was er heute Morgen als Parlamentär erlebte. Der Magistrat hatte ihn zum Oberbefehlshaber Fürst Schwarzenberg geschickt, damit er um Schonung für die Stadt bittet. Er durfte sogar vor dem König von Preußen und dem Zaren sprechen! Aber Sie kommen zu spät, Herr Hofrat, wenn Sie noch etwas Sinnvolles von ihm erfahren wollen. Der Wein fließt reichlich, und wann hatte je ein Steuereintreiber so viele begeisterte Zuhörer?« Der Kaufmann konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Ich hörte den Bericht des Landsteuereintreibers, als er noch nüchtern war, Herr Hofrat«, versicherte Münchow dem allmählich gereizt wirkenden Mahlmann. »Werden Sie morgen wieder eine Zeitung herausbringen?«
»Das ist völlig undenkbar! Erst muss geklärt werden, wer nun die Texte genehmigt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens in drei Tagen wieder erscheinen«, erklärte Mahlmann und wurde sarkastisch. »Man hat ja schon nach Jena und Auerstedt erlebt, dass die Teilnehmer der Schlacht auf dem Rückzug durch Leipzig strömten, noch ehe wir aus Dresden die Erlaubnis des Hofes erhielten, etwas darüber zu schreiben. Aber wie sollen wir das hier verschweigen?«
Mit ausladender Geste wies er auf die Menge vor sich.
»Es wird eine neue Ära für die Leipziger Zeitung anbrechen!«
»Und Ihre Verhaftung nach der Affäre Colomb kommt Ihnen sicher bei den Alliierten zugute«, erinnerte Hußel, bevor er ins nächste Fettnäpfchen trat. »Die wissen doch, dass Sie die Schmähungen gegen den Kronprinzen von Schweden nur gezwungenermaßen druckten.«
Das hoffte auch der Zeitungsherausgeber.
Es war ein Kreuz mit der Zensur! Unter den Franzosen musste er immer wieder erlogene Erfolgsmeldungen der Grande Armée veröffentlichen, wörtliche Nachdrucke aus dem Westphälischen Moniteur. Doch als im Frühjahr die Alliierten kurzzeitig in Leipzig einzogen, waren die nicht besser und zwangen ihn zu ebenso haarsträubenden Veröffentlichungen. Nach Napoleons Rückkehr hatte er über die gesamte Titelseite zu widerrufen. Was für eine Blamage!
Doch die Affäre Colomb – eine vom Zensor übersehene winzige Annonce in der Ausgabe vom 14. Juni, eine getarnte Danksagung an den preußischen Rittmeister von Colomb, über dessen Husarenstreiche ganz Sachsen und Thüringen jubelten – würde ihn bei den neuen Machthabern in gutes Licht rücken. Verhaftet und nach Erfurt verschleppt hatte man ihn deshalb. Er hätte auch exekutiert werden können wie der Buchdrucker Palm aus Nürnberg! Nur seine einflussreichen Gönner am Dresdner Hof bewahrten ihn davor. Deshalb sollte er nun als Märtyrer für die gute Sache gelten.
Dass er unter strengster Polizeibewachung stand und ihm jedes Wort im politischen Teil des Blattes vorgeschrieben wurde, konnte er beweisen. Er hatte alle Texte seines Aufpassers, dieses schrecklichen Barons von Bacher, aufbewahrt. Das sollte ihn vor den Russen und Preußen reinwaschen. Immerhin hatte er patriotische Gedichte verfasst! Zugegeben – auch Lobgesänge auf Bonaparte. Aber das lag nun wirklich lange zurück …
Den größten Teil der nächsten Ausgabe hatte er bereits entworfen, eine Zusammenfassung der Ereignisse der vorangegangenen Tage. Einzelheiten und welche Generäle gefangen genommen waren, würde er erfahren, sobald er bei den Alliierten vorsprach. Und wenn er diese Siegesparade in zu Herzen gehenden Worten schilderte, die stürmischen Jubelrufe auf die gekrönten Häupter, sollte der Weiterführung der Redaktionsgeschäfte nichts im Wege stehen.
Zumal in solchen Zeiten jedes Gouvernement – ob sächsisch, russisch oder preußisch – unzählige Proklamationen zu veröffentlichen hatte. Es würde ein neuer Stadtkommandant eingesetzt werden, eine neue Regierung, das tägliche Leben musste normalisiert werden. Sie brauchten ihn.
»Das Gerücht, General Thielmann sei gefallen, hat sich nicht bestätigt«, plauderte Hußel unterdessen weiter. »Der ist schon gestern mit seiner gesamten Kavallerie abgerückt, unter Feldzeugmeister Graf Gyulai, um die flüchtende Grande Armée noch vor Weißenfels abzufangen.«
Unter österreichischem Kommando? Obwohl er doch zu den Russen gegangen ist?, dachte Mahlmann mit deutlichem Unbehagen. Hauptsache, er bleibt Leipzig fern! Denn es lag noch keine drei Wochen zurück, dass er in seiner Zeitung den einstigen sächsischen General wegen Verrats vors Kriegsgericht zitieren musste. Der würde ihm das bestimmt nicht so leicht nachsehen; er war ein Mann von Ehre, stolz und leicht aufbrausend …
»Jetzt werden Orden vergeben!«, rief Hußel und beugte sich mit dem Opernglas weit über die hölzerne Brüstung. Blücher und Schwarzenberg traten unter erneut aufflammendem Jubel vor.
Der Zar umarmte Blücher, das konnten auch Münchow und Mahlmann erkennen, während die Menschenmenge begeistert Blüchers Namen skandierte. Niemand wurde bei dieser Siegesparade euphorischer gefeiert als der siebzigjährige General.
Der Zeitungspächter ärgerte sich, nicht selbst auf die Idee mit dem Opernglas gekommen zu sein. Es war weder zu hören noch zu sehen, wer dort sonst noch und wie ausgezeichnet wurde. Aber auch das würde er nachher im Detail erfahren.
Noch einmal sog Siegfried August Mahlmann Bild und Stimmung in sich auf. Die Worte flossen ihm im Geiste nur so zu. Deshalb verabschiedete er sich kurz und bündig von seinen Begleitern und ging in sein Kontor.
Von der nun zweifellos folgenden Truppenparade konnten ihm seine Gehilfen berichten. Wenn er bei den neuen Machthabern vorsprach, war es besser, gleich einen Textentwurf vorzulegen, an dem sie Gefallen fanden. Außerdem musste er sich dringend den Pferdemist von den Schuhen putzen lassen.
»Und jetzt der Vorbeimarsch der Regimenter!«, hörte er im Gehen noch Hußel jubeln. »Dort hinten, die mit den Bögen und den Fellmützen, das sind Baschkiren. Großartige Leute, ich habe sie im Frühjahr kennengelernt. Tausende Meilen sind sie bis hierher geritten, manche brachten sogar ihre Frauen mit! Ihre Treffsicherheit mit Pfeil und Bogen ist unglaublich. Ich hab’s gesehen, ich hab’s gesehen!«
Kaiser, König, Kronprinz
Leipzig, 19. Oktober 1813
In scheinbar schönster Eintracht ritten die Sieger der Völkerschlacht über den Marktplatz und ließen sich von ihren Regimentern und den Leipzigern bejubeln. Doch ihre Gedanken hätten nicht unterschiedlicher sein können.
Alexander, Kaiser von Russland, war der Einzige, der den Triumph aus vollem Herzen genoss. Ja, das liebte er, wenn seine Soldaten und das Volk – ob nun sein eigenes oder ein fremdes – ihm donnernde »Vivats!« zubrüllten, wenn jedes joviale Lächeln oder Winken neue Begeisterungsstürme auslöste.
So gehörte es sich auch; er war der Kaiser! Und nun der mächtigste Mann Europas. In Leipzig hatte er sich für Smolensk und Moskau gerächt. Bald würde er in Paris einziehen. Er hatte den unbezwingbar scheinenden Bonaparte bezwungen. Nun war er der Retter Europas.
Ein Hochgefühl erfüllte ihn, und ungeduldig hielt er Ausschau, ob er unter den Jubelnden eine anmutige Frauengestalt entdeckte. Schließlich war die Schönheit der sächsischen Frauen sprichwörtlich.
Kaiser Franz von Österreich ließ den Jubel, die Trommelwirbel und die sonstigen Huldigungen mit mühsam verhohlener Ungeduld über sich ergehen.
Ja, sie hatten gesiegt, und es war nicht zum Allerschlimmsten gekommen. Auf seinen geheimen Befehl hin wurde seinem Schwiegersohn Napoleon der Rückzugsweg nach Westen über Lindenau und Weißenfels frei gehalten. Wer weiß, in welcher Katastrophe alles noch geendet hätte, wäre der gefürchtete Schlachtenlenker hier wie ein Tiger im Käfig in die Enge getrieben worden.
Metternich hatte vollkommen recht, dieser brillante Kopf: Frankreich durfte nicht völlig vernichtet werden, sonst würden Russland und Preußen die neuen Giganten in Europa, und Österreich geriet zwischen die Mahlsteine.
Anders als der Zar und der König von Preußen kam Kaiser Franz nicht vom Schlachtfeld, um an der Siegesparade teilzunehmen, sondern aus seinem Quartier im Röthaer Schloss, zwanzig Kilometer südlich. Anders als sie liebte er es nicht, auf dem Schlachtfeld zu sein.
Im Gegenteil, er konnte das Gemetzel nicht ertragen, den Anblick von Toten, Verstümmelten, abgeschlagenen Gliedmaßen. Eine Barbarei! Nicht einmal hier, mitten in Leipzig, blieben ihm solche Abscheulichkeiten erspart!
Ein Schauer lief ihm über den Rücken, und wehmütig wünschte er sich zurück zu seinen Herbarien und Büchern in der Wiener Hofburg.
Karl Johann, der Kronprinz von Schweden, durfte nicht neben den drei Monarchen reiten, sondern musste sich ein Stück hinter ihnen halten. Schließlich war er noch kein König. Doch die protokollbedingte Zurücksetzung störte ihn nicht. So euphorisch der Zar war, so insgeheim angewidert Kaiser Franz, so zufrieden fühlte sich Karl Johann, mit bürgerlichem Namen Bernadotte, einst Marschall von Frankreich.
Eine solch gigantische Schlacht hatte die Welt noch nicht gesehen. Allein die Verluste der alliierten Seite schätzte er auf mindestens fünfzigtausend Tote und Verwundete, und den höchsten Blutzoll hatten zweifellos die Russen gezahlt.
Doch nur zweihundert Schweden waren gefallen. Er hatte seine Truppen klug aus den Kämpfen herausgehalten und geschont. Sein Volk – genauer gesagt: das Volk, über das er einmal die Regentschaft übernahm – würde es ihm danken.
Nach menschlichem Ermessen sollte Friedrich Wilhelm von Preußen die Parade zu Ehren des Sieges über Napoleon am meisten genießen. Denn keiner der Monarchen an seiner Seite war durch Bonaparte so tief gedemütigt worden wie er.
Halb Preußen hatte der Korse nach seinen Siegen bei Jena und Auerstedt 1806 vereinnahmt, die härtesten Bedingungen auferlegt, die Königsfamilie bis in den hintersten Winkel des Reiches getrieben, nach Memel an der russischen Grenze. Und um die Erniedrigung zu vollenden, durfte der König von Preußen erst mit Napoleons Erlaubnis wieder nach Berlin zurückkehren. 1809! In seine eigene Hauptstadt!
Friedrich Wilhelm III. wusste, seine innig geliebte Luise wäre stolz auf ihn, könnte sie diesen triumphalen Tag miterleben. Doch sein Herz war kalt seit ihrem Tod, jedes Gefühl in ihm erloschen. Er konnte keine Freude mehr empfinden, nicht einmal an diesem lang ersehnten Tag.
Er wusste sehr wohl, dass der König von Sachsen darauf wartete, zur Parade der Sieger eingeladen zu werden. Wie konnte der Wettiner nur auf diesen absurden Gedanken kommen? Zugegeben, er hatte Preußen 1806 als Einziger beigestanden. Doch als die Herausforderung an Napoleon mit einem Fiasko endete, schloss Friedrich August ohne Wissen Preußens einen Separatfrieden mit Frankreich. Er ließ sich von Bonaparte zum König erheben, während die preußische Königsfamilie ins Exil musste, in größter Not, durch eisige Lande, in ärmlichste Hütten.
Und was tat Friedrich August von Sachsen, während Luise litt, in erbärmlichen Unterkünften fror, von einem Fieber ins andere fiel, bis ihr schließlich das Herz brach? Er sonnte sich im Glanz des Usurpators und ließ sich noch zum Herzog von Polen erheben.
Deshalb würde es für den sächsischen König keine Gnade geben. Und auch nicht für sein Land.
Sollten sie jubeln, die Leipziger.
Schon bald erwartete sie ein böses Erwachen.
Blutige Hände
Leipzig, Thomaskirche, 19. Oktober 1813
Während der Premierleutnant Trepte seine Aufträge erledigte, verharrte Henriette in der zum Lazarett umgewandelten Thomaskirche an der Seite des verwundeten preußischen Stabsoffiziers. Der lag immer noch in tiefer Bewusstlosigkeit. So spürte er wenigstens keine Schmerzen, und sie durfte über die unverhoffte Begegnung mit Maximilian nachsinnen.