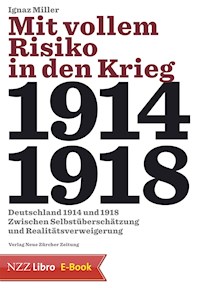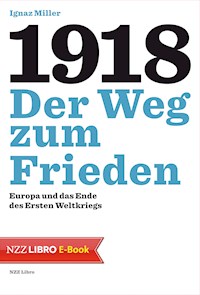
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
«Von einem Krieg weiss man immer nur, wie er anfängt», meinte Charles de Gaulle einmal. Ignaz Miller konzentriert sich darauf, das Ende des Grossen Kriegs zu erklären. Eine seiner Thesen lautet: Das parlamentarisch-demokratische System, wie es etwa Frankreich und England kannten, war dem Kaiserreich in dieser Krisenzeit überlegen. Als Opfer seiner eigenen Propaganda war Deutschland in den Krieg gezogen, und als solches beendete es den Krieg: Das Angebot der Alliierten zum ersehnten Waffenstillstand ersparte dem Reich die Kapitulation. Keine vier Wochen später begrüsste jedoch der nachmalige Reichspräsident Friedrich Ebert die paradierenden Truppen mit den Worten «Unbesiegt im Felde!» Ignaz Miller dekonstruiert auf anschauliche Weise verschiedene Mythen, die seit 1918 aufgebaut wurden und noch heute zirkulieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 649
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignaz Miller
1918 – der Wegzum Frieden
Europa und das Ende des Ersten Weltkriegs
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2019 (ISBN 978-3-03810-372-1)
Lektorat: Thomas Heuer, Basel
Titelgestaltung: TGG Hafen Senn Stieger, St. Gallen
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-411-7
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
1
Das lange Ende und ein bekannter Anfang
2
Die menschenopfernden Generäle auf der Suche nach einem Sieg
3
Die alternden Egoisten, die Tausende opferten
4
Midinettes und Industrielle retten den Krieg
5
1917: das Jahr, in dem Deutschland (fast) alles gelang
6
Torpedierung der Schifffahrt und die Folgen
7
Die unterschätzten USA und ein ausserordentlicher Präsident
8
Wenn rumänische Zöllner einen Wanderzirkus kontrollieren
9
Lenins Reise von Zürich nach St. Petersburg
10
Ein Klima der Unaufrichtigkeit: Hindenburg, Ludendorff, die Presse und die Meinungssteuerung
11
Der deutsche Traum vom Osten
12
Der Friedensvertrag der Illusionen: Brest-Litowsk
13
Kräfte und Versorgung
14
Die Industrialisierung des Kriegs
15
Die Parlamentarier werden wach
16
Unter dem Diktat der OHL
17
Anläufe zur Besinnung
18
Die Meutereien in der französischen Armee und deren Erneuerung
19
Ein gemeinsames Oberkommando und ein beratender Generalstabschef für die Regierung
20
Keine Niederlage, sondern ein Generalstreik: Caporetto
21
Zwei überragende Staatsmänner
22
Nach dem Ausstieg Russlands: im Vorfeld der deutschen Offensive 1918
23
Eine Entscheidungsoffensive mit vielversprechendem Anfang und unerwünschtem Ausgang
24
Ein Finale mit amerikanischer Hilfe und Ludendorffs Nervenzusammenbruch
25
Die Attacke auf den weichen Teil der deutschen Front im Süden
26
Österreich-Ungarn am Ende
27
Die unbelasteten Kräfte der Demokratie
28
Die Stunde der Liquidierer
29
Der Erfolg des Waffenstillstands
30
Besser als sein Ruf: Der Friedensvertrag von Versailles
Anhang
Anmerkungen
Quellen und Literatur
1 Der Waffenstillstand. Aquarell von André Fraye, 1918. Fraye war selber Soldat gewesen und hinterliess zahlreiche Skizzenbücher. © Coll. La contemporaine.
2 75-mm-Geschütz in Feuerstellung. Die Pferde waren bereits in Deckung. In der fahrenden Artillerie war es immer der Ehrgeiz, den ersten Schuss bereits auszulösen, bevor die Fahrer mit den Rössern in Deckung waren. © Maurice-Louis Branger/Roger-Violett/Keystone.
3 Georges Clemenceau: Ungeachtet seiner bald 80 Jahre machte der Ministerpräsident und Kriegsminister es sich zur Pflicht, die Front intensiv zu bereisen und die Soldaten in den Schützengräben aufzusuchen. Rechts von ihm General Henri Mordacq, sein Kabinettschef. Mordacq publizierte seine Aufzeichnungen über die Jahre mit dem Regierungschef unter dem Titel: Le Ministère Clemenceau. © Roger-Violett
4 Der Kölner Erzbischof Felix Kardinal von Hartmann läuft mit einem Schleppenträger eine Ehrenkompanie ab. Den Einwohnern von Laon blieb der Kardinal nach seiner Predigt in nachhaltiger Erinnerung: «Die Franzosen, dieses gottlose Volk, muss man alle umbringen.» Hist. Archiv d. Erzbistums Köln.
5 Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson war in wenigen Jahren vom Rektor der Universität Princeton zum Gouverneur von New Jersey und danach gleich ins Weisse Haus gewählt worden. Aufgestellt hatten ihn die Gewerkschafter der Tammany-Society. © Corbis.
6 Wilhelm II. in der Uniform der Leib-Husaren, auch Totenkopfhusaren genannt. Bild um 1901. © Corbis.
7 Der Chef des britischen Expeditionskorps, Douglas Haig, entstammte einer Dynastie von schottischen Wiskey-Distillern, war bei Hofe und in der Presse gut gelitten und bevorzugte servile Mitarbeiter. Bild von William Orpen © Imperial War Museum.
8 Feldmarschall Ferdinand Foch, der alliierte Oberbefehlshaber, war ein anerkannter Stratege, in dem Erich Ludendorff seinen Meister fand. Statt dessen System der wuchtig vorgetragenen strategischen Keile aufzunehmen («Wir hauen ein Loch in die Front»), griff Foch auf breiter Front an und nahm Ludendorff damit die Möglichkeit, Schwerpunkte zu bilden. Bild von William Orpen © Imperial War Museum.
9 Die Unterzeichnung des Friedenvertrags im Spiegelsaal in Versailles. Im Vordergrund im Stuhl Johannes Bell, deutscher Minister für Verkehr und Bau. Gegenüber Woodrow Wilson, Georges Clemenceau, Lloyd George. Links weiter Colonel House und Jan Smuts in Uniform. Bild von William Orpen © Imperial War Museum.
1Das lange Ende und ein bekannter Anfang
«Von einem Krieg weiss man immer nur, wie er anfängt», meinte Charles de Gaulle einmal. Manchmal weiss man nicht einmal das. In Deutschland spezialisierte sich eine organisierte, regierungsamtlich geförderte Geschichtsschreibung darauf, den Nachweis zu führen, nicht für den Ersten Weltkrieg verantwortlich gewesen zu sein. Mit dem australischen Historiker Christopher Clark findet sie ihre bejubelte Fortsetzung. Diese Tradition reicht zurück bis zur organisierten Meinung durch das Auswärtige Amt in der Weimarer Republik. Dass sie von Staats wegen herbeigeführt wurde, macht sie nicht glaubwürdiger.
Zur Erklärung des Ersten Weltkriegs könnte man mit dem grossen britischen Historiker Eric Hobsbawm die Ursachen in einem unverdauten Imperialismus orten. Das war auf höherem Niveau die deutsche Meinung, alle Staaten seien verantwortlich gewesen.
Da bliebe aber noch die Frage nach der Sonderstellung des deutschen Kaiserreichs in einer liberalen Staatenwelt, dem Modell des 19. Jahrhunderts. Giuseppe Mazzini und Victor Hugo waren die beiden grossen Vorläufer. In mehr als gewisser Weise knüpft die heutige EU an diese Staatenwelt des 19. Jahrhunderts an. Sie integriert beiläufig auch das grosse Deutschland. Dass es sich die längste Zeit des 20. Jahrhunderts nicht hat integrieren lassen, sondern lieber auf seinem Gewaltweg beharrte, ist unübersehbar.
Gab es womöglich eine unterschiedliche Einstellung zur Gewalt? Waren der Frankreichfeldzug und der Beschuss von Paris 1871 nicht gewissermassen symptomatisch? Während Victor Hugo mit Giuseppe Mazzini noch an ein Vereintes Europa mit Paris als Hauptstadt glaubte?
Erklärungsversuche weisen gerne zurück. In den vorhergehenden Generationen die Gründe für die späteren zu suchen und zu finden, ist gern geübte Eigenart der Gewohnheit der Historiker. Erklärungsversuche bleiben mit Vorliebe am 19. Jahrhundert hängen, an seinem Historismus, seiner Angst vor der Dekadenz, seiner plakativen Schreckensvision eines untergehenden Roms, am liebsten ledergebunden und mehrbändig in üppiger Ausstattung. Dazu eine tiefe Sorge der »beati possidentes« vor einer sozialen Bedrohung. Dieses 19. Jahrhundert verlief im Blick zurück weitgehend parallel von Bordeaux bis Frankfurt a. O.
Insofern gibt ein historistisch angehauchter Imperialismus zur Erklärung für den Ersten Weltkrieg nur bedingt verwertbare Motive her. Sicher auch nicht ein Viollet-le-Duc oder eine allenthalben aufschiessende Burgenromantik.
Die Erklärungen zielen gerne auf den Nationalismus. Aber litten alle darunter? Jakob Buckhardt (1818–1897) hatte die Grossstaaten alle im Verdacht, zu einer Gewaltpolitik fähig zu sein, um innenpolitische Ambitionen zu befriedigen.
Wie schaut es neben dem artverwandten Imperialismus mit dem Liberalismus aus? Das Rote Kreuz war sicher kein Ausweis einer militanten Tendenz. Ebenso wenig die Haager Friedensordnung. Oder andere Anläufe, das Staatensystem sicherer zu machen. In Deutschland wurde ihnen nie wirklich applaudiert. Wie Staatssekretär (Aussenminister) von Jagow dem amerikanischen Botschafter erklärte, «war Deutschlands bestes Asset in einem Krieg die Bereitschaft zu einem plötzlichen, überwältigenden Schlag».1 Genau deswegen hütete sich das Reich davor, die Bryan-Friedensverträge zu unterschreiben, die sich der amerikanische Aussenminister zur Konfliktvermeidung ausgedacht hatte. Es hätte sonst sein «bestes Asset» preisgegeben.
Wenn der Spiritus Rector der deutschen Liberalen, Friedrich Naumann, meinte: «Jede substantielle Revision des Globus zum deutschen Vorteil ergibt sich wahrscheinlich durch einen Friedensvertrag nach einem erfolgreichen Krieg»,2 deutet dies mehr auf ein latentes Kriegsklima hin als auf den Ehrgeiz, den Frieden sicherer zu machen.
In gewisser Weise war der Friede nicht populär. Die politische Selbstisolierung Deutschlands in Europa wurde innenpolitisch als «aufgezwungen» verkauft – und war immer nur militärisch. Die multilateralen Versuche zur Friedenssicherung wie die Bryan-Friedensverträge ignorierte Berlin nach Kräften. Das Reich sah sein Heil auch nie in derAbrüstung. Die war nun wirklich nicht populär, sondern immer nur in seiner Aufrüstung.
Bezeichnenderweise wissen heute nicht einmal mehr Historiker in Deutschland, dass mit dem Reichstagsakten-Forscher Ludwig Quidde, einer der ihren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Dass Deutschland es lieber mit dem Militarismus hielt, ist nicht besonders neu. Für diesen Sonderweg hat das Land schwer bezahlt. Und Europa ebenso.
1918 – der Weg zum Frieden beleuchtet eine kurze Etappe auf dem langen Weg Deutschlands. Das Buch zeigt, dass das Kaiserreich den westlichen Demokratien insgesamt deutlich unterlegen war.
Es zeigt weiter, dass erst die demokratischen Kräfte die Energie aufbrachten, sich aus dem Bann der Autokraten zu lösen (am Hof wie im Militär) und über den Waffenstillstand vom 11. November 1918 zum Frieden zu kommen. «Revolutionen träfen nur besiegte Völker», meinte Marschall Ferdinand Foch zu Matthias Erzberger während der Waffenstillstandsverhandlungen.3 Diese Beobachtung hat etwas für sich. Siehe Russland, aber auch Deutschland oder Österreich-Ungarn. Die Demokratien nahmen Rücksicht auf die Bevölkerung; und sie hinterfragten die Leistungen der militärischen Führung. Erst die Parlamentarier wagten, an der alles kommandierenden OHL (Obersten Heeresleitung) zu zweifeln.
Die Regierungen in Paris und London setzten den gemeinsamen Oberbefehl durch und nahmen im Zweifelsfall selbst auf dem Schlachtfeld ihren Einfluss wahr. Georges Clemenceau – der fliessend Englisch sprach – besuchte zur Freude der britischen Einheiten auch deren Frontabschnitte und «gerne unter Gefahr»,4 wie Kabinettschef Henri Mordacq notierte. David Lloyd George dagegen machte um Schützengräben einen weiten Bogen. Er konzentrierte sich lieber auf seine Generäle. Angefangen bei dem mit Intrigen vertrauten Field Marshal Douglas Haig (aus der gleichnamigen Whisky-Dynastie).
Die Generäle vom Wert eines gemeinsamen Oberkommandos zu überzeugen war harte politische Arbeit. Der Krieg fing militärisch an und hörte politisch auf. Aber unter Philippe Pétain kamen die französischen Streitkräfte auch taktisch weiter. Einschliesslich der vorangetriebenen «Mechanisierung des Krieges» und der maximal möglichen Substituierung der Infanterie durch die Mechanik. Dazu gehörte aber auch, die schwere Artillerie mit Traktoren zu ziehen. Alles in Erwartung der amerikanischen Einheiten. Dass sie französisches Material erhielten (75-mm-Feldgeschütz, Breguet-14-Flugzeuge, Panzer und gezogene Artillerie), überstieg die Kalkulationen der torpedierfreudigen deutschen Marineleitung. Die Heeresleitung wiederum erhoffte sich dank der U-Boote ein verhandungswilliges Grossbritannien. Heer und Marine erhofften sich mehr, als die Realität hergab. Die OHL und Erich Ludendorff waren grösste Hoffer.
Am Ende fing sich Italien und die Alliierten standen am Brenner. Sicher nicht zur Freude Bayerns. München musste sich in Berlin energisch wehren gegen den unbegründeten Verdacht, einen Separatfriedensvertrag auszuhandeln und vom Reich abzufallen.
So hatten sich der Kaiser und sein Kronrat das Ende sicher nicht ausgemalt, als sie sich 1914 zum Krieg entschlossen. Wie auch das unzeremonielle Ende der Monarchie, die Abdankung des Kaisers und die Flucht nach Holland ausserhalb aller Überlegungen standen. Dabei war es mehr eine Flucht nach vorne gewesen. Am Anfang – vor 1914 – forderten Überrüstung, Überschuldung und Übermut ihren Tribut. Jacob Burckhardts Verdacht einer Aussenpolitik aus innenpolitischen Motiven wird davon sicher nicht widerlegt. Dass sich die Bevölkerung einwickeln liess, steht auf einem anderen Blatt.
Als Winston Churchill und Charles de Gaulle von einem dreissigjährigen Krieg sprachen, steckte der Zweite Weltkrieg noch in seinen Anfängen. Er wurde das lange Schlusskapitel des 1914 ausgelösten Konflikts. 25 Jahre nach den Kriegserklärungen an Russland und Frankreich im Jahr 1914 folgte 1939 der Überfall auf Polen. Bis zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands sollte es schliesslich knapp 31 Jahre dauern.
Diese drohende Aussicht einer bedingungslosen Kapitulation schwebte bereits 1918 über Deutschland. Die politischen Führer der USA, einflussreiche Republikaner im Senat wie Henry Cabot Lodge und weite Teile der Presse in den USA verlangten nichts anderes.
Auf deutscher Seite waren im November 1918 Heeresleitung, Parlamentarier und Regierung willens zu kapitulieren. So verzweifelt war die Lage. Einzig die in letzter Sekunde signalisierte Bereitschaft der Alliierten zum ersehnten Waffenstillstand ersparte dem Reich diesen Schritt. Dass der Versailler Vertrag tel quel auf den Waffenstillstandsbedingungen aufbaute, wissen höchstens einige Spezialisten.
Keine vier Wochen später begrüsste jedoch der SPD-Führer und nachmalige Reichspräsident Friedrich Ebert die paradierenden Truppen in Berlin mit seinem «Unbesiegt im Felde!» Der Feldmarschall Paul von Hindenburg fing den Ball dankbar auf und monierte vor dem Reichstag seine Dolchstosslegende. Kein Parlamentarier kam auf die Idee, dass der vormalige Generalstabschef mit dieser Erklärung nur vom eigenen Versagen ablenkte. Die Oberste Heeresleitung hatte die politische Führung ahnungslos gehalten. Das Notgeständnis des drohenden Zusammenbruchs hatte die Politiker komplett überrumpelt.
Als Opfer seiner eigenen Propaganda war Deutschland in den Krieg gezogen im Glauben, neidische Nachbarn hätten sich gegen das Reich verschworen. Um aus dem Krieg mit der Überzeugung zurückzukehren, den Sieg und zumindest Belgien verdient zu haben. Lieber noch Fürstenkronen. Das Baltikum dachte sich Berlin monarchisch und unter deutscher Kontrolle.
Gefangen in ihrer Verantwortlichkeitsleugnung vergab die Weimarer Republik die Möglichkeit für einen Neuanfang. Statt Frieden und Abrüstung dominierten Revision und heimliche Aufrüstung. Ohne die gründliche Vorarbeit der Weimarer Republik hätte das Dritte Reich nicht schon fünf Jahre später über eine kriegsbereite Armee verfügen können.
Der britische, leider früh verstorbene Historiker Tony Judt schrieb in seinem Buch Postwar, dass der Versailler Friedensvertrag kaum so schrecklich gewesen sein könne, wenn das Reich 20 Jahre später wieder Europa überfallen konnte.5 Der schlechte Ruf des Vertrags ist eine der bleibenden deutschen Propagandaleistungen. Wie auch die Betonung einer alliierten Verantwortung für den Kriegsbeginn von 1914. Dieser Doppelmythos – nicht für den Krieg verantwortlich gewesen und im Felde unbesiegt zu sein – bildete den Humus für die alldeutsche Vaterlandspartei des Kaiserreichs und deren nationalsozialistischen Sprösslinge. Dies gilt auch für die finanzielle Seite des Vertrags.
Im Sinn Jacob Burckhardts spielten sicher die labilen Finanzen eine Rolle. Das Reich hatte sich vor dem Krieg schwer verschuldet. Die Wirtschaft steckte in einer scharfen Konjunkturkrise. Die Vorstellung einer fetten französischen Kriegskontribution hatte entschieden ihren Reiz.
Die Wurzeln der NS-Bewegung im Friedensvertrag von Versailles zu orten, ist bis heute ein intensiv gepflegter Nachkriegsmythos. Er bietet den grossen Vorteil der moralischen Entlastung vom Krieg und von der unglaublichen Verbrechensorgie bis hin zur Massenversklavung und zur industriell betriebenen Vernichtung missliebiger Minderheiten.
Das beliebte Frankreichfeindbild und ein unübersehbarer Hass auf Georges Clemenceau erleichtern die Vorstellung, dass die NS-Bewegung mit allen ihren Folgen im Grunde eine – weitere böse – Erfindung des französischen Ministerpräsidenten war. Quasi im Sinn einer Fortsetzung des Kriegs mit anderen Mitteln. Die Praxis sah anders aus. Paris ging immer wieder auf Berlin zu. Bis zur Akzeptierung der Militarisierung des Rheinlands.
Aber für diesen Nachkriegsmythos gib es einen prominenten Zeugen: John Maynard Keynes. Der Beamte der Treasury schrieb 1919 sein in Deutschland viel zitiertes Pamphlet The Economic Consequences of the Peace, eine Kombination von manifester Germanophilie, Antisemitismus, verletzter Eitelkeit (Keynes wurde in Paris wegen Illoyalität aus der britischen Verhandlungsdelegation geworfen), vor allem aber mit deutschem Propagandazahlenmaterial. Was seinem Erfolg höchstens entgegenkam.
Am 5. Oktober 2010 schrieb Le Monde: «La guerre de 1914 est enfin terminée …». Am 3. Oktober 2010 zahlte Deutschland die letzten Schulden: 95 Millionen Euro. Das waren die Zinsen für Anleihen, die Berlin in den 1920er-Jahren aufgenommen hatte, um die Reparationen zu finanzieren.
Die Pariser Friedenskonferenz war aus europäischer Sicht ein erster wichtiger Anlauf zu Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung. Die Gründung des Völkerbunds bildete den zentralen Teil des Versailler Vertrags. Für die Schweiz, der die Missachtung der belgischen Neutralität alles andere als gleichgültig gewesen war, boten sich neue Sicherheitsperspektiven. Sie trat dem Völkerbund bei. Sicher nicht nur deswegen, weil die Idee einer Zukunft ohne Krieg schlecht war, sondern auch um Gelegenheiten wie dem Attentat von Sarajevo vorbeugen zu können. Das Deutsche Reich entschloss sich 1914, sie zu nutzen. Wie der britische Diplomat Eyre Crowe bereits im Juli 1914 formulierte: «Es geht in diesem Kampf nicht um den Besitz Serbiens, sondern um Deutschland, das auf eine politische Diktatur in Europa zielt, und die Mächte, die ihre individuelle Freiheit zu erhalten wünschen.»
Auch Wilhelm II. sah die Ursache für den Krieg nicht im Attentat. In seiner Thronrede vom 6. August 1914 führte der Kaiser aus: «Die gegenwärtige Lage ging nicht aus vorübergehenden Interessenkonflikten oder diplomatischen Konstellationen hervor, sie ist das Ergebnis eines seit langen Jahren tätigen Übelwollens gegen Macht und Gedeihen des Deutschen Reichs […].» Eyre Crowe sah seine Freiheit gefährdet. Der Kaiser fand, man habe etwas gegen Deutschland. Damit widersprachen sie sich nicht einmal.
Dem Mediävisten Hermann Heimpel ist das Wort zu verdanken: «Die vornehmste Aufgabe der Geschichte ist die Gegenwart.» Er sagte es 1941 in seiner Strassburger Antrittsrede mit bemerkenswerter Offenheit. Insofern können andere Zeiten andere Akzente setzen, bis hin zu den demokratischen Leistungen der «Roten Marine». Den Kriegsbeginn betreffend wird es im Zweifelsfall heissen: «[…] weiss nur, wie er anfängt».
Dieses Buch konzentriert sich darauf, zu zeigen, wie er aufhört. Und dass sich die Demokratien im Krieg deutlich überlegen zeigten.
2Die menschenopfernden Generäle auf der Suche nach einem Sieg
Im August 1915 notierte Wilhelm Groener, bei Kriegsende Ludendoffs Nachfolger an der Spitze der OHL (Obersten Heeresleitung) und von Hindenburg persönlich verlesen: «Das Gefühl der Unfähigkeit, zu einem Abschluss des Krieges zu gelangen, ergriff weite Kreise, von Falkenhayn angefangen […]. In Berlin bildeten sich Klubs, zu denen Professoren und Staatsmänner gehörten, die die Verständigung mit England anstrebten und darum den Verzicht auf Belgien ausgesprochen wissen wollten. Diese Bestrebungen waren zweifellos von richtiger politischer und staatsmännischer Einsicht geleitet – aber der Einfluss der Kreise, die diese Einsicht hatten, war zu gering, um sich die Hoffnung auf einen Siegfrieden, zu dem nach alter Vorstellung Beute gehörte, durchzusetzen, und den Weg zur praktischen Durchführung ihrer Gedanken wussten sie wohl kaum. […] So gingen wir eben dem neuen Unternehmen entgegen (Serbienfeldzug), das unsere allgemeine Lage verbessern sollte.»1
Unter dem Datum vom 11. November 1915 bilanzierte der Generalmajor weiter: «Heute erhalte ich die Zusammenstellung der Verluste vom Anfang des Krieges bis Ende Oktober 1915. Über 15000 Offiziere und über eine halbe Million Unteroffiziere und Mannschaften sind tot. Welch gewaltige Zahlen. Wie recht hatte Graf Schlieffen, der dauernd auf die Notwendigkeit für Deutschland hinwies, den Krieg schnell zu beenden, also, wo man die Entscheidung suche, die ganze Kraft einzusetzen. Statt dieser schnellen Entscheidung – man mag es drehen, wie man will – die Niederlage an der Marne, weil man auf dem entscheidenden rechten Flügel zu schwach war. Alle Erfolge, die wir seitdem gehabt haben, können den ersten Fehler nicht wieder gut machen. Wir kämpfen uns durch weite Kriegsschauplätze und wissen nicht, wie man zum Frieden kommen soll, der den schweren Opfern entspricht.»2
Dies war die Erkenntnis der Ratlosigkeit. Der Frieden war nicht so ohne Weiteres erreichbar.
Wilhelm Groener, geboren 1867, hatte die Generalstabsausbildung an der Kriegsakademie in Berlin 1896 als Jahrgangsbester absolviert. Der Württemberger und Sohn eines bescheidenen Zahlmeisters war eine Ausnahmeerscheinung im preussisch dominierten Generalstab mit seiner unverkennbar feudalen Note. Helmuth von Moltke hatte ihn neben Erich Ludendorff als möglichen Chef der Operationsabteilung (Aufmarsch) ausgespäht, wies ihm aber schliesslich das Transportwesen und damit den Nachschub zu. Mit seinem ausgeprägten Verständnis für die Voraussetzungen der (modernen) Kriegsführung erwies sich Wilhelm Groener als die perfekte Besetzung. Sein ausgefeilter Mobilmachungsaufmarsch bestand im August 1914 die Bewährungsprobe glänzend.3
Der deutsche Angriff auf Frankreich mit dem Ziel der schnellen Vernichtung lief sich jedoch bereits Anfang September 1914 – vier Wochen nach Kriegsbeginn – an der Marne fest.
Es war eine Krise für eine ganze Generation von Generalstäblern. Sie war auf den Plan ihres vergötterten Chefs Alfred von Schlieffen – «das Genie» – gedrillt worden und hatte keine Alternative. Der 1833 geborene Graf von Schlieffen hatte den Generalstab seines Nachfolgers Helmuth von Moltke (der Jüngere) von 1891 bis 1905 geleitet. Dessen unzeremonielle Ablösung am 13. September 1914 behob die Krise des deutschen Angriffs weniger, als dass sie sie kaschierte.
Wie Groener in seiner Analyse des Scheiterns an der Marne festhielt, «war unsere Führung wohl allen taktischen Anforderungen gewachsen, die an sie herantraten, nicht aber den operativen. Den Generalstab und die höheren Führer zu operativem Denken zu erziehen, war Schlieffens Ziel gewesen, aber die praktische operative Übung in grösserem Rahmen fiel im Frieden fast vollkommen aus. Vor eine solche Aufgabe wurde der Kommandierende General nur im Kaisermanöver gestellt, und das war ein- oder zweimal in seiner militärischen Laufbahn […]. Es war unser Glück, dass auf der Feindseite der gleiche Mangel an operativem Blick herrschte wie bei uns. Joffre war kein grösserer Stratege als Moltke […]. Nur in einem Punkt war der französische Generalissimus dem deutschen als Führer weit überlegen: er besass Energie und Selbstvertrauen.»4
Moltkes Nachfolger war der am Hof gern gelittene und ebenfalls im Schatten Schlieffens aufgewachsene Erich von Falkenhayn.5 Der neue Generalstabschef konnte gar nicht anders denken und handeln als im Geist seiner beiden Vorgänger.
Entsprechend konzentrierte sich der Liebling des Kaisers darauf, die an der Marne verlorene operative Initiative zurückzugewinnen. Unter seiner Führung versuchte die OHL (Oberste Heeresleitung), den Angriff wieder aufzunehmen und die franko-britisch-belgischen Armeen in ihrer offenen Flanke zu fassen.
Dieser durchschaubare Versuch mündete in einen Wettlauf zum Meer. Dass sich das Gros der belgischen Armee beizeiten aus der belagerten Festung Antwerpen hatte absetzen können, erleichterte den deutschen Kräften die Aufgabe sicher nicht. Zumal die Oberste Heeresleitung meinte, mit Belgien längst abgeschlossen zu haben, zu ihrer unangenehmen Überraschung jedoch anderweitig belehrt wurde.
Am 28. September trug Falkenhayn dem Kaiser vor: «Unser rechter Flügel – die Sache unverständlich – ist nicht in der Lage, sich gegen den linken Flügel der Franzosen durchzusetzen. Unsere fünf Korps schaffen es nicht, die französischen Kräfte definitiv auszuschalten, wiewohl die an dieser Stelle nicht über eine numerische Überlegenheit verfügen.»6
Es folgte ein neuer Umfassungsversuch bei Arras unter dem Kommando des bayerischen Kronprinzen Rupprecht. Die Schlacht dauerte vom 2. bis zum 9. Oktober. In Erwartung des Sieges am folgenden Tag reiste der Kaiser am 4. Oktober an.
Er hatte nicht mit Ferdinand Foch gerechnet.
Joffre hatte seinen besten Mann mit der Führung der 2. und der frisch gebildeten 10. Armee sowie der Territorialkräfte betraut. Foch steifte Louis Ernest de Maud’huy, dem Kommandeur der 10. Armee, in seiner verzweifelten Lage umgehend den Rücken: «Ich kenne nur drei Arten zu kämpfen: angreifen, halten oder abhauen. Ich verbiete Ihnen Letzteres! Suchen Sie sich eine der beiden Ersteren aus».7
Maud’huy hielt. Damit blieben Arras und Roye unter französischer Kontrolle. Maud’huy hatte vier Wochen zuvor noch die 16. Infanteriedivision kommandiert, dann ein Korps übernommen, um sich jetzt an der Spitze einer notmässig gebildeten Armee wiederzufinden.8 Joffre hatte gleich stangenweise die Generäle ablösen lassen, die der Härte der Abwehrkämpfe nicht gewachsen waren.
Der deutsche Sturmlauf scheiterte schliesslich definitiv vor Ypern. Falkenhayn hatte sich «festgebissen», wie Wilhelm Groener notierte. Knappe fünf Wochen dauerte die Schlacht um das belgische Städtchen unweit der Atlantikküste.
Der frisch gekürte OHL-Chef fand angesichts der aufgelaufenen Verluste nicht mehr die Energie, die Schlacht beizeiten abzubrechen. Unter dieser Unfähigkeit der obersten militärischen Führer zur rechtzeitigen Einsicht in eine misslungene Operation sollten in den folgenden Kriegsjahren die alliierten Armeen fast noch mehr leiden als die kaiserlichen.9
Erst am 13. November 1914 rang sich die Oberste Heeresleitung (OHL) – faktisch der grosse Generalstab im Feld – dazu durch, den nötigen Entschluss zu fassen. Die «enormen Verluste» hatten die Höhe von 100000 Mann erreicht.10 Dem britischen Expeditionskorps erging es in der Verteidigung nicht viel besser als den Angreifern. Es verlor in der Abwehrschlacht vor Ypern 80 Prozent seiner Bestände, schaffte es aber, die Front zu halten.
Der OHL-Chef sah die Westfront als kriegsentscheidend an. Im Gegensatz zu Hindenburg und Ludendorff. Die wollten den Schwerpunkt auf den Osten setzen und bestürmten den Generalstabschef, die Front im Osten verstärken.
Wie berechtigt Falkenhayns Annahme war, sollte sich im Jahr 1918 zeigen. Russland im März 1918 den Friedensvertrag von Brest-Litowsk abgezwungen zu haben und weite Gebiete vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer zu beherrschen, erwies sich als wertlos, band aber weiterhin gut eine Million Soldaten.11
Die Entscheidung fiel im Westen. Dort setzten sich die in der Zwischenzeit mechanisch stark aufgerüsteten – und seit dem Frühjahr 1918 unter einem gemeinsamen Oberkommando geführten – Armeen der Alliierten gegen die ausgelaugten deutschen Kräfte durch.
Falkenhayn und seine engsten Mitarbeiter in der OHL – allesamt erzogen im Glauben an die eigene Überlegenheit – vertrauten aber auch 1915, im Jahr der allgemeinen Kriegsverlegenheit, weiterhin darauf, doch noch die operative Initiative zurückzugewinnen und die überlegene Manövrierfähigkeit der anerkannt gut geführten deutschen Armeen auszuspielen. So konnte sich die Idee des Wettlaufs ans Meer durchsetzen. Ein Jahr später kam dann der Versuch, in Verdun durchzustossen. Im Grunde sollten beide Schlachten den Fehler an der Marne ausbügeln und den Schlieffen-Plan in extremis retten.
Gleichzeitig sah der OHL-Chef die Grenzen des Möglichen. So meinte Erich von Falkenhayn im März 1915 nur, dass der «Krieg keinen vollen militärischen Erfolg bringen» werde. Er sah vielmehr, dass sich die Möglichkeit eines «zweiten punischen Krieges» abzeichnete.12 Der dann mit dem Zweiten Weltkrieg bereits 21 Jahre später auch kam.
«Diese Unterhaltung», so Groener, «zeigt, dass Falkenhayn damals einer der wenigen Militärs war, die nüchtern und richtig die Dinge betrachteten. Hätte er nur auch die Folgerungen aus seiner Einsicht gezogen und sich mit dem Reichskanzler zusammengetan, um den Krieg, von dem er keinen vollen Erfolg mehr erhoffte, auf politischem Wege zu beenden. Aber der Mut, sich öffentlich zu seiner Einsicht zu bekennen, fehlte ihm; auch er liess die innere Stimme gar zu gerne durch die äusseren Erfolge beruhigen und betäuben. Niemand hat es gewagt, der Lage klar ins Auge zu sehen.»13
Zu den Eigenheiten des politischen Systems in Deutschland gehörte, dass die strategisch-politische Initiative gänzlich der Obersten Heeresleitung überlassen blieb. Die Regierung nahm keinerlei Einfluss. («Aber die Politik ist doch Strategie», so ein überraschter Charles de Gaulle Jahrzehnte später, als ihm der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard gestand: «Von Strategie verstehe er nichts.») Der Kaiser war nominell oberster Kriegsherr, liess sich aber von der Heeresleitung steuern.
Der Reichskanzler Bethmann-Hollweg verfolgte die Ereignisse ebenfalls passiv. Nicht anders seine Nachfolger. Ebenso begnügte sich das Parlament bis 1917 mit einer Zuschauerrolle. Der Generalstabschef war faktisch niemandem rechenschaftspflichtig.
Solange ihm keine groben Fehler unterliefen oder eine offenkundige Überforderung vorlag – wie bei Falkenhayns Vorgänger Helmuth von Moltke –, war er sakrosankt.
Moltkes Ablösung erfolgte jedoch höchst informell – auf Druck der weiteren Armeeführung und der Hofkamarilla, aber sicher nicht auf Druck des Kaisers.14 Einem modernen Staat entsprach dieses Ablösungsprozedere nur sehr bedingt. Unübersehbar sind vielmehr gewisse Ähnlichkeiten mit der altgermanischen Gepflogenheit, sich bei erkennbarem Heilsverlust – wie eben einer misslungenen Schlacht – ihrer Führer unzeremoniell zu entledigen.
Dabei wurde die Lage nicht besser. Wie Wilhelm Groener am 1. August 1915 notierte: «Das erste Kriegsjahr ist zu Ende. Im Westen ist das festgehalten und gesichert, was der schlieffensche Gedanke in einem mächtigen Ansturm uns eingebracht hat. Die Entscheidung dort ist bereits Ende August (1914) gefallen. Was seitdem im Westen geschehen, ist der Tapferkeit der Truppen und der Entschlossenheit der Führung zuzuschreiben, nichts von dem wieder aufzugeben …»15
Bereits am 30. April 1915 hatte er zur folgenreichen Wirkung des missglückten Plans notiert: «Es ist unser Verhängnis, seit dem ersten Aufmarsch nie wieder an entscheidender Stelle stark genug zu sein. Wir haben uns unserer Stärke törichterweise selbst beraubt, als wir die 6. und 7. Armee nicht dem schlieffenschen Aufmarsch entsprechend eingesetzt haben. Davon geht die Kette aus, die unsere operative Freiheit mehr und mehr fesselt. Das ist die Frucht der bösen Tat, die fortzeugend Böses muss gebären, das Fatum, dem wir nicht mehr entrinnen können, wenn uns nicht noch ein Glücksfall in den Schoss fällt. Diesen Zufall erhofft man von dem Zusammenbruch der Russen oder vom Tod des Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch, der an Leberkrebs leiden soll.»16
Nicht anders als Groener beurteilte Georges Clemenceau den (misslungenen) Schlieffen-Plan. Als er in der Krise von 1917 die Regierungsgeschäfte in Paris übernahm, bemerkte er zu seinem Kabinettschef Henri Mordacq: «Ich meine, dass die gefährlichste Krise, die das Land überstanden hat, die am Anfang des Krieges war. Die Deutschen haben sich eine Gelegenheit entgehen lassen, uns zu vernichten.»17
In der Zwischenzeit erfolgte der Serbienfeldzug, glänzend geführt von August von Mackensen und seinem überragenden Generalstabschef Hans von Seeckt. Der Feldzug ging einher mit dem Kriegseintritt Bulgariens an der Seite der Mittelmächte Deutschland/Österreich-Ungarn. Allerdings gelang es der ans Meer abgedrängten serbischen Armee, ein Drittel der Mannschaftsbestände zu retten.
Die französische Marine transportierte sie nach Korfu und Bizerta an der tunesischen Küste. Die Neuaufstellung von sechs Divisionen (110000 Mann) erfolgte mit französischem Material und französischen Instruktoren. Stationiert wurde die neue serbische Armee im griechischen Saloniki und eingesetzt schliesslich 1918 unter dem Kommando von Franchet d’Espèrey in seiner schnellen Offensive gegen das kriegsmüde Bulgarien.18
Noch vor der Operation gegen Serbien19 versuchten die britischen und französischen Kräfte, die deutsche Front in einem Zangenangriff bei Arras und in der Champagne zu durchbrechen. Der französische Oberkommandierende Joseph Joffre hatte die Idee seit Juli 1915 ventiliert, wiewohl die Materialausstattung unzureichend war.
Der französischen Armee fehlte immer noch weitgehend die schwere Artillerie. Was man hatte, war aus der Festung Verdun und anderen befestigen Plätzen ausgebaut worden. Die Armee hatte die schwere Artillerie vor dem Krieg faktisch aufgegeben. Sie fand den ans Pferd gebundenen Transport zu umständlich und konzentrierte sich auf die Feldartillerie mit der berühmten 75-mm-Kanone.20
Bezeichnenderweise blieb die Armeeführung auch in den ersten Kriegsmonaten bei ihrer Abneigung gegen eine schwere Artillerie. Erst nach Frontbesuchen der Parlamentarier Abel Ferry und André Tardieu und der Intervention von Charles Humbert im Senat bequemte sich die Armeeführung, schwere Geschütze anzufordern.21
«Die famose Theorie der Offensive um jeden Preis, in jedem Gelände, immer und überall, kommt uns zu teuer zu stehen. General D’Urbal musste sich nach der letzten Offensive bei Arras von seinen Untergebenen als Mörder traktiert lassen», notierte Abel Ferry.22
Die verheerenden Verluste bei den Angriffen im August 1914 hatten in der Führung keinen erkennbaren Einsichtsprozess ausgelöst. Das Oberkommando behielt die Verlustzahlen nach Möglichkeit einfach für sich und schirmte sich gegen die politische Führung ab.23 (Der für die Doktrin verantwortliche Chef der Operationsabteilung im Generalstab [3e bureau] war von 1898 bis 1900 Louis de Grandmaison. Der Oberstleutnant fiel im März 1915 vor Soissons. Ein Opfer seiner eigenen Doktrin.24)
Am 6. November musste Joffre, der gelernte Genieoffizier und Absolvent der École polytechnique, die am 25. September 1915 initiierte Somme-Schlacht schliesslich abbrechen. 4000 Offiziere und 150000 Mann waren gefallen, ohne dass sich die Fronten nennenswert bewegt hätten. Dazu kamen noch einmal 3700 Offiziere und 136000 Mann, die am Chemin des Dames (nördlich von Soissons) ihr Leben gelassen hatten.25 Das Wort vom «Massaker der französischen Infanterie» ging um.26
Bereits im Frühjahr des Jahrs, am 23. April 1915, hatte Abel Ferry unter dem Eindruck der gescheiterten Angriffe in der Woëvre-Ebene (unweit von Verdun) erschüttert «die Leichtfertigkeit» notiert, «mit welcher die Generäle, diese alternden Egoisten, Tausende von Menschen opfern».27
Der Sprössling einer der führenden Familien der III. Republik – radikal-sozialistischer Abgeordneter und in der 2. Regierung Viviani Minister – hatte sich mit 33 Jahren als Infanterieleutnant mobilisieren lassen. Ferry wurde dem 166. Infanterieregiment zugewiesen und führte in der Woëvre-Ebene einen Zug. Seine Kritik richtete sich gegen die Regierung wie gegen die militärische Führung: «In den Schützengräben sinnlose Tode; in Paris keine Regierung.»28
Das GQG (Grand Quartier Général), das Oberkommando der französischen Armee, revanchierte sich mit einer Versetzung Ferrys ins belgische Nieuwpoort. Der Posten bot weniger Anlass zur Kritik an der unzureichenden Führung.29
Matthias Erzberger – gelernter Primarschullehrer und ein «animal politique» – stellte erst sehr viel später, am 26. April 1918, im Parlament die ketzerische Frage: «Wie gedenkt die OHL den Krieg zu beenden, wann hört die entsetzliche Menschenschlachterei auf?»30 Da näherte sich der Krieg schon seinem Finale. Aber nicht, weil der Sieg winkte. Im Gegenteil. Es blieb nur der Waffenstillstand.
Wie der nachmalige Vizekanzler Friedrich von Payer festhielt, musste das junge Reichstagsparlament sein Geschäft erst mühsam lernen.31 Dies bedingte politische Ausnahmebegabungen wie Mattias Erzberger, die selbst einen Erkenntnisprozess durchlaufen mussten. Gleichzeitig liessen sie sich mit geschönten Nachrichten und Vorlagen abspeisen. Informationen aus erster Hand flossen spärlich. Anders als im französischen Parlament gab es auch keine Offiziere im Reichstag.
Bis er begriffen wurde, war der Krieg bereits vier Jahre alt, das Militär weiterhin sakrosankt, die Verluste waren horrend, aber der Glaube an einen Sieg war intakt. Wenn auch weiterhin nicht erkennbar.
Am 20. Oktober 1915 versammelte Erich von Falkenhayn die Armeechefs des Westheers in Mézières und «gab in sehr geschickter Weise einen politisch-strategischen Rückblick über die letzten Monate, dem man im allgemeinen durchaus zustimmen kann, wenn auch nach meiner Ansicht zu stark hervorgehoben war, dass bei den Operationen im Osten der Vernichtungsgedanke zurücktreten musste infolge der zahlenmässigen Überlegenheit der Russen und ihrem absoluten Bestreben, sich einer Umfassung zu entziehen, es überhaupt zu einem Entscheidungskampf kommen zu lassen […]. Auch die heutige Aussprache mit Falkenhayn hat meine Ansicht gefestigt, dass die Stärke seiner Befähigung mehr auf politischem als auf strategischem Gebiet liegt», so Groener.32
20 Jahre später kommentierte Wilhelm Groener bei der Niederschrift seiner Memoiren seinen Tagebucheintrag mit den Worten: «Hier taucht also zum ersten Mal der Begriff der Ermattungsstrategie bei Falkenhayn auf. Für die Operation im Osten hat er ja wirklich nur das beschränkte Ziel gehabt, da immer der Gedanke an die grosse Operation im Westen in ihm lebendig war. Dass er auch von Anfang an im Westen auf den Vernichtungsgedanken verzichtet hätte, wie er später sich und anderen glauben zu machen suchte, möchte ich bezweifeln. Auf jeden Fall hat er die Folgen einer Ermattungsstrategie nicht logisch zu Ende gedacht: der Feind sass am längeren Hebelarm, und unsere Aufgabe war zu verhindern, dass wir selbst durch einen Ermattungskrieg zermürbt wurden. Im Innersten hat Falkenhayn wohl doch gehofft, eines Tages so viel Kräfte verfügbar zu haben, um mit einem Durchbruch im Westen die Kriegsentscheidung herbeizuführen.»33
Der Wechsel der strategischen Prämisse von der Vernichtung zur Ermattung mündete bei Falkenhayn in den Plan, die französische Armee in Verdun zu verschleissen. «Wann der Plan des Angriffs auf Verdun in Falkenhayn entstanden ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Anfang Dezember [1915] stand er bereits ziemlich fest in ihm […]», erinnerte sich Wilhelm Groener: «Die Meinung war, die französische Führung zu zwingen, ‹den letzten Mann einzusetzen […] und Frankreichs Kräfte zu verbluten›[…]. Hinter diesen zuversichtlichen Worten stand leider nicht die notwendige strategische Klarheit. Es kam darauf an, die Festung [Verdun] zu nehmen, das allein war das wahre strategische Ziel. Falkenhayns Absichten gingen aber nicht ausschliesslich auf die Festung, sondern auf einen englischen Gegenangriff, den er durch das Verdun-Unternehmen herauszulocken hoffte. Selten aber haben sich Hoffnungen und Wünsche, wie die von Falkenhayn in der Weihnachtsdenkschrift ausgesprochenen, so Punkt für Punkt in ihr Gegenteil verkehrt wie vor Verdun: mit Hoffnungen und Wünschen, die der tatsächlichen Grundlage entbehren, gerät man eben leicht auf einen strategischen Irrweg […]. Dass auch General v. Falkenhayn bei aller Zuversicht der Sprache seiner Sache nicht ganz sicher war, könnte man daraus schliessen, dass er in der Weihnachtsdenkschrift den uneingeschränkten U-Boot-Krieg forderte. Noch vor weniger als einem halben Jahr hatte er die Gefahr des Kriegseintritts von Amerika mit seinen überreichen Mitteln an Menschen und Material richtig eingeschätzt […]. Seitdem hatten die hochgeschraubten Hoffnungen der Marine, mit dem U-Boot-Krieg England in wenigen Wochen niederringen zu können, Eingang bei ihm gefunden […]. Der sonst so kühle Falkenhayn hat dabei unterlassen zu prüfen, ob diese Rechnung glatt aufgehe; die Zahl unserer U-Boote stand in keinem Verhältnis zur Grösse des zu beherrschenden Raumes und zu den starken Abwehrmitteln der Engländer.»34
Über den Angriff auf Verdun ist viel gerätselt worden, und schon Groeners Analyse ist sicher die überzeugendste. Es mag auch eine Rolle gespielt haben, dass der grosse Generalstab (die Oberste Heeresleitung im Frieden) den Angriff auf Verdun 1912 zum Gegenstand einer Übung gemacht hatte: «Die Patentlösung war Angriff auf den Douaumont als Schlüssel der Festung, der eines Nebenangriffs auf dem westlichen Maasufer nicht entbehren durfte. Weshalb dieser 1916, im Ernstfalle, zunächst unterblieb, ist mir nicht bekannt.» So Ernst von Wrisberg, im preussischen Kriegsministerium zuständig für die Heeresversorgung mit Waffen, Munition, Gerät, Pferden sowie Soldaten und selbst Generalstäbler.35
Das französische Oberkommando hatte der Festung nur beschränkten Wert beigemessen und die anderweitig dringend benötigte schwere Artillerie weitgehend ausgebaut.36 Die deutsche Seite baute ihrerseits aus ihren Festungen im Hinterland die Artillerie aus und kratzte für den Angriff auf Verdun alle verfügbaren Reserven zusammen: «Es werden weitere schwere Batterien zur 5. Armee herangefahren und zwar von Mazedonien und aus Metz, Namur und Lüttich. Es begann damit die Entblössung der grossen Festung Metz-Diedenhofen, die sich 1918 verhängnisvoll bemerkbar machte», erinnerte sich Groener in seinem Eintrag zum 12. März 1916.37
Neben dem Militär hatte die deutsche Elite ihre Reputation mit dem Krieg verknüpft. Sie hoffte spätestens auf einen Sieg bei Verdun. Die Absicht war es, dort die französische Armee zu umfassen, nachdem die OHL bereits zweimal gescheitert war: erstmals an der Marne, dann bei Ypern.
Mit leerer Hand zurückzukommen, wäre das Eingeständnis eines strategischen und politischen Fehlers gewesen. Es würde das Ende ihrer Privilegien bedeuten. Einzige Hoffnung war es, mit einem rasch wachsenden Lebensstandard infolge weiträumiger Annexionen und einer ansehnlichen Kriegsbeute die Massen zu befriedigen. Darauf war das Budget zugeschnitten. Finanzminister Karl Helfferich hatte die Interessen der Industrie und der steuerscheuen Junker berücksichtigt. Es war auf Sieg aufgebaut. Der nachmalige Vorstand der Deutschen Bank hatte die Kriegsbeute – einschliesslich der Einverleibung Belgiens – schon fest eingeplant. Die Rechnung für den Krieg belief sich 1918 auf nicht weniger als 14 Milliarden Goldmark.38
Dieses Beutedenken erfasste weite Bereiche des politischen Spektrums. Selbst die SPD war nicht immun, sondern in gewisser Weise Gefangene der allgemeinen Vorstellungen. Bis hin zur SPD-Führung. André Tardieu, ein Gehilfe Clemenceaus und späterer Ministerpräsident, meinte: «Die sogenannte deutsche Demokratie zeigte eine Haltung wie die aktivsten Handlanger des Imperialismus und des Militarismus: Ebert, Scheidemann, David, Erzberger, Brockdorff-Rantzau, Hindenburg keineswegs zu vergessen.»39 Bezeichnenderweise stimmte die SPD immer für die Kriegskredite und gab damit das wirksamste Mittel aus der Hand.
Jede gedankliche Alternative zum schnellen Vernichtungskrieg gegen Frankreich vermieden zu haben, sollte sich jedoch spätestens nach der verlorenen Marne-Schlacht im September 1914 gründlich rächen. Die vermeintlich überlegene operative Antwort auf die strategische Unterlegenheit war an der Marne gescheitert. Damit standen die Generalstäbler vor unangenehmen Konsequenzen. Die Schlussfolgerungen waren so unangenehm, dass sie ihnen die folgenden vier Jahre lang zu entgehen suchten.
Dass man sich damit begnügte, den Feldherrn zu wechseln, führte nur bedingt weiter. Erich von Falkenhayn hatte Helmuth von Moltke abgelöst. Der neue Generalstabschef bewies zweifellos Realitätssinn, als er festhielt: «Wenn wir den Krieg nicht verlieren, so haben wir ihn gewonnen.» Groener attestierte Erich von Falkenhayn, dass er seines überlegenen politischen Gespürs wegen eher zum Frieden gefunden hätte als sein verbissener Nachfolger Ludendorff. Dieser hatte für seine Angriffspläne nur eine nihilistische Alternative parat: «Dann muss Deutschland eben untergehen.»40
Aber auch von Falkenhayn mochte sich nicht durchringen zur angemessenen operativen Antwort auf die Einsicht, dass der Krieg für Deutschland nicht zu gewinnen war. Bezeichnenderweise reagierte er auf Groeners Vorschlag, das Eisenbahnnetz zwischen Deutschland und Belgien mit einem Planungshorizont von drei bis vier Jahren auszubauen, mit dem verblüfften Kommentar: «Wollen Sie so lange Krieg führen»?41
Falkenhayn suchte lieber das Feldherrenglück vor Ypern und vor Verdun. Das Ergebnis war, dass er abgelöst wurde. Seine Stelle übernahm das Gespann, das es am besten verstanden hatte, sich die kultische Verehrung der öffentlichen Meinung zu sichern. Wiewohl aus nachvollziehbaren Gründen kein Freund des U-Boot-Kriegs, änderte von Falkenhayn im Vorfeld seines operativen Entschlusses zum Angriff auf Verdun seine Meinung. Sicher nicht, weil neue Erkenntnisse vorlagen. Sondern weil nunmehr alles herangezogen wurde, um einen Erfolg in Aussicht zu stellen. Immer wenn grosse operative Entscheidungen mit knapp erwartetem Ausgang anstanden, wurde der U-Boot-Krieg unverzichtbar.
Nirgends schimmert die Hoffnung als gedankliche Basis für die geplanten Operationen stärker durch als bei den Plädoyers für den U-Boot-Krieg. Gedankliche Ehrlichkeit war sicher nicht die Stärke des Generalstabs. Einzig Wilhelm Groener wies – in seinen Memoiren – darauf hin, wie fragwürdig die Annahme der Marineleitung war angesichts der wenigen verfügbaren Boote und der Millionen Quadratkilometer Meeresfläche. Aber Groener hatte als Experte für das Eisenbahnwesen und damit den Nachschub als einziger eine realistische Vorstellung von den verschwindend geringen Möglichkeiten.
Falkenhayns Nachfolger Erich Ludendorff fand für sein taktisches Geschick allgemein Anerkennung. Ludendorff war ob seines totalitären Esprits aber auch gefürchtet. Veit Freiherr Marschall genannt Greiff aus dem für die Personalpolitik zuständigen Militärkabinett des Kaisers riet lebhaft von Ludendorff ab. Er fürchtete, dass der fanatische Offizier alles mit sich reissen und am Ende sogar die Monarchie gefährden werde.42 Mit dieser Einschätzung traf Marschall genau den Punkt.
Nicht zuletzt unter dem Druck der öffentlichen Meinung – gesteuert auch durch die Kriegszensur – und in Teilung der strategischen Ratlosigkeit, wie den Krieg zu einem Ende zu bringen, entschied Wilhelm II. sich gleichwohl für den ungeliebten Offizier «mit dem Habitus eines Handlungsreisenden». Wiewohl Ludendorff im geistigen Zuschnitt und in der Gewandtheit weit hinter Falkenhayn zurückblieb, jedoch keineswegs dessen persönliche Anspruchslosigkeit und seine Mässigung bei Tisch teilte.
Ludendorffs grosse Leistung bleibt 1917 die Rückführung des Westheers auf die sogenannte Siegfriedstellung (Operation Alberich), eine verkürzte Verteidigungslinie. Sie war mit weniger Truppen zu halten. Die frei gewordenen Divisionen rückten an die russische Front ab, sofern sie nicht dringend auf dem Balkan gegen Serbien und Rumänien sowie zur Verstärkung der stark bedrohten Türkei benötigt wurden.
Die Defensive im Westen und der Bezug der Siegfriedlinie im März 1917 gingen einher mit einer Zerstörungsorgie.43 Dazu Groener: «Ich war mit den Massnahmen Ludendorffs für das Jahr 1917 restlos einverstanden. Seine besten Fähigkeiten, die des Organisierens, kamen dabei zu voller Geltung. Der Rückzug in die ausgebaute Siegfriedstellung war ein vortrefflicher operativer Schachzug».44 Wie die beiden renommierten französischen Militärhistoriker Fernand Gambiez und Maurice Suire festhielten, erlaubte die Verkürzung, zehn Divisionen aus der Front herauszuziehen und sie den Reserven zuzuweisen.45
Aber viel mehr fiel dem allseits gerühmten Gespann Hindenburg/Ludendorff nicht ein. Auf der Konferenz in Cambrai vom 5. September 1916 hatte es eine genauere Vorstellung von der Lage und Gelegenheit, das strategische Problem in seiner vollen Bedeutung zu sehen. Es schien «unter den dunkelsten Farben». Die Entente verfügte über 420 Divisionen, die Zentralmächte über 350. An der Westfront standen 178 alliierte Divisionen deutschen 129 gegenüber. Die Verluste an der Somme und vor Verdun erschreckten selbst die ganz Entschlossenen. Dazu machte sich die Handelsblockade bemerkbar.46 Angetan von den grosszügigen Versprechungen der Marineleitung, setzte (auch) Ludendorff auf den U-Boot-Krieg und auf die Subversion in Russland.47
Anders als Falkenhayn gestattete Ludendorff sich keine Siegeszweifel. Da er bislang einen erfolgreichen Bewegungskrieg im Osten geführt hatte, statt gegen eine Wand anrennen zu müssen, fiel ihm dies auch sehr viel leichter. Insofern war es verständlich, dass er den Ausweg aus dem strategischen Dilemma im Osten suchte – was sein Vorgänger verweigert hatte – und sich im Westen auf eine lang anhaltende Defensive einstellte. Zur Entlastung im Westen waren die maritimen Nachschubwege zu blockieren.
Auf der Kronratkonferenz in Plöss am 8. Januar 1917 entwickelte Ludendorff eine dreifache Antwort: umfassende Mobilisierung im Inneren (das sogenannte Hindenburg-Programm), Übergang zum unbeschränkten U-Boot-Krieg (mit dem Risiko, die USA in den Krieg zu ziehen) und Aufbau einer starken Defensivposition mit verkürzter Front im Westen.
Die Bedenken des Reichskanzlers und des Kaisers gegen den U-Boot-Krieg wischte Admiral von Holtzendorff beiseite mit der Zusicherung, Grossbritannien in sechs Monaten in die Knie zwingen zu können. Arthur Zimmermann, der ephemere Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, wollte von den USA die Zusicherung erhalten, eine freie U-Boot-Jagd wenigstens zwei Monate lang zu tolerieren.48 Das war wohl etwas naiv.
Mit dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk am 3. März 1918 lebten Ludendorff und die OHL die deutschen Raum- und Versorgungsträume aus. Im Westen kamen sie einem Frieden jedoch keinen Millimeter näher. Nach bald vier Jahren steckten sie immer noch in derselben strategischen Sackgasse. Mit dem durch den U-Boot-Krieg provozierten Kriegseintritt der USA verschlechterte sich die strategische Position Deutschlands sogar. Auch geriet die Lage auf dem Balkan zunehmend ins Wackeln. Die k. u. k. Monarchie zeigte galoppierende Auflösungserscheinungen. Sie war unterernährt und kriegsmüde. Die Versorgung der k. u. k. Einheiten in Italien war erschreckend. Die Mannschaften waren ausgehungert und zerlumpt, die Feldartillerie weitgehend unbespannt.
Die Hoffnungen der OHL richteten sich nach dem Frieden mit Sowjetrussland auf eine letzte grosse Offensive im Frühjahr 1918. Es war einmal mehr eine deutsche Hoffnung ohne Alternative. Dieses Mal waren selbst die Ziele nur vage formuliert. Die Hoffnung, mit einem Aufsprengen der Westfront und einer Trennung der britischen von den französischen Armeen einen Rückzug der britischen Truppen an den Ärmelkanal auszulösen, hatte den Glauben an den Vernichtungsgedanken ersetzt. Ludendorff selbst war sich über die Limiten seiner Offensive durchaus im Klaren: «Ich verbitte mir das Wort Operation. Wir hauen ein Loch in die Front, und dann sehen wir weiter.»49
Aber selbst das Loch wollte nicht gelingen. Damit war nach vier Kriegsjahren auch den Offizieren klar: Der Frieden war militärisch nicht zu erzwingen. Der weitsichtige bayerische Kronprinz und Armeeführer Rupprecht sah es als einer der Ersten.
Dass der Zusammenbruch dann noch viel schneller kam als befürchtet, war auch eine Folge der optimistischen Annahmen, die sich die Marineleitung nach dem Kriegseintritt der USA zurechtgelegt hatte. Sie hatte den nötigen Schiffsraum für die amerikanischen Divisionen mitsamt ihrer Ausrüstung kalkuliert. Die Amerikaner kamen aber ohne Ausrüstung. Das Material (Artillerie, Flugzeuge, Panzer) stellten die Franzosen. Damit verschoben sich die Kräfte noch sehr viel schneller zuungunsten Deutschlands als prognostiziert.
Die Leistungen der französischen Industrie – wiewohl vom Norden und vom Energieträger Kohle amputiert – und die intensive Nutzung der Ressourcen des Empires wurden auf deutscher Seite grob unterschätzt.
Mit Ludendorffs Forderung (an die Regierung) nach einem Waffenstillstand nahm der Krieg schliesslich sein Ende. Wenn auch nicht dasjenige, das sich der Generalstab 1914 ausgemalt hatte, als er zum Krieg trommelte. Der Glaube war abhandengekommen. Aber war er nicht schon Erich von Falkenhayn vor Verdun abhandengekommen? «Es ist merkwürdig, welche Rolle der Glaube an das Kriegsglück, die Hoffnung auf das ‹Trotzdem›, in diesem Krieg bei unseren Führern gespielt hat», so Wilhelm Groener über Falkenhayns Überlegungen.50 Von einem Krieg weiss man eben immer nur, wie er anfängt.
Wie sich vor Verdun zeigte, nahmen gerne auch grosse Schlachten einen unerwarteten Ausgang. Der deutsche Versuch, die Front zu durchstossen und damit noch einmal zurück zum Bewegungskrieg zurückzufinden, scheiterte unter grossen Opfern. Die französische Führung war nicht bereit, sich in die Planspiele der OHL einzufügen.
Mit der Abwehr des deutschen Angriffs betraute das französische Oberkommando Philippe Pétain, den späteren Maréchal und unrühmlichen Chef des ebenso unrühmlichen Vichy-Frankreichs. In einer bezeichnenden Würdigung seines Ruhms bemerkte Charles de Gaulle einmal, dass Pétain im Grunde bereits 1926 gestorben sei.
Die Wahl des Grand Quartier Général fiel auch deshalb auf Pétain, weil er sofort verfügbar war. Es hatte ihn mit seinem Stab und seinen Einheiten aus der Front herausgezogen, um die für das Frühjahr 1916 geplante Somme-Offensive vorzubereiten. Aufgefallen war der grosse Systematiker bereits während seiner Zeit als Lehrer an der École Supérieure de la Guerre (1908–1910) mit seinem prägnanten Satz: «Das Feuer tötet.» Damit setzte sich Pétain markant vom vorherrschenden Sturm- und Offensivdenken «um jeden Preis» ab.
Der gelernte Infanterieoffizier legte Wert auf Tarnung und Schutz, Ausnutzung des Geländes und Auffächerung der Einheiten. Der junge Charles de Gaulle war einer seiner Lieutenants gewesen, als er 1911 in Arras das 33. Infanterieregiment befehligte. Bei Kriegsausbruch kommandierte Pétain die 4. Infanteriebrigade und zeichnete sich in den Abwehrgefechten aus.
Ende August mit 58 Jahren zum General befördert, befehligte Pétain in der Marne-Schlacht die 6. Infanteriedivision. Im Oktober sah er sich bereits an der Spitze des 33. Armeekorps wieder. Eine späte, aber umso steilere Karriere.
Sein Biograf Guy Pedroncini zeichnet das Bild eines umsichtigen und fürsorglichen Kommandeurs mit einem scharfen Auge für die Möglichkeiten der neuen Technik und der Bereitschaft, sie sich sofort zunutze zu machen. Bei seiner Übernahme der 6. Infanteriedivision, einer erschöpften Einheit, sorgte er sofort dafür, dass die Strassen freigemacht wurden, um zu manövrieren. Weiter schaltete Pétain den Fliegerenthusiasten Colonel Estienne ein, um aus der Luft die deutschen Artilleriestellungen zu erkunden.
Estienne flog selbst und lieferte der eigenen Artillerie die Position auf einer Handskizze. Dies reichte, um eine deutsche Brigade auszuschalten. Pétains Vorgesetzter, General Hache, war davon so beeindruckt, dass er ihm die gefragten 120-mm-Geschütze zur weiteren Verwendung überliess und die Idee übernahm, die feindlichen Artilleriestellungen vor seinem Frontabschnitt aus der Luft erkunden zu lassen.51
Philippe Pétain legte grossen Wert auf gut befestigte Unterstände. Dies war im allgemeinen Sturmdenken bislang als vernachlässigbar angesehen worden. Er rügte sofort Material- und Ausrüstungsmängel bis hin zu fehlenden Schutzschilden bei den Maschinengewehren.52 Der General genierte sich nicht, die deutsche Ausrüstung mit der französischen zu vergleichen. Er fand die deutschen Minenwerfer und Handgranaten besser und verlangte dringend Abhilfe.53
Nachdem er im Oktober 1914 das 33. Korps übernommen hatte, forderte er umgehend mehr schwere Artillerie an (allein drei Batterien 155L sowie 105 mm) sowie vier zusätzliche Batterien Feldartillerie (75-mm-Geschütze), Telefonverbindungen und Winterausrüstung.54 Es war die exakte Umkehrung der bisherigen Praxis der französischen Armee, bei Sicht des Gegners unvorbereitet ins Gefecht zu gehen.55
Pétain setzte im Stellungskrieg vielmehr auf die entscheidende Rolle der Artillerie – alle 100 Meter ein 75-mm-Geschütz –, auf eine minutiöse Vorbereitung der Angriffe und einen schonenden Umgang mit den Menschenleben. Mithin auf eine rigorose Anpassung der Mittel an die Ziele oder der Ziele an die Mittel. Nach einem Wort de Gaulles war es «das Reale, das dem 33. Armeekorps beigebracht wurde, und nachfolgend der französischen Armee».56
Im Rahmen seines systematischen Ansatzes erkannte Pétain unmittelbar die Möglichkeiten der Fliegerei. Sicherung der Lufthoheit war für ihn ein Muss, ebenso die Unterstützung offensiver Vorstösse durch die Fliegerei.
Ab 30. Juli 1915 konnte die Aufklärung auf die ersten Luftaufnahmen zurückgreifen. Am 6. August 1915 stand ihr die N12 als erstes Luftgeschwader zur Verfügung. Ein zweites folgte drei Wochen später. Damit hatte Pétain ständig Maschinen in der Luft. Einzige Schwierigkeit war die fehlende Übung: Die meisten schweren Batterien hatten noch nie mit Luftbeobachtern zusammengearbeitet.57
Zu Pétains Erkenntnissen aus der Champagne-Schlacht (vom Herbst 1915) gehörte, dass die aktuelle Ausstattung der französischen Armee an Waffen und Gerät faktisch verhindere, die nachgelagerten Verteidigungslinien des Feindes zu nehmen. Solange die Hinterhangstellungen der Artillerie nicht genommen seien, seien selbst die bestgeführten Angriffe zum Scheitern verurteilt. Die erste feindliche Verteidigungsstellung sei in wenigen Stunden zu erreichen, die zweite aber nur nach einer neuen und langen Vorbereitung zu nehmen. In dieser Zeit verstärken und bauen die Deutschen die dritte Linie aus. Nur wenn dies unterbunden werden kann, hat man eine Chance. So sein Resumé.58
Der Angriff auf Verdun setzte am 21. Februar mit einem gewaltigen Artillerieschlag ein. Pétain übernahm das Kommando am 25. Februar um Mitternacht. Die Lage war mehr als heikel. Die Festung Douaumont war genommen. Die Armee des Kronprinzen stand gerade noch vier Kilometer vor der letzten Verteidigungslinie. Wie Guy Pedroncini rekonstruieren konnte, hatte Pétain die Lage blitzartig erfasst und seinen Entschluss gefällt. Es war dringlich, die Kampffront zu reorganisieren und dafür drei fundamentale Ziele zu definieren: 1. den Nachschub für die Schlacht zu sichern; 2. das deutsche «Hackmesser» niederzuringen mit der Zuführung der nötigen Artillerie und 3. einen übermässigen Verschleiss der Kampfdivisionen zu vermeiden, mithin die Schlacht auf Dauer anzulegen. Entsprechend kam es darauf an, über eine starke Artillerie mit unbegrenzten Mengen Munition zu verfügen und die Kampfdivisionen schnell abzulösen.59
Verdun war eine Schlacht der Organisation, und Pétain war, so Pedroncini, «in Verdun der Organisator des Sieges».60 Der Nachschub musste auf Camions herangeführt werden. Die Eisenbahnlinien lagen unter dem Feuer der deutschen Artillerie. Die Organisation des Verkehrs auf der 50-Kilometer-Strecke von Bar-le-Duc nach Verdun war drakonisch. Sie war ausschliesslich dem Automobil vorbehalten. Eine allfällige Nutzung wurde von den Seitenstrassen her blockiert. Im Schnitt verkehrten täglich über 3400 Camions in beiden Richtungen im Abstand von 25 Sekunden, in Spitzenzeiten mit 8000 Fahrzeugen sogar alle 5 Sekunden.61
Bei einer Panne waren sie umgehend in den Graben zu stossen, um die Strasse frei zu halten. Parkieren war ebenso streng verboten wie Überholen. Die Camions transportierten Tag für Tag 12000 Mann und 2000 Tonnen Material. 9000 Mann waren laufend mit Unterhalt und Instandsetzung der Voie Sacrée beschäftigt. Dafür hatte der beauftragte Hauptmann Doumenc am 20. Februar im Gymnasium von Bar-le-Duc eine «Commission régulatrice automobile» eingerichtet. Sie unterteilte die Voie Sacrée in insgesamt sechs Abschnitte. Für jeden Abschnitt setzte die Commission einen Beauftragten mit den nötigen Verbindungsmitteln, der Überwachung und Pannenhilfe ein. Auf der Route wurden von März bis Juni 1916 monatlich 400000 Mann und 500000 Tonnen Material befördert. Dazu kamen noch die 200000 Verletzten in den Fahrzeugen des Sanitätsdienstes. Während des ganzen Kriegs, so André Doumenc, ein direkter Nachfahre des organisatorisch begabten Hauptmanns Doumenc, wurde keine einzige Strasse so stark und so lange belastet wie die für die Versorgung von Verdun.62 Die Times nahm das Thema des Motortransports auf: «Der Krieg hat den Motortransport zu einer Wissenschaft gemacht und nirgends manifestiert sich die französische Effizienz besser», so Lord Northcliffe, der Herausgeber, am 6. März 1916.63
Die Camions waren Fünftonner (bei Kriegsende Siebentonner) und rollten auf Vollgummipneus. Sie fuhren mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 Stundenkilometer.64 Das reichte gerade, um einmal pro Tag die Strecke hin und wieder zurück zu machen. Die Menge der Camions bedingte grosse Werkstätten und dahinter Reparaturzentren für die grossen Reparaturen und Instandsetzungen. Davon gab es bei Kriegsende insgesamt 1918.
Der massive Camioneinsatz ist besonders eindrücklich angesichts der insgesamt 170 Automobile, über die die Armee bei Kriegsbeginn verfügte.65 1915 beschaffte das Kriegsministerium 2000 Camions aus den USA, der Rest kam aus der heimischen Produktion. Peugeot produzierte 6000 Camions, aber auch 2000 Panzermotoren und insgesamt sechs Millionen Granaten, und Berliet den mit Verdun berühmt gewordenen CBA.66
Dieses ausgeklügelte Transportsystem auf der kurvenreichen Route ermöglichte Philippe Pétain, die Divisionen laufend auszuwechseln, bevor sie sich verschlissen hatten. Einige wurden sogar mehrfach eingesetzt. In den letzten Monaten der Schlacht kämpften 66 französische Divisionen auf einem schmalen Abschnitt von kaum mehr als 10 Kilometern gegen 45 deutsche. Anders als die französischen Einheiten wurden die deutschen bis zur weitgehenden Vernichtung in der Stellung belassen.
Erdrückend blieb bis zum Schluss die deutsche Überlegenheit bei der schweren Artillerie. (21 Millionen Schuss aus Geschützen über 120 Millimeter, gegen 10 Millionen Schuss aus Geschützen über 75 Millimeter).67 Mit der alliierten Offensive an der Somme Anfang Juli 1916 endeten die letzten deutschen Angriffe. Philippe Pétain hatte bereits im April das Kommando über die übergeordnete Armeegruppe übernommen. Für ihn rückte Robert Nivelle nach.
Verdun wurde gehalten. Die französische Armee hatte sich nicht verschlissen. Joffre konnte sogar seine Entlastungsoffensive an der Somme starten. Erich von Falkenhayn war vom Frieden weiter entfernt als je zuvor. Ende August 1916 wurde er abgelöst. Für ihn rückte das vergötterte Duo Hindenburg/Ludendorff nach.
3Die alternden Egoisten, die Tausende opferten
«Wir sind weder regiert, noch kommandiert», notierte Abel Ferry aus der Sicht des Parlamentariers und Frontoffiziers.1 Diese mangelnde politische Aufsicht war im Kaiserreich besonders stark ausgeprägt. Sicher auch institutionell vorgezeichnet, wie Wolfgang Mommsen schreibt: «Nach Verfassung des Deutschen Reiches war der Kaiser Oberster Kriegsherr […]. Aber Wilhelm II. war dieser Aufgabe von Anbeginn nicht gewachsen; er übertrug den Oberbefehl dem Generalstabschef […]. Der politischen Leitung stand, gemäss Usancen und Gegebenheiten, kein Recht zu unmittelbarer Einmischung in Fragen der militärischen Operationen zu.»2
Unter dem Nimbus der Siegesgewissheit nutzten in der Praxis Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff den Spielraum, um politischen Einfluss zu nehmen. Etwa bei den Verhandlungen in Brest-Litowsk, bei der Besetzung weiter Teile Russlands oder bei der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand.
Erst mit den Niederlagen schwand die Aureole. Der SPD-Parlamentarier Albert Südekum zerpflückte Ludendorff und seine «Nebenregierung» mit ihrem gut organisierten Zensur- und Propagandaapparat.3 Vorsichtig und umsichtig wie Politiker sind, verwies Südekum – selbst im September 1918 – zunächst auf den verheerenden Einfluss der Zensur, bevor er sich der Parallelregierung der OHL zuwandte.4
Albert Südekum gehörte zu der Gruppe von Parlamentariern, die nicht darauf warteten, dass ihnen Macht zufiel. Ihre Parteien bildeten den Interfraktionellen Ausschuss. Sie holten sie sich sukzessive – erkennbar seit der Friedensresolution des Reichstags 1917 – und liessen sich dabei auch nicht ablenken von Ludendorffs Propagandamaschine in eigener Sache oder von der unter den kaiserlichen Beamten üblich gewordenen – und diffamierend gemeinten – Bezeichnung «Arbeiter- und Soldatenrat» für den Interfraktionellen Ausschuss.5
Ludendorff war ähnlich wie Josef Joffre sakrosankt (wenn auch nicht ganz so allmächtig). Beide lebten von ihrer Aura als Siegesgarant. Aber wie der liberale Deputierte Naumann mit seiner in der Kommissionssitzung aufgeworfenen «Frage Ludendorff» zeigte, kannte die Verehrung ihre Grenzen.6 Zunehmend insbesondere in der Vorphase zum Waffenstillstand.
Ludendorff hatte sich mit seiner «Nebenregierung» im Reichstag nicht nur Freunde gemacht. Der Generalquartiermeister zögerte nicht einmal vor einer Kriegsbedrohung der Niederlande.7
Ludendorff wiederum beklagte sich, nicht über einen Georges Clemenceau oder einen David Lloyd George zu verfügen, um das Parlament besser zu dominieren. Der General bemängelte in seinen Memoiren insbesondere einen Verständnis- und Energiemangel der zuständigen Minister und bewies wenig Verständnis dafür, über keinerlei konstitutionelle Macht zu verfügen.8
Joffres «Diktatur» lebte vom Kriegsminister Alexandre Millerand. Der Kriegsminister deckte seinen Sieger an der Marne.9 Dass Joffre neue Macht usurpierte, provozierte nur den Spott eines erfahrenen Parlamentariers wie Abel Ferry: «Meine Definition für die Aufgaben des Generalissimus, so wie Joffe sie versteht: ‹Ein Minister für das Armeezone genannte Territorium›».10
Nicht einmal der Staatspräsident, Henri Poincaré, war vor der «Diktatur» Joffres sicher: «Der allmächtige und zu mächtige Generalissimus, wie jeder erkennt […] ausser Millerand […]. Heute gab Poincaré nicht unbekümmert merkwürdiges Beispiel: im August und September 1914 gab das GQG eine Zusammenstellung der deutschen Armeen, aber es weigerte sich, die Namen der französischen Armeekommandanten zur Kenntnis zu geben», notierte Abel Ferry in seinen Carnets secrets.11 «Poincaré wurde noch etwas deutlicher: ‹Um Joffre hat sich ein ganzes Ministerium gebildet. Eine verborgene Diplomatie. Tardieu spielt den Aussenminister. Der Generalissimus korrespondiert direkt mit dem Grossherzog Nikolaus und mit Lord Kitchener. Man muss wissen, ob wir zwei Regierungen haben. Das wird alles böse enden.› – Die Frage Joffre, der Mittelmässige, der Menschenschlächter und Pfleger der Presse, die Frage Joffre reift.»12
Am 1. Mai 1915 schob Poincaré im Ministerrat nach: «[…] seiner Meinung nach sollten die Beziehungen des Oberkommandos (GQG) mit der Regierung einmal grundlegend diskutiert werden im Ministerrat». Premierminister Viviani beschwerte sich in selbiger Sitzung in heftigen Tönen, nur bruchstückweise und höchst informell informiert zu werden. «Dass das GQG seinen Standort Chantilly aufgebe, habe er vom Blumenhändler in seinem Quartier erfahren, das ist nicht angenehm für einen Premierminister», so Viviani.
Die 45000 Mann Verluste in der Woëvre gaben im Ministerrat ebenso zu denken wie der Oberkommandierende: «Beim Hinausgehen spart Viviani nicht mit bitteren Klagen über Joffre: ‹ein Mittelmässiger›.»13
Die feldgedienten Offiziere im Parlament waren eine französische Spezialität. Aus dem Reichstag ist nur der liberale Deputierte Ludwig Haas überliefert. Er tat in der Verwaltung Dienst.14
Abel Ferry und seine Offizierskollegen im Parlament artikulierten ihre Beobachtungen mit Vehemenz. Insbesondere ihre Kritik an der Generalität. So notierte etwa Abel Ferry am 23. April 1915 nach seiner Rückkehr vom Fronteinsatz «[…] die bekümmernswerte Leichtfertigkeit, mit der die Generale, diese alternden Egoisten, Tausende von Menschenleben opfern».15
Wie Abel Ferry weiter ausführte: «Der französische Soldat opfert sich für Frankreich. Aber der General zwischen Frankreich und ihm veranstaltet einen Holokaust, nur damit Tardieu über ihn schreibt.»16 Tardieu war – unter anderem – Mitarbeiter der bürgerlichen Blätter Le Temps und Figaro.
Über seine parlamentarischen Mitstreiter in Uniform schrieb Ferry: «Abrami in seiner Sensibilität, Kerguezec in seinem Eifer, Lebrun in seiner Rechtschaffenheit und Jouvenel, Chefredaktor des Matin, alle in Verdun, denken genauso […]. Wir bestürmen die Regierung.»17 Dazu kamen noch eine Reihe zwischenzeitlich verletzter oder gefallener Parlamentarier wie Hauptmann Jacques Dumesnil, Oberstleutnant Josse, Hauptmann Ybarnégaray.18 Und natürlich der 1918 gefallene Abel Ferry. Ferry war ein interessanter Fall. Clemenceaus Kabinettschef, der General Mordacq,19 widmete ihm einen ausführlichen Nachruf («würdiger Nachfolger eines grossen Staatsmannes»).
Abel Ferry wurde nach dem Regierungswechsel (Sturz der Regierung Viviani) Abgeordneter und Mitglied der Commission de l’Armée. Er nutzte am 15. Dezember 1915 das Forum, um das Haut Commandement zu attackieren und erlebte die Rede von Driant. Der Schwiegersohn des Generals Boulanger politisierte als Deputierter «nationalistisch», war Oberstleutnant und Kommandant des 56. und des 59. Jägerbataillons. Driant, der am 22. Februar 1916 in Verdun fiel, wies in seiner Rede darauf hin, dass die Verteidigungslinien nicht solide seien.20
In toto rieben sich die feldgedienten Parlamentarier an den vermeidbaren Verlusten, der einfallslosen Führung und nicht zuletzt der Einmischung des Haut Commandement (Oberkommandos) in die Regierungsgeschäfte. Wie Ferry festhielt: «Eine Regierung ohne Führung, Dualität von Regierung und Oberkommando in Frankreich, fehlende Koordinierung unter den Verbündeten, das ist es, mit dem wir kämpfen.»21