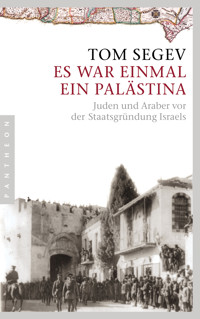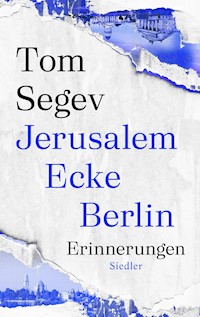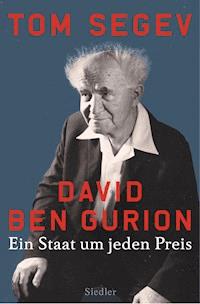19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unverzichtbar für das Verständnis des aktuellen Konflikts: Wie der Sechstagekrieg die Welt verändert hat
Tom Segev schildert Ursachen, Verlauf und Auswirkungen des Sechstagekriegs, den Israel im Juni 1967 mit seinen arabischen Nachbarstaaten führte. Er zeichnet die Entscheidungsprozesse innerhalb der israelischen Regierung nach und legt das Geflecht der verschiedenen Interessen offen, die diesen Krieg zu einer folgenschweren weltpolitischen Auseinandersetzung werden ließen.
Am frühen Morgen des 5. Juni 1967 stiegen die Flugzeuge der israelischen Luftwaffe in den Himmel. Bereits wenige Tage später hatte Israel seine arabischen Kriegsgegner besiegt und kontrollierte nun ein Territorium, das um ein Vielfaches größer war als das eigentliche Staatsgebiet. Mit dieser spektakulären militärischen Operation begann der dritte militärische Nahostkonflikt, der als »Sechstagekrieg« in die Geschichtsbücher eingehen sollte.
Bis heute sind die Auswirkungen dieses arabisch-israelischen Kriegs für Israel und die gesamte Region spürbar, nicht zuletzt deshalb, weil die wichtigsten damaligen Protagonisten wie PLO-Chef Jassir Arafat, Itzhak Rabin als Stabschef oder Ariel Sharon als Kommandeur einer Panzerdivision noch Jahrzehnte später das Gesicht des Nahen Ostens prägten.
Anhand zahlreicher bisher unbekannter Quellen schreibt Tom Segev die erste umfassende Geschichte dieses folgenschweren Kriegs, seiner politischen und gesellschaftlichen Hintergründe und Nachwirkungen. Mit großem Scharfsinn und erzählerischer Brillanz entlarvt Segev dabei den Mythos von der Unvermeidbarkeit des Blutvergießens im Sommer 1967.
Der Nahost-Konflikt ist ohne die Ereignisse des Jahres 1967 nicht zu verstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1497
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
TOM SEGEV
1967
ISRAELS ZWEITE GEBURT
Aus dem Englischen vonHelmut Dierlamm, Hans Freundl und Enrico Heinemann
Pantheon
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die englische Ausgabe erschien 2007 unter dem Titel»1967: Israel, the War, and the Year that Transformed the Middle East«bei Metropolitan Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen derPenguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Pantheon Ausgabe April 2009
Copyright © 2005 by Tom Segev
Copyright © der deutschspachigen Ausgabe 2007by Siedler Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Karte: Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-641-23517-8V001
www.pantheon-verlag.de
Für Itai
Inhalt
EINLEITUNGHelden
Yechiam
Abie
TEIL I
Zwischen Rischon le-Zion und Manhattan
KAPITEL 1Sussita-Tage
Die Israelis: »Wir kommen ganz gut zurecht«
Die Frauen: »Soll der Junge seine Knöpfe selbst annähen?«
Das Fernsehen: »Es hat etwas Symbolisches«
Die Eltern: »Hoffentlich gibt es keine Dürre«
Die Rezession: »Es weht ein widriger Wind«
KAPITEL 2Andere Leute
Die Misrachim (I): »Es ist besser, Aschkenasi zu sein«
Die Misrachim (II): »In Europa isst man nicht auf der Straße«
Die israelischen Araber: »Ich heiße Ahmed«
Die Kibbuzim: »Es ist alles nur eine Pappkulisse«
Die Politik: »Der größte Lügner in unserem Land«
Die Juden (I): »Lasst uns in diesem Land sterben«
Die Juden (II): »Gut, so einen Hahn zu haben«
Die Emigranten: »Eine Schande für das Land«
Die Jugend: »Überall herrscht bittere Verzweiflung«
TEIL II
Zwischen Israel und Palästina
KAPITEL 3Landkarten und Träume
Fatah: »Es gibt auch palästinensischen Zionismus«
Das Dorf Samua: »Wahnsinn«
Kontraste: »Die zwei Völker Israels«
Jerusalem: »In die Stadt«
Nostalgie: »Achse und Band«
Reflexionen: »Wir haben nichts anzubieten«
KAPITEL 4Das Syrien-Syndrom
Konfrontationen (I): »Ist Dischon den Tod wert?«
Konfrontationen (II): »Wir können doch nicht sieben Millionen Syrer umbringen!«
Feierlichkeiten: »Wer weiß, wie viele?«
TEIL III
Die vierzig Tage des Gefreiten Jehoschua Bar-Dayan
KAPITEL 5Drei Wochen bis zum Krieg: Was will Nasser?
Überraschung: »Wenn man Rauch steigen lässt …«
Spannung: »Jizchak war deprimiert«
Die Nerven: »Wie können Sie es wagen?!«
KAPITEL 6Elf Tage bis zum Krieg: Noahs Vater wartet
Tastende Schritte: »Sie sind der Einzige«
Diplomatie: »Alles wegen eines Alibis«
KAPITEL 7Zehn Tage bis zum Krieg: Was will Amerika?
Druck: »Mich macht keiner zum Schuhabstreifer«
Befürchtungen: »Moshe Dayan, Moshe Dayan«
KAPITEL 8Neun Tage bis zum Krieg: eine schreckliche Lage
Angst: »Achten Sie auf Ihr Äußeres«
Holocaust: »Nasser ist Hitler«
KAPITEL 9Eine Woche bis zum Krieg: der Aufstand der Generäle
Ein Stammeln: »Der Krieg führt zu nichts«
Drohungen: »Ihr Zaudern wird uns Tausende von Menschenleben kosten«
Neue Entwicklungen: »Jetzt ist auch Hussein unser Feind«
Gemeinsames Schicksal: »Ich bin Jüdin«
KAPITEL 10Fünf Tage bis zum Krieg: aus dem Amt gedrängt
Intrigen: »Gift«
Aufruhr: »Das wird die Hölle«
Eschkol gibt nach: »Geschichte, was immer du tun magst – tue es schnell«
KAPITEL 11Drei Tage bis zum Krieg: die Entscheidung
Vorschlag: »Streng geheim«
Grünes Licht: »Mir fiel ein Stein vom Herzen«
KAPITEL 12Tag eins
Der Nebel des Krieges: »Bums – Rums – Wums«
Sieg: »Überraschend und großartig«
KAPITEL 13Tag zwei
Aufregung: »Mein Gott! Das Land ist plötzlich so groß!«
Riskantes Spiel: »Ich gebe zu, ich war ein Feigling«
KAPITEL 14Tag drei
Tränen: »Ich berühre die Kotel!«
Gefangene: »Sie liegen da, hingemetzelt«
Legenden: »Die Menschen sind freudetrunken«
KAPITEL 15Die letzten Tage
Albträume (I): »Der Auftrag: Damaskus!«
Albträume (II): »Die Zeiger auf meiner Uhr blieben stehen«
Vertreibung: »Die Tränen der Unschuldigen«
Die Abschlussparade: »Dies sind meine Söhne«
TEIL IV
Sie dachten, sie hätten gewonnen
KAPITEL 16Ein neues Land
Trauer: »Warum hast du einen Piloten geheiratet?«
Ausflüge: »Das ist meine Freude im Leben«
Teilungen: »Baladna – Baladkom«
KAPITEL 17Siegesalben
Bilder: »Der Krieg fördert das Beste in den Menschen zutage«
Soldatengespräche: »Ein heiliges Buch«
Täuschungen: »Einmal in tausend Jahren«
KAPITEL 18Die aufgeklärte Besatzung
Richtlinien: »Die Männlichkeit der Araber«
Initiativen: »Wir schätzten uns glücklich«
Kontrolle: »Zuckerbrot und Peitsche«
Bildung: »Eine grundsätzliche Frage«
KAPITEL 19Teddys Projekt
Annexion: »Das wird uns später noch verfolgen«
Enteignungen: »In altem Glanz wiederherstellen«
Rückkehr: »Ein seltenes Licht und viele Farben«
KAPITEL 20Von Angesicht zu Angesicht mit Ismael
Bedingungen: »Sind wir dafür in den Krieg gezogen?«
Der König: »Ein Frieden in Würde«
Kollaboration: »Ein Arschkriecher«
Gespräche: »Entschuldigung, dass wir gewonnen haben«
KAPITEL 21Der große Pfusch
Pläne: »Hunderttausend Leute werden den Irak schon nicht auf den Kopf stellen«
Möglichkeiten: »Ich weiß nicht, was ich will«
Versuche: »Wie viele Araber haben Sie bis jetzt vertrieben?«
KAPITEL 22Falken und Tauben
Worte (I): »Eine Sünde und ein Verbrechen«
Worte (II): »Kein Frieden um jeden Preis«
KAPITEL 23Neubeginn
Die Israelis: »Was für ein wunderbares Land«
Veränderungen: »Die Leute reagierten so stark«
Identität: »Etwas, das dieses Volk braucht«
KAPITEL 24Avschalom-Tage
Aussichten: »Gewusst, wie man antwortet«
Freundschaft: »Das hat doch überhaupt keinen Sinn, verdammt nochmal!«
Siedlungen: »Genau wie in der Ukraine!«
Meilensteine: »Es ist schön, an der Macht zu sein«
Danksagung
Anmerkungen
Literaturauswahl
Personenregister
Abbildungen
EINLEITUNG
Helden
Yechiam
Am Abend des 5. Juni 1966 entzündete Josef Weitz zwei Gedenkkerzen für seinen Sohn Yechiam, dessen Tod sich an diesem Tag zum zwanzigsten Mal jährte. Der damals 76-jährige Weitz war der Oberförster des Jüdischen Nationalfonds (JNF), einer Organisation der zionistischen Bewegung, die sich um den Erwerb und die Kultivierung von öffentlichem Land kümmerte. Er lebte jetzt seit fast sechzig Jahren im Land Israel; in dieser Zeit hatte der JNF Millionen von Bäumen angepflanzt. Weitz war im Alter von achtzehn Jahren aus Russland eingereist. Zunächst als Landarbeiter in Palästina tätig, stieg er im Laufe der Jahre zum Leiter der »Abteilung für Land und Wälder« des JNF auf. Er war außerdem an der Planung neuer Gemeinden beteiligt und galt als Gründungsvater des israelischen Staates; als alter Mann schrieb er Kindergeschichten. Weitz saß vor den Gedenkkerzen und blätterte in den alten Briefen, die sein Sohn geschrieben hatte. Sein Yechiam, schrieb er in das Tagebuch, blicke mit einem traurigen Lächeln von einem Foto an der Wand auf ihn herab.
Yechiam war in einer hektischen Zeit aus Krieg und Hoffnung zu seinem Namen gekommen. Er wurde im Oktober 1918 in einer der ersten zionistischen landwirtschaftlichen Siedlungen geboren, in Yavnel in Untergaliläa. Die britische Armee unter General Edmund Allenby hatte die Besetzung des unter türkischer Herrschaft stehenden Palästina fast abgeschlossen; am Abend von Yechiams Geburt erreichten Allenbys berittene Soldaten das Gebiet um Yavnel. Acht Tage später, als Yechiam beschnitten wurde und seinen Namen erhielt, hörte Josef Weitz zum ersten Mal von der Erklärung des britischen Außenministers Lord Arthur James Balfour, in der er sich positiv zu dem Bestreben der zionistischen Bewegung äußerte, eine »nationale Heimstätte«, einen jüdischen Staat in Palästina, zu errichten. Die Balfour-Erklärung war gut zehn Monate vorher abgegeben worden, doch Untergaliläa wurde damals noch von den Türken regiert und hatte keinen Kontakt zu den britisch besetzten Gebieten.
Weitz und seine Nachbarn waren über diese Nachricht ganz aus dem Häuschen. Als sie zur briss (Beschneidungsfeier) zusammenkamen, bewegte die »Vision der bevorstehenden Erlösung« ihre Herzen. »Ihre strahlenden Augen und die freudigen Ausrufe brachten einen Segen zum Ausdruck – dass das jüdische Volk im eigenen Land leben soll«, schrieb Weitz. Als der mohel nach dem Namen des Neugeborenen fragte, rief ein Gast aus: »Yechiam! Yechiam!« – was so viel bedeutet wie: »Lang lebe die Nation«. Und so kam der Junge zu seinem Namen. Es war »ein Zeichen für den Bund, den die englische mit der hebräischen Nation eingegangen war, damit diese in ihrem eigenen Land wiederauferstehen würde«, so Weitz. Er hätte sich keinen patriotischeren Namen ausdenken können; vor seinem Sohn hatte niemand ihn getragen.
Yechiam wuchs in Jerusalem auf. Sein Vater gehörte zu den Gründern von Beit Hakerem, einer komfortablen, abgelegenen Wohngegend im Westteil der Stadt: Steinhäuser mit roten Ziegeldächern, umgeben von dem Grün der Pinien und Zypressen. In den Gärten blühten Narzissen und Alpenveilchen, und Josef Weitz hatte einen Kirschbaum. Die Bewohner des Viertels erzogen ihre Kinder zu loyalen Zionisten und Führungspersönlichkeiten mit Pioniergeist; gebildet im Sinne der europäischen Kultur, sollten sie so auf das Leben in der sehnsüchtig erwarteten »nationalen Heimstätte« vorbereitet werden.
Wie die meisten Kinder der Jerusalemer Gründungselite besuchte Yechiam das Hebräische Gymnasium. Er war ein guter Schüler, der sich einmal beklagte, dass seine Lehrer die Schüler nicht ausreichend für den Dienst am Vaterland anleiteten. Er wuchs zu einem stattlichen, charismatischen jungen Mann heran und schloss sich der sozialistischen Jugendbewegung ha-Schomer ha-Za’ir an, wo er für die Arbeit im Kibbuz ausgebildet wurde, was damals bei vielen Jugendlichen üblich war. Als 1936 der arabische Aufstand gegen die Briten und die Zionisten ausbrach, »trat Yechiam in die Armee ein«, wie sein Vater schrieb. Gemeint war damit die Haganah, die größte Selbstschutzorganisation der jüdischen Gemeinschaft in Palästina. »Er gewinnt anscheinend an Ernsthaftigkeit«, schrieb sein Vater, »hat er sich selbst gefunden?« Offenbar nicht, denn Yechiam verließ bald darauf das Militär, um in London Chemie und Botanik zu studieren. »Ich bin ganz verliebt in London«, schrieb er seinen Eltern. Aber als der Zweite Weltkrieg ausbrach, kam er nach Hause und meldete sich wieder freiwillig, dieses Mal bei der Palmach, dem »stehenden Heer« der Haganah.
Nach dem Krieg wurde Yechiam für antibritische Operationen ausgebildet. Die Einwanderungspolitik der Briten, die darauf zielte, das Wohlwollen der Araber zu finden, hielt Opfer der NS-Verfolgung davon ab, sich in Palästina niederzulassen. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1946 holten Palmach-Einheiten zum Schlag gegen die britische Herrschaft aus: Sie überfielen elf Brücken und zerstörten zehn davon. Yechiam wurde in dieser »Nacht der Brücken« getötet. Er fiel im Norden in der Nähe von Achziv. Nur wenige Stunden, nachdem sein Vater in der Zeitung von der Militäroperation gelesen hatte, wurde er nach Haifa ins Krankenhaus gerufen. Er bat darum, den Leichnam seines Sohnes sehen zu dürfen. »Ich zog den Rand des Tuches zurück und sah seine Locken und seine Stirn. Das dichte Haar war wild und lebendig, und seine Stirn war glatt und gedankenvoll. Hier lag Yechiam, für immer zum Schweigen gebracht.«1
Yechiam wurde so beigesetzt, wie er gelebt hatte: als der Sohn eines Vaters, der in einer sehr kleinen Gesellschaft eine bekannte Gestalt war. Jeder kannte jeden, und viele waren miteinander verwandt. »Das jüdische Jerusalem geleitete gestern zu Tausenden Yechiam, den Sohn von Josef Weitz, zu seiner letzten Ruhestätte«, berichtete die Tageszeitung Davar. Die Landesflagge wurde über den Leichnam drapiert. Dreizehn weitere Männer waren in jener Nacht gefallen, aber ihre Körper waren in tausend Stücke gesprengt worden. Yechiams Begräbnis stand daher auch für ihres. Die Allgemeinheit wurde zur Teilnahme aufgefordert. In Haifa, dem Ausgangspunkt des Leichenzuges, wurde die Produktion gestoppt, der Verkehr stand still, Schulen wurden geschlossen, und in Jerusalem kam der Zug nur noch mühsam durch die Menschenmenge voran. Yechiam wurde auf dem Ölberg beigesetzt.
Weitz hielt seinen Schmerz im Tagebuch fest: »Der geliebte Sohn ist gegangen! Man kann es nicht akzeptieren – ist er wirklich von uns gegangen? Denn er lebt in jedem Winkel des Hauses weiter; er ragt neben jedem Baum und jeder Blume auf, er spiegelt sich in jedem Buch, in jeder Zeile, auch in diesem Moment … Ich höre seine Stimme, höre sein letztes Schalom, eilig hervorgestoßen, als er aus dem Haus ging. Und er drängt in jeden Gedanken und unterbricht ihn. Es fällt mir schwer zu schreiben, ich muss ihn beklagen und Rema auch.« Rema Samsonov war Yechiams Frau. Sie stammte aus einer Familie, die seit Generationen in Chadera lebte, und wurde später eine berühmte Sopranistin. »Zwei junge Menschen, groß und aufrecht, schön, zärtlich. Ich hatte mir Großes für sie erhofft.«
Weitz gab sich selbst die Schuld. »Warum habe ich ihn nicht begleitet? … Wenn ich ihn begleitet hätte, wäre ihm vielleicht nichts zugestoßen?« Er war von einem »brennenden Verlangen« erfüllt, genau zu wissen, wie Yechiam gefallen war, wie und wo man ihn getroffen hatte, wie er die letzten Momente verbracht, was er zuletzt gesagt hatte. Freunde teilten ihm die letzten Worte seines Sohnes mit, und ja, hier fand sich heldenhafte Opferbereitschaft für die Heimat: »Ich bin verloren … Führt die Operation fort«, oder »Ich bin erledigt – ihr macht weiter«, und auch: »Kümmert euch um Rema.« Der Vater schien verletzt: »Kein Wort des Abschieds für seine trauernden Eltern?« Aber vielleicht hatte Yechiam dazu nicht mehr die Kraft gehabt.
Weitz schilderte, wie er mit seinem Schmerz umging: »Meine Seele ist entzweigerissen, in die gemeinschaftliche und die individuelle.« Er fand Trost in der massenhaften Anteilnahme an seiner Trauer; der öffentliche Aspekt schien ihn, zumindest anfangs, von seinem eigentlichen, privaten Schmerz abzuschirmen. Außerdem hielt er es für seine Aufgabe, die öffentliche Rolle eines hinterbliebenen Vaters zu erfüllen. »Die ganze Nation marschierte in Haifa und in Jerusalem mit uns«, notierte er in seinem Tagebuch, »und Menschen aus allen Kreisen strömten in Scharen zu Beileidsbesuchen in mein Haus. Sie sagen, er sei das Opfer für die Nation.«
Yechiams Tod bekam tatsächlich eine nationale und historische Dimension. »Wir plädieren nicht für einen Opferkult«, hieß es in einer Tageszeitung, »aber jedes Opfer wie Yechiam Weitz ist uns sieben Mal so viel wert. Nicht nur wegen der Art, wie er gelebt hat, sondern wegen der Art, wie er ums Leben kam.« Auch der ranghöchste Zionist im damaligen Palästina kondolierte: Mosche Schertok, der später als Mosche Scharett Israels erster Außenminister und zweiter Ministerpräsident werden sollte. Yechiam, so Schertok an Weitz, sei dem rechten Weg gefolgt und habe eine »heilige Pflicht« erfüllt. Weitz griff diese Worte auf: »Ich habe das auch gesagt: Wir müssen Stärke zeigen angesichts der bösen gojim, sowohl der arabischen wie der britischen. Und Yechiam hat diesen Weg eingeschlagen. Er hat daran geglaubt. Er war ihm ganz ergeben. Er wird von allen bewundert.« Dass ausgerechnet Yechiam, der im Zeichen der Balfour-Deklaration geboren worden war und zu einer Zeit aufwuchs, als die »nationale Heimstätte« unter dem Schutz des Empire mit so großen Hoffnungen aufgebaut wurde, bei einer Operation gegen die Briten starb, war eine Ironie der Geschichte, die dem Vater durchaus bewusst war.
Während des Begräbnisses wandte sich Weitz, allerdings »im Flüsterton«, mit der schwierigsten Frage an Schertok, die ein trauernder Vater einem Politiker stellen konnte: »War die Operation notwendig? Und welchen Sinn hatte sie?« Schertok, dessen Augen laut Weitz »freundlich und zärtlich« blickten, gab ihm genau die Antwort, die Weitz gerne hören wollte: Jawohl, die Operation sei notwendig gewesen, weil sie die Juden ihrem Ziel näher gebracht habe. »Das Herz aus Stein wurde davon erweicht«, so Weitz. Jedes Jahr quälte er sich mit derselben Frage und rief sich stets in Erinnerung, dass sein Sohn nicht umsonst gestorben war. Das Land zu bebauen und die Bereitschaft, dafür zu sterben, waren in seinen Augen Werte, mit denen die Juden ihr Anrecht auf Erez Israel, das Land Israel, bestätigten. Sein toter Sohn und das Land Israel – das ganze Land – verschmolzen allmählich zu einer Einheit. »Ich wandere im Land herum, und wenn ich die Luft meines ganzen Landes, von Grenze zu Grenze, atme und die des Volkes, das darin lebt und es sich zu eigen macht, meines Volkes, dann höre ich eine tröstende Stimme, die sagt: Ja, es war notwendig, und es wird belohnt werden. Der Sohn und all die anderen Söhne sind hier, im Meer und im Land, in Berg und Tal, in Feld und Park, in Baum und Strauch. Sie sind Teil der Nation und Teil des Landes, und wenn diese beiden wachsen und eins werden, groß und stark, dann wird ihr Andenken von jeder Generation gefeiert werden. Das Andenken an all die Söhne.«
So wurde Yechiam zu einem nationalen Mythos, einem Symbol seiner Generation, dessen Bild im Boden des Landes und im jüdischen Unabhängigkeitskampf verwurzelt war. Der Schriftsteller S. Yizhar, sein Cousin, bezeichnete ihn als »einen Baum in seiner ganzen Pracht«.2 Der Mythos griff rasch um sich. Yechiam wurde als Angehöriger einer Generation beschrieben, welche die »freie Luft« des Landes atmete und lernte, das Land zu lieben, es aufzubauen und dafür zu kämpfen: »Diese Generation brachte die besten Pioniere, Eroberer und Verteidiger der Wildnis hervor; diese Generation war in Freiheit geboren und aufrecht – die Diaspora und ihre Spezifika waren ihnen fremd.« Moshe Dayan (drei Jahre älter als Yechiam), Yigal Allon (gleichaltrig) und Jizchak Rabin (vier Jahre jünger) gehörten ebenso zu dieser Generation wie viele andere Führungspersönlichkeiten der israelischen Gesellschaft, die deren Kultur prägten. Yechiam Weitz sollte für den »neuen Hebräer« stehen, den die Zionisten in Palästina schaffen wollten. Er war das Gegenteil des »alten Juden«, des Diaspora-Juden, auf den sie mit Verachtung herabblickten. Yechiam, das war »einen neuer Mensch«.*
Josef und Ruchama Weitz mit den Yechiams 1951: »Die Kinder des Traums«
Drei Monate nach der »Nacht der Brücken« fuhr Josef Weitz in das arabische Dorf a-Sib nördlich von Akko und sah sich dort aus der Ferne an, wo Yechiam getötet worden war. »Ich konnte nicht hingehen und mich in den Staub werfen und nach Tropfen seines Blutes suchen, die in die Erde eingesickert waren.« Im Osten sah er die Überreste von Qala’at Dschedin, der »Heldenfestung«; die Kreuzfahrer hatten diesen beeindruckenden Steinturm errichtet, der dem galiläischen Herrscher Daher el-Omar später zur Festung geworden war. Die Sonne ging gerade unter, der Turm »schimmerte und erleuchtete das ganze Gebiet, bis hinauf nach Haifa«. Und da erkannte Weitz, wo Yechiams Denkmal sich erheben sollte. Er schwor sich, dass hier eine neue, jüdische Pioniersiedlung entstehen würde, zwecks Verteidigung, Aufforstung und landwirtschaftlicher Erschließung. »Die Festung soll repariert werden, und sie soll unsere sein«, schrieb er, »und über ihr soll Yechiams Name flattern, ein Symbol der Unschuld, der Hingabe und des Opfers, und an ihrer Seite soll eine ewige Flamme in die Ferne leuchten.« Dieses Projekt, erzählte Weitz seiner Frau Ruchama, werde ihnen zum Trost gereichen. So wurde der Kibbuz Yechiam gegründet.
Unmittelbar vor dem fünften Todestag ihres Sohnes veröffentlichten Josef und Ruchama Weitz eine Notiz, in der sie alle Eltern, die ihre Söhne nach Yechiam benannt hatten, aufriefen, der Anpflanzung eines Gedenkhains in der Nähe von Ma’ale Hachamisha beizuwohnen (der Name dieses Kibbuzes auf dem Weg nach Jerusalem erinnerte an fünf Siedler, die von Arabern getötet worden waren). Sie bekamen Dutzende von Antwortbriefen, sogar einen aus Lincoln in Nebraska.4 Es war eine lebhafte Angelegenheit, als gut zwei Dutzend aufgeregte und ordentlich gekämmte Kleinkinder, eines im Matrosenanzug, sich um die Eltern des ersten Yechiam drängten und zum Andenken ein Foto gemacht wurde. Das waren die Kinder des zionistischen Traums. Viele waren die erste im Land geborene Generation; ihre Eltern stammten zumeist von woanders her, vor allem aus Osteuropa. Zwei Väter kamen aus der Türkei, eine Mutter aus Deutschland. Ein Anwalt war darunter und eine Hausfrau, ein Klempner und eine Sekretärin, ein Maschinenbauingenieur, ein Fahrer und ein Ladenbesitzer. Ein Vater war Regierungsbeamter, andere Eltern hatten in Galiläa einen moschav gegründet, eine Gemeinschaftssiedlung, und betrieben Landwirtschaft. Einige dienten als Offiziere in den israelischen Streitkräften (Israel Defense Forces, IDF). Die meisten identifizierten sich mit dem israelischen Establishment und lasen Davar, die Zeitung, die die Positionen der sozialdemokratischen Partei Mapai vertrat, die mit David Ben Gurion an der Spitze die Macht hatte. Die kleinen Yechiams würden schon bald Davar Le-Yeladim lesen, die wöchentliche Kinderausgabe der Zeitung. Ihre Eltern konnten mit einiger Sicherheit Glück und Wohlstand für ihre Kinder erwarten. Außerdem durften sie hoffen, dass ihre Söhne ein besseres Leben führen würden als sie selbst, in einer hebräischen, säkularen und sicheren Umgebung: Sie würden nicht mehr verfolgt werden. Die Kinder wussten, dass sie nach einem Helden benannt waren, und manche wuchsen mit dem Gefühl auf, dass der Name ihnen eine patriotische Pflicht auferlegte.5
Die Yechiams liefen noch mit Windeln herum, da wurde ihr Name bereits in eine große politische Auseinandersetzung hineingezogen. Am 29. November 1947 schlug die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Teilung Palästinas in zwei Staaten, einen jüdischen und einen arabischen, vor. Die Mehrheit der Juden in Palästina stimmte damals der Entscheidung zu, viele sogar begeistert, doch einige widersetzten sich ihr, weil sie die staatliche Kontrolle über ganz Erez Israel wünschten. Die Opposition veröffentlichte ein Manifest, in dem es hieß: »Wir werden einen Staat haben – aber Yechiam wird außen vor bleiben.« Denn nach dem Teilungsplan sollte der Kibbuz Yechiam dem arabischen Staatsgebiet zufallen. Die Zeitung Ha’aretz bemerkte, das Grab König Davids auf dem Zionsberg in Jerusalem läge ebenfalls außerhalb der Staatsgrenze, Yechiam befände sich also in würdiger Gesellschaft. Jerusalem sollte laut Teilungsplan als separate Einheit internationaler Aufsicht unterstellt werden.6
Ende 1947 kam es zum Krieg. Er mündete in die Gründung des Staates Israel, dessen Territorium Yechiam ebenso einschloss wie Westjerusalem und andere Gebiete, die laut Teilungsplan nicht dazugehören sollten. Josef Weitz war überzeugt, dass das zionistische Projekt nur dann Erfolg haben konnte, wenn die arabische Bevölkerung aus Palästina entfernt wurde. Während des Krieges und danach beteiligte er sich an der Deportation von Arabern aus den Gebieten, die die Armee besetzt hatte, hinderte Flüchtlinge an der Rückkehr und siedelte Araber zwangsweise innerhalb des Staates an einen anderen Ort um. In den fünfziger Jahren war er maßgeblich an dem Versuch beteiligt, israelische Araber zur Auswanderung zu ermutigen. Bis an sein Lebensende war er ein überzeugter Anhänger des »Transfers«.7
1949 wurden die Bedingungen des Waffenstillstands festgelegt und die Grenzen auf der Karte mit einer grünen Linie markiert. Das Westjordanland und Ostjerusalem standen jetzt unter der Herrschaft des Haschemitischen Königreichs Jordanien. Der Ölberg lag ebenfalls außerhalb des israelischen Gebiets, und Josef Weitz konnte das Grab seines Sohnes nicht mehr besuchen. Der Gaza-Streifen wurde Ägypten unterstellt.
Viele Israelis weigerten sich, den zionistischen Traum aufzugeben, und hofften auf den Tag, an dem sich der Staat Israel an beiden Ufern des Jordans erstreckte. Einige Politiker, darunter Ben-Gurion, und manche Generäle schlossen Militäraktionen zur Ausdehnung des Staatsgebiets über die Grüne Linie hinaus nicht aus. Doch die Mehrheit der Israelis hielt eine Änderung des Grenzverlaufs nicht für sehr wahrscheinlich, und Israel erklärte wiederholt, dass es Frieden auf der Grundlage der jetzigen Situation wünsche.8 Die meisten Israelis gingen allerdings auch davon aus, dass sie noch nicht den letzten Krieg erlebt hatten. Zwar erwarteten sie ein Aufflammen der Kämpfe nicht notwendigerweise in naher Zukunft, aber die meisten waren der Meinung, dass die Araber ihren Traum von der Zerstörung Israels noch nicht aufgegeben hatten und dass die Israelis ihnen nichts anzubieten hatten, um sie zur Anerkennung des Staates und zum Friedensschluss zu bewegen.9 Bis Anfang 1966 glaubten sie jedoch, dass die Zeit für Israel arbeite, und gingen davon aus, dass die Araber sich mit der Realität abfinden würden, weil Israel stärker wurde.
Wenn Israelis den Begriff »Araber« verwendeten, meinten sie damit vor allem Ägypter, Jordanier, Syrer, Libanesen und Iraker – nicht die Palästinenser. Seit sie während des israelischen Unabhängigkeitskrieges geflüchtet und deportiert worden waren, galten die Palästinenser nicht mehr als gegnerische Macht, sondern wurden nur noch als diplomatisches Ärgernis erwähnt: Flüchtlinge, deren Anliegen einmal jährlich vor den Vereinten Nationen diskutiert wurde. Terroristische Angriffe schrieb man hauptsächlich den arabischen Staaten zu, nicht einem nationalen Kampf der Palästinenser. Da der 1949 zwischen Israel und seinen Nachbarn verhandelte Waffenstillstand durch zahlreiche Terroranschläge und Grenzvorfälle verletzt wurde, fochten Israel und Ägypten im Jahr 1956 eine »zweite Runde« aus, den so genannten Sinai-Feldzug.
Die meisten Yechiams waren zu jung, um sich an den Unabhängigkeitskrieg zu erinnern. Während des Sinai-Feldzuges besuchten sie die Grundschule. In die Armee traten sie erst ab 1964 ein. Den Wehrdienst nahmen sie als etwas Selbstverständliches hin, als Teil einer Routine, zu der sich die meisten Israelis verpflichtet fühlten und an der sie kaum etwas ändern zu können glaubten. »Ich stand kurz vor Abschluss der elften Klasse, und das Einzige, was mich damals interessierte, war die Frage, wo ich in der Armee dienen würde«, erinnerte sich ein Yechiam.10 Ihr Krieg kam 1967.
Abie
Mitte der sechziger Jahre stellte sich der Staat Israel als eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten des zwanzigsten Jahrhunderts heraus, und die meisten Israelis hatten gute Gründe, stolz auf ihr Land zu sein und an seine Zukunft zu glauben. Viele saugten eifrig den fortschrittlichen Geist der sechziger Jahre auf, der vor allem in Tel Aviv zu spüren war. Die meisten Autos auf der Dizengoff-Straße im Herzen Tel Avivs waren europäische und amerikanische Modelle, aber jeder vierte Neuwagen wurde in Israel zusammengebaut.11 Die Modelle trugen hebräische Namen – Carmel, Gilboa, Sussita –, und es gab sogar den Sabra, einen auffälligen Sportwagen. In Israel montiert wurde auch die Contessa, ein Familienauto, das von dem japanischen Unternehmen Hino gefertigt wurde. Sein Design erinnerte an amerikanische Wagen, doch der Motor war hinten. »Warum haben Sie noch keine Contessa?«, hieß es in der Werbung, als sei der Besitz gleichsam eine gesellschaftliche Pflicht.12
Der Botschafter der Vereinigten Staaten nannte die einheimische Autoindustrie »eines der Wunder Israels«. Doch ob nun harmloser Wunschtraum oder größenwahnsinniges Abenteuer – dem Industriezweig war keine Zukunft beschieden. Solange er sich hielt, war er jedoch ein weiterer Ausdruck des israelischen Traums, der in Tel Aviv, der »ersten hebräischen Stadt«, erbaut um einen Platz mit einem Springbrunnen, Holzbänken und Palmen, seinen Anfang genommen hatte.13
Die dortige Dizengoff war mehr als eine Straße: Sie war ein kulturelles und gesellschaftliches Ideal, das die hebräische Sprache sogar um ein Verb bereicherte, das von der beliebten Wochenzeitung ha-Olam ha-seh geprägt wurde: Wenn es hieß, man gehe »dizengoffen«, dann meinte man damit, auszugehen und in einem innovativen, weltlichen, städtischen Milieu zu flanieren, um zu sehen und gesehen zu werden, während man sich nach London und New York sehnte. Käufer von Luxusartikeln fanden hier teure Boutiquen und Schuhläden, welche die neueste Mode aus Mailand und Paris ausstellten. Auf den Bürgersteigen wimmelte es nur so vor Cafétischen, an denen Schriftsteller und Dichter, Journalisten, Schauspieler und andere Doyens der einheimischen Kultur ihren Geschäften nachgingen. Sie brauchten nicht weit zu laufen: Das kulturelle Treiben Israels spielt sich hier im Herzen Tel Avivs ab. Theater und Konzertsäle, Museen und Zeitungen – sie alle waren hier. Hier wurden die neuesten Filme gezeigt und subversive Ideen in Umlauf gesetzt.
Nicht nur eine Straße: die Dizengoff
Tel Aviv strahlte eine mediterrane Ruhe aus, dabei kamen viele Cafégäste, die in den zwanziger Jahren in die Stadt gezogen waren, aus Osteuropa und unterhielten sich immer noch auf Russisch, Polnisch und Jiddisch. In den dreißiger Jahren waren Flüchtlinge aus Mitteleuropa eingetroffen, die häufig immer noch Deutsch sprachen. Gegen Abend wechselte das Publikum, und die Cafés füllten sich mit jüngeren Menschen, die zumeist in Israel geboren waren. Im Café Ravel konnte man junge Frauen und gvarvarim betrachten – eine weitere Wortschöpfung von ha-Olam ha-seh, die sich auf junge Männer bezog, die herumprahlten, als wären sie doppelt so alt. Sie fuhren Vespas und Lambrettas made in Italy. Der Schauspieler und Regisseur Uri Sohar siedelte einige Szenen seines satirischen Films »A Hole in the Moon« im Café Ravel an, ein Film, der sich als einer der ersten über die zionistische Moralvorstellung lustig machte. Im Kultcafé Kassit wurde derweil über umstürzlerische Ideen diskutiert. Hier unterschrieben der Journalist Amos Kenan und der Bildhauer Yigal Tumarkin einen Brief an Ministerpräsident Eschkol, in dem sie ihm mitteilten, dass sie beschlossen hatten, gegen das Gesetz zu verstoßen und jene nicht öffentlichen Gebiete zu betreten, die unter Militärherrschaft standen. Sie wollten sich so mit dem Kampf der israelischen Araber identifizieren, die seit 1948 den verschiedensten Einschränkungen unterlagen.14 Hier ging es um Bürgerrechte, ganz ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, wo damals gegen die Rassendiskriminierung gekämpft wurde. Unweit des Kassit lag ein Speiselokal, dessen Besitzer alle nur Abie nannten. Das bei Politikern und Generälen sehr beliebte Restaurant hieß »California« und bot die ersten israelischen Hamburger an.
Abie Nathan war allseits beliebt, und zwar zu Recht, denn er strebte danach, Gutes zu tun. Die meisten Menschen nahmen ihn indes nicht ernst – ebenfalls mit gutem Grund. Sie mochten ihn, weil er naiv war und anscheinend nicht erwachsen werden wollte. Der ursprünglich aus dem Iran stammende Abie war der Sohn eines wohlhabenden Textilkaufmanns, der die jüdischen Bräuche beachtete und zu Hause Englisch sprach. Im Alter von sechs Jahren wurde Abie an eine katholische Schule in Bombay geschickt, der Rest der Familie zog später nach. Er wurde zum kompromisslosen Zionisten erzogen. So brachte man ihm beispielsweise ein hebräisches Lied von Ze’ev (Wladimir) Jabotinsky bei, der eine rechtsgerichtete revisionistische Bewegung anführte, die der Überzeugung anhing, das den Juden in der Bibel verheißene Land Israel erstrecke sich bis zum Euphrat. »Zwei Ufer hat der Jordan«, heißt es in dem Lied, »eines ist unser und das andere auch.« Niemand machte sich die Mühe, dem kleinen Abie den Sinn dieser Worte zu erklären.15
Nach dem Schulabschluss konnte Abie sich nicht entscheiden, ob er Anwalt oder Schauspieler werden sollte. Am Ende beschloss er, Pilot zu werden, und trat in die indische Luftwaffe ein. Nach dem Umzug nach Israel wurde er 1948 einer der ersten Piloten in der israelischen Luftwaffe und bombardierte im Unabhängigkeitskrieg mehrere arabische Dörfer. Als er einmal die Ruinen des Dorfes Sa’asa im Norden Israels besichtigte, fand er den Ort verlassen und die meisten Häuser zerstört vor. Unter den Ruinen entdeckte Abie verbrannte Leichen. »Ich stürzte in eine tiefe Depression«, erzählte er später. »Ich machte mir immer mehr Gedanken darüber, was der Krieg den Menschen antut.«16 Er nahm auch an dem Luftangriff auf den »Kessel von Faludscha« teil, einer ägyptischen Festung in der Nähe des Kibbuz Negba im Süden Israels. Unter den ägyptischen Offizieren, die den Angriff überlebten, war Gamal Abd el-Nasser, der spätere Präsident von Ägypten.
Nach dem Krieg bekam Abie zunächst eine Stelle als Pilot bei der israelischen Fluggesellschaft El Al, ehe er das California eröffnete. Der stattliche Mann, der überall seinen Charme spielen ließ, heiratete, bekam eine Tochter, ließ sich scheiden und pflegte sein Image als romantischer Playboy, wohlhabend und großzügig, der an eine bessere Welt glaubte. Häufig spendete er für wohltätige Zwecke.
Abie war ein neuer Heldentypus, der sich von Yechiam Weitz vollkommen unterschied. Hier der aus Jerusalem hervorgegangene Krieger, der das Nationalepos verkörperte, dort die liebenswerte Tel Aviver Berühmtheit, die das gute Leben symbolisierte. Irgendwann in den Jahren dazwischen hatte sich Israel verändert und war zu einem Land geworden, das sich von der Vision seiner Gründer deutlich entfernt hatte.
Anfang der sechziger Jahre hatte die israelische Luftwaffe den Slogan geprägt: »Die Besten gehen zur Luftwaffe«. Der Slogan war umstritten, schlug aber ein.17 Aufgrund seiner Geschichte als Pilot im Unabhängigkeitskrieg hatte Abie sich einen Platz unter »den Besten« verdient. Die Tatsache, dass er einen Privatjet besaß, wenn auch nur geleast, wurde als aufregende Neuerung betrachtet. Im Gegensatz zur Arbeitsmoral der ersten Zionisten, der von ihnen geschaffenen sozialistischen Wirtschaft und der von ihnen geförderten nationalen Ideologie – die den Landwirt im Kibbuz glorifizierte und den städtischen Unternehmer schmähte – tauchte Abie als einer der ersten Vertreter einer amerikanischen Kultur auf, die allmählich in Israel Einzug hielt. Der von bezaubernden Frauen umgebene Abie war ein tollkühner Mann, der sich von den Fesseln gesellschaftlicher Normen frei machte, obwohl er nie ein echter Revolutionär war. Als 40-jähriges Kind hatte er außerdem den eigentlichen Sinn des Lebens entdeckt: Frieden schließen. Seine Freunde überredeten ihn, für die Knesset-Wahlen vom November 1965 zu kandidieren. Abie versprach seinen Wählern, nach Ägypten zu fliegen, um mit Nasser Friedensgespräche zu führen.
In Israel werden Parteien auf dem Wahlzettel durch zwei oder drei hebräische Schriftzeichen dargestellt. Abies Zeichen waren nun-samech, die zusammen das hebräische Wort für »Wunder« ergeben. Er erhielt nur 2135 Stimmen, aber seiner Beliebtheit tat das keinen Abbruch.18 Im Gegenteil: Sein politisches Scheitern verstärkte noch sein Image, zu den Besten zu zählen. Abie träumte immer noch davon, mit Nasser zu sprechen, auch wenn er niemals verriet und vermutlich auch nicht wusste, was er denn dem ägyptischen Präsidenten bei dem Treffen sagen wollte – als hätte schon das Treffen als solches die Kraft, den Gang der Geschichte zu beeinflussen. Er warb häufig für die Idee und bat prominente Persönlichkeiten weltweit um Unterstützung. UN-Untergeneralsekretär Ralph Bunche versuchte ihm einmal mit großem Ernst zu erklären, weshalb nicht die geringste Chance bestand, dass Nasser die Initiative aufgriff. Außenminister Yigal Allon kam ins California und versuchte Abie ebenfalls von der Eskapade abzubringen, doch laut Abie versprach Allon am Ende des gemeinsamen Mittagessens, Abie auf dem Flug zu begleiten.19
Es lässt sich kaum sagen, wann genau aus dieser typischen Dizengoff-Idee ein konkretes Projekt wurde. Abie redete so viel darüber, dass schließlich seine Integrität und sein Mut auf dem Spiel standen. Er hatte das Gefühl, er müsse seinen Freunden, und vielleicht sich selbst, beweisen, dass er – um des Friedens willen – zu seinem Wort stand. Im Februar 1966 rief er in einer Anzeige dazu auf, eine Petition zu seiner Unterstützung zu unterschreiben. Viele Israelis kamen der Bitte nach, weil sie sich von Abies Versprechen anstecken ließen, mit einem Abstecher über die Grenzen des kleinen Israel in die Sphären des Friedens vorzustoßen. Sie wollten ebenso sehr, dass Abies Flug stattfand, wie die Briten sich fast ein Jahrhundert zuvor gewünscht hatten, dass Phileas Fogg die Welt tatsächlich in achtzig Tagen umrundete. Vielleicht verspürten sie das »Fernweh«, das Amos Oz bei der Kibbuz-Jugend ausmachte, einen Schmerz, den Menschen empfanden, die sich abgeschottet fühlten: »Sie sehnen sich nach anderen Orten, die zwar unbestimmt sind, aber fern.«20 Wie dem auch sei: Die massive Unterstützung bestärkte Abie jedenfalls in seinem Eifer. Er beriet sich mit seinem Anwalt, machte sein Testament und lud Journalisten ein, sich die Kisten anzusehen, die seiner Aussage nach Zehntausende Unterschriften enthielten. Als die Hunderttausender-Marke erreicht war, beschloss er, nun sei es an der Zeit zu handeln.21
Am Morgen des 28. Februar 1966 wurde Abie vom Telefon geweckt. Zwi Elgat, ein Reporter von Ma’ariv, war am Apparat. Eine Stunde später kam Elgat vorbei, um Abie zu dem kleinen Flugplatz in Herzlija zu fahren, wie sie es am Abend zuvor an der Bar des California verabredet hatten. Unterwegs holten sie noch den Fotografen der Zeitung ab. Dem Flugplatzpersonal sagten sie, dass Abie gekommen sei, um ein Bild von sich neben dem Flugzeug zu machen, das er von einer Düngemittelfirma gemietet habe. Es war eine einmotorige Stearman aus dem Jahr 1927, Abies Geburtsjahr, mit offenem Pilotensitz. Auf Hebräisch, Englisch und Arabisch war der Name »Peace 1« auf das weiße Flugzeug gepinselt.
Abie setzte sich in Fliegermontur an den Steuerknüppel, schaute direkt in die Kamera und startete plötzlich den Motor. »Eine Sekunde, vielleicht einen endlosen Moment lang, stand mir das Herz still«, schrieb Elgat am nächsten Tag. »Ich hatte das Gefühl, dass das Ganze am Ende vielleicht nur ein Traum war. Ich ging zu ihm und rief. Meine Stimme wurde von dem Propeller übertönt. Ich trat näher. ›Abie, willst du fliegen?‹ Er nickte. Ich wusste es. Ich konnte stolz auf ihn sein. Abie hatte es geschafft! Ich werde nie erfahren, wer aufgeregter war – Abie oder ich selbst. Ich weiß nur, dass ich noch Zeit hatte, ihn zu fragen: ›Abie, hast du Angst?‹ Er war blass, hatte den Pilotenhelm aufgesetzt, und er signalisierte ein einziges Wort: ›Nein!‹ Dann hob er ab. Einen Moment lang wollte ich es nicht glauben.«
Der Friedenspilot Abie Nathan 1966
Elgat war als einziger Reporter dabei, doch als die Exklusivstory erschien, war von einer amerikanischen Nachrichtenagentur in Kairo bereits die Meldung eingetroffen, dass das Flugzeug abgestürzt und Abie Nathan tot sei. Der beliebte Restaurantbesitzer wurde schlagartig zum Nationalhelden. »Ich werde jeden verklagen, der sagt, dieser Mann sei nichts als ein Selbstdarsteller gewesen«, schwor Elgat.22 Die Meldung von Abies Tod stürzte das ganze Land in Trauer. Die Tageszeitungen Ma’ariv und Jediot Aharonot brachten Sonderausgaben, Rundfunksender unterbrachen ihr Programm. Scharen von Menschen versammelten sich vor dem California, viele weinten, als hätten sie einen Freund und eine Hoffnung verloren. Seine engsten Freunde, zum großen Teil Künstler und Medienleute, drängten sich im Restaurant und unterhielten sich im Flüsterton. Plötzlich erhob einer von ihnen, der Besitzer einer Galerie, seine Stimme: »Ich bin sein bester Freund, aber ich habe die Petition nicht unterschrieben. Niemand hätte sie unterschreiben dürfen. Ihr habt ihn nach Ägypten in den Tod geschickt. Ihr habt ihn umgebracht!« Es herrschte eine schreckliche, bedrückende Stille. Und dann drängte sich der Songschreiber Chaim Hefer durch die Menge und rief: »Er lebt! Er lebt!« Eben hatte man es im Radio bekannt gegeben.
Der Nachrichtenagentur Associated Press, die ursprünglich seinen Tod gemeldet hatte, war ein Fehler unterlaufen. Nach dem Start hatte Abie die Maschine scharf in Richtung Mittelmeer gedreht und war so tief geflogen, wie er konnte, um dem Radar der israelischen Luftwaffe auszuweichen. Als er über Tel Aviv flog, berührte er fast die Dächer; über dem Meer spritzte ihm die Gischt ins Gesicht. Die Luftwaffe spürte ihn aber trotzdem auf und sandte Flugzeuge aus, die ihn zurückholen sollten, doch er weigerte sich und flog einfach weiter.23 Und dann verloren sie ihn. Er hatte weder ein Funkgerät noch genügend Treibstoff, um Kairo zu erreichen. Er kam bis Port Said, eine Hafenstadt an der nördlichen Mündung des Suezkanals, wo er sicher landete, sich dem verblüfften Flughafenpersonal vorstellte und darum bat, zu Nasser gebracht zu werden. Die Ägypter krümmten ihm kein Haar. Sie brachten ihn zum zuständigen Provinzgouverneur, bewirteten ihn reichlich und erlaubten, dass er über Nacht blieb. Ja, sie fuhren ihn sogar in die Stadt, damit er sich einen Pyjama kaufen konnte. Dann brachten sie ihn zum Flugplatz zurück. Am Abend spielte er mit den Wachen Karten und gewann. Am nächsten Tag schickten sie ihn wieder nach Hause.
Die Menschen im Restaurant umarmten und küssten sich, als die Meldung, dass er noch am Leben war, eintraf. Tränen der Freude vermischten sich mit Sekt. Auf dem Bürgersteig sprach jemand ein Dankgebet. Die Nachricht machte rasch die Runde, und es gingen Meldungen von spontanen Feierlichkeiten im ganzen Land ein. Soldaten in Kirjat Gat kauften eine Flasche Cognac und forderten Passanten auf, auf Abies Wohl zu trinken. Am nächsten Tag strömten Tausende von Menschen zum Flugplatz, um ihn zu begrüßen, und die Rollbahn musste geräumt werden, damit er landen konnte. Seine Anhänger erdrückten ihn fast.24 Es war ein entschieden israelischer Moment: Nichts war charakteristischer für die Israelis als dieser plötzliche Wechsel von lähmender Depression zu überschäumender Freude, von tiefer Verzweiflung zum Jubel über die Rettung. Im Jahr 1967 sollte sich dies wiederholen.
Im Sechstagekrieg kulminierten Ereignisse, die bereits Jahre vorher ihren Anfang genommen hatten. Seit Mitte der sechziger Jahre griff die Fatah, die Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas, militärische und zivile Ziele in Israel an. Die Fatah betrachtete diese Aktionen als direkte Fortsetzung der Kämpfe von 1948. Obwohl die Israelis die Palästinenser als feindliche Macht außer Acht ließen, markierte der Krieg, der im Juni 1967 ausbrach, im Grunde nur eine neue Runde im Konflikt der beiden Völker. Die Terroristen, die vor dem Juni 1967 nach Israel einsickerten, taten dies häufig von syrischem Staatsgebiet aus und erhöhten die Spannungen an der nördlichen Grenze. Am 7. April schoss die israelische Luftwaffe in Reaktion auf derartige Infiltrationen sechs Maschinen der syrischen Luftwaffe ab. Weitere Warnungen und Drohungen, die in Israel unmittelbar vor dem Unabhängigkeitstag im Mai geäußert wurden, erweckten den Eindruck, Israel stehe kurz vor einem Angriff auf Syrien, das mit Ägypten einen Beistandspakt im Verteidigungsfall geschlossen hatte. Mitte Mai entschieden die Ägypter sich zur Intervention und ließen in der Wüste Sinai Truppen aufmarschieren.
Die prägnanteste Schilderung dieser Entwicklung lässt sich den Kabinettsprotokollen vom 16. Mai 1967 entnehmen. »Im Lichte der Informationen und Gesuche, die Ägypten aus Syrien betreffend der israelischen Absichten erreichen, umfassend gegen Syrien vorzugehen«, erklärte Premierminister Levi Eschkol, »im Lichte der israelischen Erklärungen und Warnungen der letzten Tage und im Lichte der schwierigen Situation, in der sich Ägypten seit dem 7. April befindet, hat Ägypten den Entschluss gefasst, dass es angesichts des gegenwärtigen Stands der Dinge nicht untätig zusehen kann.« Eschkol zufolge wollte Ägypten Israel davon abhalten, seine Drohungen gegen Syrien wahr zu machen.25 Die Spannung an der ägyptischen Front griff rasch auf die jordanische und die syrische Front über. Während der Krieg mit Ägypten auf Israels Demoralisierung und ein Gefühl der Hilflosigkeit zurückzuführen war, drückten sich im Kampf gegen Jordanien und Syrien Machtstreben und messianischer Eifer aus.
Die Ereignisse, die zum Krieg führten, sein Verlauf und die Folgen sind detailliert untersucht und analysiert worden; will man verstehen, warum er überhaupt ausbrach, reicht die Kenntnis der diplomatischen und militärischen Hintergründe jedoch nicht aus. Vonnöten ist vielmehr die eingehende Beschäftigung mit den Israelis selbst. 1966 waren sie durch ein emotionales, politisches und moralisches Erdbeben tief erschüttert worden. Damals lebten nur knapp über 2,3 Millionen Juden und etwas mehr als 300 000 Araber im Land. Immer mehr Israelis verloren den Glauben an sich und versanken in Depression, Zweifeln und schließlich Verzweiflung. »Was sollen wir tun, Leute, was sollen wir nur tun«, klagte der Songschreiber Chaim Hefer. »Nichts gelingt, es gibt nicht das kleinste bisschen Glück … Alles ist deprimierend, jedermann traurig/Nichts klappt, und keiner weiß, warum.«26
Israel machte damals eine tiefe wirtschaftliche Rezession durch, und die Einwanderung ging drastisch zurück. Zehntausende kehrten dem Land sogar dauerhaft den Rücken. Die europäische Kultur der Aschkenasim wurde durch den Zustrom von Misrachim, jüdischen Immigranten aus arabischen Ländern, bedroht, was zu sozialen Spannungen und Ressentiments führte. Diese Entwicklungen zogen eine tiefe und schmerzhafte Identitätskrise nach sich, und die zionistische Vision schien am Ende zu sein. »Wir sind ein erbärmliches Volk«, sagte ein Mapai-Politiker, und viele zogen den Schluss, dass »das Unternehmen gescheitert« sei, wie eine Zeitung schrieb.27
In den Vorkriegsmonaten herrschte das weit verbreitete Gefühl, dass die Grundwerte des Staates – Opferbereitschaft und nationale Einheit – an Gewicht und Bedeutung verloren hatten, ohne dass etwas anderes an ihre Stelle getreten wäre. Unter Rückgriff auf die Hauptlehren des Zionismus stritten die Leute viel, und oft ging es dabei nicht nur um Auseinandersetzungen zwischen »links« und »rechts«, sondern eher um eine grundsätzliche Überprüfung des israelischen Traums selbst. Viele hatten den Eindruck, dass die Gesellschaft auseinanderfiel. Vor diesem Hintergrund erklärte ein Redakteur von Ma’ariv das Bedürfnis so vieler Israelis, Abie Nathan zu lieben und ihn als Helden zu verehren, so: »Du hast uns wenigstens für einen Tag aus der schrecklichen Routine herausgerissen, die an unseren Nerven zerrt.«28
Die Krise, die dem Sechstagekrieg voranging, war tiefgreifend. »Ich habe große Angst«, schrieb der Landwirtschaftsminister Chaim Gvati in sein Tagebuch.29 Israel habe seiner Beobachtung nach seit dem Unabhängigkeitskrieg vor keiner so schweren Prüfung mehr gestanden. »Allen ist klar, dass das ein Kampf auf Leben und Tod ist.« Im Ministerpräsidentenamt hörte Gvati, die Sowjetunion habe offenbar beschlossen, »bis zum Äußersten zu gehen und nicht einmal vor der Zerstörung Israels zurückzuschrecken«. Diese Berichte entbehrten jeglicher Grundlage, aber die auf Vernichtung eingestellten Israelis ließen kein Gerücht unbeachtet. Soldaten auf Wochenendausgang erzählten von Niedergeschlagenheit und schlechter Kampfmoral. »Es kursieren Gerüchte, dass wir nicht auf einen Krieg vorbereitet seien … und es herrscht kein Vertrauen, dass wir es mit unseren Feinden aufnehmen können«, schrieb der Minister. Auch diese Angst war in Wirklichkeit unbegründet. Eine Kabinettssitzung, an der Gvati teilnahm, unterbrach Stabschef Jizchak Rabin mit der Mitteilung, dass vier ägyptische MiG-Flugzeuge sowjetischer Bauart in den israelischen Luftraum eingedrungen seien. Die Flugzeuge waren wieder vertrieben worden, aber offenbar hatten zwei Gelegenheit gehabt, den Atomreaktor in Dimona zu fotografieren.30
In Erwartung der Apokalypse kam vielen Israelis der Holocaust in den Sinn. »Wie ist das möglich?«, schrieb eine Frau aus Ramatajim einer ehemaligen Klassenkameradin, die in Los Angeles lebte. »Keine 25 Jahre sind seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen, und jetzt passiert es wieder?«31 In einem Bericht an Präsident Lyndon B. Johnson hieß es, Efraim Evron, ein israelischer Diplomat in Washington, habe die Vereinigten Staaten »mit Tränen in den Augen« um Unterstützung angefleht.32
Als der Krieg endlich ausbrach, verbrachte Minister Gvati die ersten Stunden mit seinen Nachbarn im Luftschutzkeller. Am nächsten Tag war die ganze Angelegenheit so gut wie vorbei. »Es war der größte Tag in unserem Leben, vielleicht in der ganzen Geschichte des jüdischen Volkes«, schrieb er.33 Die meisten Israelis glaubten, dass die Armee sie vor der Vernichtung gerettet habe. Viele bezeichneten den Sieg als ein Wunder, als seien sie der Unterwelt entronnen und ins Paradies eingezogen. Im Leitartikel der Zeitschrift Jediot Aharonot war von »der Hand Gottes« die Rede.34 Das Untergangsgefühl verschwand; nun konnte die Geschichte von Neuem beginnen. Zwei beliebte Witze machen diesen Stimmungsumschwung deutlich: In dem ersten, der vor dem Krieg erzählt wurde, hängt in der Abflughalle des Flughafens von Lod ein Schild, auf dem der Letzte, der das Land verlässt, aufgefordert wird, das Licht auszumachen. Der zweite Witz kam nach dem Krieg auf: Zwei Offiziere denken darüber nach, wie sie den Tag verbringen können. »Erobern wir doch einfach Kairo«, schlägt der eine vor. Der andere erwidert: »Schön, aber was machen wir nach dem Mittagessen?«35
Einige Monate vor dem Krieg hatte Moshe Dayan Vietnam besucht. »Die Amerikaner gewinnen hier alles – außer den Krieg«, schrieb er nach seiner Rückkehr.36 Kurz nach dem Juni 1967 hätte man über die Israelis das Gegenteil sagen können: Das Einzige, was sie gewonnen hatten, war der Krieg. Außer den im Krieg besetzten Gebieten hatten sie nichts hinzugewonnen. Zunächst von Angstgefühlen und dann vom Siegesrausch überwältigt, handelten sie im emotionalen Überschwang häufig gegen ihre nationalen Interessen, ein Verhaltensmuster, das die Israelis häufig den Arabern zuschrieben. Der britische Botschafter meldete verwundert an seine Vorgesetzten in London: »Es ist wirklich bemerkenswert, wie oft sich die Israelis arabischer benehmen als die Araber.«37 Weder die vor dem Krieg herrschende Panik noch die Euphorie danach waren berechtigt. Und genau deshalb ist die Geschichte Israels im Jahr 1967 so schwer zu verstehen.
* In Yechiams posthum veröffentlichten Briefen definierte er sich selbst als Zionisten und Sozialisten im Geist seines Vaters. Er neigte wie viele seiner Generation dazu, den Weg weiterzugehen, den seine Eltern bereitet hatten. Ein Literaturkritiker hob das uralte jüdische Leid hervor, das in den Briefen mitschwang und auf den Identitätskonflikt zwischen dem Diaspora-Juden und dem neuen Hebräer verwies, der noch Jahre nach Yechiams Tod im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion in Israel stehen sollte. Soldatenbriefe wurden übrigens häufig publiziert – um die Verfasser, die für Israel gefallen waren, unsterblich zu machen und um der bewundernswerten und lehrreichen Botschaft willen.3
TEIL I
Zwischen Rischon le-Zion und Manhattan
In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre kam ein junger Mann namens Gabriel Stern aus Deutschland nach Jerusalem. Er nahm Kurse in Nahostwissenschaften an der Hebräischen Universität und setzte sich für die Versöhnung zwischen Juden und Arabern ein. Während des Krieges von 1948 diente er im Italienischen Krankenhaus im Jerusalemer Stadtviertel Musrara als Wachtposten. Eines Tages stand plötzlich ein Mann vor ihm und zielte, den Finger am Abzug, mit einem Gewehr auf ihn: der Feind. Der Mann stand am Ende eines langen, schlecht beleuchteten Korridors. Stern wusste nicht, wie er dahin gekommen war. Er hatte das Gefühl, dass es in diesem Augenblick um sein Leben ging: Einer von ihnen würde das Feuer eröffnen und überleben. Der andere würde sterben. Stern drückte ab. Die Kugel flog direkt in die Gestalt hinein – und zerbrach sie in tausend Stücke. Es war ein großer Spiegel. Stern hatte auf sich selbst geschossen. Er feuerte nie wieder eine Waffe ab.
KAPITEL I
Sussita-Tage
Die Israelis: »Wir kommen ganz gut zurecht«
Am Donnerstag, dem 18. Mai 1967, ließ Jehoschua Bar-Dayan bei seiner Sussita einen Ölwechsel machen, als er von der Arbeit nach Hause kam. Der 35-jährige Bar-Dayan arbeitete für den Rat zur Vermarktung von Zitrusfrüchten in Rischon le-Zion. Für den Ölwechsel musste er nach Rechovot fahren und nahm seinen zweijährigen Sohn Jariv mit. Auf dem Weg in die Werkstatt merkte er, dass kaum Lastwagen auf der Straße waren; das war ungewöhnlich. Die israelische Armee hatte wegen plötzlicher Spannungen an der ägyptischen Grenze mit der Einberufung von Reservisten begonnen. »Ich habe das Gefühl, dass ich heute Abend einberufen werde«, schrieb Bar-Dayan in das Tagebuch, das er am folgenden Tag begann.1 Er hoffte es nicht, aber sein Gefühl sagte ihm, dass es in jener Nacht passieren würde.
Seine Frau Gila, eine Kindergärtnerin, war mit den üblichen Verrichtungen eines Donnerstags beschäftigt, zu denen auch ein Gang zum Friseur gehörte. Das Paar ging an jenem Abend um 23.30 Uhr ins Bett. Bar-Dayan konnte nicht einschlafen, und um Mitternacht klingelte das Telefon. Es war Usi Avrahami, ein Freund von der Armee. »Sei in zehn Minuten fertig«, sagte er. »Gili zitterte«, schrieb Bar-Dayan am folgenden Abend in sein Tagebuch. »Ich tröstete sie, aber ich zitterte ebenfalls.« Er fuhr mit der Sussita zu Usi, und in den folgenden Stunden gingen sie mit Adressenlisten der Armee von Tür zu Tür und informierten andere Soldaten, Fahrer und Fahrzeugbesatzungen der Reserve über ihre Einberufung. Überall wiederholte sich dieselbe Szene: Sie stiegen die Treppe hinauf und klingelten. Erschrockene Ehefrauen holten ihre Männer aus dem Bett und packten ihnen den Rucksack. Die Männer gingen in das Zimmer, wo ihre Kinder schliefen, und küssten sie, und manchmal gab es auch alte Eltern, von denen sie sich verabschiedeten. Dann sagten sie ihren Frauen auf Wiedersehen und machten sich auf den Weg in das Sammelgebiet. Bar-Dayan dagegen kehrte kurz vor dem Morgengrauen noch einmal nach Hause zurück und schlief zwei Stunden. Gili hatte seine Ausrüstung gepackt. Usi holte ihn um 6.30 Uhr ab. Es war Freitag, der 19. Mai. Die Atmosphäre im Land war schon länger gespannt gewesen, und nun redeten plötzlich alle vom Krieg.
Anderthalb Jahre vorher hatte alles noch ganz anders ausgesehen. Damals war Jehoschua Bar-Dayan, »Schuka« für seine Freunde und Familie, ein optimistischer und zufriedener Mann. Rischon le-Zion hatte sich trotz seiner fast 36 000 Einwohner etwas von seinem ursprünglichen Charakter als eine der größten landwirtschaftlichen Siedlungen in Palästina bewahrt. Die Briefe, die junge Einwohner der Stadt an Freunde und Verwandte in Übersee schrieben, zeugten von einem Lebensstil, der bei vielen Israelis üblich war. Neun von zehn lebten in einer Stadt und jeder dritte in Tel Aviv, Haifa oder Jerusalem.2 Anfang 1966 waren die Briefe der Israelis von Zufriedenheit und einem großen Grundvertrauen in ihre Zukunft geprägt. Sie betrachteten sich als Teil der westlichen Welt und hatten entsprechende Erwartungen an das Leben und das Land. Sie reisten häufig ins Ausland und kauften Fernsehapparate; zwar gab es noch kein israelisches Fernsehprogramm, doch dieser Zustand würde bestimmt nicht mehr lange anhalten. Seit dem Ende des Sinai-Feldzugs von 1956 fühlten sie sich sicher und glaubten, mit ihrem Leben werde es nur noch bergauf gehen. Mitte der sechziger Jahre sah es tatsächlich so aus, als könne Israel in fast allen Lebensbereichen enorme Errungenschaften verzeichnen. Seit der Staatsgründung war der Lebensstandard stark gestiegen und näherte sich nun mit rasch wachsender Produktion, einem Überangebot an Arbeitsplätzen und einem kontinuierlichen Anstieg von Preisen und Gehältern dem Niveau in mehreren europäischen Ländern. In den frühen sechziger Jahren wies die israelische Volkswirtschaft extrem hohe Wachstumsraten von jährlich 10 bis 12 Prozent auf.3 In allen israelischen Städten war ein Aufschwung spürbar, der zu Hoffnung und Stolz Anlass gab. Selbst die Architektur griff, genau wie in Amerika, nach den Sternen.
Beerschewas erstes 14-stöckiges Wohnhaus wurde gebaut. In Kirjat Elieser, einer Vorstadt von Haifa, schoss das mit zwanzig Etagen höchste Wohnhaus aus dem Boden. In Ramat Gan stand das 27 Stockwerke hohe Gebäude der Diamantenbörse kurz vor der Fertigstellung. In Tel Aviv wurde das höchste Gebäude Israels, ein 34-stöckiger Wolkenkratzer, eingeweiht, mit dem Schalom-Observatorium ganz oben auf der Spitze. Von dort aus konnte man im Norden die Vorstädte von Haifa und im Süden den Stadtrand von Jerusalem sehen. Im Süden des Landes erhob sich die »am stärksten geplante Stadt der Welt« aus dem Sand: Arad. Überall im Land wurden neue öffentliche Gebäude eröffnet. Im Oktober wurde in Tel Aviv der Grundstein für Beth Hatefutzoth, das Museum der Jüdischen Diaspora, gelegt. Einige Monate zuvor war in Jerusalem das Israel-Museum eröffnet worden. Auf dem gegenüberliegenden Hügel wurde im August 1966 das neue Knessetgebäude eingeweiht. laut Jediot Aharonot mit der wunderbarsten Feier, die das Land je erlebt hatte. Der »Schrein der Knesset«, wie das Gebäude bezeichnet wurde, war mit Spenden des britischen Zweigs der Rothschild-Familie an den Staat Israel gebaut worden. Auch Hochschulen entstanden in rascher Folge. »Im Negev wird eine Universität geboren«, berichtete Ma’ariv aus Beerschewa. Die Universität Haifa verkündete, dass sie »Phase A« ihrer Gründung vorziehe, und plante ein 18-stöckiges Hochhaus. Die Universität Tel Aviv gründete eine juristische Fakultät.
Die Israelis konnten ihre Zeitungen mit Stolz lesen. Ma’ariv berichtete, dass Israel sich im Rahmen des französischen Raumfahrtprogramms am Aufbau eines Satellitenkommunikationssystems beteiligen werde. Ha’aretz zitierte den bekannten Wissenschaftler Ernst David Bergman mit der Aussage, dass man mit Recht ein israelisches Raumfahrtprogramm erwarten dürfe. Bei einem internationalen Leistungsvergleich von einem Dutzend Ländern landeten die israelischen Schüler in Mathematik auf dem ersten Platz; amerikanische Schüler schnitten am schlechtesten ab. Im gleichen Jahr gewann Israel die asiatischen Basketballmeisterschaften. »Wir kommen ganz gut zurecht«, sagte ein israelischer Minister und beschrieb damit exakt die vorherrschende Gemütsverfassung.4 In Rischon le-Zion bestellte ein junges Paar einen Schaukelstuhl für seine Wohnung in der Weizman-Straße.
Das Leben hatte es gut mit David und Rina gemeint: Genau wie ihre Nachbarn Jehoschua und Gila Bar-Dayan hatten auch diese Eheleute ein hübsches Baby, das sie sehr glücklich machte. Eines Abends schrieb Rina, als sie mit David auf dem Balkon saß, einen Brief an ihre ältere Schwester Edna in New York. Sie würfen sich gegenseitig eine Streichholzschachtel zu und amüsierten sich damit, erwähnte sie im Brief. Das Baby schlief. Es war fast Mitternacht. Sie war in ihren Zwanzigern und bereitete sich auf eine Prüfung als Lehrerin vor; den Brief an ihre Schwester schrieb sie während einer Lernpause. Wie üblich verwendete sie einen vorfrankierten Luftpostbrief, den die Post herausbrachte; das war einfacher und billiger als ein normaler Umschlag. Der Schaukelstuhl, schrieb sie, werde zusammen mit einem Sofa eintreffen, dessen Bezug gut zu den Farben des Zimmers passe, und wenn es finanziell gut laufe, würden sie bald auch noch einen schönen Teppich kaufen.5
Die Sussita. Die untere Reihe zeigt die Modelle Sabra (Sportwagen), Carmel (Limousine), den Sussita-Lieferwagen und den Sussita-Kombi
.
Im Jahr 1966 betrug das Durchschnittseinkommen einer israelischen Familie 700 israelische Pfund im Monat. Der Elektroingenieur Jehuda Jost und seine Frau verdienten fast das Doppelte. »Mein nächstes Monatsgehalt beträgt 850 Pfund, und Zippora verdient als Lehrerin etwa 400 israelische Pfund im Monat«, schrieb der junge Mann an Freunde in Los Angeles. »Von diesen Gehältern können wir gut leben: Wir haben ein Telefon, wir haben Möbel für die Wohnung gekauft, wir zahlen Schulden ab, und natürlich müssen wir auch leben.« Außerdem besaßen sie ein Auto – einen gebrauchten britischen Hillman.6 In diesem Punkt gehörten sie zu den oberen zehn Prozent: Nur jede zehnte israelische Familie besaß ein eigenes Auto, aber die Zahlen stiegen schnell.7*
Rina und ihr Mann hatten beschlossen, dass sie Autofahren lernen sollte. Unterdessen nahmen sie weitere Verbesserungen an ihrer Wohnung vor: Sie täfelten die Wand gegenüber der Wohnungstür und die Diele bis zur Küche mit finnischer Kiefer voller dunkler Astknoten. »Es ist wirklich wunderschön«, schrieb Rina. »Man sitzt im Wohnzimmer, und die Wand vermittelt einem ein warmes, heimeliges Gefühl.« Sie stellte den Philodendron in die Nähe der Holzwand. Im November 1966 erhielten sie die Nachricht, dass sie bald ein Telefon bekommen würden. Das Postministerium, das für das Telefonnetz zuständig war, hatte ihnen bereits eine Rechnung über 650 israelische Pfund geschickt. »Das Ganze war eine absolute Überraschung, weil wir das Telefon erst letzten November bestellt hatten und man in Israel üblicherweise zwei oder drei (in der Regel drei) Jahre warten muss, bis man es bekommt«, schrieben sie nach New York. Nun würden sie höchstens noch ein paar Monate warten müssen.* Das Telefon kam unmittelbar vor Pessach. Es hatte eine sechsstellige Rufnummer und wurde im nächsten Brief nach Manhattan einer detaillierten Beschreibung gewürdigt: »Es ist elfenbeinfarben und befindet sich vorläufig im Arbeitszimmer, wo es sehr schön zu der Tischplatte aus Resopal passt.« Das junge Paar ließ noch einen zweiten Anschluss in der Diele legen, und bald kaufte es auch noch ein großes kupfernes Telefontischchen dazu, das von da an auf seinen Holzbeinen vor der neuen holzgetäfelten Wand am Eingang thronte.**
David arbeitete jeden Tag hart. Wie Jehoschua Bar-Dayan war er Experte für die Vermarktung von Zitrusfrüchten. Er hatte an der University of California einen Abschluss gemacht und als Regimentskommandeur beim Artilleriekorps der israelischen Armee gedient. Mehrmals pro Jahr wurde er zu Reserveübungen eingezogen. Seine Frau putzte die Wohnung, kochte und versorgte das Baby. »Jeden Tag finde ich etwas Wichtiges zum Aufräumen oder zum Kaufen; ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Aufgaben gibt«, schrieb sie, als sie ihrer Schwester versicherte, dass ihr überhaupt nicht langweilig sei. Manchmal nahm sie das Baby mit zum Swimmingpool des Weizmann-Instituts. »Es ist ein großes, sauberes, wunderschönes Becken, und die Leute, die dort hingehen, sind wirklich ›erlesen‹. Sie sind Mitarbeiter des Instituts oder Leute von draußen, die sich für eine große Summe von mehreren hundert israelischen Pfund eine Jahreskarte gekauft haben.« Einmal beschrieb sie ihrer Schwester ein neues Paar schwarzer Schuhe: »Eine Kombination aus Wild- und Lackleder. Sie sind neuste Mode, mit einem sehr breiten Absatz, einer geschlossenen Ferse und vorne viereckig.« Ihre Schwester schickte ihr »entzückende« Hosen, einen Pullover für das Baby und einen spitzenbesetzten Unterrock, der genau zum richtigen Zeitpunkt kam: »Morgen habe ich einen Termin bei meiner Schneiderin.«
Ein oder zwei Mal die Woche schaute Rina bei ihren Eltern vorbei, die in der nahe gelegenen Sokolow-Straße wohnten. Ihre Mutter war Lehrerin und Mitte der dreißiger Jahre aus der polnischen Stadt Bialystok nach Israel gekommen. Ihr Vater war Buchhalter und stammte aus der Ukraine. Die beiden hatten zu den Gründern eines Kibbuz gehört und waren nach zwanzig Jahren mit ihrem jüngeren Sohn nach Rischon le-Zion gezogen. »Angenehme Familienatmosphäre«, schrieb die Tochter an ihre Schwester. »Wir sitzen alle in der Küche. Vater isst Blumenkohl mit Butter, und Mutter schält an der Spüle Kartoffeln.«* Sie hatten einen Gasherd zum Kochen und wie neun von zehn israelischen Familien einen elektrischen Kühlschrank. Wie die meisten Israelis heizten sie ihre Wohnung mit Petroleum-Öfen. Der Petroleumhändler zog durch das Viertel und läutete eine Glocke, um auf sich aufmerksam zu machen. Manche Händler hatten noch Pferdekarren, andere waren bereits motorisiert. Die Firma Friedmann aus Jerusalem verkaufte einen Ölofen, der als dramatische Verbesserung des heimischen Komforts angesehen wurde; er trug den englischen Namen Fireside. Rinas Eltern hatten kein Telefon. Das Mittagessen war die Hauptmahlzeit der Familie. Rina hatte ihre Eltern besucht, weil sie an diesem Tag vom Kochen »befreit« war, wie sie schrieb. Ihr Mann würde erst spät von der Arbeit nach Hause kommen.
Die Frauen: »Soll der Junge seine Knöpfe selbst annähen?«
Die häusliche Rolle der Frau war klar definiert. »Ihr Mann hat es verdient, von Ihnen verwöhnt zu werden, wenigstens ein bisschen«, riet Ha’aretz ihren Leserinnen. Und weiter hieß es in dem Artikel: »Schließlich ist er der Mann, um den sich Ihr Leben dreht. Lassen Sie ihn spüren, dass Sie zu schätzen wissen, was er für die Familie leistet.« Und in dem damaligen optimistischen Geist empfahl die Zeitung: »Seien Sie mit Ihrem Leben zufrieden und zögern Sie nicht, es zuzugeben.« Es folgte eine Liste praktischer Vorschläge:
Lüften Sie das Haus, bevor Ihr Mann nach Hause kommt, um die Kochgerüche loszuwerden – abgesehen von den angenehmen natürlich. Achten Sie darauf, dass Sie genug Zeit haben, um sich frisch zu machen und auszuruhen, bevor er nach Hause kommt.
Mobilisieren Sie Ihren ganzen Instinkt, damit Sie merken, welcher Stimmung Ihr Mann ist, wenn er nach Hause kommt. Falls er gereizt und angespannt wirkt, warten Sie mit dem Essen und lassen Sie ihm Zeit, sich frisch zu machen. Oder besser noch – sorgen Sie vor: Stellen Sie einen Blumenstrauß auf den Tisch, lassen Sie im Radio sanfte Musik laufen und lächeln Sie, wenn er hereinkommt.
Wenn Ihr Mann von der Arbeit nach Hause kommt, machen Sie ihn sehr glücklich, wenn Sie sich zu ihm an den Tisch setzen, auch wenn Sie vorher schon mit den Kindern gegessen haben. In der angenehmen Gesellschaft seiner Frau wird ein Mann nach vollbrachtem Tagwerk ein gutes Mahl doppelt genießen.
Langwieriges und geschäftiges Tischabräumen und Abwaschen kann die angenehme Atmosphäre ruinieren, die Sie geschaffen haben. Lassen Sie die Mahlzeit so lange dauern, wie er es wünscht, und servieren Sie zum Abschluss eine Tasse Kaffee, aber im Wohnzimmer und nicht an einem Tisch voller Geschirr. Für den Abwasch haben Sie später noch Zeit.