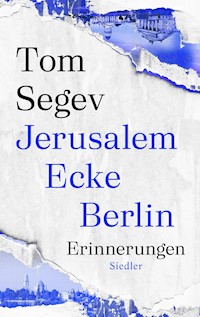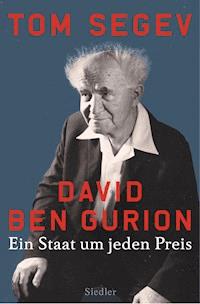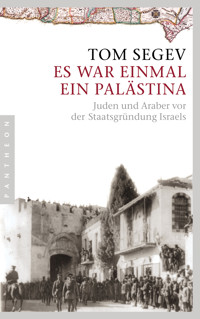
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die historischen Wurzeln des Nahostkonflikts - ein augenöffnendes Buch, brillant recherchiert und großartig erzählt
Es ist die Vorgeschichte eines Konflikts, der die Welt bis heute in Atem hält: Tom Segev widmet sich in seinem meisterhaften Buch dem turbulenten Zeitraum vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Lebendig, materialreich und mit analytisch spitzer Feder schildert Segev, wie in den drei Jahrzehnten britischer Herrschaft in Palästina die Wurzeln des israelisch-palästinensischen Konflikts gelegt wurden. Dabei stellt er manche Annahme der herkömmlichen Geschichtsschreibung auf den Kopf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tom Segev
Es war einmal ein Palästina
Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels
Aus dem Amerikanischenvon Doris Gerstner
Pantheon
Die internationale Ausgabe erschien 2000 unter dem Titel
»One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate« bei Metropolitan Books, New York.
Die deutsche Ausgabe wurde mit Zustimmung des Autors leicht gekürzt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 1999 by Tom Segev
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005
by Siedler Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München,nach einer Idee von Rothfos + Gabler, Hamburg
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Karten: Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-641-32161-1V001
www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Einleitung: Bis wir uns wiedersehen
ILLUSION(1917–1927)
1Khalil as-Sakakini bekommt Besuch
2»Ein Pakt mit dem Judentum«
3Selbstbedienung
4Ego kontra Ego
5Zwischen Mohammed und Mr. Cohen
6Nabi Musa 1920
7Alles ruhig
8Jaffa 1921
9Kulturkämpfe
10Jefim Gordin kommt nach Palästina
11Ein neuer Mensch
12Verhandlungen mit Freunden
TERROR(1928–1938)
13Die Nerven Jerusalems
14Hebron 1929
15Frühstück in Chequers
16Hamlet in Bir Zeit
17Khalil as-Sakakini baut ein Haus
18Made in Palestine
19Die Sache mit dem Esel
20Irland in Palästina
ENTSCHEIDUNG(1939–1948)
21Jagdsaison
22»Gebt mir ein Land ohne Kriege«
23Der letzte Salut
Dank
ANHANG
Abkürzungen
Anmerkungen
Literaturauswahl
Personenregister
Abbildungen
Einleitung: Bis wir uns wiedersehen
Am Südhang des Berges Zion, gleich neben den Ruinen des biblischen Jerusalem, liegt ein kleiner, protestantischer Friedhof. Der Weg dahin führt vorbei an Pinien, Zypressen, Oliven- und Zitronenbäumen und ist gesäumt mit rosa- und weißblühenden Oleanderbüschen. Schließlich steht man vor einem von Weinreben umrankten, schwarzen Eisentor. Etwa tausend Gräber liegen verstreut auf dem terrassenförmig angelegten Hügel, zum Teil versteckt unter roten Anemonen. Nicht weit entfernt, auf der Kuppe des Berges, befinden sich eine Stätte, die von Juden als das Grab König Davids verehrt wird, sowie ein Saal, von dem Katholiken glauben, dass in ihm das letzte Abendmahl stattfand; in einer nahe gelegenen unterirdischen Kammer soll die Jesusmutter Maria ewige Ruhe gefunden haben. Auch die Muslime verehren mehrere heilige Grabstätten auf dem Berg.
Bischof Samuel Gobat weihte den Friedhof in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts für eine kleine Gemeinde von Männern und Frauen, die sich Jerusalem tief verbunden fühlten. Wenige von ihnen waren hier geboren worden; die überwiegende Mehrheit war fremder Herkunft – zugereist von fast überall auf der Welt von Amerika bis Neuseeland. Die Grabsteine tragen englische, deutsche, hebräische, arabische und altgriechische Inschriften; eine Inschrift ist polnisch.1
Als die ersten Toten hier bestattet wurden, war Palästina eine entlegene Region des Osmanischen Reiches – ohne eigene Zentralregierung und mit nur wenigen verbindlichen Normen. Die Uhren tickten langsam – das Tempo wurde bestimmt vom Schreiten des Kamels und den Zügeln der Tradition. Dann begannen gegen Ende des Jahrhunderts vermehrt Fremde in das Land zu strömen, und es schien aus seiner levantinischen Betäubung zu erwachen. Muslime, Juden und Christen gleichermaßen fühlten sich vom Land Israel emotional angezogen. Manche blieben nur kurze Zeit, andere ließen sich für immer nieder. In der von ihnen angestoßenen multikulturellen Revolution, die fast hundert Jahre andauerte, gingen Prophetentum und Wunschdenken, Unternehmertum, Pioniergeist und Abenteurertum eine magische Verbindung ein. Die Grenze zwischen Hirngespinst und Realität war oft verschwommen. Es gab Scharlatane und Exzentriker aller Nationalitäten. Im Großen und Ganzen zeichnete sich diese Periode jedoch durch Unternehmungsgeist und Wagemut aus – den Mut, etwas zum ersten Mal zu tun. Eine Zeit lang gaben sich die Neuankömmlinge dem berauschenden Wahn hin, alles sei möglich.
Ein Amerikaner führte 1908 das erste Automobil ein. Kreuz und quer fuhr er damit durchs Land und sorgte überall für Aufsehen. Ein holländischer Journalist träumte davon, den Einwohnern Galiläas Esperanto beizubringen. Ein jüdischer Pädagoge aus Rumänien eröffnete einen Kindergarten in der kleinen zionistischen Siedlung Rischon le-Zion und war Mitherausgeber der ersten hebräischen Kinderzeitung. Simcha Whitman, der auch den ersten Kiosk Tel Avivs betrieb, begann mit der Herstellung von Speiseeis. Ein Mann namens Abba Cohen gründete eine Feuerwehr, und ein aus Berlin gebürtiger Unternehmer stellte die ersten Bienenstöcke auf. Ein ukrainischer Dirigent rief eine lokale Operngesellschaft ins Leben, und ein Antwerpener Geschäftsmann eröffnete eine Diamantschleiferei. Ein russischer Agronom, der in Zürich studiert hatte, pflanzte Eukalyptusbäume an, und ein Industrieller aus Wilna baute Barzelit, die erste Nagelfabrik, auf. Der russische Arzt Dr. Arieh Leo Boehm schuf das Pasteur-Institut, und ein Mann namens Smiatitzki aus Polen übersetzte Alice in Wonderland ins Hebräische.2 George Antonius, ein bekannter palästinensischer Araber, träumte von einer arabischen Universität und bemühte sich bis dahin um finanzielle Unterstützung für die Veröffentlichung eines arabischen technischen Wörterbuchs.3 Antonius stammte aus dem ägyptischen Alexandrien. Andere der in Palästina lebenden Araber kamen aus der Türkei, Marokko, Persien, Afghanistan sowie aus einem halben Dutzend anderer Länder. Es gab auch ehemalige schwarze Sklaven, die von ihren Besitzern freigelassen worden waren oder fliehen konnten.4
Zehntausende von Menschen, überwiegend Juden, wanderten aus Mittel- und Osteuropa ein, die meisten von ihnen unfreiwillig, als Flüchtlinge vor Verfolgung oder Armut. Andere kamen als mutige Rebellen, die unter dem Einfluss der zionistischen Ideologie nach einer neuen Identität suchten. Der weißbärtige Sozialist Aharon David Gordon, eine Art lokaler Tolstoi, predigte Erlösung durch körperliche Arbeit und Rückkehr zur Natur in Galiläa. Er stammte aus der Ukraine und war einer der Gründungsväter des Arbeiterzionismus, jener politischen Bewegung, die den Juden zur Unabhängigkeit verhalf. Eine fanatische junge Frau ritt in arabischen Gewändern durch die galiläischen Berge. Ihr Name war Manja Wilbuschewitz. Sie stammte aus Russland, wo sie sich unter großen inneren Qualen der kommunistischen Revolution verschrieben hatte. In Palästina gehörte sie zu den Mitbegründern einer ländlichen Kommune, einer frühen Form des Kibbuz, sowie zu den ersten Mitgliedern des ha-Schomer (»Der Wächter«), Vorläufer der israelischen Verteidigungsstreitkräfte.5 Manche jüdischen Einwanderer fingen in den gerade entstehenden zionistischen Dörfern ein neues Leben an; andere entschlossen sich, an der Mittelmeerküste eine neue Stadt zu gründen: Tel Aviv.
Die Christen wiederum brachten die imperialen Bestrebungen ihrer Heimatländer mit und ließen sich weitgehend in Jerusalem nieder. »Und so entwickelte sich Palästina und insbesondere Jerusalem zu einem wahren Turm von Babel«, wie der Kopf der zionistischen Bewegung, Chaim Weizmann, fand.6 Tatsächlich bemühten sich alle Christen, die Stadt nach ihren jeweiligen nationalen Vorbildern zu gestalten. Die russische Kirche sah mit ihren Zwiebeltürmen dem Kreml in Moskau ähnlich; die Italiener bauten ein Krankenhaus und gleich daneben einen Turm wie den des Palazzo Vecchio in Florenz. Auf dem Berg Zion errichteten die Deutschen eine Kirche, die dem Aachener Dom, der Krönungskirche Karls des Großen, nachempfunden war, während die deutsche Kolonie im Südteil der Stadt mit ihren schindelgedeckten, kleinen Steinhäusern einem Schwarzwalddorf ähnelte. Die Mitglieder dieser kleinen Gemeinde gehörten zum größten Teil der Templer-Sekte an. »Sonderbare Menschen sind in Palästina sicher«, schrieb Estelle Blyth, die Tochter jenes Mannes, der die anglikanische Kathedrale in Jerusalem errichten ließ, die wiederum vom New College in Oxford inspiriert war.7 Nicht weit davon ließ sich ein Anwalt aus Chicago nieder. Mit den Anhängern seiner Sekte gründete er die amerikanische Kolonie und träumte davon, Liebe, Mitgefühl und Frieden in der Welt zu verbreiten.8
Die Gründungsväter der amerikanischen Kolonie sind ebenfalls auf Bischof Gobats kleinem Friedhof beerdigt. Ganz in ihrer Nähe liegt der Sohn jenes deutschen Bankiers, der die erste Eisenbahnverbindung zwischen Jaffa und Jerusalem finanzierte. Daneben befindet sich die letzte Ruhestätte eines polnischen Arztes. Er eröffnete in der Straße der Propheten das erste Kinderkrankenhaus. In genau derselben Straße ließ Conrad Schick, der neben dem Arzt begraben ist, die Gebäude errichten, die seinen Ruf als bedeutendster Architekt des modernen Jerusalem begründeten. In seiner Schweizer Heimat hatte Schick Kuckucksuhren hergestellt. Etwas weiter oben liegt William Matthew Flinders Petrie begraben, ein Engländer, der von manchen als der Vater der modernen Archäologie angesehen wird. Er arbeitete lange Zeit in Ägypten, führte aber auch Ausgrabungen in Palästina durch. Später ließ er sich in Jerusalem nieder, wo er im Alter von fast neunzig Jahren starb. Vor der Beerdigung ließ die Witwe den Kopf des Verstorbenen abtrennen, in Formaldehyd konservieren und in einer Holzkiste nach London schicken, wo man durch eine pathologische Untersuchung dem Genie des Verstorbenen auf die Spur kommen wollte.*
Auf dem protestantischen Friedhof sind außerdem die vielen Fremden bestattet, die für Palästina ihr Leben ließen, darunter Soldaten, die in den von gewalttätigen Auseinandersetzungen geprägten Jahrzehnten der Mandatsperiode in Palästina Dienst taten. Feinde und Waffengefährten sind Seite an Seite begraben. Adolf Flohl war im Ersten Weltkrieg als Pilot zur Verteidigung der mit Deutschland verbündeten osmanischen Türken nach Palästina gekommen. Er wurde abgeschossen und starb im November 1917 – nicht einmal vier Wochen bevor die Briten in Jerusalem einmarschierten und die Herrschaft in Palästina übernahmen. Nicht weit von Flohl entfernt liegt Sergeant N. E. T. Knight, ein englischer Polizist, der im April 1948 ums Leben kam – nicht einmal vier Wochen bevor sich die Briten aus Palästina zurückzogen. Zwischen diesen beiden Schicksalen liegt eine Ära der Hoffnung und des Terrors.
Der Erste Weltkrieg, der Europas Eintritt ins zwanzigste Jahrhundert markierte, veränderte auch den Status Palästinas. Mehr als siebenhundert Jahre lang hatte das Land unter muslimischer Herrschaft gestanden. Durch den britischen Vorstoß im Nahen Osten ging es schließlich 1917 in christliche Hände über. Tatsächlich verglichen sich viele der britischen Soldaten mit den Kreuzrittern. Doch schon als die Briten in Palästina die Macht übernahmen, begann sich das Schicksal für das Empire zu wenden. Als Großbritannien dreißig Jahre später das Land verließ, hatte es gerade auf sein Kronjuwel, Indien, verzichten müssen. Palästina war also kaum mehr als der Epilog einer Geschichte, die bereits ihrem Ende entgegenging. In der historischen Entwicklung des Empire war Palästina nur eine ruhmlose Episode.10
Die ganze Sache war von Anfang an merkwürdig. Alles in allem schienen die Briten bei diesem Abenteuer ihr Urteilsvermögen verloren zu haben. Weder zogen sie aus ihrer Herrschaft über Palästina finanziellen Nutzen. Im Gegenteil: Die damit verbundenen Kosten gaben immer wieder Anlass zu Überlegungen, sich aus dem Land zurückzuziehen. Noch brachte ihnen die Besetzung Palästinas strategische Vorteile, obwohl dies oft behauptet wurde. Viele hochrangige Militärbeamte vertraten vielmehr die Ansicht, dass Palästina für die imperialen Interessen ohne Belang sei, und manche warnten sogar, das Engagement in Palästina könne zu einer Schwächung Großbritanniens beitragen. Schon früh deutete manches darauf hin, dass sich die Briten in politische Probleme verstrickten, für die es keine Lösung gab. Dies waren Gründe genug, um sich dem Land fern zu halten. Aber das Heilige Land war nicht irgendein Land. Sein Status richtete sich nicht allein nach seinem geopolitischen Wert. »Palästina war für die meisten von uns eher ein Gefühl als eine Realität«, wie ein Beamter der britischen Verwaltung es formulierte.11
Dabei wurden die Briten zunächst tatsächlich als Befreiungsarmee empfangen. Sowohl die Araber als auch die Juden strebten nach Unabhängigkeit, und beide hofften, sie unter britischer Schirmherrschaft zu erlangen. Aber von Anfang an war die Lage von Verwirrung, Doppeldeutigkeit und Enttäuschung geprägt. Vor ihrem Einmarsch in Palästina hatten die Briten in einem zaudernden, dilettantischen Briefwechsel die Araber glauben lassen, sie würden im Gegenzug für die Unterstützung der Briten gegen die Türken Palästina erhalten. Kurz vor der Eroberung des Landes verkündete die Regierung Seiner Majestät jedoch in der berühmten Balfour-Deklaration, sie betrachte die Bestrebungen der zionistischen Juden zur Schaffung einer »nationalen Heimstätte« für das jüdische Volk in Palästina »mit Wohlwollen«. Damit hatten die Briten den Zionisten im Grunde das Versprechen gegeben, in Palästina einen jüdischen Staat zu gründen. Mit einem Federstrich war das Gelobte Land nun zwei Parteien zugesagt. Obwohl die Briten »ein vollständiges und unversehrtes Palästina« in Besitz nahmen, wie der Hochkommissar formell bestätigte, war Palästina zerrissen, noch bevor die Regierung Seiner Majestät die Amtsgeschäfte aufnahm.
Die Briten hielten ihr den Zionisten gegebenes Versprechen; sie öffneten das Land für die massive Einwanderung von Juden. Bis 1948 nahm der jüdische Bevölkerungsanteil in Palästina um mehr als das Zehnfache zu. Den Juden wurde es gestattet, Land zu erwerben, Landwirtschaft zu betreiben, Industrie anzusiedeln und Banken zu gründen. Mit dem Einverständnis der Briten errichteten sie Hunderte neuer Siedlungen, darunter etliche Städte. Sie schufen ein Schulsystem und eine Armee; sie besaßen eine politische Führung und gewählte Institutionen. Das alles trug letztlich dazu bei, dass sie die Araber besiegten – unter britischer Schirmherrschaft und als Folge des Versprechens von 1917. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Annahme, die Briten seien pro-arabisch gewesen, förderte die britische Politik das zionistische Unternehmen.
Durch die Parteinahme für die zionistische Bewegung glaubten die Briten, die Unterstützung eines starken und einflussreichen Verbündeten zu gewinnen. Dahinter steckte die Vorstellung, dass die Juden den Lauf der Geschichte lenkten – eine Vorstellung, in der sich auf einzigartige Weise klassische antisemitische Vorurteile mit romantischer Verehrung des Heiligen Landes und seines Volkes vermischten. In Wirklichkeit war das jüdische Volk ohnmächtig; es hatte nichts aufzubieten außer diesen Mythos seiner geheimen Macht.
Die Briten taten so, als wäre die Errichtung einer nationalen Heimstätte für die Juden durchführbar, ohne den Arabern zu schaden, und manche mögen dies tatsächlich geglaubt haben. Aber natürlich war es unmöglich. In Wahrheit bildeten sich in Palästina zwei rivalisierende nationalistische Bewegungen heraus, die unweigerlich auf eine Konfrontation zusteuerten. »Für einen palästinensischen Nationalisten gab es kaum Spielraum für Zugeständnisse gegenüber dem jüdischen Nationalismus und seinen Befürwortern, den westlichen Mächten«, meint der Historiker Isa Khalaf.12 Von Anfang an blieben also nur zwei Möglichkeiten: Entweder besiegten die Araber die Zionisten, oder die Zionisten unterwarfen die Araber. Der Krieg zwischen beiden war unvermeidlich.
Und Großbritannien stand zwischen den Fronten. Hochkommissar Arthur Wauchope verglich sich selbst einmal mit einem Zirkusartisten, der versucht, auf zwei Pferden gleichzeitig zu reiten, von denen das eine nicht schnell und das andere nicht langsam laufen kann.13 Eine Zeit lang klammerten sich die Briten an die Hoffnung, es ließe sich ein palästinensisches Identitätsgefühl schaffen, das sowohl Juden als auch Araber einschließen würde, und sprachen in diesem Zusammenhang sogar vom »palästinensischen Volk«. Doch das waren leere Worte. Die Briten hielten die Araber, die Juden und nicht zuletzt sich selbst zum Narren, wie Chaim Weizmann einmal bemerkte.14 Er hatte Recht. Es ist eine faszinierende, aber nicht immer ruhmreiche Geschichte. Wie andere nationalistische Bewegungen auch, neigten die Völker in Palästina dazu, Nationalismus über Demokratie und Menschenrechte zu stellen. Der führende Kopf der arabischen Nationalbewegung machte sogar gemeinsame Sache mit Adolf Hitler.
Zwanzig Jahre nach der britischen Eroberung erhoben sich die Araber gegen ihre Besatzer. Bis 1939 hatten sie die Briten durch ihre Aufstände fast so weit gebracht, dass diese ernsthaft den Rückzug erwogen. Sie hätten sich besser dazu entschlossen. Doch es sollten noch knapp zehn Jahre vergehen, bis sie sich wirklich dazu durchringen konnten. In der Zwischenzeit brach der Zweite Weltkrieg aus, und als der Krieg vorüber war, mussten es die britischen Streitkräfte auch noch mit dem jüdischen Terrorismus aufnehmen. Tausende britischer Soldaten bezahlten das Abenteuer mit ihrem Leben.
Tatsächlich kamen die meisten von denen, die im hinteren Teil von Bischof Gobats Friedhof bestattet sind, bei den immer wieder aufflammenden Gewaltausbrüchen ums Leben, die für die dreißigjährige britische Herrschaft charakteristisch wurden. Lewis Andrews ist hier beerdigt; er wurde von arabischen Terroristen ermordet. Nicht weit von ihm entfernt liegt Thomas Wilkin, der jüdischen Terroristen zum Opfer fiel. Andrews, ein 41-jähriger Australier, war stellvertretender Distriktkommissar von Galiläa. Im September 1937 wollte er die Abendandacht in der anglikanischen Kirche in Nazareth besuchen, als ihn vier mit Pistolen bewaffnete Araber in der Nähe der Kirche überfielen. Sie feuerten neun Schüsse auf ihn ab; er war sofort tot. Der Polizist, der ihn begleitete, wurde ebenfalls getroffen und erlag später seinen Verletzungen. Andrews war ein Freund der Zionisten, in den Worten von Richter Anwar Nussaibeh ein Feind der Araber. Den Umstand, dass Andrews auf dem Weg zur Kirche ums Leben kam, kommentierte Nussaibeh wie folgt: »Er begegnete seinem Schöpfer, als er gerade auf dem Weg zu ihm war.«15 Thomas James Wilkin war Kriminalbeamter bei der palästinensischen Polizei; er wurde im Jahre 1944 wegen seiner Beteiligung an der Verhaftung und am Tod von Avraham Stern (»Ja’ir«), dem Anführer einer terroristischen jüdischen Untergrundorganisation, umgebracht. Dabei war Wilkin durchaus kein Judenhasser. Auf seinem letzten Gang begleitete ihn unter anderen Schoschana Borochow. Ihr Vater hatte den jüdischen Sozialismus in Russland mitbegründet. Sie und Wilkin waren ein Paar gewesen.16
Wenn man von Bischof Gobats Friedhof auf dem Zionsberg über den Berg des bösen Rates blickt, sieht man Government House, den Sitz der britischen Verwaltung. Im Westen sind vor dem Bergpanorama weitere Steingebäude zu erkennen, die die Briten zur Erinnerung an ihre Amtszeit in Palästina hinterließen, majestätische Bauwerke, die Autorität ausstrahlen. Da ist zunächst die schottische Kirche mit ihrem rechteckigen Glockenturm, die im Frühjahr stets von einem Meer von Wildblumen umgeben war. Weiter im Westen liegt Talbieh, ein überwiegend von wohlhabenden Arabern, darunter vielen Christen, bewohntes, vornehmes Villenviertel. Ihnen erging es unter dem britischen Mandat gut. Einer der Anwohner, ein Anwalt namens Abcarius Bey, ließ für eine jüdische Frau, die er liebte, ein großes Haus bauen. Sie hieß Leah Tennenbaum und war dreißig Jahre jünger als er. Als sie ihn verließ, vermietete er die Villa an Haile Selassie, den ins Exil geflüchteten äthiopischen Kaiser.17
Als Nächstes fällt der Blick auf einen breiten Boulevard, den die Briten anlegen ließen, um der Stadt ein dem Empire würdiges Aussehen zu verleihen. Sie benannten ihn nach ihrem König, Georg V. Am Ende der Prachtstraße befindet sich das Luxushotel King David. Im Jahre 1930 eröffnet, galt es bald als eines der Wunder des Orients; rasch entwickelte es sich zu einer Pilgerstätte für Genießer aus aller Welt. »Es ist atemberaubend!«, schwärmte Edwin Samuel in einem Brief an seine Mutter, die Gattin des ersten Hochkommissars. Ein Tourist aus Amerika hielt das Hotel gar für den restaurierten Tempel Salomons. Der Jerusalemer Bürgermeister Radschib an-Naschaschibi ging zum Haareschneiden hin.18
Das Hotel war berühmt für seine Küche und sein Personal. Hochgewachsene, athletisch gebaute schwarze Sudanesen in eng geschnittenen roten Jacketts bedienten die Gäste und boten ihnen auf goldenen Tabletts Whisky oder Kaffee an. Das King David Hotel entwickelte sich zu einem Mittelpunkt und Symbol britischer Macht, versinnbildlicht noch dadurch, dass in einem Flügel des Hotels Behörden der britischen Verwaltung untergebracht waren. Am 22. Juli 1946 schmuggelten jüdische Terroristen mehrere mit Sprengstoff gefüllte Milchkannen in das Untergeschoss des Hotels. 91 Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben; die meisten von ihnen sind auf dem Berg Zion bestattet. Die Inschriften mancher Grabsteine verkünden, die Verstorbenen hätten ihr Leben für Palästina gegeben. Auf anderen steht schlicht: »Bis wir uns wiedersehen.«
Gegenüber vom Hotel erhebt sich wie ein riesiger Phallus aus Stein das Gebäude der Young Men’s Christian Association (YMCA). Ebenfalls in den dreißiger Jahren errichtet, galt es den Zeitgenossen als architektonisches Wunderwerk. Es wurde von demselben Architekturbüro entworfen, das auch mit der Planung des Empire State Building in New York befasst war.19 Die Terrasse des YMCA-Gebäudes war ein beliebter Treffpunkt für Beamte der Mandatsbehörden und Mitglieder der High Society, die hier auf eine Limonade zusammenkamen – die Männer mit Tropenhelm, die Damen mit weißem Seidensonnenschirm. Sorgfältig achtete man darauf, die Regeln der guten englischen Gesellschaft einzuhalten. Nachmittags gab es Tee, und zum Abendessen zog man sich um. Gelegentlich besuchte man Abendvorträge oder Konzerte, ging zu Tanzveranstaltungen, die Annie Landau, eine ultraorthodoxe jüdische Schulleiterin, gab, oder schaute bei Katy Antonius vorbei, der legendären arabischen Gastgeberin und Ehefrau von George Antonius.
Die Briten bewahrten sich ein strenges Klassenbewusstsein: Die Soldaten und Unteroffiziere verbrachten ihre Freizeit in Bars und Bordellen, während die Offiziere auf Fuchs- oder Schakaljagd gingen. Der britische Jagdklub in Ramle bot seinen Mitgliedern rote Jacketts und Anstecknadeln mit den Insignien des Klubnamens, Ramle Vale Jackal Hounds, zum Kauf an. (Keines der Klubmitglieder versäumte es, dieses Jackett in seinen Memoiren zu erwähnen.)20 Die von den Behörden zwischen Latrun und Ramallah gepflasterte Straße diente hauptsächlich britischen Beamten auf dem Weg zum Wochenendpicknick.21 Und natürlich spielten die Briten Tennis. Fußball war in Palästina auch schon vor der Mandatszeit verbreitet, aber erst die Briten führten Tennis ein; es war Teil ihrer kolonialen Kultur und Mentalität.22 Ronald Storrs, der Gouverneur von Jerusalem, hielt die folgende Szene in seinem Tagebuch fest: Als der Kolonialminister Lord Milner Palästina besuchte, trank er mit dem Gouverneur von Hebron und dessen Gästen Tee. Zum anschließenden Tennismatch waren eigens zwei arabische Kriminelle aus dem Gefängnis geholt worden, die die Bälle aufsammeln sollten – das ganze Spiel über in eisernen Fußfesseln, was Milner mit Fassung zu tragen schien, wie Storrs bemerkte.23
Das koloniale Regierungssystem war »ein durch Wohlwollen abgemilderter Totalitarismus«, wie Distriktkommissar Edward Keith-Roach von Galiläa schrieb.24 Viele der Briten kamen mit imperialistischer Arroganz und einem starken Gefühl kultureller Überlegenheit. Manche empfanden ihre Herrschaft als Schicksal und Mission. So machte der erste Hochkommissar, Herbert Samuel, seiner Regierung den Vorschlag, Palästina zu erobern, um es »zu zivilisieren«.25 In einem Nachruf auf einen verstorbenen Mitarbeiter würdigte Samuel dessen Verdienste mit dem für seine Begriffe höchsten Lob: »Als Leiter der Zivilverwaltung trug er die Hauptlast der Bemühungen, praktisch von Grund auf die Strukturen eines modernen Staates aufzubauen.«26
Manche in der britischen Verwaltung identifizierten sich mit den Juden, andere mit den Arabern. Und dann gab es die, die beide Seiten verachtenswert fanden. »Ich verabscheue sie alle gleichermaßen«, schrieb General Sir Walter Norris »Squib« Congreve. »Araber, Juden und Christen, in Syrien und Palästina, sie sind alle gleich, ein widerwärtiges Volk. Die ganze Sippschaft ist nicht einen einzigen Engländer wert!« Der Polizist Raymond Cafferata drückte es etwas höflicher aus: »Ich bin weder antisemitisch noch anti-arabisch, ich bin lediglich pro-britisch.« So empfanden viele, vielleicht sogar die meisten Briten, die in Palästina stationiert waren.27
In ihrer Herrschaft spiegelte sich ein Kaleidoskop von Wahrnehmungen, Positionen und Interessen wider, die ständig miteinander in Konflikt gerieten und neu geordnet wurden. Beamte, Diplomaten und Politiker, Militärs und Journalisten stritten in einer schier endlosen Flut aus Worten, Intrigen, Allianzen und Treuebrüchen um die richtige Politik. Das Büro des Premierministers, das Außenministerium, das Kolonialministerium, das Finanzministerium, das Indienbüro, das Kriegsministerium und die verschiedenen Abteilungen der Armee waren nur einige der vielen Behörden, die in der Regierung Palästinas mitreden wollten. Auch die lokale Verwaltung war von einer Bürokratie gekennzeichnet, in der die verschiedensten Kräfte und widersprüchlichsten Positionen miteinander wetteiferten. Die Zweigstellen, Abteilungen und Unterabteilungen bildeten ein schachbrettartiges Mosaik von Institutionen, in denen zahllose Mitarbeiter damit beschäftigt waren, Memoranden, Berichte und Briefe zu verfassen, die Hunderttausende von Blättern füllten. Fast jede Notiz, die geschrieben wurde, erzeugte neue Schriftstücke, die genau das Gegenteil besagten.
Die Briten hatten bei ihrer Ankunft ein unterentwickeltes Land vorgefunden. Als sie es verließen, konnten sie auf große Fortschritte verweisen – vor allem bei den Juden –, hinterließen aber auch – vor allem bei den Arabern – viel Rückständigkeit. Kurz vor dem Abzug aus Palästina äußerte ein hochrangiger Regierungsbeamter, die Briten hätten niemals eine Palästina-Politik gehabt. »Es gab nichts außer schwankenden politischen Maßnahmen, Zaudern … keine richtige Politik.«28 Er hatte Recht. Eine Untersuchungskommission nach der anderen kam ins Land, analysierte die arabisch-jüdischen Beziehungen und reiste wieder ab. Die britische Regierung nahm für gewöhnlich ihre Empfehlungen an, änderte dann ihre Meinung und berief eine neue Kommission ein. »Wenn all die Statistiken und Berichte, die von den insgesamt neunzehn einberufenen Kommissionen verfasst wurden, übereinander gestapelt würden, hätte man einen Turm so hoch wie das King David Hotel«, schrieb Henry Gurney, der letzte Chefsekretär der Mandatsregierung.29 Wie die meisten seiner Kollegen verließ er Palästina enttäuscht, zynisch, verärgert und traurig. Der letzte Hochkommissar behauptete, die Briten hätten sich »mit Würde« aus dem Land zurückgezogen. Das stimmte nicht. Sie seien mit reinem Gewissen aus Palästina abgezogen, schrieb Gurney, und das traf zumindest für viele von ihnen zu.30 »England ist ein merkwürdiges Land«, urteilte David Ben Gurion.31 Und doch reiste er, als die britische Regierung Palästina aufgeben wollte, nach London, um sie dazu zu bewegen, noch etwas länger zu bleiben.
* Der israelische Autor Meron Benvenisti berichtet, dass die Holzkiste bei ihrer Ankunft in London von niemandem in Empfang genommen wurde und daher in den riesigen Kellerräumen des Britischen Museums verschwand. »Der Kopf von Flinders Petrie«, so Benvenisti, »ruht somit am passendsten Ort, den man sich vorstellen kann – inmitten der Schätze der Vergangenheit, die er selbst ausgrub und studierte.« Diese faszinierende Legende ist in ihrer Verschrobenheit so typisch für Jerusalem, dass man sie kaum anzutasten wagt, aus Angst, sie könne sich als Hirngespinst erweisen. Vierzig Jahre später wurde der Kopf des genialen Verstorbenen wiederentdeckt.9
ILLUSION(1917–1927)
Jane Lancaster war eine merkwürdige Person. Unverheiratet lebte sie, die Engländerin und Christin, in einem jüdischen Viertel im südlichen Jerusalem. Niemand wusste, warum sie nach Palästina gekommen war, aber eines wusste man genau – Miss Lancaster liebte das Land der Bibel. Einmal im Jahr brach sie in die Hügel Judäas auf, um Narzissenzwiebeln, Alpenveilchen und Anemonen zu pflanzen.
1
Khalil as-Sakakini bekommt Besuch
AM FRÜHEN MORGEN des 28. November 1917, einem Mittwoch, klopfte jemand an Khalil as-Sakakinis Haustür und brachte großes Unglück über ihn. Tatsächlich wäre Sakakini seinetwegen beinahe aufgehängt worden. Sakakini, ein christlicher Araber, war Pädagoge und Schriftsteller und in Jerusalem überall bekannt. Er lebte westlich der Altstadt, knapp außerhalb der Stadtmauern.
An jenem Abend hatte er nicht einschlafen können. Nachdem er sich unruhig von einer Seite auf die andere gewälzt hatte, war er schließlich aufgestanden, hatte Licht gemacht, sich eine Wasserpfeife angezündet und an den Tisch gesetzt, um einen Brief zu schreiben. »Sogar das Schlimmste ist nicht ganz so schlimm«, stand unter anderem darin zu lesen. Als er fertig war, ging es auf drei Uhr zu. Kaum hatte Sakakini sich wieder hingelegt, hörte er ganz nah das Dröhnen von Mörsern – als würden sie in seiner Straße abgefeuert. Diesmal stand seine Frau Sultana mit ihm auf. Gemeinsam gingen sie ein Stockwerk höher und lauschten. Das Donnern kam von Westen, aus der Gegend von Mea Schearim, dem jüdischen Viertel, aber sehen konnten Sakakini und seine Frau nichts. Gegen 4.30 Uhr morgens – die Sakakinis waren gerade wieder zu Bett gegangen, in der Hoffnung, noch ein paar Stunden Schlaf zu finden – setzte Artilleriefeuer ein. Die Granateneinschläge kamen immer näher, und das Donnern war gewaltig. »Wir fürchteten, das ganze Haus würde über uns zusammenstürzen«, notierte Sakakini später in seinem Tagebuch.1 Die britische Armee rückte rasch vor; Premierminister David Lloyd George hatte sich zum Ziel gesetzt, Jerusalem noch vor Weihnachten einzunehmen.2
Im Morgengrauen klopfte es an der Haustür. Sakakini ging hinunter und öffnete. Vor ihm stand Alter Levine, ein jüdischer Versicherungsagent, den er flüchtig kannte. Levine bat Sakakini, ihm Unterschlupf zu gewähren, da er von der türkischen Polizei gesucht werde. In den vergangenen Nächten sei er bereits von einem Bekannten zum nächsten geflüchtet, aber nun wisse er nicht mehr, wohin.
Levines Probleme hatten im April begonnen, als die Vereinigten Staaten an der Seite der Alliierten in den Krieg eingetreten waren. Dadurch wurde mit seinem Heimatland auch der amerikanische Staatsangehörige Levine mit einem Schlag zum Feind der Türkei. Mit dem Abzug des amerikanischen Konsuls aus Jerusalem verlor Levine jeglichen Schutz; ihm drohte die Deportation. Graf Ballobar, der Konsul von Spanien, das im Krieg neutral geblieben war, riet ihm, die Stadt zu verlassen. Levine schlüpfte in Petach Tikwa unter, einer jüdischen Ortschaft in der Nähe von Tel Aviv, seine Familie zog in die südlich davon gelegene Siedlung Rechovot. Im September erfuhr Levine von Graf Ballobar, dass die türkischen Behörden ihn der Spionage verdächtigten.3*
Levine umwehte tatsächlich ein Hauch des Geheimnisvollen. Er reiste häufig und unterhielt Kontakte zu Diplomaten zahlreicher Botschaften. Der amerikanische Konsul, Otis Glazebrook, gehörte zu seinen Freunden, und sehr wahrscheinlich berichtete Levine ihm von Zeit zu Zeit über die Lage in Jerusalem. Allerdings geben die persönlichen Papiere Levines keinen Hinweis auf eine Spionagetätigkeit.
So bald wie möglich kehrte Levine nach Jerusalem zurück. Einmal wurde er verhaftet. Warum, ist unklar – in jener Zeit wurden viele Leute ohne bestimmten Grund in Arrest genommen. Vielleicht lag es an seiner amerikanischen Staatsangehörigkeit, wurden doch viele amerikanische Staatsbürger damals aus Jerusalem deportiert.5 Möglicherweise hatte auch ein von ihm veröffentlichter Gedichtband Anlass zu dem Verdacht gegeben, er schüre pro-zionistische und anti-türkische Gefühle.6 Jedenfalls gelang es Levine offenbar, jemanden zu bestechen, denn man ließ ihn frei. Aber er wurde weiterhin gesucht. Von nun an wechselte er häufig seine Verstecke, und Levines Frau und seine drei Töchter taten es ihm gleich.
Trotzdem wurde die Familie von der türkischen Polizei aufgespürt und die Mutter bei der Verhaftung vor den Augen der Mädchen misshandelt. Im Gefängnis peitschte man Gittel Levine aus, damit sie den Aufenthaltsort ihres Mannes verriet. Konsul Ballobar bestätigte später, dass man sie gefoltert habe und ihre Nerven schwer darunter gelitten hätten. In Wahrheit verlor sie den Verstand.7 Levine unterdessen suchte Zuflucht bei Khalil as-Sakakini, »Lehrer, Christ und Freund«, wie er später schrieb.8
Sakakini war zutiefst beunruhigt. »Gott bewahre«, dachte er bei sich, »ich kann doch keinen Spion bei uns aufnehmen.« Aber er konnte es auch nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, Levine abzuweisen. Er wusste nicht, was er tun sollte. Noch nie hatte er eine so folgenschwere Entscheidung treffen müssen.9
DREI JAHRE ZUVOR, im Oktober 1914, hatte sich unter dem Fenster des spanischen Konsuls in Jerusalem eine kleine Menschenmenge versammelt. Anlass war der Eintritt der Türkei in den Ersten Weltkrieg, durch den das Osmanische Reich sein Schicksal mit dem des deutschen Kaiserreichs verknüpfte. Der Graf von Ballobar, Antonio de la Cierva Lewita, war auf seinen Balkon getreten und hatte die Menge begrüßt; die Bewohner der Stadt seien gekommen, um dem Sultan ihre Loyalität zu bezeugen, hielt er später fest. Auf einer Gebetsversammlung in der Al-Aksa-Moschee wurde verkündet, die Türkei führe einen Dschihad – einen heiligen Krieg. Die jüdische Gemeinde beeilte sich ebenfalls, dem türkischen Reich ihre Untertanentreue zu bekunden. Viele ihrer Mitglieder setzten, wenn auch widerwillig, Tarbusche auf und stellten patriotisches Verhalten zur Schau, wie der Bürgermeister von Tel Aviv, Me’ir Dizengoff, berichtet: Sie schmückten ihre Straßen und organisierten Festparaden, als im Juni 1916 bekannt wurde, dass der britische Heeresminister, Lord Kitchener, bei einem Schiffsunglück ertrunken war. Die christlichen Bewohner Jerusalems erschreckte das laut Ballobar zutiefst.10
Bei Kriegsausbruch plante Khalil as-Sakakini gerade ein großes Fest, um den ersten Geburtstag seines Sohnes Sari zu feiern. Aber »wegen der gegenwärtigen Situation haben wir uns entschlossen, ihn lieber nur tausend Mal zu küssen«. Wie viele Menschen glaubte Sakakini, dass der Krieg schnell vorüber sein würde. Vielleicht konnte man das Fest an Saris nächstem Geburtstag nachholen.11 Bis dahin würde er alles in seiner Macht Stehende tun, um der Einberufung in die türkische Armee zu entgehen.
Auch die meisten Juden hatten Angst, rekrutiert zu werden. Viele Einwanderer hatten ihre frühere Staatsangehörigkeit nicht aufgegeben – darunter Tausende Juden russischer Herkunft. Nun, da Russland in der Allianz mit Frankreich und Großbritannien Kriegsgegner des Osmanischen Reiches geworden war, standen sie vor einer schweren Entscheidung. Sie konnten das Land freiwillig verlassen, ihre Ausweisung abwarten oder die osmanische Staatsangehörigkeit annehmen und sich zur Armee einziehen lassen. Angesichts der drohenden Deportationen entstand eine zionistische Initiative, die die Annahme der osmanischen Staatsangehörigkeit trotz der dadurch entstehenden Wehrpflicht propagierte, um auf diese Weise einen Rückgang des jüdischen Bevölkerungsanteils zu verhindern. Zu den Befürwortern der Initiative gehörten zwei Persönlichkeiten, die im politischen Zionismus noch eine wichtige Rolle spielen sollten: der Jerusalemer Sprachwissenschaftler Elieser Ben Jehuda, der später als »Vater« des Neuhebräischen bekannt wurde, und David Ben Gurion, damals ein noch unbekannter Politiker in seinen Zwanzigern.
Auf seinen Reisen durch Palästina, auf denen er für die osmanische Staatsangehörigkeit warb, trug Ben Gurion demonstrativ einen Tarbusch und kleidete sich wie ein türkischer Regierungsbeamter. Wenn er vom Osmanischen Reich sprach, sagte er stets »unser Land«. Überzeugt vom Sieg der Türken, hoffte er, sie würden als Gegenleistung für treue jüdische Dienste nach dem Ende der Feindseligkeiten das Streben der Juden nach Autonomie in Palästina unterstützen. Deshalb schlug er sogar die Schaffung eines jüdischen Bataillons innerhalb der türkischen Armee vor, stieß damit jedoch auf Widerspruch. Denn eine andere Gruppe von Zionisten forderte vehement, man solle lieber auf die Alliierten setzen, und plädierte für die Aufstellung eines jüdischen Kontingentes im Rahmen der britischen Verbände. »Vielleicht hatten wir Unrecht«, räumte Ben Gurion später ein, »vielleicht aber auch nicht.«12*
Obwohl die osmanischen Behörden die jüdische Einwanderung nach Palästina und den Erwerb von Land zu Siedlungszwecken beschränkt hatten, konnte die zionistische Bewegung bis 1914 eine Reihe von Erfolgen verbuchen. In den Jahren unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatten sich Zehntausende von Juden in Palästina niedergelassen und mit Erlaubnis der Türken landwirtschaftliche Siedlungen gegründet und mit dem Aufbau eines unabhängigen hebräischen Schulsystems begonnen.13 Während des Krieges sahen sich die Zionisten hingegen zunehmend schärferer Verfolgung ausgesetzt. Weitgehend pro-westlich eingestellt, überwiegend den Staaten der türkischen Kriegsgegner zugehörig, galten sie als Bedrohung für die islamische Hegemonie.
Allerdings wurde der Zionismus nicht von allen in Palästina lebenden Juden unterstützt; vielmehr war ein Großteil der prä-zionistischen jüdischen Bevölkerung – jener Juden also, die schon vor 1880 in Palästina lebten – ultraorthodox. Die Ultraorthodoxen aber standen der Vorstellung einer säkularen jüdischen Autonomie im Heiligen Land zutiefst feindselig gegenüber. Nach ihrer religiösen Überzeugung konnte das Heilige Land nur durch die Ankunft des Messias und nicht durch politische Bestrebungen erlöst werden – das zionistische Ideal der säkularen Erlösung empfanden sie als Sakrileg. »Ein tiefer Abgrund trennt die zwei Teile des Jischuv«*, schrieb Ben Gurion und rief zum Widerstand gegen jene Rabbiner auf, »die ihr Volk verraten«. Diese wiederum fürchteten, die zionistischen Umtriebe könnten die Behörden dazu veranlassen, gegen die Juden insgesamt vorzugehen, und fühlten sich durch die wachsende Macht der Zionisten in ihrer Rolle als Oberhäupter der jüdischen Gemeinschaft herausgefordert.15
Dschamal Pascha, der vom Sultan eingesetzte Gouverneur Palästinas, war sich dieser Spaltung durchaus bewusst und achtete daher sorgfältig darauf zu betonen, dass er nur den Zionismus ablehne, nicht aber die Juden insgesamt. In seinem Tagebuch erwähnt Konsul Ballobar, Dschamal Pascha sei mit einer Jüdin verheiratet, ein Gerücht, das Dschamal später bestätigte. Die einfachen Leute in der Jerusalemer Altstadt behaupteten, seine Frau sei eine Hure.16
Ebenso genau beobachtete Dschamal die arabischen Unabhängigkeitsbestrebungen. In seinem Tagebuch schildert Ballobar beklommen die ersten Hinrichtungen von Mitgliedern der arabischen Nationalbewegung. Da es türkischer Brauch war, die Leichen der Gehenkten an den Toren der Stadt zur Schau zu stellen, konnte Ballobar sie vom Fenster des Konsulates aus sehen. Bei mindestens einer Gelegenheit entdeckte er darunter einen Mann, den er persönlich kannte – den Mufti von Gaza. Einmal scherzte Dschamal, der häufig bei Ballobar zu Gast war, mit ihm trank und Poker spielte, oft auch Ausritte in die judäische Wildnis unternahm, er würde Ballobar hängen lassen. Der Konsul konnte darüber nicht lachen.17
Bei Kriegsende hatte Ballobar, eine Schlüsselfigur im osmanischen Jerusalem, die diplomatische Vertretung für ein Dutzend Länder übernommen, darunter viele, die sich gegenseitig bekämpften, wie zum Beispiel Russland, Österreich-Ungarn, Deutschland, Frankreich, das Britische Empire und die Vereinigten Staaten. Wahrscheinlich findet man in den Annalen der Diplomatie keinen anderen Mann, der gleichzeitig der Gesandte so vieler Länder war.18 Bei Kriegsausbruch war der Graf noch keine dreißig Jahre alt. Der Sohn einer Jüdin und eines spanischen Offiziers – seine Eltern hatten sich in Wien kennen gelernt, wo sein Vater als Militärattaché tätig war – trug stets sorgfältig gebügelte Anzüge und ausgefallene Panamahüte. Obwohl er klein und mager war, mit einer spitzen Nase und langem Schnurrbart, erinnerte man sich an ihn als »einen attraktiven und liebenswürdigen jungen Mann«.19 Die opulenten Festessen in seinem Haus gegenüber der äthiopischen Kirche in Westjerusalem, in unmittelbarer Nachbarschaft von Elieser Ben Jehuda, waren legendär. Eine junge Dame aus seiner Heimat, der er während ihrer Pilgerreise in Jerusalem begegnete, wurde die große Liebe seines Lebens.
Ballobars Hauptinteresse in Palästina galt dem Schutz der Klöster und Kirchen; aber er nahm auch regen Anteil an den jüdischen Belangen.20 In seinem Tagebuch zeichnet er die örtliche Politik als ein buntes Kaleidoskop von Intrigen und Täuschungen, als Ränkespiel von Paschas und Patriarchen, Diplomaten und hohen Offizieren, Händlern und Söldnern, deren unersättliche Gier nach gutem Essen und Schmeicheleien nur noch von ihrer Leidenschaft übertroffen wurde, Klatsch auszutauschen, sich gegenseitig zu hintergehen, auszunutzen, zu bestechen und auszuspionieren, während um sie herum ein Reich zerfiel.
Der junge Graf trug das Joch seiner Verantwortung mit gewinnender Selbstironie. Er war ein kluger Mann und guter Beobachter, der aus dem, was er sah, viel lernte und das, was er sah, treffsicher festzuhalten vermochte. Er beschrieb die armselig aussehenden türkischen Soldaten, die zur Eroberung des Suezkanals undiszipliniert und in zerlumpten Uniformen aufbrachen, die Siegesparaden, die häufig vor ihrem Abzug veranstaltet wurden; einmal fiel ihm dabei ein Soldat auf, der sein Trinkwasser in einem Kinderwagen vor sich her schob, den er höchstwahrscheinlich aus einem jüdischen Hinterhof gestohlen hatte. Am südlichen Ortsausgang von Jerusalem, an der Straße nach Bethlehem, stieß er auf eine Gruppe von Frauen und Kindern, die unter der Aufsicht eines türkischen Soldaten Gräben aushob. Der wachhabende Soldat strickte. Mit einer solchen Armee hielt es der Graf für ausgeschlossen, dass die Türken den Krieg gewannen. »Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kanals wieder – oder im Paradies«, hatte Dschamal Pascha einmal zu Ballobar gesagt. Der Diplomat hielt die zweite Möglichkeit für wahrscheinlicher, zog es jedoch vor, diese Einschätzung für sich zu behalten.
Der spanische Konsul Graf Antonio de Ballobar 1918 in Jerusalem
Im Januar 1917 bemerkte Ballobar fünf Militärlastwagen, die, voll besetzt mit türkischen Soldaten, vor seinem Haus parkten. Sie blieben den ganzen Tag dort stehen, obwohl es ununterbrochen nieselte. Erst kurz vor fünf Uhr nachmittags bekam jeder Soldat ein winziges Brötchen und einen Blechnapf dünner Linsensuppe zu essen, wie Ballobar voller Mitgefühl für die hungrigen jungen Männer notierte. Draußen in der Wüste hatten sie nicht die geringste Chance.21 Wenn sie nicht dem Feind zum Opfer fielen, dann gewiss dem Hunger. Manche Soldaten plünderten die Getreidemühlen der Stadt, andere schlachteten ihre eigenen Kamele, um an Fleisch zu kommen. Ein Jerusalemer Junge berichtete, ein türkischer Soldat habe ihm auf dem Schulweg sein angebissenes Fladenbrot aus der Hand gerissen.22
Viele türkische Soldaten desertierten. Bertha Spafford Vester, deren Eltern die amerikanische Kolonie gegründet hatten, beobachtete, wie eine Gruppe Wehrpflichtiger in der Stadt eintraf. Ihre Vorgesetzten hatten sie in Ketten legen lassen.23
EINIGE ZEIT NACH dem erfolglosen türkischen Angriff auf den Suezkanal im Frühjahr 1917 startete die britische Armee ihren Feldzug zur Eroberung der Stadt Gaza. Zwei Mal versuchte sie, die Stadt einzunehmen, wurde aber jedes Mal zurückgeschlagen. Die Gefechte um die Stadt kosteten Tausende von Soldaten auf beiden Seiten das Leben, und auch die Einwohner Gazas erlitten hohe Verluste.24 Viele mussten die Stadt verlassen, da die Türken fürchteten, die Bevölkerung könne die Truppen behindern. »Eine furchtbare Panik hat nicht nur die Einwohner von Gaza, sondern das ganze Land ergriffen«, schrieb Mosche Smilanski, ein Landwirt und führender zionistischer Denker und Schriftsteller. »Was ist der Zweck dieser Vertreibung? Soll das ganze Land vertrieben werden, bevor die Briten kommen?« Flüchtlinge, von Hunger, Angst und Verzweiflung gezeichnet, verstopften die Straßen.
Eine Frau aus Gaza schilderte, wie die Türken bei der Evakuierung vorgingen. Soldaten zogen mit Peitschen von Haus zu Haus, hieben nach links und rechts auf die Bewohner ein und jagten sie ohne ihre Habseligkeiten auf die Straße. Smilanski zufolge wurden 40 000 Menschen aus Gaza vertrieben, darunter auch einige jüdische Familien. Der arabische Historiker Aref al-Aref, der spätere Gouverneur der Stadt, schätzte ihre Zahl auf 28 000; ungefähr 10 000 Personen hatten die Stadt schon vor den Kämpfen verlassen.
Die wohlhabenden Bewohner Gazas ließen sich in Hebron, Ramle und Lydda (Lod) nieder; die armen verteilten sich auf die Dörfer Palästinas oder lebten im Freien, auf Feldern und in Obstgärten. Laut Smilanski beabsichtigten die osmanischen Behörden, einen Teil der arabischen Flüchtlinge in jüdischen Dörfern unterzubringen: »Wir waren sehr besorgt bei dem Gedanken an diese besonderen Gäste. Wir hatten Angst vor der Beengtheit, dem Schmutz und der allgemeinen Unruhe. Aber wir trösteten uns mit dem Gedanken: Besser, die Araber werden zu uns geschickt, als wir zu den Arabern.«25 Der Plan wurde nie umgesetzt, doch wenige Wochen später – als die Kämpfe näher rückten – mussten auch die Bewohner von Jaffa und Tel Aviv ihre Häuser verlassen. Manche der vertriebenen Juden suchten Zuflucht bei den Arabern.
Jaffa hatte damals etwa 50 000 Einwohner, darunter ungefähr 10 000 Juden; etwa 2000 Juden lebten im benachbarten Tel Aviv.26 Die Behörden behaupteten, die Evakuierung Jaffas sei notwendig, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Soldaten könnten die Stadt nicht verteidigen, wenn sie das Schreien der Frauen und Kinder hörten, erklärte Dschamal Pascha Konsul Ballobar.27 Nur einige wenige, jüngere Juden durften in der Stadt bleiben, um die Häuser zu verteidigen.28
Die Evakuierung nahm zwei Wochen in Anspruch und artete rasch in Chaos aus. Ein Reporter vor Ort schilderte das Durcheinander von Menschen, Pferden, Maultieren und Bergen von Habseligkeiten. Tagelang saßen Männer, Frauen und Kinder unter freiem Himmel auf ihren Bündeln und warteten, bis sie an der Reihe waren. Ein Wagen nach dem anderen brach auf – Dutzende, Hunderte von Wagen, beladen mit Klavieren, Teppichen, schweren Möbeln, Thorarollen, Weizen und anderen Nahrungsmitteln. Sie hinterließen eine Fährte aus Tierexkrementen. Smilanski beobachtete, wie ein Kinderwagen von einem Esel gezogen und von zwei Kindern gelenkt wurde.29 »Tel Aviv ist eine Einöde«, schrieb er. »Eine tödliche Stille liegt über den Straßen, so als ob der Ort von einer Seuche heimgesucht worden wäre.« Ein Journalist entdeckte an einer Mauer einen von Kinderhand hingekritzelten Abschiedsgruß: »Auf Wiedersehen, Tel Aviv.«30
Die Vertreibung aus Jaffa und Tel Aviv versetzte der jüdischen Bereitschaft, die türkischen Interessen zu unterstützen, den Todesstoß. »Dieses Verbrechen werden wir Dschamal Pascha niemals vergeben!«, schrieb der Geschäftsmann Mordechai Ben-Hillel Hacohen, der als Mitbegründer Tel Avivs eine bekannte Figur des öffentlichen Lebens war. Seine Empörung hatte auch persönliche Gründe: Sein Sohn David diente in der türkischen Armee. Ursprünglich stolz auf den Offiziersrang seines Sohnes, hatte Hacohen nach der Vertreibung aus seinem Haus das Gefühl, sein Sohn setze sein Leben für ein verderbtes Reich aufs Spiel; alle beteten nun darum, dass es rasch zusammenbrechen möge.
Ben-Hillel (Markus Hillelowitsch) Hacohen stammte aus dem weißrussischen Mogilew und war ein Zionist der ersten Stunde. Er war der erste Delegierte, der beim ersten Zionistenkongress 1897 eine Rede auf Hebräisch hielt, er gehörte zu den Gründungsvätern der zionistischen Organisation in Palästina; eine seiner Töchter heiratete den Sohn des einflussreichen Schriftstellers und Philosophen Achad Ha’am, eine andere Dr. Arthur Ruppin, der in der zionistischen Siedlungsbewegung eine wichtige Rolle spielte. Als er von dem Befehl, Jaffa zu evakuieren, erfuhr, spielte er kurz mit dem Gedanken an Widerstand. Wenn Dschamal merkte, dass die Juden nicht bereit waren, sich »wie Lämmer zur Schlachtbank« führen zu lassen, würde ihn das vielleicht von der Umsetzung seines Plans abhalten. Aber diese Überlegung war nur ein Ausdruck hilfloser Wut, wie er selber schnell erkannte, »denn was kann eine kleine Schar von Menschen letztlich schon ausrichten, und wie können sich Schafe gegen die Wölfe der Wüste behaupten«? Die Entscheidung, vor der Hacohen stand, sollten die Zionisten in Palästina noch häufig treffen müssen: eine Wahl zwischen Gehorsam und Widerstand, zwischen Zurückhaltung und Kampf, zwischen jüdischem Patriotismus, der die Bevölkerung gefährden konnte, und kommunaler Verantwortung, die oft Kompromisse bis hin zu ohnmächtiger Resignation verlangte.
Aber die eigene Schwäche erboste Hacohen so sehr, dass er, um seiner Wut Luft zu machen, die arabische Bevölkerung beschuldigte, primitiv und illoyal zu sein. Viele der Araber hatten es geschafft, trotz des Evakuierungsbefehls in Jaffa zu bleiben, und vielen anderen gelang es, schon kurz danach in ihre Häuser zurückzukehren. »Wir Europäer sind loyal; wir sind es gewohnt, zu gehorchen und Befehle präzise und pünktlich auszuführen«, schrieb Hacohen daraufhin in einer Mischung aus Arroganz und Selbstmitleid.31
Viele der vertriebenen Juden suchten zunächst nordwestlich von Tel Aviv, in Petach Tikwa, Zuflucht. Als sich die Kämpfe auszuweiten drohten, mussten sie erneut fliehen, diesmal nach Norden, nach Galiläa. Der Schriftsteller und Lehrer Josef Chaim Brenner, selbst Flüchtling, schilderte eine Frau, die auf dem Boden neben einem toten Säugling saß. Viele der Vertriebenen lebten unter katastrophalen Bedingungen; innerhalb weniger Wochen breitete sich Typhus aus. »Eine Katastrophe folgt der nächsten«, klagte Mosche Smilanski.32
Die Lebensbedingungen in Palästina waren überall gleich schlecht. In manchen jüdischen Dörfern hatten die Arbeiter nur alle zwei Tage etwas zu essen. Es gab zwar einige Suppenküchen, doch die reichten nicht aus. Viele Menschen starben an Cholera. Verbissen dokumentierte Konsul Ballobar die Verbreitung der Krankheit – er selbst hörte aus Angst vor kontaminiertem Wasser auf, sich die Zähne zu putzen. Mosche Smilanski besuchte das ultraorthodoxe Viertel Mea Schearim und war tief erschüttert: »Mein Gott!«, vertraute er seinem Tagebuch an. »Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so bitterliche Armut und so viel Schmutz gibt … Alte Männer und Frauen, aufgebläht vom Hunger. Kinder, denen das Entsetzen und der Hunger ins Gesicht geschrieben stehen. Aus ihrer Kehle dringt ein jammervolles, unaufhörliches Wimmern – das Wimmern des Hungers. Und alle sind fast nackt, bedeckt nur von einigen schmutzigen Lumpen. Sie wimmeln von Ungeziefer. … Das Gesicht, die Hände, der ganze Körper – alles starrt vor Schmutz und ist übersät von eitrigen Wunden. … Dass Menschen so leben können, ohne den Verstand zu verlieren!« Einer anderen Quelle zufolge sprangen viele Menschen von Dächern oder ertränkten sich in Brunnen, um nicht hilflos mit ansehen zu müssen, wie ihre Kinder verhungerten.
Bei den Arabern fand Smilanski dieselben katastrophalen Verhältnisse vor. In manchen Dörfern waren bis zu einem Drittel der Bewohner verhungert oder Krankheiten zum Opfer gefallen. »Auf allen Straßen«, so Smilanski, »hinter jedem Zaun, in allen Flüssen und Brunnen liegen Tote. Wenn jemand krank wird, lässt man ihn auf dem Feld oder der Straße liegen, bis er stirbt, und niemand kümmert sich um ihn.« Laut Bertha Spafford Vester boten arabische Frauen auf dem Hof der amerikanischen Kolonie ihre Säuglinge zum Verkauf an, um sich Nahrung zu beschaffen. Boris Schatz, Künstler und Gründer der Kunsthochschule Bezalel in Jerusalem, berichtete von einer jüdischen Frau, die nach tagelangem Hundegebell zum Hof ihrer arabischen Nachbarn ging, um nach dem Rechten zu sehen. »Als sie die Haustür öffnete«, schrieb Schatz, »sah sie drei Kinder tot auf dem Boden liegen; die Mutter kauerte auf einem Häufchen Lumpen in einer Ecke des Hauses und hielt ihre älteste Tochter im Arm. Sie näherte sich ihnen und entdeckte zu ihrem Entsetzen, dass sie ebenfalls tot waren. Als sie aus dem Haus rannte, um andere Nachbarn zu holen, vergaß sie, die Tür zu schließen. Bei ihrer Rückkehr hatte der Hund bereits eines der Kinder gefressen.« Izzat Darwaza, ein Führer der arabischen Nationalbewegung Palästinas, schrieb, Frauen hätten das Fleisch ihrer Kinder gegessen.33 Schätzungen zufolge hatte die Bevölkerung in Palästina bis zum Jahre 1917 durch Krankheit, Hunger, Flucht und Vertreibung stark abgenommen; von 700 000 Arabern und 85 000 Juden, die vor dem Krieg im Land lebten, waren bis 1917 nur noch 630 000 Araber und 55 000 Juden übrig geblieben.* Viele von ihnen sehnten die Ankunft der Briten herbei.
IM FRÜHJAHR 1917 brachen die britischen Truppen von Ägypten aus auf. Ihr Weg führte durch die Wüste Sinai nach Norden. Ihr Vorrücken hing vom Bau einer Eisenbahnlinie ab – einem Unternehmen, für das 56 000 Arbeitskräfte und 35 000 Kamele benötigt wurden. Außerdem mussten Rohre zur Gewährleistung der Wasserversorgung verlegt werden. Die Truppen standen unter dem Oberbefehl von General Sir Edmund Allenby, einem hoch gewachsenen Mann mit beeindruckender Adlernase, der Kraft, Autorität und Charisma ausstrahlte. Sein Kommandozelt ließ er stets an vorderster Front aufstellen, was ihm die Bewunderung seiner Soldaten eintrug. Der Spross einer Familie, die angeblich von Oliver Cromwell abstammte, war Berufssoldat und 56 Jahre alt. Er war ein überzeugter Verfechter von Täuschungs- und Überraschungsmanövern und hielt große Stücke auf die Kavallerie. Bevor er nach Palästina entsandt wurde, hatte er in Südafrika und Frankreich gekämpft.
Allenby war ein eifriger Bibelleser und interessierte sich auch für die Geschichte und Geographie, die Flora und Fauna des Landes, das er erobern sollte. In den Briefen an seine Frau ließ er sich ausführlich über Vögel und Bäume, und – wie ein Anthropologe auf Exkursion – auch über die Menschen aus, denen er begegnete. Seiner Ansicht nach sahen sie alle wie biblische Charaktere aus. Allenbys Biograf meint, Vögel, Tiere und Blumen hätten diesen stets mehr interessiert als seine Soldaten.35
Ende Oktober 1917 nahmen Allenbys Truppen Beerschewa und, beim dritten Versuch, Gaza ein.36 Um diese Schlacht rankt sich eine klassische Spionagegeschichte. In ihrem Mittelpunkt steht der britische Oberst Richard Meinertzhagen, dessen Mission darin bestand, die Türken davon zu überzeugen, dass die Briten den dritten Angriff auf Gaza planten, während sie in Wirklichkeit zuerst Beerschewa einnehmen wollten. In seinem Tagebuch hielt Meinertzhagen den Plan fest:
In letzter Zeit hatte ich viel damit zu tun, ein gefälschtes Befehlsbuch des Stabsoffiziers anzufertigen, das allerlei Unsinn über unsere Pläne und Schwierigkeiten enthielt. Heute machte ich damit einen Ausritt in das Land nordwestlich von Beerschewa in der Absicht, es dort, ohne Verdacht zu erregen, dem Feind in die Hände zu spielen. … Ich begegnete einer türkischen Patrouille, die sofort die Verfolgung aufnahm. In scharfem Galopp machte ich kehrt und ritt etwa eine Meile. Als sie zurückblieben, stieg ich ab und schoss auf sie. … Sofort nahmen sie die Verfolgung wieder auf, wobei sie die ganze Zeit wild herumballerten, ohne mich zu treffen. Dies war meine Chance. Bei dem Versuch, wieder aufzusitzen, löste ich meine Provianttasche, meinen Feldstecher, meine Wasserflasche und ließ mein Gewehr fallen, das ich zuvor mit frischem Blut von meinem Pferd beschmiert hatte. Kurz, ich tat alles, um sie davon zu überzeugen, dass ich getroffen sei und kopflos zu fliehen versuchte. Als sie nun nah genug herangekommen waren, ließ ich die Provianttasche mit dem Befehlsbuch und verschiedenen Karten et cetera fallen und ergriff die Flucht. Ich sah noch, wie einer die Tasche und das Gewehr aufhob, während ich, so schnell ich konnte, zum Lager zurückpreschte und sie bald abhängte. … Wenn sie nur gemäß dem Inhalt des Befehlsbuchs handeln, dann wird uns Großes gelingen.
Meinertzhagen zufolge hatte die Finte Erfolg: Der Angriff auf Beerschewa überraschte die Türken. Die Geschichte verbreitete sich, und ein hochrangiger Offizier der deutschen Armee fühlte sich bemüßigt, den Ruf der deutschen Verbündeten zu verteidigen und die Geschichte zu bestreiten.
Meinertzhagen erfand noch eine weitere Methode, um den Feind zu schwächen. Bei Sonnenuntergang überflogen britische Flugzeuge die Gebiete, in denen türkische Truppen zusammengezogen worden waren, und warfen Opiumzigaretten ab. Allenby verbot dies, doch Meinertzhagen behauptete, die Aktion sei ohne Allenbys Wissen fortgesetzt worden. Das Resultat: »Am 6. November war ein großer Teil der türkischen Armee in Scheria und Gaza schläfrig und benebelt. Einige der Soldaten, die gefangen genommen wurden, waren kaum in der Lage, zusammenhängend zu sprechen, geschweige denn Widerstand zu leisten.«37 Die britischen Soldaten hingegen litten am meisten unter der Hitze.
Allenbys Streitkräfte bestanden aus 75 000 Infanteristen und 17 000 Kavalleristen. Außerdem verfügte er über 475 Geschütze. Mehr als die Hälfte dieser Verbände nahm an der Schlacht um Beerschewa teil; Beim Angriff auf Gaza wurden außerdem sechs Panzer eingesetzt, die die Stadt nahezu dem Erdboden gleichmachten.38 Anschließend setzten die Streitkräfte ihren Weg nach Norden fort; zwei Wochen später, Mitte November, erreichten sie Jaffa und Tel Aviv.
Die ersten britischen Soldaten, die in Tel Aviv einmarschierten, zeigten sich zutiefst beeindruckt, dass sie hier frisches Brot bekommen und ein Bad nehmen konnten. »Europa! Europa!«, riefen sie freudig. Mordechai Ben-Hillel Hacohen, der umgehend in sein Haus zurückkehrte, fasste dies als ein Kompliment auf. Die Briten hätten offenbar nicht damit gerechnet, in der Wildnis Asiens eine wohl geordnete Stadt mit hübschen Häusern und sauberen, geraden Straßen vorzufinden, vertraute er stolz seinem Tagebuch an.
Einige der Soldaten begannen zu plündern. Sie brachen in Häuser ein, deren Besitzer noch nicht nach Tel Aviv zurückgekehrt waren, zerstörten die Möbel, zerfetzten die Bücher und rissen Tür- und Fensterrahmen heraus, um sie als Heizmaterial zu verwenden. Eine der ältesten Einwohnerinnen der Stadt erinnerte sich, dass ihre Mutter es in letzter Minute schaffte, ein Klavier, das Soldaten gestohlen hatten, vor der Zerstörung zu retten. Sie hörte auch von »allerlei unerfreulichen Vorfällen, die jungen Mädchen widerfuhren«. Hacohen und Gemeindevorsteher aus Jaffa suchten die Befehlshaber der Truppen auf, um sich zu beschweren. Diese legten ihnen jedoch nahe, keine Beschwerde einzulegen, da sonst die plündernden Soldaten vors Kriegsgericht gestellt und zum Tode verurteilt würden. Hacohen und seine Kollegen hielten es für das Beste, nachzugeben. Es bleibe ihnen nichts anderes übrig, als die Gewalttätigkeiten der Soldaten mit liebevoller Nachsicht hinzunehmen, schrieb Hacohen und tröstete sich mit dem Gedanken, dass die Soldaten Tel Aviv vielleicht für eine deutsche Enklave hielten und sich eine kurze Rache gönnten. Die Briten, so glaubte er, würden letztlich für Ruhe und Ordnung, Gerechtigkeit und Disziplin sorgen. »Wir sind gerettet, wir sind erlöst!«, heißt es in seinem Tagebuch.
Viele der in Palästina eingesetzten Soldaten waren Australier. »Sie sind alle ganz reizend«, bemerkte Hacohen. »Sie haben Gesichter wie große Kinder.« Ein Mädchen aus Tel Aviv erinnerte sich später: »Die Australier waren großzügig und freigebig. Einmal hüpfte ich vor unserem Haus Seil, als sich ein australischer Soldat dazugesellte und mit mir zusammen hüpfte. Wir mussten beide lachen. Dann nahm er das Seil, wickelte es um seine Hand, und ich versuchte, so hoch zu springen wie er. Zum Schluss gab er mir einen großen Schokoladenriegel.« Die Soldaten hatten auch ein Orchester, und Tel Aviv schickte ihnen Mosche Hopenko, einen der ersten Geigenlehrer der Stadt.39
Doch der Krieg war noch nicht zu Ende. Deutsche Flugzeuge bombardierten Jaffa; Petach Tikwa wurde mehrfach erobert und zurückerobert, und Ende November wandte sich Allenby seinem nächsten Ziel zu: Jerusalem.
Die Briten näherten sich der Stadt auf zwei Hauptrouten: von Süden, parallel zur Straße nach Hebron, und von Westen, entlang der Straße nach Jaffa. Die Türken leisteten heftigen Widerstand. Mehrmals gelang es ihnen, den britischen Vorstoß zu bremsen und sogar abzuwehren. Die Türken kontrollierten befestigte Bollwerke in den Bergen wie Kastel und Nabi Samuel, die die Briten von unten angreifen mussten. Vereinzelt kam es zu Nahkampfgefechten mit Bajonetten und Säbeln. »Galoppierende Pferde sind schwer zu lenken, wenn man nur eine Hand zur Verfügung hat, weil die andere den Säbel hält«, schrieb ein britischer Kavalleriekommandant. »Von der Ausrüstung und dem Gewehrkolben behindert, war es für die Kavalleristen fast unmöglich, die rasch ausweichenden Türken am Boden zu treffen. Immer wieder verfehlte man das Ziel, bis irgendwann der eine oder andere Türke nicht schnell genug war … Ich bin gefragt worden, wie wir uns an diesem Tag gefühlt haben. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich keine Angst hatte – wahrscheinlich weil ich zu viel zu tun hatte und die Erregung sehr groß war. Es war ein Gefühl wie Champagner auf leeren Magen.«40
Die Briten waren gut organisiert. Im Gegensatz zu den Türken litten sie keinen Hunger. Sie erhielten ihren ganzen Proviant, einschließlich Brot, aus Ägypten geliefert. Bis Beerschewa erfolgte der Transport mit dem Zug, dann wurden die Güter auf Maultiere verladen, danach auf Lastwagen und schließlich auf Kamele. Viele der Kamele waren jedoch der Reise nach Jerusalem durch gebirgiges und schlammiges Gelände nicht gewachsen und verendeten. Andere wurden von den Soldaten erschossen, damit sie nicht länger zu leiden hatten. Die Kadaver wurden in die Wadis gerollt, wo sich wachsame Einheimische sofort auf sie stürzten. »Zweifellos dienten sie zahllosen palästinensischen Familien als exzellentes Abendessen«, berichtete einer der Offiziere. In den Kriegserinnerungen aus dieser Zeit wird auch häufig das Leiden der Pferde beschrieben, die in dem schroffen Gelände der judäischen Berge Mühe hatten voranzukommen; Viele wurden von türkischen Granaten getroffen. Schließlich ließ Allenby tausend Esel aus Ägypten herbeischaffen. Die schweren Kanonen, die man aus Ägypten mitgebracht hatte, mussten zurückgelassen werden.
Aber der gemeinsame Feind von Türken und Briten war nun der Winter. Nach wochenlangen Gefechten, die in der Wüstenhitze begonnen hatten, trugen viele britische Soldaten immer noch Sommeruniformen und sogar kurze Hosen. In den britischen Streitkräften kämpften Ägypter, Inder, Neuseeländer und Australier, die unter der Kälte ganz besonders litten. Ein General verglich die judäischen Berge sogar mit dem Himalaya.41
Im April, nach der Evakuierung Jaffas und Tel Avivs, hatte Dschamal Pascha die in Jerusalem verbliebenen Konsuln zu einer dringenden Besprechung in sein Hauptquartier auf dem Ölberg einberufen. Das Treffen fand in einem Gebäude statt, das einem deutschen Hohenzollernschloss nachempfunden und nach Kaiserin Auguste Viktoria benannt war. Dschamal wollte die ausländischen Konsuln davon in Kenntnis setzen, dass er Jerusalem wie zuvor Gaza und Jaffa zu evakuieren gedenke, um für die Schlacht gewappnet zu sein. Graf Ballobar äußerte in seinem Tagebuch allerdings die Vermutung, Deutschland als Verbündeter werde die Türkei zwingen, Jerusalem kampflos aufzugeben, um es nicht der Gefahr der Zerstörung auszusetzen.42 Er hatte Recht: Berlin wusste genau, dass die Stadt keinen militärischen Wert besaß und es besser war, sie aufzugeben, als die Verantwortung für die Zerstörung heiliger Stätten übernehmen zu müssen. Im November, nach dem Fall Beerschewas, Gazas und Jaffas, konnten die Bewohner Jerusalems das Donnern der heranrückenden Geschütze hören. Sie wussten, dass sie am Vorabend einer neuen Ära standen. »Jerusalem wird fallen, morgen oder übermorgen«, schrieb Khalil as-Sakakini am 17. November. Er irrte sich nur um drei Wochen. Inzwischen war jedoch Alter Levine an seiner Tür erschienen.43
SAKAKINI HATTE ANGST, den jüdischen Flüchtling bei sich aufzunehmen. Sollte dies bekannt werden, würden ihn die Türken des Verrats anklagen, dessen war er gewiss. Wies er Levine jedoch ab, so verriet er sein eigenes kulturelles Erbe. Sakakini war überzeugt, dass Levine nicht bei ihm persönlich Schutz suchte, sondern vielmehr Zuflucht zur traditionellen arabischen Gastfreundschaft nahm: »Er suchte Schutz in der Kultur meines Volkes, die älter ist als der Islam und auch nach ihm noch Bestand haben wird. Durch seine Bitte, ihm in meinem Haus Schutz zu gewähren, hat er mir eine große Ehre erwiesen, denn sie erlaubt es mir, den Geist unserer Geschichte und unserer Kultur unter Beweis zu stellen … Ich hoffe, mein Volk wird darüber frohlocken, dass ein Fremder bei ihm Schutz gesucht hat durch mich, und ich habe ihn im Namen meines Volkes aufgenommen, nachdem sein eigenes Volk und seine eigene Familie ihn abgewiesen haben.«44 Levine versicherte, dass niemand von seinem Aufenthaltsort wisse. Sakakini ließ ihn ein.
In den folgenden Tagen führten die beiden Männer viele lange Gespräche und lernten sich dabei recht gut kennen. Beide waren äußerst komplexe Persönlichkeiten, voller Widersprüche, Zweifel und Fragen hinsichtlich ihrer Kultur und Identität. Levine, ein gebürtiger Russe, war damals 35 Jahre alt und Vater dreier Töchter. Sakakini, der aus Jerusalem stammte, war 39 Jahre alt und hatte einen Sohn. Levines Vater Morris, der in der Gegend von Minsk Landgüter verwaltet hatte, war mit seiner Familie um 1890 nach Palästina ausgewandert, aber schon kurz darauf weiter in die Vereinigten Staaten gereist, wo er Geld für eine Jeschiwa, eine höhere Talmudschule, und ein Krankenhaus in Jerusalem auftreiben wollte. Die meisten der Jerusalemer Juden lebten damals von Spenden, die Leute wie Morris Levine im Ausland sammelten. Wenige Jahre später erhielt er die amerikanische Staatsangehörigkeit. Sein Sohn Alter besuchte die Jeschiwa, löste sich aber später von der orthodoxen Welt, in der er aufgewachsen war. Als Erwachsener bezeichnete er sich zwar selbst als traditionellen Juden, aber da er Zionist war, betrachteten ihn die Ultraorthodoxen als Verräter.45
Khalil as-Sakakinis Vater war Zimmermann gewesen und hatte wie Morris Levine eine aktive Rolle in seiner Gemeinde gespielt. Sakakini selbst hatte zunächst die griechisch-orthodoxe Kirchenschule und später die von Bischof Blyth gegründete anglikanische Schule besucht.46 Später überwarf er sich mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen und dessen Anhängern wegen der Korruption in der Kirche und ihres arabischen Nationalcharakters, den Sakakini unterstützte. »Weder kann ich mich der Führung dieses korrupten, gemeinen Priesters unterwerfen, noch mich dieser verabscheuenswerten Sekte anschließen«, erklärte er, als er die Kirche verließ. Nachdrücklich betonte er: »Ich bin kein Orthodoxer! Ich bin kein Orthodoxer!« Wie Alter Levine neigte er dazu, sich über einen liberalen Nationalismus zu definieren, während er gleichzeitig an seinen religiösen Wurzeln festhielt. In seinem Testament sollte er seinen Sohn dazu anhalten, im Geist der Bergpredigt zu leben.47
Levine war ein moderner Geschäftsmann, ganz dem Geiste des neuen