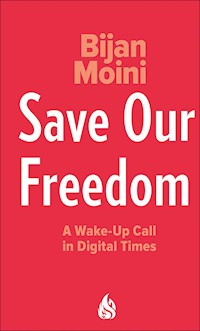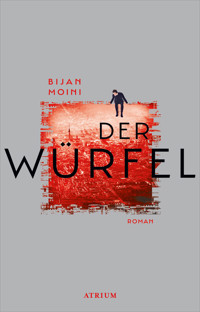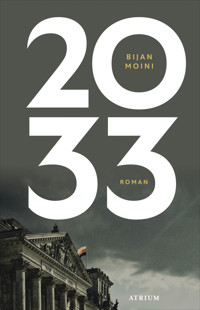
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Bijan Moinis neuen Roman sollten Sie lesen. Danach wird die Welt für Sie eine andere sein.« Ferdinand von Schirach Deutschland, 2033. Die rechtsextreme Partei AUFSTAND stellt die Bundeskanzlerin. Als die junge Anwältin Marie Wigand ihrer Chefin bei einem neuen Strafprozess assistieren soll, ahnt sie noch nichts von seinem historischen Ausmaß. Die Generalsekretärin der einzigen Oppositionspartei REFORM wird angeklagt, hinter einem Bombenanschlag auf die Parteizentrale des AUFSTANDs zu stecken. Doch schnell stellt sich heraus, dass es nicht allein um Schuld oder Unschuld geht: Sollte die Politikerin verurteilt werden, droht ein Verbot ihrer Partei – und der Weg für den AUFSTAND wäre frei, das Grundgesetz abzuschaffen. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt, und Marie findet sich in einem Kampf zwischen David und Goliath wieder, in dem es auch für sie selbst immer gefährlicher wird ... Ein beklemmendes Gedankenexperiment: Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bijan Moini
2033
Roman
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2025
Zitat von Erich Kästner: Über das Verbrennen von Büchern © Thomas Kästner
Covergestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Covermotiv: David Cohen / unsplash
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.
ISBN978-3-03792-243-9
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für unsere Kinder
Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat.
Erich Kästner
1
»Mein Mandant möchte ein Geständnis ablegen.«
Der gepolsterte Stuhl fühlte sich immer noch warm an. Marie bildete sich ein, durch ihre Robe den Schweiß des korpulenten Anwalts zu spüren, der bis eben darauf gesessen hatte. Die vorangegangene Verhandlung vor der zweihundertdreißigsten Strafabteilung des Amtsgerichts Tiergarten hatte sich endlos gezogen. Der Angeklagte war nicht aufgetaucht. Sein sichtlich nervöser Verteidiger hatte unzählige Male versucht, ihn zu erreichen, und dabei immer stärker geschwitzt. Die ganze Zeit über hatte Marie mit wippenden Oberschenkeln im Zuschauerraum gesessen. Gerade als die Richterin einen Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen wollte, kam er endlich hereingeschlurft.
Doch die Verzögerung war nicht Maries größtes Problem. Das saß nun, nachdem seine Strafsache aufgerufen worden war, direkt vor ihr in Gestalt ihres großen Bruders. Im Grunde machte man das nicht – Verwandte oder gute Freunde verteidigen. Aber er hatte wieder einmal darauf bestanden. Seine Strafe wurde noch verhandelt, Marie hingegen fühlte sich längst gestraft.
Die Richterin sah von ihr zu Felix. »Na dann. Bitte.«
Er richtete sich etwas auf. Von der Seite konnte Marie nicht erkennen, ob er der Richterin in die Augen sah. »Ja, ich hab das gemacht. Und es tut mir wirklich leid.« Es klang eher trotzig als reuevoll, aber für seine Verhältnisse war das gar nicht schlecht.
»Da brauche ich mehr von Ihnen. Was genau haben Sie gemacht, was tut Ihnen leid?«
»Na, alles aus der Anklageschrift, was der Staatsanwalt vorgelesen hat. Der Herr Oberstaatsanwalt, meine ich.«
Die Richterin machte eine ungeduldige Handbewegung. »Erzählen Sie bitte mal die ganze Sache mit Ihren Worten. So, wie Sie sie einem Freund erzählen würden.«
»Okay … Also, das war vor drei Monaten, zwei Tage nach dem Anschlag.«
»Dem Anschlag auf die Parteizentrale des AUFSTANDS«, präzisierte die Richterin. Marie erschauderte. Die Erinnerung an jenen Abend war noch zu lebendig.
»Ja, genau. Ich war deswegen immer noch total aggro. Ich bin Parteimitglied, wissen Sie. Und eine Ex von mir war an dem Abend im Gebäude, zum Glück hat sie überlebt. Aber so viele andere Menschen sind gestorben. Ich war noch in der Nacht am Tatort, hab später die Bilder von den Leichen gesehen – das hat mich nicht mehr losgelassen. Um mich zu beruhigen, bin ich irgendwann mit dem Auto durch die Stadt gecruist, das mach ich öfter. Dann hab ich am Moritzplatz diesen Stand der REFORM gesehen. Und wie der Typ da –«
»Der Zeuge Franzen«, korrigierte die Richterin.
»Ja, der. Wie der Zeuge da einfach weiter Wahlkampf gemacht hat, das hat mich total provoziert. Der hat da rumgerufen, Zettel verteilt, die Leute angequatscht. Eine riesige Fahne hatte er auch aufgestellt. Ich meine, wie kann man denn nach so was weitermachen, als wäre nichts gewesen!«
»Und das haben Sie ihm so gesagt?«
»Ungefähr, ja.«
Die Richterin sah in die Akte. »Der Zeuge hat ausgesagt, Sie hätten ihn als ›Hurensohn‹, ›Transe‹, ›Arschloch‹, ›Scheißwichser‹ und ›Terrorist‹ bezeichnet. Und als einige Dinge mehr, die er nicht verstanden oder wieder vergessen habe.«
Marie schloss die Augen und rieb sich die Stirn. Felix war ihr Bruder, der Mensch, der ihr immer am nächsten gestanden hatte. Und doch trennten sie Welten, seit er sich dem rechtsextremen AUFSTAND angeschlossen hatte. »Ja, kann schon sein, dass ich das alles gesagt habe«, murmelte Felix. »Ist mir ziemlich peinlich. Ich war wirklich auf hundertachtzig. Der Anschlag war erst zwei Tage her –«
»Das sagten Sie bereits. Was geschah dann?«
»Der Typ – der Zeuge – ist einfach stehen geblieben, hat überhaupt nicht reagiert. Das hat mich eigentlich noch mehr provoziert. Da hab ich ihm gesagt, wenn er nicht sofort einpackt, mach ich das für ihn.«
»Da saßen Sie noch im Auto?«
»Ja. Als er sich dann nicht vom Fleck gerührt hat, hab ich Gas gegeben und bin in seinen Stand gefahren. Hab ich noch im selben Moment bereut. Also, schon als ich den Fuß durchgedrückt habe, in der Sekunde hab ich gewusst, dass das ein Fehler ist. Ich hab mich dann auch entschuldigt.«
Die Richterin runzelte die Stirn. »Von einer Entschuldigung hat der Zeuge laut Akte nichts gesagt.«
»Hab es vielleicht nicht so laut gesagt. Aber es tat mir da schon leid, und als ich zu Hause war, noch mehr. Hab mich echt scheiße gefühlt. Auch jetzt noch, wenn ich daran denke.«
Hätte Marie es nicht besser gewusst, hätte sie ihm die Reue vielleicht abgenommen. Sie spürte einen überraschenden Anflug von Stolz auf ihren Bruder, auch wenn sich das vollkommen falsch anfühlte.
»Danke, Herr Wigand.« Die Richterin wandte sich an den Oberstaatsanwalt. »Vor dem Hintergrund des Geständnisses würde ich nur noch den Zeugen Franzen hören und die übrigen Zeugen entlassen. Sind Sie einverstanden?« Der Oberstaatsanwalt nickte. »Sie auch, Frau Wigand?«
»Ja.« Marie war erleichtert. Sie sah auf die Uhr: kurz vor zehn. Später als erhofft, aber früher als befürchtet.
Die Richterin ließ die Zeugen hereinrufen und entließ alle bis auf Franzen, der nun etwas umständlich Platz nahm und die Fragen der Richterin beantwortete. Er bestätigte Felix’ Angaben – außer der Entschuldigung – und schilderte die große Angst, die er trotz seiner Standhaftigkeit empfunden habe. Weder der Oberstaatsanwalt noch Marie stellten Fragen, und der Zeuge durfte gehen. Nun stützte sich die Richterin auf den Tisch und sah Felix eindringlich an. »Das wäre schon die dritte Verurteilung, bei der Sie Ihr Fahrzeug verwendet haben, Herr Wigand. Und die Bewährungszeit für Ihre letzte Verurteilung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung läuft auch noch.«
»Sie endet aber in zwei Monaten, Frau Vorsitzende«, sagte Marie.
»Das sehe ich hier. Umso erstaunlicher, dass Ihr Mandant sich nicht zusammenreißen konnte.«
Felix schien tatsächlich nicht zu befürchten, dass die Bewährung widerrufen oder er in der neuen Sache zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt werden könnte. »Dafür hab ich doch die beste Anwältin der Stadt«, hatte er am Tag zuvor mit einem Lachen gesagt und ihr auf die Schulter geklopft. Sie hatte nicht mitgelacht. Erst nachdem sie ihm klargemacht hatte, sein »Scheißauto« könne als Tatwerkzeug eingezogen werden, war er kleinlaut geworden. Für dieses Auto – ein mattgrauer getunter Jeep – würde er alles tun. Die Strategie war deshalb klar gewesen: gestehen, Reue zeigen, glaubwürdig versichern, dass er zum wirklich allerletzten Mal so einen Mist gebaut habe, noch mehr Reue zeigen – und beten, dass die Richterin ihm glaubte. Oder die REFORM zumindest halb so sehr hasste wie er.
Felix hob die Hand, sagte dann aber, ohne abzuwarten: »Ich werde das nicht wieder tun, Euer Ehren.«
Euer Ehren. Marie verdrehte die Augen. Jedes Mal sagte er es falsch. Ihr Blick blieb an der riesigen Deutschlandflagge haften, die über die Wand hinter der Richterin gespannt worden war. Seit zwei Monaten hingen Flaggen wie diese in allen Berliner Gerichtssälen.
»Warum sollte ich Ihnen das abnehmen?«, fragte die Richterin.
»Weil ich nicht blöd bin. Ich will nicht in den Knast.«
»Das will niemand.«
»Ich kann so was wirklich nicht noch mal machen. Wegen meiner Schwester. Ich kann ihr das nicht antun, nicht schon wieder.«
Das war gut. Bullshit natürlich, aber gut. Marie sah zur Richterin, die die beiden Geschwister abwechselnd musterte. Sie würde die Strafe wieder zur Bewährung aussetzen, da war Marie sich sicher.
Der Oberstaatsanwalt schien das ebenfalls zu spüren. »Eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung ist unbedingt erforderlich, Frau Vorsitzende. Der Angeklagte hat mit einem Jeep einen Wahlkampfstand umgefahren, der Zeuge Franzen stand nur zwei Meter daneben. Unsere politische Kultur befindet sich gerade im freien Fall, und selbst Gewalttaten von AUFSTAND-Anhängern bleiben ohne Konsequenzen.« Marie zollte ihm innerlich Respekt. »Der Angeklagte ist nur einer von Dutzenden, wenn nicht Hunderten, die nach dem Anschlag Reformer angegriffen haben. Trotzdem steht nur eine Handvoll von ihnen vor Gericht. Weil die Polizei und auch viele meiner Kollegen diese Taten weder aufklären noch verfolgen. Wir müssen Straflosigkeit und Siegerjustiz ein Ende bereiten. Abschreckung ist dringend geboten.«
Die Richterin schmunzelte. »Zum Plädoyer hatte ich Sie noch gar nicht aufgefordert.«
Der Oberstaatsanwalt verzog den Mund. Es war ihm anzusehen, dass er sich zusammenreißen musste, um nicht noch mehr zu sagen.
»Wenn ich trotzdem darauf erwidern darf, Frau Vorsitzende?«, sagte Marie.
»Bitte.«
»Ich teile die Sorge des Oberstaatsanwalts um die Demokratie. Aber es gibt keinen Grund dafür, die politische Gesamtlage meinem Mandanten anzulasten. Es ist Sache der Staatsanwaltschaft, Straftaten zu verfolgen, nicht aber die meines Mandanten, für ein Exempel bereitzustehen.«
Der Oberstaatsanwalt legte nach. Doch der Richterin war anzumerken, dass sie für all seine großen Argumente keinen Platz in dieser kleinen Strafsache sah. Als er merkte, dass er nicht zu ihr durchdrang, wechselte er die Ebene. »Zumindest muss das Auto eingezogen werden. Erst war es ein illegales Autorennen, jetzt eine Sachbeschädigung gegen ›den Feind‹, wie der Angeklagte die REFORM auf Y nennt – was wird er wohl als Nächstes mit dem Fahrzeug anstellen? Das Auto muss weg.«
Felix schob seine Hände unter die Oberschenkel und schaukelte kaum merklich vor und zurück. Die Richterin wandte sich mit fragendem Blick an Marie.
»Das wäre vollkommen unverhältnismäßig, Frau Vorsitzende. Mein Mandant hat über Jahre all sein Geld in dieses Fahrzeug gesteckt. Davon kann man halten, was man will, aber es ist mindestens hunderttausend Euro wert. Wir können das notfalls belegen. Im Gegensatz dazu wiegt die Tat, die er eben gestanden und für die er Reue gezeigt hat, nicht besonders schwer. Ihm wegen dieser Sache seinen einzigen wirklichen Vermögenswert zu nehmen, wäre eine viel zu harte Strafe.«
Marie spürte Felix’ Blick, doch sie ignorierte ihn. Sie wusste, dass er größere Gegenwehr erwartete. Aber mehr war dazu nicht zu sagen.
»Die Fahrerlaubnis wäre sowieso weg«, sagte die Richterin an den Oberstaatsanwalt gewandt. »Der Angeklagte müsste im Falle einer Verurteilung mindestens ein Jahr auf seine Fahrerlaubnis verzichten.«
»Dann sitzen wir in einem Jahr wieder hier. Ich sehe in der Biografie des Angeklagten nichts, was auf Besserung schließen ließe.«
Einmal noch hielt Marie dagegen, dann war die Sache ausdiskutiert. Die Plädoyers waren kurz. Der Oberstaatsanwalt forderte neun Monate ohne Bewährung, Marie eine mittelhohe Geldstrafe.
»Sie haben das letzte Wort«, sagte die Richterin zu Felix.
»Von mir aus schicken Sie mich in den Knast – aber bitte, bitte nicht das Auto.«
—
»Sag mal, bist du bescheuert?«
Marie und Felix standen vor seinem Jeep, und er hatte gerade nach der Fahrertür gegriffen. Vor ein paar Minuten war die Freude noch groß gewesen: fünf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, ein Jahr ohne Fahrerlaubnis, aber das Fahrzeug gehörte weiterhin ihm. Kurz hatte sie sich von der Erleichterung ihres Bruders anstecken lassen und sogar lachen müssen, als er sie vor der Tür des Verhandlungssaals in die Luft hob. Danach waren sie entspannt die Straße entlangspaziert, zwei harmonisch vereinte Geschwister – bis Marie die Entriegelung eines Fahrzeugs hörte und das vertraute Grau vor ihr aufragte, die lächerlich breiten Reifen, die kriegerische Stoßstange. Nun stand Felix etwas perplex da, eine Hand schon am Türgriff.
Marie entriss ihm den Schlüssel und verriegelte das Fahrzeug wieder. »Du willst mich verarschen, oder?«
»Ach komm, ich fahr total brav, da kontrolliert mich doch niemand.«
Sein selbstgefälliger Tonfall machte Marie noch wütender. »Du bist mit dem Scheißauto gekommen. Die Fahrerlaubnis hatten sie dir doch schon vorläufig entzogen!« Marie schüttelte heftig den Kopf. »Wenn das jemand gesehen hätte!«
»Wenn jemand was gesehen hätte?«, fragte eine Stimme hinter Marie. Sie drehte sich um.
»Herr Oberstaatsanwalt!«
Er sah vom Autoschlüssel in Maries Hand zu dem Jeep. »Ihrer?«
»Hat mir mein Bruder geliehen. Ich habe kein Auto.« Sie hatte nicht mal einen Führerschein.
»So, so.« Der Oberstaatsanwalt hatte die Situation sicher richtig erfasst, schien aber keine Lust zu haben, das Offensichtliche auszusprechen. Stattdessen fixierte er Felix. Sein Ausdruck war hart, viel härter als im Gerichtssaal. Die Kraft und Entschlossenheit, die er eben noch ausgestrahlt hatte, waren etwas anderem gewichen. Wut vielleicht, oder sogar Hass. Einige Augenblicke schien er zu überlegen, ob er noch etwas sagen sollte. Dann verlor sich sein Blick. Er wandte sich von Felix ab, nickte Marie zu und ging davon.
Wortlos sahen sie ihm nach. Erst jetzt fiel Marie auf, wie klein er eigentlich war, er überragte kaum die Autos auf dem Parkstreifen. Als er die nächste Straßenecke erreicht hatte, holte Felix Luft – sie sah an seinem Ausdruck, dass er dem Mann eine Beleidigung hinterherschicken wollte. Doch ein kräftiger Schlag in seine Seite genügte, dass die Luft aus ihm wich und sein Mund zuklappte. Dann war der Oberstaatsanwalt verschwunden.
Kopfschüttelnd steckte sie den Autoschlüssel ein, holte ihr Smartphone heraus und bestellte ein Taxi. Felix stand teilnahmslos daneben, die Hände in den Hosentaschen. In Marie brodelte es. Sie wartete darauf, dass ihr Bruder irgendetwas sagte. Warum verdammt noch mal blieb er so unbekümmert? »Junge, das kann doch alles nicht dein Ernst sein!«, fuhr sie ihn an. »Erwartet ja keiner von dir, dass du Sozialarbeiter wirst. Aber Menschen beschimpfen und einschüchtern, Wahlkampfstände umfahren und dann auch noch ohne Führerschein ins Auto steigen – was ist los mit dir?«
»Du verstehst das nicht.«
»Ich versteh das nicht? Weißt du, was du nicht verstehst? Wie es sich anfühlt, in den ersten drei Berufsjahren schon zum fünften Mal den großen Bruder vor Gericht verteidigen zu müssen. Oder der eigenen Chefin zu erzählen, warum man wieder in der Arbeitszeit privat zu Gericht muss.«
Felix sah sie alarmiert an. »Ava weiß davon?«
»Natürlich! Die weiß auch, dass du keinen Job länger als zwei Monate durchhältst, dass du das wenige Geld, das du mit Gott weiß was verdienst, in dieses Scheißauto steckst. Und dass deine Verschwörungstheorien schneller wechseln als deine ›Freunde‹ aus dem Kampfsporttraining. Irgendjemandem muss ich den ganzen Mist ja erzählen!« Felix wandte sich wieder von ihr ab. »Und dann noch ausgerechnet heute! Ich sollte eigentlich längst im Büro sitzen und mich auf ein neues Mandat vorbereiten. Ein richtig großes. Stattdessen muss ich mich um deine Scheiße kümmern!«
»Zwingt dich ja keiner.«
Marie sah ihren Bruder fassungslos an, aber er hatte die Augen geschlossen. Dieser Feigling. Sie machte einen Schritt und trat mit voller Wucht gegen eine Felge seines Autos.
»Hey!« Felix ging hastig in die Knie und fuhr leise fluchend mit dem Finger über die Delle.
Sie ging zum nächsten Rad.
»Marie!« Ihre Blicke trafen sich. Er litt. Gut so.
Sie trat erneut zu.
Er sprang auf, sie wich zurück. Einen unwirklichen Moment lang hatte sie Angst, er würde sie schubsen. Doch er blieb stehen, sein Blick starr auf eine Stelle hinter ihr geheftet, die Fäuste geballt. Nach einer gefühlten Ewigkeit löste sich seine Anspannung schlagartig, und er umarmte sie. Zögernd ließ sie sich darauf ein. Für einen Augenblick war sie wieder das Mädchen, das all seine Trauer in der Halsbeuge des einzigen Bruders begrub. »Es tut mir leid«, flüsterte er. Mit jeder Sekunde, die sie sich hielten, schrumpfte ihr Frust. Sie hatte keinen Zweifel daran, dass er es ernst meinte. Auch wenn es nichts nützen würde.
—
Der Weg vom Gericht zur Kanzlei führte an der Siegessäule vorbei. An den Laternenmasten hingen noch immer einzelne Wahlplakate, alle vom AUFSTAND. Die Plakate der REFORM waren schon lange vor der Bundestagswahl in Fetzen gerissen und nie ersetzt worden.
Felix blickte gut gelaunt aus dem Fenster. »Sind sie nicht schön?«
»Die Plakate?«
»Nein, die Fahnen!«
Marie nahm die vielen Hundert Deutschlandfahnen kaum noch wahr, die den Kreisverkehr säumten und alle Straßen, die zur Siegessäule führten. Der neue Berliner Bürgermeister hatte sie vor anderthalb Jahren aufhängen lassen, eine Woche nach Amtsantritt, unter wilden Protesten. Aber Marie war es so gewohnt, sie zu übersehen, dass ihr der Anblick jetzt völlig grotesk erschien. Sie waren ziemlich klein geraten und flatterten armselig im Wind.
»Hast du gehört, dass Vogel die erste Strophe des Deutschlandlieds wieder zur Nationalhymne machen will? Sie meint, das –«
»Felix. Bitte verschone mich mit Vogels Gesabbel.« Seit die langjährige AUFSTAND-Vorsitzende vor ein paar Wochen Bundeskanzlerin geworden war, gab es vor ihren nationalistischen und rassistischen Einfällen kein Entrinnen mehr. Vor allem, wenn man mit einem ihrer treuesten Jünger zusammenwohnte.
»Besser als der Mist, den wir uns so lange Zeit von deiner REFORM anhören mussten.«
»Meiner REFORM? Junge, ich hab mit denen nix am Hut, und das weißt du. Ich wähle die nur, weil deine Leute elende Faschisten sind!«
»Besser Faschisten als Verräter. Die ganze REFORM, alles Verräter von Volk und Vaterland.«
Die Taxifahrerin nickte kaum merklich. Marie atmete lautstark aus und sah nach draußen. Dieses Gespräch hatten sie schon so oft geführt, in allen erdenklichen Varianten. Es war einfach sinnlos. Und es schmerzte, jedes einzelne Mal. Während der schlimmen ersten Jahre nach dem Tod ihrer Eltern waren sie noch unzertrennlich gewesen, sie beide gegen den Rest der Welt. Ohne ihren Bruder hätte Marie vielleicht nicht mehr aus dem tiefen Loch herausgefunden, in das sie damals gestürzt war. Aber als sie ihr Studium begann und Felix seine zweite Ausbildung abbrach, änderte sich alles. Maries damaliger Mitbewohner Kilian war eine linke Socke und nahm sie überallhin mit. Bis dahin hatte sie gar keinen Kopf für Politik gehabt, und plötzlich war sie umgeben von klugen, nachdenklichen und einfühlsamen Menschen, die großen Eindruck auf sie machten. Sie konnte und wollte sich ihrem Einfluss gar nicht entziehen. Felix hingegen stürzte sich in die Kampfsportszene, fuhr von Turnier zu Turnier und gewann sogar ein paar schlecht bezahlte Kämpfe. Bis Marie begriff, dass sein ganzes Umfeld von fanatischen AUFSTAND-Leuten durchsetzt war, hatte sie ihren Bruder längst verloren. Das Band zwischen ihnen war nie gerissen, aber mittlerweile bis zum Äußersten gespannt.
Sie würde ihm natürlich nichts von dem Kanzleitermin erzählen können, den sie später hatte. Weder, wen sie treffen würde, noch, worum es vermutlich ging. Dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben konnte sie nicht erzählen, wie sie sich gerade fühlte, wie aufgeregt sie war, wie unsicher. Nicht auszudenken, wie er darauf reagieren würde, sollte ihre Chefin das Mandat annehmen. Fast wünschte sie sich, Ava würde es nicht tun. Aber nur fast.
Am Fuße des Towers, in dem ihre Kanzlei zwei Etagen besetzte, stieg Marie aus. »Bringen Sie ihn bitte, wohin er möchte«, sagte sie der Fahrerin und gab Felix seinen Autoschlüssel zurück. »Nur nicht wieder zum Kriminalgericht.«
Marie hörte ihren Bruder leise lachen, bevor sie die Tür zuwarf, dann fuhr das Taxi weiter. Sie atmete tief durch, schüttelte die Arme aus und hüpfte einige Male auf der Stelle wie eine Sprinterin vor dem Start. Dann betrat sie das Gebäude.
2
Noch bevor Marie aus dem Aufzug trat, hörte sie laute Stimmen.
»Nun lassen Sie uns schon rein.«
»Wir müssen uns den Raum ansehen!«
Zwei Männer standen im Empfangsbereich von Finkenbein und Partner. Der Kleinere der beiden versuchte vergeblich, sich über den massiven Tresen zu beugen.
»Frau Jansens Büroleiter hat mir gesagt, ich soll Sie nicht in unsere Räume lassen«, antwortete Lothar ruhig. Marie liebte ihn für seine Gelassenheit. Alle liebten ihn dafür. Ob er sich um ihre IT-Probleme kümmerte, Schriftsätze in letzter Sekunde Korrektur las oder ungebetene Gäste abwimmelte – nichts konnte ihn erschüttern. Er bezeichnete sich selbst als Empfangsherr, aber dass das nicht stimmte, hatte Marie früh gemerkt. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie er einmal mit ihr bis kurz vor Mitternacht geblieben war, weil sie unbedingt eine Frist einhalten musste. Niemand hatte ihn dazu gezwungen, aber sie war erst seit ein paar Wochen Anwältin gewesen, und er schien gespürt zu haben, dass sie Unterstützung brauchte.
»Wir sind vom BKA, Herr …«
»Schwenk.«
»Es ist unsere Aufgabe, Frau Jansen zu beschützen. Herrgott, wir wissen seit dem Anschlag doch alle, welcher Gefahr Politiker ausgesetzt sind. Sie müssen uns unsere Arbeit machen lassen!«
»Sie können arbeiten, so viel Sie wollen. Nur nicht in unserer Kanzlei.«
Marie musste grinsen, was Lothar sah und mit einem Augenzwinkern quittierte. Ohne die Polizisten zu grüßen, ging Marie an ihnen vorbei den Gang hinunter. Die meisten Büros waren bereits besetzt. Manchen Kollegen winkte Marie zu, andere grüßte sie, einige ignorierte sie – je nachdem, welche Gepflogenheit sich zwischen ihnen herausgebildet hatte. Die Tür zu ihrem eigenen Büro stand wie meistens offen. Der Raum war riesig, fast so groß wie Maries letzte Wohnung, aber deutlich leerer. Sie stellte sich vor das bodentiefe Fenster und ließ den Blick über die Stadt schweifen, über die breiten Straßen und die vielen Flachdächer bis zum Fernsehturm, der noch genauso aussah wie in ihrer Kindheit. So startete sie fast jeden Morgen in der Kanzlei. Sie stand so lange da, bis sich das Gefühl einstellte, wirklich hier hinzugehören. In eine der besten Kanzleien der Stadt, in einen verrückt gut bezahlten Job, der all ihre finanziellen Sorgen binnen Monaten beseitigt hatte – und die von Felix gleich mit. Einen aufregenden Job, in dem es um alles ging, um Freiheit oder Haft, um Glück oder Verderben, und immer wieder um verdammt viel Geld.
Vom Flur hörte Marie ein vertrautes Paar quietschende Schuhe und drehte sich um. Ava kam gerade zur Tür herein. Wie immer trug sie weiße Sneaker und einen edlen Hosenanzug. Die Ärmel ihres Jacketts hatte sie hochgekrempelt, ihre schwarzen Locken lauerten auf den Schultern wie zum Sprung bereite Federn.
»Und?«
Marie war unsicher, worauf die Frage sich bezog. »Ich hab mir gestern einiges durchgelesen, aber worum es genau gehen könnte –«
Ava winkte ab. »Nicht das. Die Verhandlung!« In ihrer Stimme schwang immer diese besondere Melodie mit, wie Marie sie nur von Menschen kannte, die mit einer anderen Sprache aufgewachsen waren. Avas Akzent war ihr inzwischen so vertraut, dass sie selbst Fremden auf der Straße ihre iranische Herkunft anhörte. Zumindest glaubte sie das.
Marie spähte an Ava vorbei auf den Gang. Ihre Chefin schloss die Tür und setzte sich auf den Besucherstuhl. Marie lächelte unsicher. »Müssen wir darüber reden?«
Ava hob die Augenbrauen. »Wann hast du mir das erste Mal von deinem Bruder erzählt?«
»Puh, weiß ich gar nicht …« Marie wusste es noch ganz genau. Wie könnte sie je vergessen, dass sie kurz nach Beginn ihrer Referendarstation bei Finkenbein und Partner vor Avas Augen in Tränen ausgebrochen war, weil die Polizei Felix nach einer Schlägerei kurzzeitig festgenommen hatte? »Vor drei oder vier Jahren vielleicht?«
»Und immer noch ist es dir unangenehm, über ihn zu sprechen.« Marie zuckte mit den Schultern. Sie wollte über Felix reden, wollte Ava all ihre zwiespältigen Gedanken, die ständigen Sorgen anvertrauen – und zugleich nichts weniger als das.
»Lass es raus, sonst hängt es dir den ganzen Tag nach.«
Sie sah auf ihre Hände. »Es lief okay. Bewährungsstrafe, sein Auto durfte er auch behalten. Leider.«
Ava lächelte. »Musst du nicht gut finden, klingt aber nach einer ordentlichen Verteidigung. Wohnt er denn immer noch bei dir?«
»Ja.«
»Du weißt, wenn ich ihm mal einen Job besorgen soll … Wir würden sicher auch hier etwas für ihn finden.«
Marie wollte nichts weniger als das. Sollte Felix diese Chance in den Sand setzen, wäre ihr das viel zu unangenehm. Und er würde sie in den Sand setzen, würde sie so tief darin vergraben, dass sie nie wieder das Tageslicht erblickte. Allein die Vorstellung, wie er sich gegenüber einem der Partner danebenbenahm, verursachte ein heftiges Schamgefühl in ihr. »Danke, Ava. Weiß ich wirklich zu schätzen.«
»Das ist kein Tarof.«
Das Wort hatte Ava Marie früh beigebracht, weil es keine gute Übersetzung dafür gab. Tarof war eine Geste der Höflichkeit, die in einem Angebot bestehen konnte, dessen Annahme wiederum unhöflich wäre. »Ich weiß.«
Ava musterte sie. »Du wirst mich nie helfen lassen, oder? Es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen.«
»Du hast mir schon genug geholfen. Allein, dass du dir den ganzen Kram immer anhörst. Und dass du mich in der Kanzlei deckst, wenn ich seinetwegen mal wieder vor Gericht muss.«
Ava machte eine abwehrende Handbewegung. »Dir keine Steine in den Weg zu legen, ist keine Hilfe. Du kriegst Felix aus diesem Kreislauf nur heraus, wenn er einen Job hat, der ihm etwas gibt. Geld natürlich, vor allem aber Anerkennung. Gute Arbeit hat mich als Jugendliche auch von einem gefährlichen Pfad abgebracht.«
Marie horchte auf. Es war selten, dass Ava etwas von sich preisgab. Aber auch dieses Mal ging sie nicht ins Detail. »Ich kann euch natürlich zu nichts zwingen.« Sie stand auf und wandte sich zum Gehen.
»Wollten wir nicht noch über den Termin sprechen?«, fragte Marie.
»Wozu? Ich weiß nicht mehr als gestern.«
»Es muss doch eigentlich um –«
»Kann sein. Lass uns einfach hören, was sie sagt.« Sooft sich Ava inzwischen Zeit für Marie persönlich nahm, so selten verlor sie über das Geschäft auch nur ein Wort zu viel.
—
Als Ava den Raum verlassen hatte, holte Marie ihre neue Robe aus der Tasche und hängte sie in den übergroßen Einbauschrank. Lange hatte sie eine viel zu kurze Variante aus Plastik besessen, die sie über Kleinanzeigen geschenkt bekommen hatte. Drei Jahre lang war sie damit durch die Gerichtssäle der Republik gezogen, stets begleitet von dem Gefühl, dass alle erkannten, wie billig das hässliche Ding war. Vor einer Woche hatte sie sich endlich dazu durchgerungen, für über fünfhundert Euro eine Robe aus Seide zu kaufen. Wunderschön war sie. Und passte auch noch perfekt.
Marie setzte sich an den Schreibtisch und nahm aus der Innentasche ihres Blazers einen Blister mit Hydrocortison-Tabletten. Im Spiegel des Aufzugs hatte ihr Gesicht wieder ganz schön zerknittert ausgesehen. Und mit jeder Minute fühlte sie sich schwerer. Wie viel würde sie für den Rest des Vormittags brauchen? Mit geübtem Griff presste Marie eine Tablette aus dem Blister, biss sie entzwei, schluckte die eine Hälfte und verstaute die andere wieder in der Aussparung des Blisters.
Kaum hatte sie ihren Laptop aufgeklappt, kam Michael Kerstner zur Tür herein, der Managing Partner der Kanzlei. »Na?«
Michaels Büro befand sich nur zwei Türen weiter, und es war offensichtlich, dass er auf Marie gewartet hatte – oder vielmehr darauf, dass Ava sie allein ließ. Mit seinem schiefen Grinsen stellte er sich vor ihren Schreibtisch. Die langen Arme reichten ihm fast bis zu den Knien. Marie wusste, warum er hier war, aber sie würde ihn zappeln lassen. »Na?«
Michael verschränkte die Hände und streckte die Arme genüsslich über dem Kopf aus. »Guter Morgen bislang. Hab gerade ein geiles Mandat geclost: CEO einer Bank. Soll 75 Millionen veruntreut haben. Der Typ ist selbst locker zwanzig, dreißig Mille schwer, den werde ich ordentlich melken, sag ich dir!«
Melken war eines seiner Lieblingswörter. Jedes Mal, wenn er einen Mandanten melken wollte – es waren immer Männer –, musste Marie sich unweigerlich vorstellen, wie er mit Schürze und Gummihandschuhen auf einem dreibeinigen Hocker saß und ihnen den Penis langzog.
»Kaum Chancen auf einen Freispruch. Aber er will unbedingt parallel zum Strafverfahren noch seine Arbeitgeberin verklagen. Soll er machen!« Er lachte.
Marie stimmte nicht mit ein. Sie konnte es nicht leiden, wenn Michael abschätzig über seine Mandanten sprach. Trotzdem – wenn der Managing Partner lachte, musste sie ihm irgendeine Form der Bestätigung geben. »Das ist ja lustig.«
Sein Lachen erstarb. »Ja, ja, ich weiß – du bist dir noch zu fein für so was. Aber ohne meine Umsätze könnten wir direkt zehn Leuten hier kündigen.« Er sah sie an, als wäre sie die Erste auf dieser Liste.
Michael war der Rainmaker der Kanzlei. Mit großem Abstand zu Ava machte er den höchsten Umsatz aller fünfzehn Partner. Und das zählte viel – wenn nicht gar alles – in dieser Welt. Umsatz macht dich unantastbar, hatte Ava Marie schon früh erklärt. Es war nur ihr zu verdanken, dass Marie ihm nicht – wie all die anderen angestellten Rechtsanwälte – in den Arsch kriechen musste, wann immer er sie in ein Gespräch verwickelte. Ohne Ava hätte Marie allein seinetwegen die Kanzlei längst verlassen. Natürlich hatte sie nichts dagegen, Geld zu verdienen. Im Gegenteil: Sie war lange genug arm gewesen, um jeden Euro, den sie verdiente, zu schätzen. Aber nicht um jeden Preis.
Marie beschloss, es abzukürzen. »Ich weiß auch nicht, worum es heute Nachmittag geht.«
»Ach komm. Irgendwas wird dir Ava doch erzählt haben.«
»Nur, dass wir heute einen Termin mit Nina Jansen haben.«
Michael sprach plötzlich leiser. »Es hat doch bestimmt was mit dem Anschlag zu tun, wenn die Vorsitzende der REFORM ausgerechnet jetzt hierherkommt.«
»Keine Ahnung.«
»Wenn es um den Anschlag geht, müssen wir darüber in der Partnerversammlung reden.«
»Das hast du sicher auch Ava gesagt.«
»Natürlich.«
Eine Weile sah er sie unschlüssig an. Dann zog er mit gerunzelter Stirn ab.
—
Es war ein lauer Winterabend eine Woche vor der Bundestagswahl gewesen, als die Bombe explodierte. Marie saß gerade mit Felix auf ihrem winzigen Balkon nicht weit vom Ort des Geschehens und ließ vor Schreck ihr Weinglas fallen. Natürlich wollte Felix sofort nachsehen, was passiert war. Widerwillig folgte sie ihm, ohne die Scherben aufzulesen. Schon auf dem Weg nach unten ploppten auf Y die ersten Kurzvideos vom Tatort auf.
Felix hielt kurz inne und sah gebannt auf sein Smartphone. »Die Parteizentrale!«, rief er entsetzt und nahm jetzt drei, vier Stufen auf einmal. Er war längst draußen, als Marie die Haustür erreichte, und schon nicht mehr zu sehen, als sie auf der Straße stand. Erst am Alex fanden sie sich wieder, im hinteren Teil einer sich rasch verdichtenden Menschenmenge. Ein paar Polizisten versuchten, die Schaulustigen zurückzuhalten und per Megafon dazu zu bewegen, eine Rettungsgasse für die Löschfahrzeuge zu bilden. Die Stimmung war aufgekratzt, die Leute riefen durcheinander. Handys wurden in die Luft gehalten. Felix und Marie schlugen einen Bogen, um einen Blick auf das Gebäude am nördlichen Rand des Platzes zu erhaschen. Dann sahen sie es: Ganz oben waren die Fensterscheiben fast über die gesamte Front zerborsten. Flammen loderten im Innern. Dicker schwarzer Rauch stieg auf und verlor sich im dunklen Himmel. Mit ihrem Smartphone zoomte Marie näher ran und sah plötzlich einen zerfetzten Arm an einem Mauerrest hängen. Fassungslos wandte sie sich ab. Ihr wurde übel. Sie musste würgen, doch es kam nichts.
»Das war Jansen mit ihren Scheißreformern. Diesen feigen Siffern!« Felix bebte vor Wut.
Es fiel Marie schwer, ihre Gedanken zu sortieren, während sich ein bitterer Geschmack in ihrem Mund ausbreitete. »Warum sollten sie das getan haben?« Die Vorstellung, dass vor wenigen Momenten dort oben Menschen einen grausamen Tod gefunden haben mussten, war kaum auszuhalten.
»Na, weil sie die Wahlen verlieren werden!«
»So was hilft doch nur dem AUFSTAND selbst.«
»Nicht, wenn sie Vogel erwischt haben.«
Natürlich. Ohne seine Parteichefin war der AUFSTAND nur halb so stark. Gut möglich, dass sich die Kanzlerkandidatin in der Parteizentrale aufgehalten hatte. Vielleicht hatte der Anschlag wirklich auf sie abgezielt. Aufgeregt fragte Marie Y nach Angaben zu den Opfern, doch dort war nur von namenlosen »Toten und Verletzten« die Rede.
Plötzlich ging ein Raunen durch die Menge.
»Sie lebt!«, rief jemand. Jeder wusste, wer gemeint war. Menschen fielen sich um den Hals, auch Felix umarmte wildfremde Leute, Jubel brach aus. Aber nicht bei allen. Marie freute sich nicht über die Nachricht. Es war ein hässliches Gefühl, doch sie konnte es nicht ändern. Vogel war ihr suspekt, oder besser: unheimlich. Sie war klug, eloquent, wirkte in Talkshows sehr sympathisch – sagte aber Dinge über Ausländer und Grundbedarfler, über Linke und Menschen mit Behinderung, die Marie schaudern ließen.
Bald nach dem ersten Jubel schlug die Stimmung um, und die Wut kehrte zurück. Angefacht von den ersten Liveanalysen auf Y, machte sich eine Gruppe auf den Weg zur Zentrale der REFORM. Felix wollte mit. Er grinste beim Anblick der aufgebrachten Menge, aber darunter schien etwas hindurch, das Marie nur als Hass bezeichnen konnte. Es machte ihr Angst, ihn so zu sehen. Sie packte ihn am Arm. »Felix, wir müssen nach Hause.« Wie von Sinnen sah er sie an. »Mir ist schwummrig zumute, und ich habe meine Tabletten zu Hause vergessen.« Natürlich hatte sie auch diesmal einen Notfall-Blister in der Hosentasche, doch diese Notlüge riss ihren Bruder aus seiner Trance, als hätte sie ihm Ammoniak unter die Nase gehalten. Sein Blick klarte auf, und er legte ihr ohne ein weiteres Wort den Arm um die Schultern, teilte mit der freien Hand die ihnen entgegenkommende Menge und führte sie aus dem Chaos heraus. Hätte er sich an jenem Abend ausgetobt, wäre er vielleicht zwei Tage später nicht mit dem Wahlkämpfer aneinandergeraten – oder er hätte wegen Schlimmerem vor Gericht gestanden.
Den Rest des Abends hatten sie am Küchentisch gesessen und sich gegenseitig Nachrichten vorgelesen und vorgespielt. Offenbar hatten zwei Drohnen im Schutz der Dunkelheit die Chefetage der AUFSTAND-Zentrale angegriffen. Die erste hatte ein Fenster durchschlagen, die zweite war durch die Flure bis zur Tür eines Konferenzraums geflogen und dort explodiert. Der Raum war voll besetzt gewesen, neun Menschen starben, knapp dreißig wurden verletzt. Von den Tätern fehlte jede Spur. Das gab Felix genug Raum, um von einer Theorie zur nächsten zu springen. »Der französische Geheimdienst!« – »Islamisten!« – »Der Ex-Freund der Generalsekretärin!« Aber er kehrte immer wieder zurück zu der Überzeugung, dass die REFORM dahintersteckte.
Noch während sie diskutierten, veröffentlichte Vogel ein Video. Sie stand mitten im zerstörten Konferenzraum, hatte Ruß im Gesicht, Haarsträhnen klebten auf ihrer Stirn, und Blut rann ihr die Schläfe hinunter. Hier und da loderte noch Feuer, hinter ihr war die Stadt durch ein Loch in der Fassade zu sehen. Marie sah, dass Felix Tränen in den Augen hatte.
»Liebe Deutsche. Ich habe heute neun Freunde und Mitstreiter verloren. Wenn ich nicht wegen eines Anrufs meiner kranken Tochter den Raum verlassen hätte, wäre ich jetzt ebenfalls tot. Wie lange wollen wir diesen Zustand noch ertragen? Wie lange wollen wir uns von den Feinden unseres Landes noch verhöhnen lassen? Es ist egal, ob es diesmal Islamisten waren, eine ausländische Macht oder die Landesverräter von der REFORM. Das deutsche Volk hat genug! Wir werden unser Land gegen den Terror verteidigen – mit allen Mitteln! Ausländer müssen raus! Linksextreme in den Knast! Und all die Woken, die diesen Zustand zu verantworten haben, müssen dieses Land verlassen! Die Zeit ist reif für ein großes Reinemachen. Für einen Neuanfang. In einer Woche werden wir damit beginnen!« Sie ballte die Faust und sah wütend in die Kamera.
Maries Magen zog sich zusammen, während Felix sich mit der Faust auf die Brust schlug.
—
Der AUFSTAND gewann die Wahl nicht nur, sondern bekam die von Vogel so begehrte absolute Mehrheit. Und nur drei Wochen später platzte die nächste Bombe: Es gab eine Tatverdächtige für den Anschlag. Einer Frau namens Olga S. wurde vorgeworfen, die beiden Drohnen gesteuert zu haben. Doch sie geriet schnell in den Hintergrund, weil die Berliner Staatsanwaltschaft, die für Terrorstraftaten eigentlich gar nicht zuständig war, einen weiteren Haftbefehl gegen die mutmaßliche Auftraggeberin von Olga S. erwirkte. Und diese Frau war niemand Geringeres als Skadi Semmerich – die Generalsekretärin der REFORM.
3
Marie konnte sich kaum konzentrieren. Die Steuerhinterziehungssache, an der sie eigentlich arbeiten sollte, war auch mit Ys Hilfe kompliziert, vor allem aber wahnsinnig dröge. Als sie endlich eine fremde Stimme auf dem Gang hörte, klickte sie alle geöffneten Programme weg und wartete gespannt.
Nach einer weiteren Ewigkeit klingelte ihr Smartphone. Lothar.
»Sie ist da.«
»Im großen Konfi?«
»Nein, da habe ich die beiden Polizisten geparkt. Sie ist bei Ava. Lass unbedingt dein Smartphone liegen.«
Marie legte es auf die Ladestation und verließ das Büro. Als sie am Ende des Gangs um die Ecke bog, sah sie eine Frauengestalt in dunklem Anzug vor Avas Büro stehen, offenbar von einem privaten Sicherheitsdienst. Die Frau drehte sich zu Marie und musterte sie. Nach einem zackigen Klopfen öffnete sie Avas Tür und ließ Marie eintreten.
»Da bist du ja schon.« Ava ging auf sie zu und ergriff ihren Arm. »Das ist Rechtsanwältin Marie Wigand. Sie arbeitet seit vielen Jahren für uns. Ich binde sie überall ein, damit sie mich bald ersetzen kann.« Es stimmte, dass Marie auf all ihren Mandaten arbeitete, und mittlerweile ausschließlich für sie. Aber das mit dem Ersetzen glaubte ihr niemand.
Ava führte Marie zu einer kräftigen Frau mit hochgekrempelten Pulloverärmeln. Ihre Augen funkelten. »Marie – das ist Nina Jansen, die Vorsitzende der REFORM.«
Natürlich wusste Jansen, dass Marie sie kennen musste. Trotzdem spielte sie mit. Ihr Gesichtsausdruck strahlte eine routinierte Offenheit aus, doch der wache Blick schien Marie in Sekundenschnelle zu durchleuchten. Während sie sich die Hände schüttelten, suchten Maries Augen unwillkürlich nach der Narbe an Jansens Hals. Da war sie, die Spur eines Jahre zurückliegenden Attentats, dick, rot und wulstig wie ein überlanger Regenwurm. Die vielen falschen Behauptungen, das Attentat sei nur inszeniert gewesen, hatten offenbar auch in Marie Zweifel geweckt. Jedenfalls konnte nur das die Erleichterung erklären, die sie beim Anblick der Narbe spürte.
Auf eine Geste von Ava hin setzten sie sich auf die beiden türkisfarbenen Ledersofas, die in der verglasten Ecke des Büros einander gegenüberstanden. In den Polstern versank Marie immer so tief, dass sie das Gefühl hatte, nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen zu können. Draußen begann es zu regnen. Dünne Spritzer erschienen auf den Fensterscheiben und malten chaotische Muster.
»Was können wir für Sie tun, Frau Jansen?«
Die Reformerin rutschte vor und stützte ihre kräftigen Unterarme auf die Knie. Obwohl Marie sie noch nie persönlich getroffen hatte, war ihr Jansens ernstes Gesicht völlig vertraut. Politisch stimmte sie ihr vielleicht nicht immer zu, aber sie hatte großen Respekt vor dieser Frau. Davor, dass sie nach dem Attentat die Politik nicht aufgegeben hatte, kurz darauf sogar Parteivorsitzende geworden war. Und dass sie in den vergangenen Monaten bis tief in den Wahltag hinein für ihre Partei gekämpft hatte. Auch noch, als alles längst verloren war.
»Sie haben von Skadis Festnahme gehört?«
»Natürlich«, sagte Ava. »Und dass vor Kurzem Anklage gegen sie erhoben wurde.«
»Wir dachten zunächst, sie würde bald wieder entlassen. Ein politischer Stunt, um uns einzuschüchtern.«
»Das dachte ich auch.«
»Inzwischen sitzt sie seit zwei Monaten in U-Haft, und gestern hat uns jemand gesteckt, dass das Kammergericht die Anklage gegen sie tatsächlich zulassen will.«
Das überraschte Marie. Gerichte durften Anklagen nur zulassen, wenn sie eine Verurteilung für überwiegend wahrscheinlich hielten. Marie hatte fest damit gerechnet, dass das Gericht der Einschätzung der vom AUFSTAND gelenkten Staatsanwaltschaft in diesem Fall nicht folgen würde.
Auch Ava wirkte irritiert. »Haben sie doch etwas Handfestes gefunden?«
»Natürlich nicht. Aber der Druck auf das Gericht ist groß, die Sache schnell zu eröffnen und tatsächlich zu verhandeln. Und wir können natürlich nicht ausschließen, dass es Skadi tatsächlich verurteilen will.«
Will. Bis vor Kurzem hätte Marie bei dieser Wortwahl protestiert. Nun musste sie an den Fall in Thüringen denken. Vor drei Jahren fing die dortige Landesregierung an, ausreisepflichtige Ausländer in Lagern zusammenzupferchen und zu unbezahlter Arbeit zu zwingen. Zwei Gerichtsinstanzen hielten das für rechtmäßig, erst das Bundesverwaltungsgericht sah es anders. Kurz darauf weigerte sich eine Amtsrichterin in Stuttgart, einen Landtagsabgeordneten des AUFSTANDS wegen Körperverletzung zu verurteilen, obwohl er mitten im Plenum eine REFORM-Abgeordnete krankenhausreif geschlagen hatte. Seither gab es fast im Wochentakt Beispiele für fragwürdiges Verhalten von AUFSTAND-Anhängern im Justizapparat. Und das würde jetzt, da diese Partei auch im Bund regierte, nur noch schlimmer werden.
Ava sah Jansen abwartend an.
»Wir möchten, dass Sie Skadi Semmerich verteidigen.«
Obwohl Marie mit dieser Antwort gerechnet hatte – warum sonst sollte die Parteivorsitzende persönlich sie aufsuchen? –, konnte sie nur schwer ihre Verwunderung verbergen. Ava war eine fantastische Strafverteidigerin – aber eine Terrorverdächtige hatte sie noch nie vertreten.
Ein wohlvertrautes Klicken ertönte. Irritiert sah Jansen auf Avas Hände. Marie wusste, dass sie darin ein geöffnetes Zigarettenetui liegen sehen würde.
»Stört es Sie?«
»Natürlich.«
Ava hielt inne, die Zigarette kurz vor den Lippen.
»Aber bitte, es ist Ihr Büro.«
Maries Chefin vollendete die Bewegung und entzündete die Zigarette mit einem Streichholz. Wider alle Regeln und Proteste rauchte sie auch im Büro. So habe sie das mit Finkenbein persönlich bei ihrem Einstieg verhandelt, entgegnete sie jedes Mal, wenn sich jemand darüber beschwerte. Ava lehnte sich zurück und stützte den Arm mit der Zigarette auf ihre Hüfte. Wenn jemand mal ein Porträt von ihr malen würde, dann müsste es von dieser Pose sein, dachte Marie und verkniff sich ein Grinsen.
»Sie wissen, was wir hier machen?«
»Ich habe eine Vorstellung davon.«
»Es gibt sehr viel geeignetere Verteidiger im Land für eine solche Sache. Semmerich hat sicher längst einen?«
»Ja. Spindel.«
Ava pfiff durch die Zähne. Marie hatte schon einiges von Marius Spindel gehört. In den letzten zehn Jahren hatte es kaum ein pressewirksames Großverfahren gegeben, in dem er nicht mitgemischt hätte. Und auch wenn er bei Kollegen wegen seiner Geltungssucht unbeliebt war, würde niemand bezweifeln, dass er einer der besten Strafverteidiger des Landes war: detailversessen, dominant, redegewandt.
»Dann brauchen Sie uns doch wirklich nicht.«
»Doch. Ich will, dass Sie mit in dieses Verfahren einsteigen. Und zwar mit Blick auf ein anderes. Vogel geht es nämlich nicht um Semmerich, es geht ihr um sehr viel mehr.«
In Ava schien es zu arbeiten, denn statt einer direkten Antwort zog sie stumm an ihrer Zigarette.
Erst nach einigen Augenblicken verstand Marie die Anspielung und erschrak. »Vogels Regierung will die REFORM verbieten lassen!«, sagte sie.
Jansen nickte.
»Und deshalb muss Semmerich freigesprochen werden«, führte Marie ihren Gedanken fort.
Wenn das Kammergericht feststellte, dass Semmerich als Generalsekretärin der REFORM mitten im Wahlkampf einen Bombenanschlag auf den politischen Gegner in Auftrag gegeben hatte, wäre das ein wichtiger Baustein für ein Parteiverbot. Vielleicht würde es sogar für sich genommen reichen, dass das Bundesverfassungsgericht einem entsprechenden Antrag stattgab. Erst recht, wenn Semmerich den Entschluss dazu nicht allein getroffen hätte.
»Sie waren früher viel vor dem Bundesverfassungsgericht«, sagte Jansen zu Ava. »Ich will, dass Sie voll in diesen Strafprozess einsteigen, ihn so tief es geht durchdringen. Damit wir vorbereitet sind, falls es wirklich zu einer Verurteilung und einem Verbotsverfahren kommt.«
Ava nahm den Aschenbecher vom Tisch, ging ein paar Schritte zum Fenster und sah hinaus. Der Wind war stärker geworden und jagte die Regentropfen über die Scheibe. In der Ferne krümmten sich die Baumkronen. Aber hinter dem dicken Glas war es so still, dass Marie das Knistern der beiden letzten Züge hörte, die Ava von ihrer Zigarette nahm. Der langsam emporsteigende Rauch waberte über ihrem Kopf wie eine Denkblase.
Sie drehte sich zu Jansen und drückte die Zigarette aus. »Ich kann das leider nicht übernehmen.« Sie stellte den Aschenbecher ab und setzte sich wieder aufs Sofa. Mit einem Mal lag viel Spannung in der Luft. Vielleicht hatte Marie sie auch erst jetzt bemerkt.
»Warum nicht?«, fragte Jansen ruhig.
»Aus einer ganzen Reihe von Gründen.« Ava setzte zu einer ihrer berüchtigten Aufzählungen an. Sie begann immer mit dem kleinen Finger ihrer rechten Hand und zählte bis zum Daumen durch. So habe sie es als Kind gelernt, hatte sie Marie einmal erklärt. »Erstens bin ich momentan komplett ausgelastet, Sie brauchen mich aber sicher sofort. Zweitens habe ich schon lange kein Kapitaldelikt mehr verteidigt, und noch nie eine Terrorverdächtige. Und drittens ist mir das alles viel zu politisch. Ich will mit dem ganzen Hickhack nichts zu tun haben.«
»Hickhack?« Jansens Narbe schien plötzlich röter als zuvor. »Wir reden hier nicht von parteipolitischem Geplänkel. Der AUFSTAND will die einzige Oppositionspartei des Landes verbieten!«
»Meine Kanzlei verteidigt Manager, von Politik halten wir uns fern.«
»Diesen Luxus haben Sie bestimmt nicht mehr lange.«
»Was soll das denn heißen?«
Jansen sah Ava gequält an. »Haben Sie nicht mitbekommen, was in den letzten Jahren los war? Wie der AUFSTAND in den Bundesländern, in denen er regiert, Geflüchtete inhaftiert, zu Arbeit zwingt oder heimlich in die Wüste ausfliegt? Wie er das Versammlungsrecht beschränkt und Aktivisti monatelang in Präventivhaft steckt, wie er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auflöst? Wie er ehemalige Regierungsmitglieder meiner Partei vor Gericht zerrt, so wie jetzt Skadi? Wie er unliebsame Privatmedien mit Regulierung überzieht und eine NGO nach der anderen verbietet? Glauben Sie wirklich, dass vier Jahre mit Vogel in einer Bundesregierung ohne Opposition spurlos an Ihnen vorübergehen würden?«
»Was wollen die tun, mich ausbürgern und aus dem Land werfen?«
Jansen sah sie stumm an.
Ava lachte auf. »Das ist doch albern.«
»Sie sehen nicht, wie ernst die Sache ist, Frau Montaseri. Würde die REFORM verboten, fielen all ihre Parlamentsmandate in Bund und Ländern weg …«
»… und damit die Sperrminorität Ihrer Partei, ich weiß«, vollendete Ava den Satz.
Marie zuckte zusammen. So weit hatte sie nicht gedacht. »Der AUFSTAND hätte mit einem Schlag mehr als zwei Drittel der Stimmen in Bundesrat und Bundestag«, sagte sie langsam. »Vogel könnte die Verfassung ändern und das Bundesverfassungsgericht abschaffen. Und danach ohne Sorge vor Kontrolle auch Grundrechte und freie Wahlen.«
Marie blickte zu Ava, doch die sah wieder aus dem Fenster. Wollte sie die Gefahr nicht wahrhaben? »Es hat aufgehört zu regnen.« Ava stand auf. »Darf ich Ihnen unsere Dachterrasse zeigen?«
—
Marie war erleichtert, als sie nach draußen traten. Die Luft roch frisch, perlenförmige Wassertropfen schimmerten auf den Bodenplatten aus Kunststoff. Durch einen Spalt beschien die Sonne den bewölkten Himmel, und in der Ferne strahlte der Fernsehturm eine große Unbekümmertheit aus. Zwei von Maries Associate-Kollegen, die gerade mit Kaffeebechern am Geländer standen, verzogen sich auf ein Zeichen von Ava nach drinnen. Verstohlen sahen sie sich nach Jansen um.
Ava wischte mit dem Ärmel einen der Hochstühle trocken, der an der Brüstung stand, und bot ihn Jansen an, die dankend ablehnte.
»Warum sagen Sie nicht, weshalb Sie mich wirklich engagieren wollen?«
Jansens Augen blitzten, aber sie schwieg.
»Sie wollen mich nicht dabeihaben, weil ich eine so tolle Verfassungsrechtlerin bin –«
»Doch, das wollen wir.«
»Aber nicht nur deshalb. Sie wollen mich dabeihaben, weil ich damals Vogel verteidigt habe.«
Marie stutzte. Ihr wurde heiß. Wie konnte sie das nicht wissen? Stand ihre Chefin etwa dem AUFSTAND nahe? Nein, das war unmöglich. Marie musste sich beherrschen, das Gespräch nicht zu unterbrechen. Doch ihr blieb nichts anderes übrig, als vorzugeben, dass sie wusste, worum es ging.
Jansen seufzte. »Das mag auch eine Rolle spielen.«
»Eine entscheidende Rolle.«
»Eine entscheidende Rolle. Sie kennen Vogel. Nach allem, was ich gehört habe, schuldet sie Ihnen viel. Es wäre ein starkes Zeichen, wenn Sie diesmal auf unserer Seite im Gerichtssaal stünden. Es würde allen deutlich machen, dass der AUFSTAND nun genau jene Repression betreibt, die er uns stets – zu Unrecht – vorgeworfen hat. Und dann sollen Sie auch noch eine verdammt gute Verteidigerin sein. Ich kann mir niemand Besseren vorstellen für diese Sache. Wir brauchen Sie, Frau Montaseri.«
Ava schüttelte langsam den Kopf. »Meine Partner würden mir das nie durchgehen lassen.« Aber sie klang nicht mehr so entschlossen wie vorhin im Büro. Vielleicht hatte die Aussicht auf eine nahezu allmächtige AUFSTAND-Regierung sie doch beeindruckt. Oder etwas anderes, das Marie nicht erkannte.
Falls auch Jansen den Wandel in Avas Stimme bemerkt hatte, ließ sie es sich nicht anmerken. »Ihre Partner werden es Ihnen durchgehen lassen, wenn sie hören, was wir Ihnen zahlen wollen.«
Ava hob die Augenbrauen.
»Zweitausend Euro.«