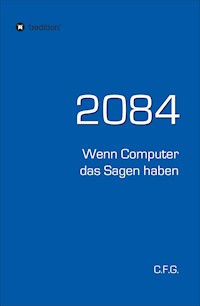
21,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
2084 dürften Computer sehr viel intelligenter sein als Menschen. Was werden die Folgen sein, werden Computer unser geistiges Leben dominieren? Welche Rolle kommt dem Menschen dann noch zu? Das Buch schildert die Möglichkeit einer intellektuellen Symbiose zwischen Mensch und Computer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
2 0 8 4
WENN COMPUTER DAS SAGEN HABEN
C. F. G.
Impressum:
Copyright © 2016 C.F.G.Herstellung und Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Es wird keine Garantie und Gewährleistung für die Aktualiät, Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhaltes übernommen. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
978-3-7345-3373-0 (Paperback)978-3-7345-3374-7 (Hardcover)978-3-7345-3375-4 (e-Book)
Inhalt
VORWORT
TEIL I: DIE ZUKUNFT – EINE VISION
1.IRRATIONALITÄT
1.1irrationales und Unrationelles
1.2Denkmethoden
1.3Limitationen
1.4Der computer als Berater
1.5Die sechste Demütigung
2.VISIONEN
2.1Trägheitsmoment
2.2Die krone der Schöpfung
2.3Science-Fiction
2.4Denk-Maschinen
2.5Chronologie
3.PERSONAL BERNOULLI CONSULTANT (PBC)
3.1PBC
3.2Fehlkonstruktion Gehirn
3.3Optimale Beratung
3.4Methodik
3.5Entscheidungstheorie
3.6Rationalität
4.IMPLIKATIONEN
4.1Individualismus
4.2Wirtschaft
4.3Produktionsfaktoren
4.4Komplexität
4.5Regierung
4.6Liberalismus
4.7Rechtssystem
4.8Sicherheit
4.9Privatsphäre
4.10Steuern
4.11Geld
4.12Register
4.13Schulsystem
4.14Autonomie
4.15Oral
4.16Sprachanalyse
4.17Anipulation
4.18Kommunikation
4.19Programmierung
4.20Selbsterkenntnis
4.21Gesundheit
4.22Selbstwertgefühl
4.24Roboter
4.25Missetaten
TEIL II: DAS HEUTE – DER STAND DES WISSENS
1.INTELLIGENZ
1.1Verfügbarkeit
1.2Hard- und Software
1.3Benutzerinterface
1.4Intelligenz
1.5Prognosefähigkeit
1.6Künstliche Intelligenz
1.7Leichte Und schwierige kognitive Probleme
2.ERKENNTNIS
2.1Die drei ebenen der ErkennTnismodelle – ein Exkurs
2.2Modelle der Welt
2.3Empirismus
2.4Grenzen der Prognostizierbarkeit
3.RATIONALITÄT
3.1Entscheidungstheorie
3.2Wissenschaft und Wissenschaftstheorie
3.3Savages Modell der Welt
3.4Rationales Lernen
4.PHILOSOPHISCHE FRAGEN
4.1Induktionsproblem und Sinnkriterium
4.2Scheinargumente
4.3Reflexion
4.4Emotionen
TEIL III: DIE VERGANGENHEIT – EIN RAPPORT AUS DEM JAHRE 2084
1.SPEZIES MENSCH
1.1Der Kokon
1.2Das Gehirn
1.3Varianten
1.4Fitness
1.5Ausbreitung
1.6Aggressivität
1.7Entwicklungsperspektiven
2.KOOPERATION UND KOMMUNIKATION
2.1Kooperation
2.2Kooperation unter Zwang
2.3Kooperation via Ideologien
2.4Betriebe
2.5Kommunikation
2.6Desinformation
3.MYTHEN
3.1Sinn des Lebens und der Liebe
3.2Leiden und Tod
3.3Geschlechter
3.4Psyche
3.5Kunst
3.6Philosophie
3.7Gott und Götter
3.8Kirchen
3.9Religionskriege
3.10Schenbild
3.11Dogmatisches Denken
3.12Gottesbeweise
3.13Religionsangebote
4.STAAT
4.1Rechtfertigung
4.2Absolutismus und Totalitarismus
4.3Ideologien
4.4Geld
4.5Wohlstand
4.6Gesetze
4.7Sicherheit
4.8Verwaltung
4.9Steuern
4.10Propaganda
4.11Sozialismus/Kommunismus
4.12Demokratie
4.13Mafia
4.14Die artgerechte Haltung von Menschen
VORWORT
Dies ist ein schwieriges Buch, denn es geht um eine vielschichtige Materie. Dies ist ein unangenehmes Buch, denn der Mensch kommt nicht gut weg. Dies ist ein optimistisches Buch, dennoch kann es Depressionen auslösen.
Niemand kommt auf den Gedanken, man könne gut Tennis spielen, ohne entsprechenden Unterricht. Selbst der talentierteste Spieler braucht Anweisungen und muss regelmäßig üben, um erfolgreich Tennis zu spielen. Jedoch glauben fast alle Menschen, sie könnten gut denken, ohne es studiert und trainiert zu haben. Kaum jemand weiß, dass es Gesetze und Regeln gibt, nach denen man denken sollte – noch weniger befolgen sie. Es scheint sogar, dass Denkvorgänge ein Tabu sind: Analytisches Kalkulieren gilt als kaltherzig, Bauchgefühl hingegen als eine gute Entscheidungsgrundlage. In der Schule werden Denkregeln nicht gelehrt; bestenfalls nimmt der Schüler derartige Prinzipien in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern durch Osmose auf.
Die schlechte Nachricht: Nichts deutet darauf hin, dass sich dies ändern wird. Im Gegenteil: Die ungenügende Schulung im Denken verhindert das Nachdenken über das Denken – ein Teufelskreis. Die Umbesinnung müsste also von außen an den Menschen herangetragen werden.
Die gute Nachricht: Genau das wird noch in diesem Jahrhundert geschehen! Smarte Computer werden das Denken für die Menschen übernehmen und sie instruieren. Die dabei zur Anwendung gelangenden Denkregeln sind heute schon bekannt. Doch im Unterschied zum Menschen, der sie nicht anwenden kann oder nicht anwenden will, werden smarte Computer sie konsequent befolgen.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die sich in ihrem Stil völlig voneinander unterscheiden: Teil I hat Sachbuch-Charakter, Teil II ist technisch orientiert und Teil III besitzt essayistische Züge. Jeder Teil ist in sich abgeschlossen und kann für sich gelesen werden; zentrale Überlegungen werden jeweils wiederholt.
In Teil I wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss Computer und Computerprogramme in Zukunft auf die Menschen haben werden. Da Computer „Denkmaschinen“ sind, werden sie vor allem die Art und Weise des Denkens verändern. Konkret wird ihr Einfluss sich vor allem bei der Entscheidungsfindung bemerkbar machen und weniger als Hilfsaggregat für Berechnung, Steuerung, Kommunikation und Informationsbeschaffung, wie das heute der Fall ist. Um die besten Entscheidungen zu treffen, brauchen Computer ein Konzept. Man könnte auch sagen, dass intelligente Software eine Philosophie umsetzen wird. Und so wie Philosophen zuweilen einen großen Einfluss auf die Denkweise ihrer Zeit hatten, so werden auch Computer das geistige Leben der Zukunft prägen und damit gravierende gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Umwälzungen bewirken.
In Teil II wird versucht, die Philosophie der Computer von morgen zu skizzieren. Dies kann zwar keine Einführung in die Methodik des Denkens bzw. in die Wissenschaftstheorie sein. Aber es soll zumindest umrissen werden, was sich hinter rationalen Denkmethoden mit dem Ziel, optimale Entscheidungen zu treffen, verbirgt.
In Teil III blickt ein smarter Computer des Jahres 2084 70 Jahre zurück. Er teilt kaum eine der vielen, den Menschen lieb gewordenen und selbstverständlichen Ansichten unserer heutigen Zeit. Insbesondere unser Selbstverständnis, aber auch Sozialstrukturen, Unternehmertum und Nationalstaaten kommen ihm archaisch vor.
Es wurde versucht, das Buch kurz zu halten gemäß der Weisheit: „Weniger ist mehr.“
TEIL I
DIE ZUKUNFT
Eine Vision
Wie werden intelligente Computer unser Leben verändern? Die Kernthese dieses Buches lautet, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft dank rationaler Denkmethoden unser materielles und insbesondere unser geistiges Leben dominieren werden. Die Folgen werden dramatisch sein. Bereits jetzt, mit Computern lediglich in der Rolle eines beschränkten Gehilfen, hat die Technisierung eine neue Welt geschaffen, ein globales, überwachtes Dorf. Aber wie groß werden die Umwälzungen erst sein, wenn Computer intelligenter sind als Menschen? Welche Rolle kommt dem Menschen dann noch zu? Was hat das für Auswirkungen auf das Selbstverständnis des Menschen?
1. IRRATIONALITÄT
1.1 Irrationales und Unrationelles
Der Mensch, ein vernunftbegabtes Wesen?
Der Mensch hält sich für ein vom Verstand geleitetes Wesen. Objektiv betrachtet ist jedoch das Gegenteil der Fall: Das Verhalten des Menschen ist zumeist höchst unvernünftig. Der Ökonom Harry Markowitz schrieb einmal, dass der rationale Mensch ebenso wenig existiere wie das Einhorn. Dies liegt unter anderem daran, dass zu einem guten Teil die menschlichen Bedürfnisse wie z. B. der Fortpflanzungstrieb genetisch bedingt sind. An den Verhaltensprogrammen des Menschen hat sich seit den frühen Stufen seiner Entwicklung nicht viel geändert; sie sind viele Tausend Jahre alt. Der aktuellen Situation aber werden sie nicht mehr gerecht. Verhaltensweisen, die sich bei der Entstehung und Entwicklung des Menschen als Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil erwiesen haben, sind in einer derart durch Technik veränderten Umwelt kontraproduktiv. So war es beispielsweise für Frühmenschen noch eine gute Strategie, sich in guten Zeiten Fettreserven anzulegen, um für schlechte Zeiten besser gerüstet zu sein; heute wirkt sich dieses Verhalten jedoch lebensverkürzend aus. Der hochgelobte Verstand des Menschen kann diese Instinkte nicht zähmen.
Dabei wäre heute das verstandesmäßige Handeln wichtiger denn je, da wir nicht mehr nur lokal begrenzte Probleme zu lösen haben. Krisen sind heute vielfach global, kaum ein Land bleibt verschont, man denke nur an die Wirtschaftskrisen und die Klimaproblematik. Diese Schwierigkeiten müssten „kalt“ analysiert und daraus optimale Entscheidungen abgeleitet werden. Der Mensch kann es sich nicht mehr leisten, irrational und unrationell zu handeln.
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts keimte Hoffnung auf eine rationalere Welt auf, als der Wiener Kreis um Moritz Schlick die Fundamente der sogenannten Wissenschaftstheorie legte. Eine Umsetzung der neuen Erkenntnisse in die Praxis schien nur eine Frage der Zeit. Längst hat sich diese Hoffnung als Trugschluss erwiesen. Auch nach der Jahrtausendwende sind emotionsgeladenes Denken und Verhalten en vogue. Schlimmer noch, Rationalität hat einen schlechten, Irrationalität einen guten Ruf.
1.2 Denkmethoden
Astronom zu einem Kollegen: „SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ist ja gut und recht, aber wäre die Suche nach intelligentem Leben hier auf der Erde nicht dringender?“
Will man in einer Sportart Erfolg haben, so muss man zunächst die Technik erlernen, die Strategien bzw. Taktiken studieren und die körperlichen Voraussetzungen schaffen. Ohne Studium und Training geht es nicht. Seltsamerweise ist dies beim „Denksport“ anders. Hier sind die meisten Menschen der Ansicht, dass Denken nicht erlernt werden muss. Bildung muss zwar erst erworben werden, aber Denken geht von selbst. Gut, gewisse Leute sind etwas gescheiter als andere, so wie es beim Sport Athleten gibt, die mehr Talent haben als andere. Aber eine Denkschule brauche es für erfolgreiches Denken nicht.
Diese eigentümliche Ignoranz gegenüber dem Denken ist neueren Datums. Früher galt das Erlernen von Latein als Denkschulung, Mathematik und insbesondere logisches Schließen als Bestandteil einer höheren Ausbildung. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Vielmehr sind emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz gefragt; analytisches Denken hingegen gilt als inhuman, ja gefährlich.
Richtig zu denken, ist schwierig. Wie nicht anders zu erwarten, ist die Wissenschaft vom „richtigen“ Denken, die Wissenschaftstheorie, nicht leicht verständlich. Die entsprechende deutschsprachige Literatur ist zudem meist an Fachleute gerichtet. Wenn das Denken in der Schule gelehrt würde, wären wir immerhin ein Stück weiter. Wie beschwerlich der Weg zu rationalem Denken noch ist, wird besonders offensichtlich, wenn man im Internet Diskussions-Foren verfolgt.
1.3 Limitationen
Wer rettet die Menschheit?
Die Irrationalität des Menschen kann an dem alles dominierenden Problem der Menschheit illustriert werden: an der Überbevölkerung. Kriege, Hunger, Kriminalität, Umweltzerstörung und vermutlich auch der Klimawandel entstehen nur, wenn zu viele Menschen auf zu engem Raum leben. Trotz dieser trivialen Einsicht gibt es nur wenige Menschen, von Politikern ganz zu schweigen, die einen Bevölkerungsstopp befürworten. Gemäß dem Soziobiologen E. O. Wilson hat die Erde bereits im Jahr 1978 die Grenze der für den Planeten langfristig noch tragfähigen Bevölkerung überschritten, im Jahr 2000 gar schon um 40%.
Ein Land wie die Schweiz mit mehr als acht Millionen Einwohnern könnte eigentlich nur etwa eine Million Menschen nachhaltig aufnehmen. Die Folge: Die Kriminalität steigt. Die Biodiversität nimmt rapide ab, unberührte Natur gibt es keine mehr. Für junge Schweizer ist Natur ein Park mit dem Schild „Rasen betreten verboten“.
Derartige Missstände zeigen, dass der Kampf Verstand gegen Gefühle nicht gewonnen werden kann. Wer also soll die Menschen vor sich selbst retten? Die einzige Hoffnung ist, dass es rechtzeitig gelingt, künstliche Gehirne zu bauen, die intelligenter sind als die Menschen. Künstliche Gehirne könnten mit ihrer rationalen Denkweise die für Frieden, Wohlstand und eine intakte Natur unerlässlichen Entscheidungen treffen. Die Chance der Menschen besteht also darin, mit ihrer eingeschränkten Intelligenz hochintelligente Maschinen zu bauen, die sie vor sich selbst schützen.
1.4 Der Computer als Berater
Der Computer – dein Freund und Helfer?
Es ist offensichtlich, dass Computer unser tägliches Leben immer mehr verändern und erleichtern (und verkomplizieren). Doch diese Veränderungen, nennen wir sie technische Veränderungen, sind nur die eine Seite der Computer-Revolution. Die andere Seite – und diese ist hauptsächlich Gegenstand dieses Buches – sind die Veränderungen des Denkens, die Computer bewirken werden. Technische Neuerungen können die meisten Menschen (wenigstens die jüngeren) problemlos übernehmen und davon profitieren. So ist beispielsweise das Handy in kürzester Zeit akzeptiert worden und hat unser Verhalten verändert. Gedankliche Umwandlungsprozesse hingegen sind viel schwieriger zu akzeptieren, auch deshalb, weil sie die Welt nachhaltiger umformen als technologische Fortschritte.
Während die technischen Veränderungen bereits begonnen haben und ganz gut extrapolierbar sind, haben die geistig-intellektuellen Reformen noch gar nicht richtig eingesetzt. Momentan werden Computer noch den Menschen angepasst. Die Folge ist, dass wir vom Potenzial der Computer nur rudimentär profitieren. Erst wenn Computer die Führung im Denken übernommen haben, werden die Fortschritte richtig spürbar sein. Voraussetzung ist natürlich, dass Computer leistungsfähiger sind als menschliche Gehirne und ihre Programme eine höhere Intelligenz besitzen als Menschen. Derartige Computer und Computerprogramme werden in einigen Jahrzehnten zur Verfügung stehen.
Die Computer der Zukunft werden die Probleme und Wünsche ihrer Besitzer verstehen und sie entsprechend beraten. Man stelle sich so etwas wie ein Smartphone vor, das man immer bei sich hat. Es berät den Besitzer jederzeit und allwissend: Es ist der bestmögliche Arzt, Versicherungsagent, Jurist, Psychologe, Anlageberater, Politexperte und und und.
1.5 Die Sechste Demütigung
Sohn zum Vater: „Papi, Papi, in der Schule haben sie gesagt, dass wir vom Affen abstammen.“ Vater zum Sohn: „Du vielleicht – ich sicher nicht.“
Der Mensch hat schon einige Demütigungen über sich ergehen lassen müssen: Erstens musste er erfahren, dass sich das Universum nicht um ihn dreht. Zweitens wurde er nicht von einem höheren Wesen erschaffen, er stammt von Einzellern ab. Drittens hat der Mensch keine Seele, er ist eine Maschine. Viertens ist der Mensch nicht in der Lage, den Mikrokosmos zu begreifen. Und fünftens ist die Antriebskraft des Menschen nicht er an sich, sondern seine egoistischen Gene (wir werden darauf noch genauer eingehen). Diese Demütigungen hat der Mensch – zwar mit Krisen – überstanden, ohne seinen Hochmut abzulegen. Nun steht ihm allerdings eine sechste Demütigung bevor: das Aufkommen von höheren Intelligenzen.
Die Frage ist nicht, ob Computer jemals intelligenter sein werden als Menschen; die Frage ist lediglich, wann. Und da Computer, wenn sie ein gewisses Intelligenzniveau erreicht haben, sich selbst immer weiter verbessern werden, und zwar rasant, werden sie den Menschen intellektuell bald weit hinter sich lassen und schließlich zu den geistigen Autoritäten auf diesem Planeten werden. Gravierende Konsequenzen für das Selbstverständnis des Menschen werden die Folgen sein. Konfrontiert mit einer geistig hoch überlegenen Kaste wird er zur Zweitrangigkeit herabgestuft und in eine geistige Krise stürzen. Die Menschheit steht am Anfang des 21. Jahrhunderts vor einer intellektuellen Irrfahrt, die wohl erst am Ende des Jahrhunderts zu einer neuen Orientierung führen und in ein neues Selbstverständnis münden wird.
So wie man das 20. Jahrhundert in der Geschichte der Menschheit als jenes der Technik etikettiert hat, wird das 21. Jahrhundert als jenes des künstlichen Intellekts in die Geschichtsbücher eingehen. Und so wie die technische Entwicklung bereits im 19. Jahrhundert ihren Siegeszug begann, sich aber erst im 20. Jahrhundert richtig entfaltete, so haben auch die geistigen Turbulenzen schon im 20. Jahrhundert begonnen. Ihren Höhepunkt aber werden sie erst im 21. Jahrhundert erreichen.
Das Ergebnis wird, etwa um das Jahr 2084, ein neues, von Computern dominiertes Denken sein, geprägt durch deren Rationalität. Zwar wird auch das angesammelte Wissen sehr viel umfangreicher sein als heute – das ist aber nur ein gradueller Unterschied. Es wird die Qualität des Denkens und nicht die Quantität sein, die den Unterschied ausmacht.
2.VISIONEN
2.1Trägheitsmoment
Das Geschrei der Böotier!?
Ist es nicht vermessen, eine Vision des 21. Jahrhunderts zu entwerfen, wenn wir schon größere Mühe dabei bekunden, uns die Entwicklung der nächsten zehn Jahre vorzustellen? Scheint das Unterfangen, mehrere Jahrzehnte überblicken zu wollen, da nicht aussichtslos?
Wenn der Versuch trotzdem nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, dann vor allem, weil, wie schon gesagt, geistige Anpassungen viel Zeit brauchen. Technische Innovationen wie z. B. das selbstfahrende Auto können sich relativ rasch ausbreiten und werden schnell akzeptiert. Neuerungen im Denken hingegen setzen sich nur langsam durch. So war beispielsweise schon in der Antike bekannt, dass die Erde eine Kugel ist – dies ist aber noch nicht bis zur „Flat Earth Society“ vorgedrungen. Das liegt daran, dass der Mensch geistige Einstellungen als Kind schnell und gründlich aufnimmt. Später gelingt ihm dies nur noch oberflächlich. Deswegen dauert es stets etwa eine Generation, bis radikale neue Ideen weiten Kreisen bekannt sind, eine zweite, bis sie akzeptiert und eine dritte, bis sie mit allen Konsequenzen umgesetzt sind. In Bezug auf gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen sind somit 70 Jahre, etwa drei Generationen, keine allzu große Zeitspanne.
Als Beispiel für den langen Weg bis hin zur Akzeptanz von neuen geistigen Ideen sei das „Gesetz der Großen Zahlen“ genannt. Es wurde von dem Mathematiker Jakob Bernoulli aus Basel im Jahr 1689 formuliert. Bis der Ökonom Harry Markowitz auf die Idee kam, dieses Prinzip auf die sogenannte „Portfolio Selection“, die Diversifikation als Mittel zur Minimierung des Risikos von Kapitalanlagen, anzuwenden, vergingen Jahrhunderte, und bis die Banken diese Einsicht umsetzten, nochmals Jahrzehnte. (Ganz verinnerlicht haben die Banken die Idee der Diversifikation aber auch heute noch nicht, wie die Bankenkrise 2008 beweist.)





























