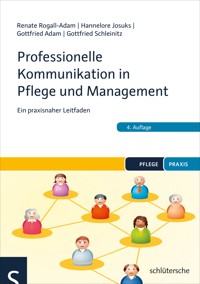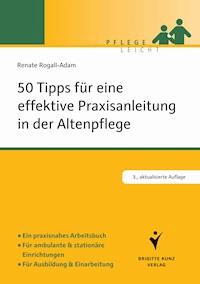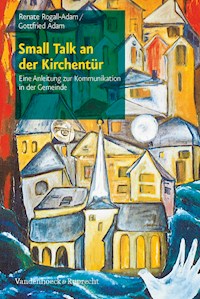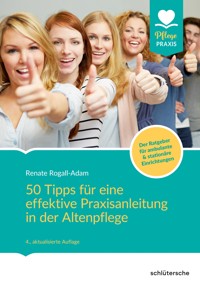
50 Tipps für eine effektive Praxisanleitung in der Altenpflege. Der Ratgeber für ambulante und stationäre Einrichtungen E-Book
Renate Rogall-Adam
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es ist gar nicht so einfach, eine Praxisanleitung effektiv und sicher zu gestalten. Diese 50 Tipps aber machen Mut: Sie sind sozusagen die Basis für jede Praxisanleitung. Ob ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtung – in diesem handlichen Nachschlagewerk finden sich die wichtigsten Instrumente für eine gute Beziehung zwischen Anleiter, Auszubildendem und Team. Kritik so formulieren, dass sie auch wirkt. Sich in Konfliktsituationen sachlich und neutral verhalten. Verräterische Signale der Körpersprache etc. Die 50 Tipps konzentrieren sich auf das Wesentliche. Renate Rogall-Adam hat sie in zahlreichen Fort- und Weiterbildungen für Praxisanleiter gesammelt und stellt sie leicht verständlich vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Renate Rogall-Adam ist Diplom-Pädagogin und Supervisorin (DGSv). Sie war Dozentin für Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen und Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Hannover im Studiengang Pflege.
»Praxisanleiterinnen prägen nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die persönliche Entwicklung der Auszubildenden.«
RENATE ROGALL-ADAM
pflegebrief
– die schnelle Information zwischendurchAnmeldung zum Newsletter unter www.pflegen-online.de
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89993-990-3 (Print)ISBN 978-3-8426-8967-1 (PDF)ISBN 978-3-8426-8968-8 (EPUB)
© 2019 Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden. Alle Angaben erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autoren und des Verlages. Für Änderungen und Fehler, die trotz der sorgfältigen Überprüfung aller Angaben nicht völlig auszuschließen sind, kann keinerlei Verantwortung oder Haftung übernommen werden.Die im Folgenden verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen stehen immer gleichwertig für beide Geschlechter, auch wenn sie nur in einer Form benannt sind. Ein Markenzeichen kann warenrechtlich geschützt sein, ohne dass dieses besonders gekennzeichnet wurde.
Titelbild: Robert Kneschke - stock.adobe.comCovergestaltung und Reihenlayout: Lichten, Hamburg
Inhalt
Vorwort
1Die Praxisanleiterin
1. Tipp: Klären Sie die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
2. Tipp: Denken Sie an die Aufgaben der Praxisanleitung
3. Tipp: Organisieren Sie die Anleitung
4. Tipp: Fördern Sie die Motivation
5. Tipp: Entwickeln Sie Organisationshilfen
2Die Auszubildenden
6. Tipp: Klären Sie die Erwartungen
7. Tipp: Machen Sie die Auszubildenden mit ihren Aufgaben und Pflichten vertraut
8. Tipp: Sorgen Sie für die Integration der Auszubildenden in das Team
3Das Lernfeldkonzept als Grundlage der Anleitung
9. Tipp: Machen Sie sich mit den Grundlagen des Lernfeldkonzepts vertraut
10. Tipp: Arbeiten Sie mit dem Lernort »Schule« zusammen
11. Tipp: Gestalten Sie die Lernsituationen
4Kommunikation
12. Tipp: Beachten Sie die Grundregeln der Kommunikation
13. Tipp: Achten Sie auf Ihre Körpersprache
14. Tipp: Achten Sie auf geschlechterspezifische Kommunikation
15. Tipp: Nehmen Sie kommunikative Grundhaltungen ein
16. Tipp: Verwenden Sie hilfreiche Fragetechniken
17. Tipp: Senden Sie Ich-Botschaften
18. Tipp: Hören Sie aktiv zu
19. Tipp: Geben Sie Feedback
20. Tipp: Sprechen Sie Ihre Anerkennung und Wertschätzung aus
21. Tipp: Vermeiden Sie Kommunikationsstörungen
5Der Prozess der Anleitung
22. Tipp: Gestalten Sie den Beziehungsprozess
23. Tipp: Strukturieren Sie den Prozess der Anleitung
24. Tipp: Formulieren Sie Ziele für die Anleitung
25. Tipp: Praktizieren Sie konkrete Methoden der Anleitung
26. Tipp: Formulieren Sie Lernaufgaben
27. Tipp: Führen Sie ein Vorgespräch
28. Tipp: Sichern Sie die Ergebnisse im Nachgespräch
29. Tipp: Dokumentieren Sie die Anleitung
6Die Durchführung von Gesprächen
30. Tipp: Bereiten Sie Sachgespräche adäquat vor
31. Tipp: Entwickeln Sie einen individuellen Gesprächsleitfaden
32. Tipp: Gestalten Sie die Gesprächseröffnung
33. Tipp: Denken Sie an die persönliche Vorstellung
34. Tipp: Gestalten Sie das Gesprächsende
35. Tipp: Werten Sie Gespräche aus
36. Tipp: Planen Sie das Erstgespräch
37. Tipp: Vernachlässigen Sie nicht das Zwischengespräch
38. Tipp: Bilanzieren Sie im Abschlussgespräch
39. Tipp: Sprechen Sie Kritik adäquat aus
7Die Beurteilung
40. Tipp: Führen Sie eine Beurteilung so transparent wie möglich durch
41. Tipp: Orientieren Sie sich an Kriterien
42. Tipp: Erkennen Sie Fehler im Beurteilungsprozess
43. Tipp: Fördern Sie die Selbsteinschätzung der Auszubildenden
44. Tipp: Entwickeln Sie ein Grundschema für Ihre Vorgehensweise
45. Tipp: Planen Sie das Beurteilungsgespräch
8Umgang mit schwierigen Situationen
46. Tipp: Erkennen Sie die Ursachen von Konflikten
47. Tipp: Wenden Sie Strategien der Konfliktlösung an
48. Tipp: Sprechen Sie über den Verlauf des Konflikts (Metakommunikation)
49. Tipp: Lernen Sie, schwierige Situationen zu bewältigen (Auszubildende)
50. Tipp: Lernen Sie, schwierige Situationen zu bewältigen (Beschwerden von Angehörigen)
9Zusatz-Tipps und Schlussbemerkung
9.1Setzen Sie sich mit dem neuen Pflegeberufegesetz (PflBG) auseinander
9.2Beachten Sie bei der Praxisanleitung die unterschiedlichen Profile der Generationen
Schlussbemerkung: »Die Geschichte vom Seepferdchen«
Literatur
Register
Vorwort
Die Praxisanleitung ist ein zentraler Schwerpunkt in der praktischen Pflegeausbildung. Praxisanleiterinnen führen Auszubildende schrittweise in die eigenständige Wahrnehmung und Durchführung der beruflichen Aufgaben ein. Durch Anleitung, Begleitung und Beratung prägen sie nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch die persönliche Entwicklung der Auszubildenden.
Dieses Arbeitsbuch behandelt die wichtigsten Aspekte der Praxisanleitung in insgesamt 50 Tipps. Erfahrungsberichte von Praxisanleiterinnen haben dabei die Auswahl der Themen maßgeblich bestimmt. Gute Kenntnisse in der Kommunikation und Gesprächsführung sind eine wichtige Voraussetzung für die Anleitungstätigkeit. Darum liegt in diesem Bereich ein bewusst gewählter Schwerpunkt der Tipps.
Die theoretischen Ausführungen sind eher knapp gehalten und in erster Linie für die Anleitungspersonen gedacht. Die einzelnen Tipps schließen mit Anregungen zur individuellen Weiterentwicklung der eigenen Praxis. Sie sollen den anleitenden Personen helfen, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Deshalb wird auch die persönliche Anrede verwendet.
Das Arbeitsbuch gliedert sich in neun Themenbereiche, denen die Tipps zugeordnet sind.
1. Die Praxisanleiterin
2. Die Auszubildenden
3. Das Lernfeldkonzept als Grundlage der Anleitung
4. Kommunikation
5. Der Prozess der Anleitung
6. Die Durchführung von Gesprächen
7. Die Beurteilung
8. Umgang mit schwierigen Situationen
9. Zusatz-Tipps und Schlussbemerkung
Das Pflegeberufegesetz von 2017 löst die bisherigen Gesetze zur Alten- sowie Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung ab. Die Pflegeausbildung nach dem neuen Pflegeberufegesetz wird im Jahre 2020 beginnen. Bis dahin gelten weiterhin die bestehenden Gesetze.
Unter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen behalten die »50 Tipps für eine effektive Praxisanleitung« weiterhin ihre volle Geltung. Kommunikation, Gesprächsführung, Beurteilung usw. sind bleibende Bestandteile jeder Praxisanleitung.
Ab 2020 wird es im Wesentlichen im dritten Themenbereich Veränderungen geben. Diese Veränderungen betreffen die Ausbildungsform und die Orientierung an Kompetenzen. Im 9. Kapitel sind daher zwei Zusatz-Tipps hinzugefügt worden.
1. 9.1 »Setzen Sie sich mit dem neuen Pflegeberufegesetz auseinander«. Hierbei geht es um die neue Gesetzeslage.
2. 9.2 »Beachten Sie bei der Praxisanleitung die unterschiedlichen Profile der Generationen«. In diesem Tipp wird die Frage der unterschiedlichen Generationsprofile aufgenommen.
Durch Rückmeldungen aus der Praxis wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass sich bei der Anleitung das Thema der Unterschiedlichkeit der Generationen vermehrt als Herausforderung erweist. Die Ausführungen in Kapitel 9.2 möchten für die Unterschiedlichkeit der Generationen sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, dass diese für eine gute Zusammenarbeit bei der Anleitung zu beachten ist.
Es freut mich, dass die »50 Tipps für eine effektive Praxisanleitung in der Altenpflege« weiterhin auf Interesse stoßen. Allen Leserinnen und Lesern der 4. Auflage wünsche ich ein gutes Gelingen beim Transfer vor Ort.
Renate Rogall-Adam
1 Die Praxisanleiterin
1. Tipp: Klären Sie die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen1
Im »Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG)«, das am 1. August 2003 in Kraft trat, und in der »Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers (AltPflAPrV)« vom 26. November 2002 werden die Aufgaben der Praxisanleitung folgendermaßen formuliert:
• Der Träger der praktischen Ausbildung hat die Ausbildung planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel erreicht werden kann (§ 15 (1) AltPflG).
• Die auszubildende Einrichtung stellt die Praxisanleitung durch eine geeignete Fachkraft auf der Grundlage eines Ausbildungsplanes sicher (§ 2 (2) AltPflAPrV).
• Es ist Aufgabe der Praxisanleitung, die Schülerin oder den Schüler schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heranzuführen und den Kontakt mit der Altenpflegeschule zu halten (§ 2 (2) AltPflAPrV).
Die Gesamtverantwortung für die praktische Ausbildung liegt bei der Altenpflegeschule (§ 4 (4) AltPflG). Die Altenpflegeschule unterstützt und fördert die praktische Ausbildung durch die Praxisbegleitung. Die Praxisanleitung ist durch die Einrichtung sicherzustellen. Die Einrichtung ist verpflichtet, einen Ausbildungsplan zu erstellen. Nach den gesetzlichen Vorgaben sollen Praxisanleiterinnen über eine berufspädagogische Zusatzqualifikation verfügen. In den gesetzlichen Vorgaben zur Altenpflegeausbildung wird der Umfang der pädagogischen Qualifikation offen gelassen. Die diesbezüglichen konkreten Bestimmungen finden sich in den einschlägigen Erlassen der zuständigen Ministerien der einzelnen Bundesländer.
Die Praxisanleitung wird durch gesetzliche Vorgaben und strukturelle Rahmenbedingungen beeinflusst. Eine entscheidende Rahmenbedingung der praktischen Ausbildung stellt die Pflegequalität der jeweiligen Einrichtung dar, wozu
• das Leitbild der Einrichtung und das Pflegeleitbild,
• ein Pflegemodell und ein Pflegekonzept,
• das Pflegeprozessmodell als Grundlage für die individuelle Pflege und
• eine angemessene personelle und räumliche Ausstattung gehören.
Zusätzlich nehmen auf die Organisation, den Prozess und das Ergebnis der Praxisanleitung Einfluss: die Auszubildende, die Praxisanleiterin, das Team und die Patienten/Bewohner mit ihren Angehörigen.
Mit der praktischen Anleitung von Auszubildenden übernimmt die Praxisanleiterin neben der pflegerischen Tätigkeit eine weitere Aufgabe. Diese erfordert einen zusätzlichen Zeitaufwand. Dafür sollte sie in entsprechendem Umfang freigestellt werden. Verbindliche Anhaltszahlen für den zeitlichen Rahmen sind nicht bekannt.
Wie viele Auszubildende eine Praxisanleiterin anleiten kann oder soll, ist nicht festgelegt. Aus arbeitsrechtlichen und anderen Gründen ergibt sich jedoch die Situation, dass die Anleiterin nicht immer anwesend sein kann. Auch wenn sie die Gesamtverantwortung für die Planung und Durchführung der Anleitung trägt, müssen Teilaufgaben an pädagogisch geeignete Teammitglieder delegiert werden.
Neben Auszubildenden in der Altenpflege werden in den Einrichtungen auch noch andere Gruppen angeleitet (z. B. Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege, neue Mitarbeiterinnen, Praktikanten, Pflegekräfte). Die Grundlagen der Anleitung sind unabhängig von den Personen, die angeleitet werden. Unterschiede bestehen allein im Ausbildungsstand und in den Inhalten. Inwieweit die Praxisanleiterin weitere Gruppen in der Einrichtung anleitet (wie z. B. neue Mitarbeiter oder Pflegekräfte), entscheidet der Träger der Einrichtung.
Erstellen Sie eine Stellenbeschreibung für die Praxisanleitung
• Sorgen Sie für die Entwicklung einer Stellenbeschreibung für die Funktion der Praxisanleitung. In ihr werden organisatorische Regelungen schriftlich festgelegt und aufbau- sowie ablauforganisatorische Aspekte beschrieben. Dazu gehören:
– Bezeichnung der Stelle, Zielsetzung der Stelle,
– Beschreibung der Stelle und ihrer Aufgaben,
– Anforderungen an die Stelleninhaberin,
– unmittelbare Vorgesetzte und unmittelbar Unterstellte der Stelle (Organigramm),
– Regelung der Vertretung, Befugnisse,
– Regeln der Zusammenarbeit, Beziehungen nach außen.
Eine solche Stellenbeschreibung macht transparent, wie die Praxisanleiterin im Organisationsgefüge eingeordnet ist.
• Formulieren Sie Kriterien zur Qualität der Praxisanleitung ausgehend vom Leitbild der Einrichtung und vom Pflegeleitbild.
• Klären Sie mit Ihrer Pflegedienstleitung, ob und in welcher Weise eine Dokumentation der Zeit, die für die Anleitung benötigt wird, dazu beitragen kann, zu verbindlichen Regelungen hinsichtlich des zeitlichen Rahmens zu kommen.
2. Tipp: Denken Sie an die Aufgaben der Praxisanleitung
Praxisanleitung ist die systematische und zielgerichtete Anleitung am jeweiligen Einsatzort. Dabei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der die Lernenden an pflegerisches Handeln heranführt. Die Lernerfordernisse des Lernorts Schule und die Angebote des Lernorts Praxis sind aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise entsteht eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Das Ausbildungsziel besteht darin, die zukünftigen Fachkräfte zu professioneller Pflege zu befähigen. Zu den Bereichen der Praxisanleitung gehören insbesondere:
• Einführung in die konkrete Pflegepraxis
• Zusammenführung von theoretischen Inhalten und praktischer Tätigkeit
• Entwicklung einer personen- und prozessorientiert gestalteten Pflege
• Begleitung der individuellen Lernerfahrungen der Auszubildenden
• Mitwirkung bei der Bewertung fachpraktischer Leistungen
• Pflege des Kontaktes mit dem Lernort Schule
Mit einer auf solche Weise konzipierten Praxisanleitung sind folgende Aufgaben verbunden:
• Anleitung organisieren (z. B. Mitwirkung bei der Erstellung des Ausbildungsplanes, Festlegen von gezielten Anleitungen unter Berücksichtigung der personellen Situation),
• Anleiten, Beraten und Gespräche führen (z. B. Einführung in die Einrichtung, praktische Anleitung im Pflegealltag, Lernberatung im Blick auf die praktische Ausbildung),
• Begleiten und fördern (z. B. die Auszubildenden dort abholen, wo sie »stehen«: Wenn man von den Auszubildenden ausgeht, unterstützt und fördert dies die persönliche Entwicklung),
• Kooperieren und kommunizieren (z. B. am Lernort Praxis mit den Teammitgliedern, am Lernort Schule mit den Dozenten und der Leitung),
• Beobachten und beurteilen (z. B. Beobachtung der Lernfortschritte, Anregungen zur wechselseitigen Reflexion geben, Bescheinigungen und Beurteilungen erstellen).
Dieses Aufgabenprofil erfordert bestimmte Kompetenzen, um eine qualitativ gute Praxisanleitung gestalten zu können:
•Fachkompetenz umfasst Kenntnisse, Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Blick auf Pflege, den Anleitungsprozess und die Evaluation.
•Kommunikative Kompetenz bedeutet: mit Auszubildenden im Team, mit Dozenten der Ausbildung situationsgerecht auf der Grundlage von Akzeptanz, Wertschätzung und Echtheit Kontakt aufzunehmen und zu kommunizieren sowie Beobachtungen wertfrei zu formulieren und die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen.
•Soziale Kompetenzen sind: Offenheit, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen, Team- und Konfliktfähigkeit.
•Methodenkompetenz bedeutet, die Anleitung zielgerichtet und systematisch, aber auch prozesshaft zu gestalten.
Anregungen
• Sie haben die Aufgabe der Praxisanleitung neu übernommen, in Ihrer Praxisanleitung treten schwierige Situationen auf oder Sie möchten eine neue Konzeption für Ihre Anleitung entwickeln oder… Für solche Situationen lohnt es sich, mit anderen Kollegen gemeinsam die anstehenden Fragen zu reflektieren und zu beraten. Das schafft Zufriedenheit und trägt zur Qualität der Arbeit bei.
• Für eine solche Beratung, in der sich Kollegen gegenseitig beraten, empfiehlt sich das strukturierte Vorgehen, wie es die Arbeitsform der Kollegialen Beratung beinhaltet: Einbringen einer Situation – Rückfragen aus der Gruppe beantworten – die Situation durch die Gruppe beraten lassen – jedes Gruppenmitglied formuliert einen Lösungsweg – die problemeinbringende Person bezieht Stellung zur Beratung durch die Gruppe – Feedback aller an der Beratung beteiligten Personen.
3. Tipp: Organisieren Sie die Anleitung
Eine kontinuierliche Praxisanleitung erfordert ein planvolles Vorgehen. Dies ist in Kooperation mit der Leitung der Station zu gestalten. Dabei sind folgende Aspekte zu bedenken:
(1) Im Blick auf die Rahmenbedingungen
• Wie viel Zeit steht für die Praxisanleitung zur Verfügung?
• Wie viele Auszubildende sind anzuleiten?
• Welche räumlichen Gegebenheiten sind für die Durchführung von Gesprächen vorhanden?
• Wie ist die Vertretungsfrage bei Abwesenheit/Verhinderung (Krankheit, Urlaub) geregelt?
• Welche Unterstützung kann das Team der Praxisberaterin geben?
• Sind die Patienten/Bewohner der Einrichtung für die Anleitung geeignet und geben sie ihr Einverständnis?
(2) Im Blick auf das Ausbildungsangebot
Grundlage für die praktische Ausbildung ist der Ausbildungsplan. Jede Einrichtung hat einen solchen Plan zu erstellen. Die Inhalte richten sich nach der geltenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. In thematischer Hinsicht ist u. a. zu klären:
• Was soll gelernt werden?
• Welche Lernmöglichkeiten bietet die Einrichtung?
• Welche Lernaufgaben können gestellt werden?
Anregungen
• Reflektieren Sie vor Beginn der Anleitung die einzelnen Bereiche und stellen Sie die Aufgaben zusammen, die sich daraus ergeben.
• Teilen Sie das Ergebnis Ihrer Überlegungen der Pflegedienstleitung mit und klären Sie mit ihr verbindlich das weitere Vorgehen.