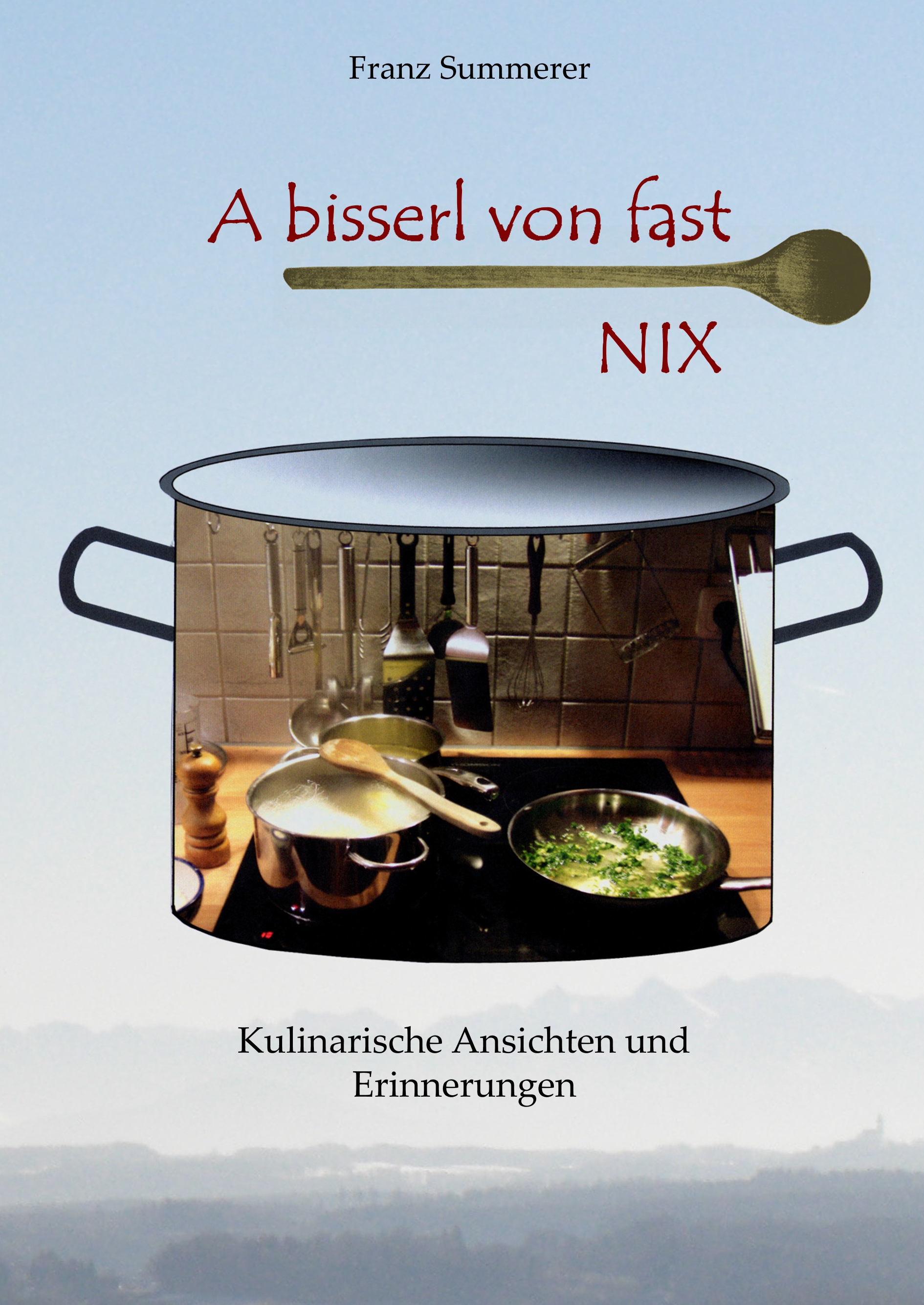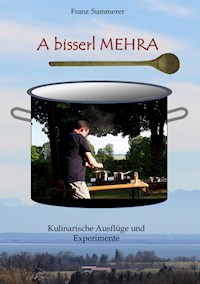
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"A bisserl mehra" ist die Fortsetzung von dem 2011 erschienenen Buch "A bisserl von fast nix". Es geht wieder um Kochen und Backen und um allerlei Nützliches und Interessantes, das Hobbyköche oder -bäcker wissen sollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Carbonara – auf der Suche nach dem Original
Die Kochmythen
Suppen – gekocht oder gebraten?
Angegrillt – fertig oder selbstgemacht
Griechenland
Italien
Österreich
Frankreich
Dahoam in Bayern
Management By Cake
Marmeladen
Essen Trinken und die Arbeit
Aus is
Anhang: Rezepte im Überblick
Für alle, die mich immer wieder ermutigt haben, weiterzuschreiben.
Vorwort
„Derf’s a bisserl mehra sei?“. Das war früher die klassische Frage der Metzgereiverkäuferin, wenn man ein paar Scheiben Wurst haben wollte. Egal, ob man 100, 150 oder 200 g bestellte, es wurden immer noch ein paar Scheiben draufgelegt und die Frage nachgeschoben, ob es denn noch ein bisschen mehr sein darf. Und es hätte unverständliche Blicke sowohl von der Verkäuferin als auch von den Kunden weiter hinten in der Schlange hervorgerufen, wenn man diese rhetorische Frage mit „nein“ beantwortet hätte. Schließlich wusste jeder erfahrene Einkäufer, dass man nicht 120 g bestellt, wenn man 120 g haben will, sondern eben 100 g, um der Verkäuferin ihren üblichen Verhandlungsspielraum zu lassen.
Wenn ich jetzt nach meinem ersten Buch „A bisserl von fast nix“ ein zweites mit dem Titel „A bisserl mehra“ nachlege, könnte man meinen, dass sich dahinter die gleiche Absicht verbirgt: Erst ein dünnes Buch schreiben, wo nicht alles drin steht, nur um dann noch ein zweites nachschieben zu können. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das nicht meine Absicht war. Wie ich im ersten Buch bereits erklärt hatte, hatte ich nie vor, ein Kochbuch zu schreiben, und ich weigere mich noch heute, mein Buch als Kochbuch einzuordnen. Und so war es für mich selbstverständlich, dass nicht alle meine Kochrezepte in diesem Buch niedergeschrieben wurden, sondern nur diejenigen, die damals am ehesten meine Philosophie und meine Einstellung zum Kochen repräsentierten.
Doch wie so oft im Leben nahm die Entwicklung einen anderen Lauf, als sich der Erfinder das vorgestellt hatte. Zwar wurde mein Buch von den meisten wie ein Roman oder eine Komödie gelesen. Nach dem Lesen jedoch verschwand das Buch nicht wie üblich im Bücherregal, sondern es landete in der Küche, wo es als Nachschlagewerk für das eine oder andere Gericht dient. Anders gesagt, es steht bei den Kochbüchern, wo es nie hätte hin sollen. Und ich muss zugeben, dass es sogar bei uns zuhause regelmäßig auf dem Kochbuchhalter liegt, weil meine Frau und meine Jungs es ab und zu nutzen und weil auch ich nicht alle Rezepte immer im Kopf habe.
Andererseits beinhaltet mein Buch auch bei weitem nicht alles, was ich so koche und backe, so dass ich immer wieder irgendwo anders nachschlagen muss, wenn ich etwa einen bestimmten Kuchen backe oder eben Gerichte koche, die ich nur selten zubereite. Deshalb war es mir bei meinem zweiten Buch von Anfang an ein wichtiges Anliegen, alle Rezepte, also die aus dem alten Buch und die aus diesem Buch am Ende nochmal zusammenzufassen.
Ich habe mir für dieses Buch sehr viel Zeit gelassen. Ich hatte genaugenommen nie einen festen Termin im Auge, sondern ich schrieb einfach dann und wann, wann immer ich gerade Zeit und Muße hatte oder wenn ich den Drang hatte, etwas Kochtechnisches aufzuschreiben – sei es für mich oder für jemand anderen. Und so vergingen die Jahre und natürlich hatte sich einiges in meinem Leben verändert. Allen voran waren es meine Jungs, die erwachsen wurden, die immer mehr, aber auch immer abwechslungsreicher aßen und mich dadurch natürlich mehr forderten. So wurden neue Gerichte in mein Repertoire aufgenommen, neue Kochgeräte angeschafft und weitere Optimierungen durchgeführt, um noch effizienter und flexibler zu werden. Natürlich war das ein permanentes Wettrüsten, denn kaum hatte ich beispielweise zwei zusätzliche Herdplatten installiert, schon kam die Forderung nach zwei verschiedenen Nudelsorten und drei verschiedenen Soßen. Es gab keine Ausrede mehr. Kaum hatte ich mir eine mobile Herdplatte für den Außenbereich angeschafft, schon war es eine Selbstverständlichkeit, dass es zu Gegrilltem auch Reis oder Pommes gab. Und so war schließlich vor lauter Kochen und Effizienzsteigerung das Schreiben mehr und mehr in den Hintergrund gerückt und immer seltener geworden. Langsam hatte ich mich damit abgefunden, dass dieses Buch nie oder bestenfalls zur Rente fertig werden würde. Doch dann kam es anders.
Eines Tages wurden wir spontan an Pfingsten zu einem Geburtstag eingeladen. Normalerweise waren wir an Pfingsten immer in Frankreich, aber weil mein Großer im Abi war und beide Jungs es mittlerweile auch uncool fanden, mit Ihren Eltern in Urlaub zu fahren, blieben wir dieses Jahr an Pfingsten zuhause. Und wie meistens an Pfingsten war auch das Wetter so schlecht, dass die eigentlich geplante Radl-Tour ins Wasser fiel und wir stattdessen mit einer Freundin Geburtstag feiern konnten. Ihrem Mann hatte ich zum 50. Geburtstag mein erstes Buch geschenkt, aber das war über drei Jahre her. Umso verwunderter war ich, als er mir jetzt nach so langer Zeit erzählte, dass er zurzeit mein Buch liest. Er hatte immer gedacht, es sei ein Kochbuch und weil er ja selbst nicht kocht, hatte er es seiner Frau überlassen, sich mit meinem Buch zu beschäftigen. Doch nun hatte er einen neuen Job, der ihm abverlangte, sehr viel Zeit in der S-Bahn zu verbringen. Also hatte er auch sehr viel Zeit zu lesen, und so kam es, dass er sich eines Tages mit meinem Buch beschäftigte.
Er war ganz begeistert über all die Anekdoten, die ich aus meinem Leben erzählte. Wir sind gleich alt und so konnte er viele Dinge sehr gut nachvollziehen, etwa wie ich mit 14 Jahren mit dem Mofa in die Stadt fuhr, um meine erste Pizza zu essen. Kurzum, er war ein begeisterter Leser und er fragte mich, ob noch mehr von mir zu erwarten sei. Als ich ihm erzählte, dass das zweite Buch schon weit fortgeschritten sei und ich aber im Moment nicht die Zeit fände, es fertig zu stellen, ermunterte er mich, das doch zu tun.
Nun machte das Buch plötzlich die Runde – jeder am Tisch wollte einmal reinschauen. Meine Tischnachbarin fragte mich, ob ich die Gerichte selbst erfunden oder irgendwo abgeschrieben habe, und ich hatte meine Mühe, diese spontane Frage zu beantworten, denn die Wahrheit ist etwas komplizierter. Natürlich habe ich einige Gerichte selbst erfunden, aber auch alle anderen Gerichte schreibe ich nicht einfach nur ab. Ich würde nie ein Rezept aus einem Buch abschreiben und dann veröffentlichen – das ist ja Unsinn und nicht mal erlaubt. Andererseits sind die meisten meiner Gerichte Standardgerichte, wie man sie in bayerischen oder italienischen Restaurants bekommt. Ein wesentlicher Unterschied zu den meisten Kochbüchern ist jedoch, dass ich jedes Gericht selbst koche und so lange optimiere, bis ich auch wirklich 100 % zufrieden damit bin. Die meisten Kochbücher, die ich bisher gesehen habe, sind einfach nur eine Ansammlung von Rezepten, und man merkt auch, dass der Autor sie selbst nie gekocht hat.
Jedenfalls hatte diese Diskussion zusammen mit den aufmunternden Worten meines Freundes und dem anhaltenden schlechten Wetter mich dazu bewegt, mich gleich am nächsten Tag hinzusetzen und wieder zu schreiben. Trotzdem vergingen weitere Jahre, bis ich das Buch endlich so weit hatte, dass ich zufrieden war. Oft gab es Momente, an denen ich gerne was ausprobiert und geschrieben hätte, aber da fehlte mir die Zeit. Dann wieder gab es Phasen, wo ich Zeit gehabt hätte, aber nicht in Stimmung war, zu schreiben. Erst als die Corona Pandemie uns heimsuchte und wir von panischen Politikern zum zuhause bleiben und zum Nichtstun gezwungen wurden, schaffte ich es schließlich, das Werk zu vollenden.
In all der Zeit hatte sich vieles verändert. In meinem ersten Buch hatte ich kaum Gerichte mit Fleisch erwähnt, weil wir tatsächlich damals schon sehr wenig Fleisch aßen. Zwischendurch jedoch, als die Jungs im Teenager-Alter waren, konnte ich gar nicht viel genug Fleischgerichte zubereiten. Und schließlich kehrte sich ihre Fleischeslust in das komplette Genegenteil. Der eine wurde aus Gründen des Klimaschutzes vegan, der andere reduzierte seinen Fleischkonsum aus gesundheitlichen Gründen. Meine Frau siedelte sich irgendwo dazwischen an, lebte aber mehr und mehr vegan. Und ich? Naja, ich passte mich an. Zuhause aß auch ich immer öfter vegan oder vegetarisch, aber wenn ich ab und zu die Gelegenheit hatte, in einem Restaurant ein Stück Fleisch zu essen, dann nutzte ich sie. Wenn ich dann allerdings wieder von einer meiner zahlreichen Dienstreisen nach Südafrika zurückkam, wo man sich fast ausschließlich von Steak ernährt, war ich sehr froh, für mindestens eine Woche kein Fleisch essen zu müssen. Trotzdem habe ich die Rezepte zu Fleischgerichten im Buch beibehalten, denn die waren ja erstens schon lange geschrieben und waren zweitens trotzdem sehr gut. Aber ich erkannte, dass sich viele meiner Gerichte sehr leicht „veganisieren“ lassen. Ein Apfelkuchen z. B., bei dem man Margarine statt Butter verwendet und das eine Ei durch Eiersatz ersetzt, schmeckt genau so gut wie das Original. Oder wenn man zu Spaghetti Aglio & Olio statt Parmesan gemahlene Walnüsse isst, hat man ebenfalls ein schmackhaftes veganes Essen.
Die Rezepte in diesem Buch stammen wie schon erwähnt aus unterschiedlichsten Quellen – von Freunden oder Verwandten, von meiner Mutter oder einfach von mir selbst, angeregt durch einen Restaurantbesuch. Teilweise probiere ich Dinge einfach aus, weil ich gerade zu viel von irgendwas habe, was jedoch nicht immer gelingt. Manchmal suche ich auch im Internet nach Anregungen. Aufgrund der Vielzahl von Rezepten besteht hier jedoch die Kunst darin, sehr schnell die guten von den schlechten zu unterscheiden. Manche Leute veröffentlichen einen unglaublichen Mist und ich frage mich dann immer, ob die denn ernsthaft meinen, dass das gut sei. Aber dann wiederum findet man auch echte Highlights – auch wenn es oft nur kleine Anregungen sind. Beim Lesen dieses Buches werden Sie selbst darauf kommen, wo das Rezept her ist, was ich daran optimiert habe und wie ich auf diesen Weg gekommen bin. Und mit etwas Phantasie und Kreativität wird es Ihnen vielleicht sogar gelingen, das eine oder andere Rezept noch weiter zu verfeinern oder zu optimieren.
Den Untertitel „Kulinarische Ausflüge und Experimente“ habe ich aus mehreren Gründen gewählt. Zum einen haben mich viele Ausflüge – oder nennen wir sie besser Reisen – zu so manch einem Rezept angeregt. Das heißt jedoch nicht immer, dass ich mich intensiv mit der jeweiligen landestypischen Küche beschäftigt habe. Oft entstanden im Urlaub einfach aus der Not heraus Rezepte, die nichts oder nur am Rand mit dem jeweiligen Land zu tun haben. Wenn ich etwa im Kapitel „Frankreich“ Zitronenmarmelade vorstelle, dann heißt das nicht, dass das dort eine landestypische Spezialität ist, sondern einfach nur, dass ich sie in dem Land zum ersten Mal gemacht habe. Zum anderen sind meine Ausflüge manchmal einfach gedanklicher Art. Wenn ich etwa die Schweinebratensuppe erwähne, dann soll das nur eine Anregung zum Nachdenken, nicht unbedingt zum Nachmachen sein. Und wenn doch, dann sind wir auch schon bei den Experimenten, die ich in der Küche gerne mache, die aber auch offen zugegeben nicht immer mit Erfolg gekrönt sind, wofür etwa meine Zitronentorte ein sehr gutes Beispiel wäre.
Carbonara – Auf der Suche nach dem Original
„Carbonara e una Coca Cola“ klingt vielen Deutschen in meinem Alter noch heute im Ohr, wenn Sie den Namen dieses italienischen Gerichtes hören. Der deutschen Band „Spliff“ gelang damals ein echter Ohrwurm und Spaghetti alla Carbonara scheinen seitdem der Inbegriff der italienischen Kochkunst zu sein: Einfach in der Zubereitung und sensationell im Geschmack. Doch was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Gericht?
Für mich ist Spaghetti alla Carbonara eines der besten Beispiele, wie sich aus leichten Variationen der Zutaten und Zubereitungsmethoden eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Nudelsoßen entwickelt hat. Wenn Sie heute fünf Kochbücher aufschlagen, in denen Spaghetti alla Carbonara beschrieben sind, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit fünf verschiedene Rezepte finden. Und wenn Sie im Internet recherchieren, werden Sie hunderte finden, von denen keines wirklich genau dem anderen gleicht. Und etwa jeder dritte Autor behauptet für sich, das Originalrezept zu beschreiben.
In manchen italienischen Dialekten heißt der Carbonaio auch Carbonaro und seine Frau ist dann die Carbonara. Spaghetti alla Carbonara heißt also nicht mehr und nicht weniger wie Spaghetti nach Art der Köhlerin. Aber was hilft uns das jetzt weiter? Woher wollen wir wissen, wie eine Köhlerin Spaghetti zubereitet hat? Und hat es jede Köhlerin auf die gleiche Art gemacht? Sicher nicht, denn auch damals schon waren die Geschmäcker verschieden, jedoch die Vielfalt und Verfügbarkeit der Zutaten noch etwas bescheidener als heute.
Die einzige Zutat, bei der sich alle Rezepte einig sind, sind die Eier. Als ich dieses Rezept als Kind zum ersten Mal hörte, dachte ich, italienisch zu können. „Carb on ara“ – das heißt ganz sicher „mit einem Ei“. So einfach war italienisch. Als ich später lernte, dass Ei gar nicht ara heißt, sondern uovo, war ich etwas irritiert und ich ahnte schon, dass carb nicht mit und on nicht einem heißt. Aber offensichtlich waren Eier etwas, was auch einfache Leute wie Köhler sich leisten konnten. Das lässt sich leicht nachvollziehen, denn Hühner sind einfach zu halten und spielen deshalb schon seit tausenden von Jahren eine wichtige Rolle in der menschlichen Ernährung.
Uneinig dagegen sind sich die Rezepte bei der Anzahl der Eier und, was ich besonders irritierend finde, bei der Frage, ob man das ganze Ei oder nur das Eigelb verwenden sollte. Ein bisschen logisches Denken könnte diese Frage jedoch schnell auflösen. Köhler waren wie gesagt einfache Leute, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Köhlerin sich den Luxus gegönnt hätte, nur das Eigelb zu verwenden. Sonst hätte sie ja gleichzeitig ein Gericht kochen müssen, bei dem nur Eiweiß gebraucht wird. Solche Gerichte gibt es zwar, wie ich später noch zeigen werde, aber ich halte das trotzdem für unwahrscheinlich und deshalb kann das Originalrezept meiner Meinung nach nur mit dem ganzen Ei sein. Die Anzahl der Eier hing sicherlich von den Vermögensverhältnissen der Köhler-Familie ab, aber realistisch betrachtet ist mehr als ein Ei pro Person bzw. Portion eher unwahrscheinlich. Meine Logik kommt deshalb zu dem Schluss, dass im Originalrezept genau ein ganzes Ei pro Portion zu verwenden ist.
Große Uneinigkeit gibt es bei der zweiten Zutat. Schinken oder Speck? Geräuchert oder nicht geräuchert? Gekocht oder nicht gekocht? Allein die Art und Weise, wie sich die Leute im Internet über diese Frage streiten, zeigt schon, wie wenig Ahnung die meisten Menschen davon haben, was sie eigentlich täglich essen. Schinken wird in jedem Fall gepökelt und fast immer geräuchert – egal ob er roh ist oder ob er vor dem Räuchern oder während des Räucherns gekocht wurde. Nicht geräucherter Schinken schmeckt eher langweilig. Schinken und Speck unterscheiden sich durch ihren Fettgehalt. Schinken wird aus der Hüfte des Schweins (die nennt man bei Menschen Arschbacke) gewonnen und enthält fast nur mageres Fleisch. Ein kleiner Fettstreifen am Rande schadet nicht, wird aber häufig entfernt. Speck dagegen wird aus der Bauchregion des Schweins gewonnen und hat den Ruf, diese Region auch später in unserem Körper wieder aufzusuchen. Speck ist nämlich sehr viel fetter als Schinken. Das magere Fleisch (= Muskeln) wird dabei von mehreren Fettstreifen durchzogen. In Bayern nennt man den Speck Wammerl, den Schinken dagegen Schlegel.
Kühlschränke, Gefriertruhen und industrielle Kältetechnik gibt es erst etwa seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Aber schon lange vor Christus wurden Schweine als Haustiere und Fleischlieferanten gehalten. Weil aber auch früher keine Familie ein ganzes Schwein auf einmal essen konnte, mussten sich die Menschen etwas einfallen lassen, wie sie das Fleisch haltbar machen konnten. Neben dem Trocknen des Fleisches standen dabei vor allem das Pökeln und das Räuchern im Vordergrund. Noch in meiner Kindheit war es in den meisten Familien gängige Praxis, – je nach Familiengröße – einmal oder mehrmals im Jahr ein Schwein zu schlachten. Dabei musste die ganze Familie mithelfen. Die jüngsten durften zunächst nur das Blut rühren, und ich kann mich noch an viele Schweine erinnern, deren Blut ich gerührt habe. Ich habe um jedes Schwein geweint und trotzdem habe ich jedes gegessen. Nach dem tödlichen Schuss oder Schlag wurde dem Schwein sofort die Kehle durchgeschnitten. Das auslaufende Blut wurde in einem Eimer aufgefangen und musste gerührt werden, damit es nicht gerinnt. Schließlich wurde nichts verschwendet und nur ungeronnenes Blut konnte später zu Presssack und Blutwurst weiterverarbeitet werden. Die Innereien und andere eher minderwertige Teile wurden sofort in einem großen Kessel gekocht und direkt vor Ort mit viel Brot, Salz und Bier verschlungen. Solche Schlachtungen waren damals ein Samstag-füllendes, anstrengendes Event, und noch heute wird zumindest die Tradition des Kesselfleischessens in Bayern gepflegt.
Der weitaus größte Teil des Fleisches wurde in „Gselchts“ verwandelt. Ein Gselchts, zu Deutsch Geräuchertes, zeichnet sich dadurch aus, dass das rohe Fleisch zunächst mehrere Wochen gesurt (= gepökelt) wird. Danach wird es geräuchert. Je nach Verfahren ist das Fleisch dann nach sechs bis acht Wochen genießbar, hält jedoch deutlich länger. Man kann es direkt mit Brot und wahlweise Meerrettich verspeisen, oder eben zu den verschiedensten Gerichten wie etwa Spaghetti alla Carbonara verarbeiten. Während man zum direkten Verzehr eher den Schlegel vorzieht, verwendet man zum Kochen, vor allem aber zum Braten, eher das Wammerl. Und deshalb gehe ich davon aus, dass auch die Köhler das so gemacht haben.
Gekochter Schinken hat nur eine sehr kurze Haltbarkeit und ist deshalb eher eine Errungenschaft der Neuzeit. Dass die Köhler in ihrem Gericht gekochten Schinken verwendet haben, ist also eher unwahrscheinlich. Auf der Suche nach dem Originalrezept können wir neben dem ganzen Ei also eine zweite Zutat mit hoher Wahrscheinlichkeit ausmachen: Roher, geräucherter Speck.
Die dritte und auch letzte Zutat, bei der sich fast alle Rezepte einig sind, ist der Käse. Doch bei der Frage, ob es sich dabei um Parmesan oder um Pecorino handeln muss, scheiden sich wieder einmal die Geister. Die Historie hilft uns hier nicht weiter. Den aus Schafsmilch gewonnenen Pecorino gibt es zwar schon wesentlich länger als den Parmesan, der aus Kuhmilch hergestellt wird. Trotzdem gibt es auch den Parmesan schon seit etwa 1000 Jahren. Seinen Siegeszug begann der Parmesan mit der starken Verbreitung der Kuhherden. Diese wiederum begann mit der Entstehung größerer Weideflächen und somit mit der massiven Abholzung der Wälder. Da die Köhler hier einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, wäre es durchaus nachvollziehbar, dass sie auch selbst von den modernen Errungenschaften profitiert haben und tatsächlich schon Parmesan hergestellt oder zumindest verwendet haben. Aber das ist reine Vermutung, und spätestens an dieser Stelle endet deshalb die logische Suche nach dem Originalrezept.
Das Originalrezept von Spaghetti alla Carbonara zu suchen, macht etwa so viel Sinn, wie das Originalrezept des bayrischen Schweinebratens zu suchen. Jeder Koch und jede Hausfrau machen es auf ihre Art und variieren dabei die Zutaten und Zubereitungsmethoden nach ihrem ganz eigenen Geschmack. Und so bleibt uns auf der Suche nach dem besten Rezept nichts anderes übrig, als einfach verschiedene Vorschläge auszuprobieren. Am naheliegendsten ist es dabei, mit dem Einfachsten zu beginnen.
Spaghetti mit Eiern und Speck
Eier und Speck zu kombinieren ist nicht gerade neu. Eier mit Nudeln zu kombinieren ebenso wenig. Auch die sogenannten Schinkennudeln werden gelegentlich mit Speck statt mit Schinken serviert. Wenn man alle drei Zutaten verbindet, hat man eine schnell zubereitete Mahlzeit, die man als einfache Hausmannskost bezeichnen könnte. Dieses Gericht habe ich mir schon als Student regelmäßig gekocht, weil es nur wenige Zutaten erfordert und unglaublich einfach geht.
Während die Nudeln kochen (es müssen nicht zwangsläufig Spaghetti sein), schneiden Sie etwas Speck und braten ihn in einer Pfanne an. Wenn Sie eine beschichtete Pfanne verwenden und der Speck fett genug ist, ist kein zusätzliches Fett erforderlich. In einer unbeschichteten Pfanne dagegen sollten Sie ein Stück Butter dazugeben. Lassen Sie den Speck bei leichter bis mittlerer Hitze brutzeln und bereiten Sie in der Zwischenzeit die Rühreier vor. Je nach Geschmack können Sie dafür ein bis zwei Eier pro Person einplanen. Verquirlen Sie die Eier mit einer Gabel und geben Sie Salz und Pfeffer dazu. Alternativ können Sie noch etwas Milch oder Sahne und geriebenen Parmesan dazu geben.
Wenn die Nudeln fertig sind, seihen Sie sie ab und geben sie direkt in die Pfanne mit dem brutzelnden Speck. Nun geben Sie sofort die Eier-Mischung darüber und rühren kräftig um. Normalerweise stockt das Ei an den heißen Nudeln und das Gericht ist sofort servierfertig. Aber dieses nur leicht gestockte Ei ist nicht jedermanns Sache und so können Sie die Nudeln natürlich auch noch ein wenig in der Pfanne schwenken, um die Eier besser durchzukochen. Wenn Sie es noch mehr gekocht haben wollen, können Sie auch die Ei-Mischung schon vor den Nudeln in die Pfanne geben, zunächst die Eier mit Speck zubereiten und dann die Nudeln untermischen. Allerdings hat diese Mischung jetzt nur noch wenig mit Spaghetti alla Carbonara zu tun. Am Ende können Sie noch Pfeffer über die Nudeln mahlen.
Dieses Rezept ist, wie schon oben erwähnt, sehr einfach, aber leider auch wenig italienisch. Das ist sozusagen die bayrische Variante von Spaghetti alla Carbonara.
Spaghetti alla Galileo
Bei meiner Suche nach neuen Rezepten für Spaghetti alla Carbonara stoß ich im Internet auf ein Video von Galileo – der Wissenssendung von Pro7. Hier durfte zunächst ein erfundener Hobbykoch seine Variante vorstellen, bei der er jedoch alles falsch machte, was man nur falsch machen konnte. Daraufhin erklärte ihm eine junge hübsche Frau – angeblich eine italienische Profiköchin – wie es wirklich funktioniert. Immerhin hat sie die richtigen Spaghetti ausgewählt und korrekt erklärt, wie man Spaghetti kocht und wie man sie eben nicht kocht: Dass man sie nicht abschrecken darf, dass man kein Öl ins Wasser schüttet und dass die erste Handlung beim Nudelkochen immer das Erhitzen des Wassers ist.
Natürlich war auch sie davon überzeugt, dass ihr Rezept das Original ist und dass es genau so und nicht anders zu machen sei. Umso interessanter fand ich es, dass sie in der Pfanne zuerst Zwiebeln anbriet, bevor sie dann den Speck dazu gab. Das genaue Rezept geht so:
In einem großen Topf 500 g Spaghetti kochen. In der Zwischenzeit eine Zwiebel fein würfeln und in einer Pfanne mit etwas Butter andünsten. Dann etwas Speck schneiden (die genaue Menge hat sie nicht verraten, aber ich würde zwischen 200 und 300 g schätzen), zu den Zwiebeln geben und bei leichter Hitze mit andünsten. In einer Schüssel zwei Eigelb (kein Eiweiß) mit zwei Handvoll Parmesan vermischen und mit etwas Nudelwasser verrühren. Die fertigen Spaghetti abseihen, zurück in den noch heißen Topf geben, die Speck-Zwiebelmischung und die Ei-Käsemischung darunter rühren. Am Ende noch mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen.
Ich habe dieses Gericht noch am selben Abend ausprobiert, wenn auch mit kleinen Variationen. Zunächst einmal konnte ich es nicht verstehen, warum sie für zwei Portionen 500 g Spaghetti kocht. Selbst ich, dem man früher nachsagte, ein richtiger Mangione (= italienisch: Fresssack) zu sein, konnte nie 250 g Spaghetti essen. Schon gar nicht mit Eiern und Speck. Dass man nur das Gelbe vom Ei verwenden soll, wurde damit begründet, dass die Soße an den Nudeln nicht stocken soll. Und zwei Eier und davon sogar nur die Dotter für 500 g Spaghetti halte ich dann doch für sehr wenig. Meine Variante, die ich nur für mich selbst zubereitet habe, bestand deshalb aus 150 g Spaghetti und einem Eigelb. Alles andere übernahm ich unverändert, wenn auch mit gewisser Skepsis.
Die Skepsis war durchaus angebracht, denn das Ergebnis war aus meiner Sicht eher bescheiden. Die Zwiebeln und der Speck passen für meinen Geschmack nur mäßig zueinander. Das Ganze hat am Ende einen ziemlich säuerlichen Geschmack, was natürlich von den Zwiebeln kommt. Da die Dame sehr überzeugend erklärt hat, dass Knoblauch, Chili oder ähnliche Gewürze bei diesem Gericht nichts zu suchen haben, habe ich mich daran gehalten, wobei man vielleicht genau damit noch einiges hätte gut machen können. Dass das Eigelb die Soße sehr cremig macht, ist zwar richtig, aber es macht sie auch sehr deftig und schwer verdaulich.
Die Kochbuchvarianten
Ich habe zuhause drei italienische Kochbücher und selbstverständlich fehlt in keinem davon das Rezept für Spaghetti alla Carbonara. Zugutehalten muss man allen dreien, dass sie keine Zwiebeln verwenden.
In einem der Bücher wird Speck zusammen mit Chili ohne Zugabe von Öl angebraten und ebenfalls nur das Eigelb verwendet. Je 100 g Spaghetti wird dabei ein Eigelb vorgeschlagen. Das Eigelb wird ähnlich wie im vorher beschrieben Rezept mit Nudelwasser und Käse vermischt, allerdings wird hier Pecorino statt Parmesan empfohlen. Der wesentliche Unterschied zum ersten Rezept ist also die Verwendung von Chilis statt Zwiebeln und die Menge der Eier. Die Chilis machen sich für meinen Geschmack wirklich sehr gut, aber das Eigelb ist erneut zu deftig.
Im zweiten Buch, das jedoch sehr deutsch und wenig italienisch zu sein scheint, wird zum Anbraten des Specks Olivenöl UND Butter empfohlen. Chili kommt nicht vor. Es wird wieder ein Eigelb je 100 g Nudeln verwendet, die diesmal jedoch mit Parmesan und saurer Sahne verquirlt werden. Diese Mischung wird dann noch mit einer Prise Muskatnuss gewürzt. Das weitere Verfahren ist wie vorher. Die Zugabe von Sahne oder auch saurer Sahne ist die typisch deutsche Abwandlung dieses Gerichts. Und wenn sich italienische Köche bei Spaghetti alla Carbonara einig sind, dann zumindest darin, dass Sahne bei diesem Gericht gar nichts zu suchen hat. Und da kann ich mich anschließen.
Das dritte Rezept – ebenfalls von einem deutsche Autor – schlägt vor, gekochten Schinken zusammen mit geräuchertem Speck in Butter anzubraten. Die Eiermischung besteht für 500 g Spaghetti aus drei ganzen Eiern und drei Eigelben, Parmesan, 100 ml süßer Sahne und zwei zerdrückten Knoblauchzehen. Letzteres halte ich für besonders kurios, weil der Knoblauch dadurch ja nicht gegart wird, sondern mehr oder weniger roh verspeist wird. In diesem Fall erzeugen Sie also ein Gericht, das ähnlich wie Tsatsiki auch am nächsten Tag noch Spuren hinterlässt.
Alle drei Varianten kann man essen, aber keine davon hat mich wirklich überzeugt.
Meine Empfehlung
Wenn es schon so viele verschiedene Rezepte für Spaghetti alla Carbonara gibt, dann ist es sicher nicht tragisch, wenn ich noch ein weiteres hinzufüge. Aufgrund meiner Liebe zu Spaghetti con Aglio & Olio ist es naheliegend, dass ich den Zutaten Knoblauch, Chili und auch Petersilie treu bleibe. Da kann man in Verbindung mit Spaghetti fast nichts falsch machen.
Beginnen Sie wie immer mit dem Kochen der Spaghetti – etwa 300 g bis 360 g für zwei Personen. Während die Nudeln kochen, schneiden Sie ca. 80 g, maximal 100 g Speck in kleine Würfel oder Streifen. Der Speck sollte nicht zu fett sein, ein Schinken mit Fettstreifen ist im Zweifelsfalle vorzuziehen. Geben Sie nun etwa zwei Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne und erhitzen Sie das Öl, allerdings nicht zu stark. Ich nehme dazu keine beschichtete Pfanne, weil ich die Nudeln später direkt in der Pfanne mische und eine beschichtete Pfanne dafür unpraktisch ist. Braten Sie den Speck bei mittlerer Hitze an.
Während der Speck vor sich hin brutzelt, schlagen Sie zwei Eier (Eigelb UND Eiweiß) auf, geben etwas Salz, Pfeffer und geriebenen Parmesan dazu und verquirlen es mit einer Gabel zusammen mit zwei Esslöffeln des Nudelwassers. Achten Sie auf den Speck – er sollte nicht zu knusprig werden oder gar verbrennen. Schneiden Sie nun eine Knoblauchzehe und eine Chilischote klein und geben Sie sie in die Pfanne zum Speck, kurz bevor der Speck fertig ist. Der Knoblauch sollte wie bei Aglio & Olio nur kurz angedünstet werden und höchstens ganz leicht Farbe annehmen, also schalten Sie die Herdplatte am besten ab, sobald der Knoblauch in der Pfanne ist. Nun hacken Sie noch etwas Petersilie und geben sie ebenfalls in die Pfanne, der sie bei geringer Resthitze noch ein leichtes Brutzeln entlockt.
Wenn die Spaghetti fertig sind, seihen Sie sie ab und geben sie sofort in die noch heiße Pfanne mit dem Speck. Sollte die Pfanne bereits abgekühlt sein, erhitzen Sie sie noch einmal kurz, bevor Sie die Spaghetti dazu geben. Jetzt mischen Sie die Speck-Soße unter die Nudeln. Dann geben Sie die Ei-Käsemasse und nach Geschmack noch etwas frisch gemahlenen Pfeffer dazu und mischen alles noch einmal gut durch. Servieren Sie die Spaghetti sofort und reichen Sie dazu noch ein wenig geriebenen Parmesan.
Frisch zubereitete Spaghetti Carbonara nach meiner Empfehlung
Vorsicht: Dieses Gericht birgt eine ähnlich hohe Suchtgefahr wie Spaghetti mit Aglio & Olio! Sie mögen vielleicht schmunzeln, wenn ich im Zusammenhang mit Essen von Suchtgefahr spreche. Tatsächlich aber stecken in den meisten unserer Lebensmittel natürliche Drogen. Scharfe Gewürze wie Pfeffer oder Chilis lösen im Körper zunächst einen Schmerz aus, der dann zur Ausschüttung von Endorphinen führt, die ja bekanntermaßen glücklich machen. Pfeffer enthält zudem Stoffe, die in der Leber zu körpereigenen Aufputschstoffen umgewandelt werden, die ähnlich wirken wie die Designer Drogen Speed und Ecstacy. Doch damit nicht genug. Weizen, und somit auch Nudeln, enthalten sogenannte Exorphine, die an die Opiatrezeptoren im Darm andocken und dann eine ähnliche Wirkung wie Opium haben. Und zu guter Letzt tut auch noch die Petersilie ihre Wirkung. Sie enthält Myristicin und Apiol – Stoffe, die entspannend und krampflösend wirken und bei höherer Dosis sogar halluzinogen sind.
Wenn Sie jetzt geschockt sind, welchen Drogencocktail ich Ihnen da empfehle, rate ich Ihnen, sich einmal genauer mit den natürlichen Drogen in unserem täglichen Essen zu beschäftigen. Einen guten Überblick dazu gibt Udo Pollmer in seinem Buch „Opium fürs Volk“1
Spaghetti mit Schinken-Sahne Soße
Das ist sozusagen genau das Gegenteil der echten Carbonara, aber witzigerweise das, was viele Deutsche darunter verstehen: Eine Schinken-Sahne-Soße. Auch die kann lecker sein, sollte aber nicht als Carbonara bezeichnet werden.
Bei einer Schinken-Sahne-Soße finde ich es sehr wichtig, dass zuerst der Schinken angebraten wird, bevor die Zwiebeln dazu kommen, denn so kommt der Geschmack des angebratenen Schinkens viel mehr zur Geltung. Geben Sie Zwiebeln und Schinken dagegen gleichzeitig in die Pfanne, wird der Schinken im Saft der Zwiebeln gekocht und die Soße schmeckt etwas langweilig.
Und so einfach geht es: Schneiden Sie für zwei Portionen ca. 150 g gekochten Schinken in kleine Rechtecke. Geben Sie etwas Öl in eine Pfanne und erhitzen Sie es. Dann verteilen Sie die Schinken-Stücke gleichmäßig in der Pfanne und braten Sie einige Minuten lang bei mittlerer Hitze an. In der Zwischenzeit würfeln Sie eine Schalotte. Sobald der Schinken etwas Farbe angenommen hat, geben Sie die Schalottenwürfel dazu und braten bzw. dünsten sie noch einige Minuten mit an. Nun geben Sie einen Becher Sahne dazu. Lassen Sie die Hitze unverändert, bis die Sahne anfängt aufzukochen. Nun mischen Sie reichlich geriebenen Parmesan dazu und lassen die Soße nur noch ganz kurz aufkochen. Dann nehmen Sie die Hitze weg. Sie können jetzt noch mit frisch gemahlenem Pfeffer würzen, oder das später zusammen mit den Nudeln machen.
Idealerweise sollten die Nudeln mittlerweile fertig sein, denn die Schinken-Sahne-Soße mag es gar nicht, noch lange rumzustehen oder weiter zu köcheln. Die Zubereitungszeit ist sehr kurz, also sollten Sie auf jeden Fall mit dem Kochen der Nudeln starten, bevor Sie den Schinken schneiden.
Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich keine Zwiebel verwendet habe, sondern eine Schalotte. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass meine Verdauung nach dem Genuss von Zwiebeln manchmal sehr heftig reagiert. Als ich dann irgendwo gelesen hatte, dass Schalotten wesentlich bekömmlicher seien, habe ich die Zwiebel in einigen Gerichten durch Schalotten ersetzt. Ob meine Verdauung den Unterschied wirklich erkennt, kann ich nicht sagen, aber wir fanden dabei heraus, dass uns Schalotten zu vielen Gerichten besser schmeckten als die klassischen Haushaltszwiebeln. Als ich die Schinken-Sahne-Soße für meinen Großen eines Tages wieder mit normalen Zwiebeln zubereitete, kam prompt eine Beschwerde. Seither wird sie nur noch mit Schalotten gemacht.
Die römische Variante
An dieser Stelle sollte das Kapitel Carbonara ursprünglich zu Ende sein. Doch wie es der Zufall wollte, stolperte ich über eine Fernsehsendung, bei der eine Köchin die beste Carbonara Roms vorstellen sollte. Nachdem Rom ja nicht gerade eine kleine Stadt ist, war das schon eine stolze Behauptung und ich war sehr gespannt auf ihre Version.
Zunächst drehte sich alles um den Speck. Nicht irgendein Speck durfte es sein, sondern nur ein Guanciale. Ein Guanciale ist ein Speck, der aus der Schweinebacke hergestellt wird und somit naturgemäß sehr fett ist. Das gab für mich schon mal einen Punkt Abzug, denn dass zu fetter Speck diesem Gericht eher schadet als nutzt, hatte ich ja schon vorher angedeutet. Der Speck wurde in dünne Streifen geschnitten und knusprig angebraten. Schließlich wurde das Ganze noch mit etwas Weißwein abgelöscht.
Dann wurde ein Ei, und zwar ein ganzes, nicht nur das Eigelb, mit reichlich römischem Pecorino gemischt, mit etwas Pfeffer gewürzt und mit Nudelwasser sämig gerührt. Schließlich kamen die frisch abgeseihten Spaghetti in die Pfanne zum Speck. Die Pfanne wurde dann sofort vom Feuer genommen, bevor alles mit der Eiermischung verrührt wurde. Die Behauptung, die beste Carbonara Roms zu machen, wurde am Ende plötzlich zur Aussage, dass dies die beste Carbonara der Welt sei.
Der deutsche Koch, der die Sendung moderierte, fragte schließlich noch nach der Sahne, worauf die italienische Köchin ihm sagte, dass Sahne nur Leute verwenden, die nicht kochen können. In Rom würde kein Koch jemals Sahne verwenden – für kein Gericht. Was die Carbonara betraf, konnte ich mich der Köchin durchaus anschließen, aber die allgemeine Aussage, dass gute Köche niemals Sahne verwenden würden, führte ich eher auf die römische Arroganz zurück, wofür sie auch eher bekannt sind, als für ihre Kochkunst.
Obwohl mir, wie gesagt, der fette Speck etwas zuwider ist, musste ich natürlich auch diese Variante ausprobieren. Vor allem das Ablöschen mit Weißwein fand ich sehr interessant. Natürlich verwendete ich keinen Guanciale, sondern normalen, bezahlbaren Speck. Aber ansonsten hielt ich mich streng an die Vorgaben – sogar der Pecorino, den ich im Kühlschrank hatte, war ein romanischer. Das Ergebnis war allerdings eher ernüchternd. Also es handelt sich hier durchaus um eine gutes Gericht und ich habe schon deutlich schlechtere Pasta gegessen. Aber meiner Carbonara kann dieses Rezept definitiv nicht das Wasser reichen. Wenn das die beste Carbonara Roms sein soll, dann tun mir die Römer fast ein bisschen leid. Wenn es sogar die beste Carbonara der Welt sein soll, dann muss ich sagen „Die spinnen die Römer“.
Die vegetarische Carbonara
Mittlerweile ernährte sich die Hälfte meiner Familie aus Gründen des Klimaschutzes vegan oder vegetarisch und aus Solidarität gab es für die ganze Familie wenigstens einen komplett fleischlosen Tag. Das fiel mir – abgesehen von meiner morgendlichen Wurstsemmel – nicht weiter schwer, denn die meisten Gerichte sind ja bei uns ohnehin fleischlos. Doch eines Tages hatte ich ein unstillbares Verlangen nach Spaghetti Carbonara und das war ausgerechnet an einem Montag – der Tag, den wir zum Veggie-Tag erklärt hatten.
Es wäre natürlich ein Leichtes gewesen, den Speck einfach wegzulassen. Doch gerade der geschmacksintensive Speck ist es ja, der diesem Gericht seinen Charakter verleiht. Also musste etwas anderes her, das sehr geschmacksintensiv ist. Was lag da näher als getrocknete Steinpilze? Ich weichte die Steinpilze wie üblich für etwa eine halbe Stunde in heißem Wasser ein. Dann gab ich etwas Olivenöl in die Pfanne und briet die Pilze ein bisschen an. Nach einigen Minuten kamen noch eine kleingeschnittene Knoblauchzehe und eine Chilischote dazu, die ich etwa ein bis zwei Minuten bei leichter Hitze mitbraten ließ. Bevor der Knoblauch braun wurde, nahm ich die Hitze weg und gab noch etwas gehackte Petersilie dazu.
Das Ei verquirlte ich mit etwas Parmesan, Salz, Pfeffer und Nudelwasser. Schließlich gab ich die abgeseihten Spaghetti in die Pfanne und verrührte alles mit der Eiermischung. Ich machte also alles genau so wie bei meinem Lieblingsrezept, nur dass ich den Speck durch die Steinpilze ersetzt hatte. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, oder besser gesagt, es konnte sich genießen lassen und ich fasste den Entschluss, dieses Gericht bei der nächsten Gelegenheit meiner Frau vorzusetzen, die bisher alle Arten von Carbonara wegen Ihrer Abneigung vor Speck verweigert hatte.
Ich war überrascht, wie gut es bei Ihr ankam. Dieses Gericht wurde von da an öfter auf unseren Speiseplan gesetzt. Allerdings nie wieder montags, denn meine Frau hatte längst den Montag zum veganen Tag erklärt, und Carbonara ohne Ei ist auch für mich eine nicht lösbare Aufgabe.
Die Koch-Mythen
Viele Empfehlungen von Köchen und Hausfrauen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Oft haben diese Empfehlungen einen guten Grund, den die meisten zwar nicht erklären können, aber damit positive Erfahrungen gemacht haben. Häufig werden auch Gründe genannt und diese werden, weil sie logisch klingen, genauso leichtfertig weitergegeben wie die Empfehlungen selbst. Tatsächlich aber basieren viele dieser Tipps auf falschen Annahmen, auf Unwissen oder auf veralteten Gegebenheiten. Auf einige dieser Kochmythen, die mir immer und immer wieder begegnen und zugleich aufstoßen, möchte ich hier näher eingehen.
Das Salz im Nudelwasser.
„Geben Sie das Salz erst ins Nudelwasser, wenn es schon siedet“ empfehlen auch Profiköche gerne. Als Begründung heißt es, dass das Salz ja den Siedepunkt des Wassers erhöht und es deshalb länger dauert und mehr Energie kostet, wenn man das Salz bereits vor dem Erhitzen zugibt. Richtig ist daran jedoch nur, dass sich der Siedepunkt erhöht. Allerdings sollte man wissen, von welcher Größenordnung wir hier sprechen. Bei einem normal gesalzenen Nudelwasser liegt diese Temperaturerhöhung bei etwa 1 °C bzw. 1 K. Das gesalzene Wasser siedet also auf Meereshöhe nicht bei 100 °C, sondern ca. bei 101 °C. Nehmen wir also an, wir stellen das Wasser bereits mit 60 °C auf die Herdplatte, weil wir natürlich warmes Wasser verwenden, so müssen wir die Temperatur statt um 40 K nun um 41 K erhöhen. Ein Mehraufwand von 2,5 % an Energie und Zeit. Nicht gerade beachtlich, aber doch Grund genug, den Mythos aufrechtzuerhalten.
Aber stimmt das wirklich? Wenn das Salzwasser den Siedepunkt verschiebt, dann tut es das doch auch, wenn wir es nach dem Sieden zugeben. Müsste dann das siedende Wasser nicht sofort zur Ruhe kommen, wenn wir das Salz zugeben? Doch tatsächlich kann man genau das Gegenteil beobachten: Sobald man das Salz ins siedende Wasser kippt, brodelt es noch einmal richtig auf, gerade so, als würde das Salz den Siedepunkt absenken und nicht erhöhen. Wie kann das sein?
Fakt ist, dass sich hier zwei verschiedene physikalische Effekte überlagern. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man also zuerst die Physik des siedenden Wassers begreifen. Reines (= destilliertes) Wasser siedet bei einem Umgebungsdruck von 1013 mbar bei 100 °C. Aber was genau bedeutet Sieden? Siedet eine Flüssigkeit, sobald die ersten Dampfblasen aufsteigen oder doch erst, wenn alles richtig blubbert und spritzt? Viele Wissenschaftler, die sich im Lauf ihrer Arbeit mit der Bestimmung des Siedepunkts beschäftigt haben, wissen, wie extrem schwierig es ist, den exakten Siedepunkt einer Flüssigkeit zu bestimmen. Ein Grund dafür ist ein immer vorhandenes Ungleichgewicht in der Flüssigkeit. Dort, wo die Wärme zugeführt wird, ist die Flüssigkeit oft deutlich wärmer als weiter entfernt davon. Im Kochtopf beispielweise ist die heißeste Stelle am Boden, während die Flüssigkeit ganz oben einige Kelvin kälter sein kann.
Außerdem gibt es in der Mitte des Kochtopfs einen sogenannten Siedeverzug. Dampfblasen haben nämlich eine schwere Geburt und oft brauchen sie einen Geburtshelfer in Form von sogenannten Siedekeimen. Das heißt, dass das Wasser in der Mitte des Topfes teilweise schon überhitzt ist, also mehr als 100°C hat, aber noch keine Dampfblasen entstanden sind. Die Salzkörner, die Sie nun zugeben, sind genau die benötigten Siedekeime und helfen den Dampfblasen ins Leben.
Um das Salzwasser zum Sieden zu bringen, müssen Sie es also auf jeden Fall zuerst überhitzen und am Ende die Siedetemperatur des Salzwassers erreichen. Und um es auf dieser Siedetemperatur des Salzwassers zu halten, ist auch immer die gleiche Energie notwendig, egal ob Sie das Salz ganz am Anfang oder erst am Ende zugeben. Und selbst den findigen Spezialisten, die ausrechnen, dass es energetisch günstiger sei, das Salz am Anfang zuzugeben, weil dadurch die spezifische Wärmekapazität des Wassers gesenkt werde, möchte ich zu denken geben, dass es am Ende immer die gleiche Menge an NaCl- und H2O-Molekülen sind, die auf Siedetemperatur gebracht werden müssen. Was bei dieser Argumentation nämlich gern vergessen wird, ist dass die spezifische Wärmekapazität sich immer auf die Masse bezieht und nicht auf das Volumen, bei der Zugabe des Salzes sich aber die Masse erhöht und mit ihr auch die absolute Wärmekapazität.
Wenn man es jetzt aber ganz genau nimmt, dann müsste nach meiner Einschätzung das Wasser, bei dem das Salz von Anfang an dazugegeben wird, minimal schneller kochen. Die Zugabe des Salzes erhöht ja wie bereits erwähnt die Siedetemperatur, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Dampfdruck abgesenkt wird. Kleinerer Dampfdruck bedeutet geringere Verdunstung während des Erhitzens. Bei einem offenen Topf ist die Verdunstung eine der Hauptursachen für Wärmeverluste. Somit geht beim ungesalzenen Wasser mehr Wärme durch Verdunstung verloren und somit weniger Wärme in das Wasser. Bei offenem Deckel müsste demnach das ungesalzene Wasser etwas später sieden. Bei geschlossenem Deckel dagegen sollte kein Unterschied sein. Dieser Effekt ist jedoch rein rechnerisch so gering, dass er experimentell schwer nachweisbar ist und nicht einmal die Energie wert ist, die man dafür verschwenden würde.
Wenn Sie das jetzt alles nicht so genau verstanden haben, dann behalten Sie einfach als Fazit: Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt Sie das Salz in das Wasser geben, so lange es vor den Nudeln in den Topf kommt. Wenn Sie jedoch gerne das physikalische Phänomen des Siedeverzugs beobachten, dann geben Sie es genau dann rein, wenn das Wasser siedet, und das heißt, unmittelbar bevor Sie die Nudeln reingeben.
Mehl sieben