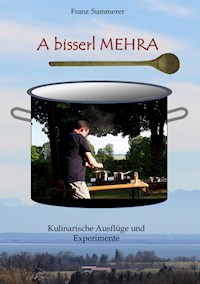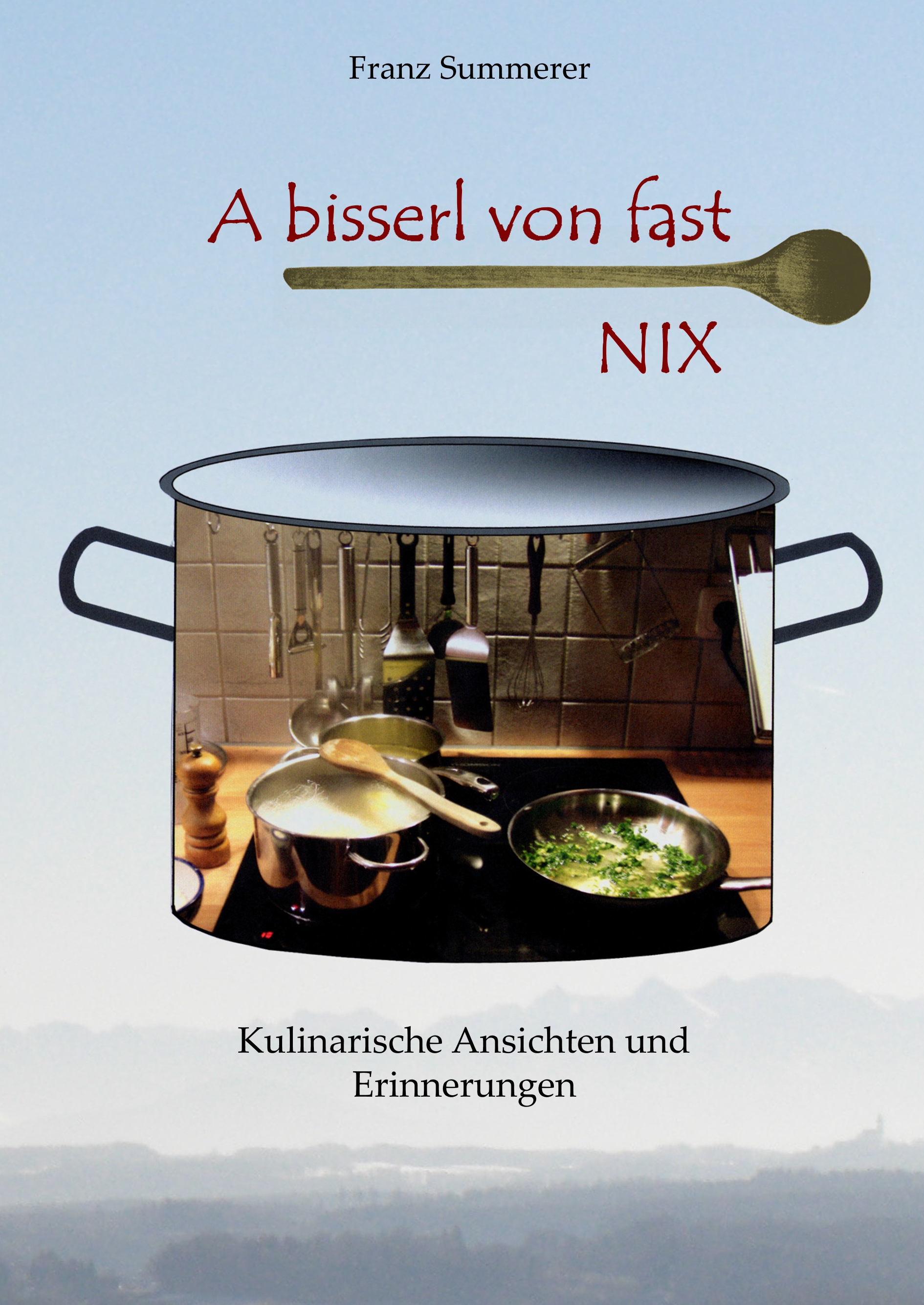
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Franz Summerer zeigt, wie man mit Effizienz und Schnelligkeit zu hervorragenden Gerichten kommt. Er verknüpft seine Rezepte mit Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend und gibt praktische Tipps vom Auffüllen einer Pfeffermühle über die Organisation größerer Feste bis hin zum Erkennen eines guten Bieres. Neben Pizza und zahlreichen Pasta-Gerichten widmet sich der Autor auch typischen Biergarten-Brotzeiten wie Obazda und Wurstsalat. Aber auch Kuchen, Nachspeisen und original französische Croissants werden erklärt. Beim Thema Pasta wir sogar ein kurzer Ausflug in die Experimentalphysik gemacht. A bisserl von fast NIX ist mehr als nur ein Kochbuch. Es ist der Ausdruck einer kulinarischen Lebenseinstellung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Aglio & Olio
Im Biergarten
Das Handwerk
Pizza & Co.
Risotto
Auberginen
Tomaten
…und andere Pasta-Soßen
Schnitzel mit Soße und Beilagen
Antipasti
Pasta
Braten, Dünsten, Kochen
Kartoffeln
Mehlspeisen
Nach dem Essen
Kuchen und Torten
Bier, Wein und Hochprozentiges
Die Gäste kommen
Zum Abschluss
Anhang: Rezepte im Überblick
Für Max, Felix und Sylvia, die mich bei diesem Buch sehr unterstützt haben und jetzt auch ohne mich keinen Pizza-Service mehr brauchen.
Für meine Mutter, die mit ihren Kochkünsten einen wesentlichen Teil zum Gelingen dieses Werks beigetragen hat.
Für meine Freunde und Kollegen, denen ich jetzt vieles nicht mehr erklären muss, weil sie es hier nachlesen können.
Und für mich, der in schwierigen Zeiten einen guten Ausgleich zum Alltagsstress und sogar ein neues Hobby gefunden hat.
Vorwort
Als ich mir zum ersten Mal darüber Gedanken machte, ein Buch zu schreiben, grübelte ich, wie denn der Titel lauten könnte. „Ein bisschen von Allem“, fiel mir spontan ein. Aber dann hielt ich inne und überlegte mir, wie anmaßend es sei, zu behaupten, dass ich von ALLEM schreiben würde. Ganz sicher werde ich nichts über Atomphysik, über Relativitätstheorie, über theoretische Thermodynamik und über viele andere Themen schreiben. Ganz abgesehen von den vielen Dingen, über die ich gar nichts schreiben könnte, oder noch schlimmer, die ich nicht mal kenne! „Von Allem“ fiel also schon mal aus. Genaugenommen ist das, worüber ich schreibe und worüber ich eigentlich schreiben könnte, im Vergleich zu dem, was schon alles geschrieben wurde, verschwindend gering. So gut wie gar nichts. „Ein bisschen von Nichts“ widerstrebte aber meinem mathematischen Verständnis, denn egal, ob man von „Nichts“ ein bisschen oder ganz viel nimmt – es bleibt immer Nichts. So entschied ich mich schließlich, meinem Buch den Titel „Ein bisschen von fast Nichts“ zu geben. Und weil es auch ein bisschen ein bayrisches Buch werden sollte, musste auch der Titel so sein: „A bisserl von fast nix“.
Zwei Tage nachdem ich mich für diesen Titel entschieden hatte, nahm ich die neue Fernsehzeitung für die darauf folgende Woche aus dem Briefkasten. Wie immer wurden auch diesmal auf der Titelseite reißerisch Beiträge angekündigt, die nie das halten, was sie versprechen. Diesmal wurde ein Beitrag von Peter Scholl-Latour angekündigt unter der großspurigen Verheißung: „Die Wahrheit über die Welt“. Spontan fand ich mich bei meiner Titelwahl bestätigt. Da kennt also jemand die Wahrheit über die ganze Welt. Da kann ich einfach nicht mithalten.
Ich wollte kein Kochbuch schreiben. Ebenso wenig wollte ich „meine Memoiren“ schreiben. Zugegeben - „A bisserl von fast nix“ beschäftigt sich sehr viel mit Kochen, Essen und Trinken – aber eben nicht nur. Genaugenommen wollte ich einfach nur das zum Besten geben, was ich meinen Freunden und Bekannten und vielleicht noch vielen anderen netten Menschen, die ich nie kennengelernt habe, mitteilen möchte. Tipps und Tricks für verschiedene Lebenssituationen sozusagen. Und dabei konzentriere ich mich natürlich auf die Lebenssituationen, bei denen ich mich wirklich in der Lage fühle, Tipps zu geben. Das sind eben die Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie ziemlich gut kann. Es erklärt sich somit von selbst, dass ich nichts über Joggen, Skifahren, Rasenmähen usw. schreibe – obwohl ich auch diesen Tätigkeiten nachgehe – sondern eben über Kochen, Essen und Trinken und einigen anderen Dingen, die eng damit zu tun haben. Und weil dabei sehr oft persönliche Erfahrungen eine Rolle spielen, finden Sie in diesem Buch auch das ein oder andere Kindheitserlebnis bis hin zu wissenschaftlichen Experimenten.
Effizienz nimmt bei mir einen hohen Stellenwert ein. Minimaler Aufwand für maximalen Nutzen. Das hat schon in der Schule gut funktioniert, es funktioniert in der Arbeit und es funktioniert ganz besonders beim Kochen. Effizient Kochen geht schneller als Essen gehen, ist gemütlicher und macht richtig Spaß! Ich habe Köche kennengelernt, die haben hervorragend gekocht, aber sie waren dabei so langsam, dass mir der Hunger vergangen war, bevor der erste Happen serviert wurde. Diese Leute hatten entweder keine Familie oder sehr geduldige Kinder. Jedenfalls werden sie nur selten die gleichen Gäste haben.
Alle hier vorgestellten Kochrezepte sind sehr einfach, keinesfalls sensationell und auch nicht besonders neu. Die Kunst liegt eher in der Optimierung. Natürlich ist es leichter, bei Pasta etwa zuerst alle Zutaten für die Soße vorzubereiten, dann die Soße zu kochen, dann die Nudeln zu kochen und schließlich die Komponenten zusammenzuführen. Aber bei dieser Vorgehensweise verschwenden Sie täglich Zeit. Zeit, die Sie vielleicht dazu verwenden könnten, spazieren zu gehen, ein Buch zu lesen oder die Tagesschau zu sehen. Aber natürlich fordert diese Effizienz auch ihren Tribut: Wenn Sie kochen, dann kochen Sie – sonst nix. Effizientes Kochen erfordert Konzentration, insbesondere wenn Sie mehrere Gerichte gleichzeitig kochen. Lassen Sie sich nicht ablenken, seien Sie der Herr Ihrer Küche! Und wenn Ihr Lebensgefährte sich beschwert, dass Sie nicht mehr mit ihm reden, während Sie kochen, dann erklären Sie ihm, dass Sie das in Zukunft mit ihm machen, während Sie in der gewonnenen Zeit mit ihm spazieren gehen. Das wird Ihrer beider Gesundheit gut tun.
Die Rezepte sind stark italienisch angehaucht, doch manchmal auch bayrisch oder einfach nur frei erfunden. Dass die meisten Gerichte fleischlos sind, ist eher Zufall oder einfach nur eine Folge meiner persönlichen Meinung, dass Fleisch in einer guten Ernährung nicht erforderlich ist. Dass keine Fischrezepte vorkommen, liegt dagegen an der einfachen Tatsache, dass meine Frau und meine Kinder keinen Fisch mögen und er somit in unserer Küche nicht vorkommt.
Und es gibt noch einen gravierenden Unterschied zu Kochbüchern: Sie finden bei mir häufig keine genauen Mengenangaben. Der Grund dafür ist einfach, dass es beim täglichen Kochen nicht praktikabel ist, alles peinlich genau abzuwiegen. Man kocht nach Gefühl und Erfahrung. Und es macht überhaupt nichts, wenn es jedes Mal etwas anders schmeckt – im Gegenteil, das macht das Essen jedes Mal wieder zu einer kleinen Überraschung. Weil es aber fürs erste Mal sicher hilfreich ist, ein Gefühl für die Menge zu haben, habe ich mich an manchen Stellen dazu überwunden, es doch zu tun, und am Ende finden Sie sogar eine Rezeptübersicht, bei der ich versucht habe, möglichst genaue Mengenangaben zu machen.
Und liebe Leserin, lieber Leser: Das war soeben die einzige Stelle, an der ich zwischen männlich und weiblich einen Unterschied mache. Ich weigere mich, der Koch/die Köchin zu schreiben oder Koch (w/m) oder was auch immer. Der Inhalt meines Buches ist eindeutig für beide Geschlechter gedacht, aber weil ich weiß, dass Frauen mehr Leid ertragen als Männer, werden bei mir nur die männlichen Begriffe verwendet. Der Koch, der Handwerker, der Lebensgefährte – betrachten Sie es bitte als geschlechtsneutral.
Zu guter Letzt noch ein Tipp: Nehmen Sie nicht alles, was ich schreibe, tierisch ernst. Vieles davon ist einfach nur meine persönliche Meinung, und es gibt Leute, die mir nachsagen, manchmal ein wenig zu übertreiben. Tragen Sie es also mit Humor und regen Sie sich bitte nicht auf, wenn Sie zu bestimmten Themen eine ganz andere Meinung haben.
Aglio & Olio
„Dieses Gericht wird ohne Käse serviert“, habe ich einmal in einem Kochbuch gelesen. Bis heute frage ich mich, wie das eigentlich gemeint war. Spaghetti mit Aglio & Olio, also mit Knoblauch und Olivenöl, ohne Parmesan? Für mich unvorstellbar! Vielleicht bedeutet ja „serviert“ einfach nur, dass man den Käse nicht drüber streuen soll, bevor man es seinen Gästen vorsetzt. Aber was genau damit gemeint war, bleibt wohl das Geheimnis des Kochbuchs bzw. dessen Autors. Und das ist leider nur eines der vielen Geheimnisse, die Kochbücher in sich bergen. Erstaunlicherweise wird in jedem Pasta-Kochbuch erklärt, wie man Nudeln kocht. „In reichlich Salzwasser al dente kochen“ findet man in vielen Kochbüchern auf jeder zweiten Seite. Aber dass Wassermenge, Wassertemperatur und sogar die Form des Kochtopfs (hoch oder breit) dabei einen entscheidenden Einfluss haben, ist nirgendwo erwähnt. Meistens wird man mit der Aufgabe, die Nudeln al dente, also bissfest, zu kochen, alleine gelassen. Manchmal wird zwar noch erklärt, wie man das machen soll, aber warum bleibt offen.
Noch bemerkenswerter finde ich, wenn in manchen Büchern das Kochen von Nudeln mit jeder neuen Pastasoße immer wieder erklärt wird, während etwa das richtige und effiziente Würfeln von Zwiebeln nie erklärt wird. Es wird vorausgesetzt. Und schon oft habe ich mich beim Lesen dieser Kochbücher gefragt, wieviele Zwiebeln der Autor des Buches wohl schon selbst „fein gewürfelt“ hat.
Aber halt. Spaghetti mit Aglio & Olio erfordern keine Vorkenntnisse, denn Zwiebeln werden gar nicht benötigt, und der Rest ist so einfach, dass es für jeden Kochanfänger machbar sein müsste:
Für 2 Portionen kochen Sie so viele Spaghetti, wie 2 Personen eben essen. Ich würde dafür 300 g kochen, wenn ich schon eine Vorspeise hatte, 360 g ohne Vorspeise und mit richtigem Hunger. Während die Spaghetti kochen, 2 große oder 3 mittlere Knoblauchzehen schälen und fein würfeln – das halte ich jetzt nicht für erklärungsbedürftig, denn ich weiß nicht, was man dabei falsch machen könnte. 2 kleine scharfe Chilischoten ebenfalls klein schneiden. In einer Pfanne einen kräftigen Schuss Olivenöl (der Boden sollte gut bedeckt sein) erhitzen und Knoblauch und Chilischoten dazu geben. Achtung: Nur leicht andünsten; wenn der Knoblauch braun wird, können Sie das Ganze entsorgen und von vorn anfangen. Man muss für das Zusammenspiel von Pfanne und Herd ein Gefühl entwickeln, aber lieber vorsichtig und mit wenig Hitze anfangen. Beim Einsetzen des ersten Brutzelgeräusches sollte man schon in Alarmbereitschaft sein.
Nachdem die Platte abgeschaltet (und gegebenenfalls die Pfanne beiseite gestellt) wurde, reichlich Petersilie fein hacken und in die Pfanne geben. Ein erneutes, leichtes Brutzelgeräusch zeigt, dass das Öl noch heiß genug war und die Petersilie genau zum richtigen Zeitpunkt hinzugegeben wurde.
Mittlerweile müssten langsam die Spaghetti fertig sein. Ob man dies durch Überwachen der Kochzeit oder durch mehrfaches Probieren feststellt, bleibt jedem selbst überlassen. Ich persönlich bevorzuge das Probieren, weil ich damit auch den Salzgehalt des Wassers permanent überprüfen und nachjustieren kann. Die fertigen Spaghetti abseihen und in die Pfanne geben. Kräftig Pfeffer darüber mahlen und alles gut mischen. Spätestens jetzt sollten Sie feststellen, dass man dazu keine beschichtete Pfanne nehmen soll, denn das macht das Mischen und das Servieren nicht leicht. Schließlich wollen wir nicht gleich beim ersten Gericht die gute, beschichtete Pfanne zerstören.
Die Pfanne kann man nun zusammen mit den zwei Tellern an den Tisch stellen. Mit einer Spaghettizange bringt man die Beute am einfachsten in die Teller – aber natürlich geht es auch mit Gabel und Löffel. Nun reibt man noch kräftig Parmesan über die Nudeln und schon hat man eines der wunderbarsten Abendessen vor sich stehen. Doch bevor man sich darauf stürzt, sollte man sicherstellen, dass reichlich Rotwein und Wasser auf dem Tisch steht. Das Wasser ist gegen den Durst, und der Rotwein ist von diesem Gericht nicht wegzudenken. Ganz ehrlich: Ich kenne kein anderes Pasta-Rezept, bei dem die einfache Zubereitung und der perfekte Geschmack so genial kombiniert sind. Doch bevor es wirklich genial schmeckt, muss man einige sehr grundlegende Dinge beachten:
Spaghetti
Ich persönlich nehme nur Spaghetti der Marke De Cecco. Sie sind etwas dicker als die meisten Spaghetti anderer Hersteller, aber unübertroffen gut. Bei anderen Pastamarken gibt es ähnliche Nudeln, die dann jedoch meistens nicht Spaghetti heißen. Bei Barilla z. B. heißen sie Spaghettoni. Dem Nudelkochen werde ich mich in einem späteren Kapitel noch genauer widmen.
Pfeffer
Er muss immer frisch gemahlen sein. Frischer Pfeffer aus einer guten Mühle hat ein hervorragendes Aroma, während gemahlener Pfeffer nach absolut nichts schmeckt – das wäre eine Beleidigung für jedes gute Essen. Eine Pfeffermühle ist ein absolutes Muss in jedem noch so bescheidenen Haushalt. Viele erklären mich für verrückt, wenn ich erzähle, dass ich meine Pfeffermühle sogar in den Urlaub mitnehme (im Übrigen auch meine Parmesanreibe).
Tipp: Zum Auffüllen einer Pfeffermühle verwendet man am besten einen Milupa-Babynahrungstrichter.
Parmesan
Guten Parmesan kriegt man z. B. in der Metro. Je älter, umso besser. Bei uns ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man einen Parmigiano Reggiano nimmt, in Italien dagegen kann man auch durchaus guten Grana kaufen. Ob man den Parmesan mit einer einfachen Käsereibe grob oder mit einer speziellen Parmesanreibe sehr fein reibt, ist Geschmackssache. Entscheidend ist, DASS er ganz frisch gerieben wird. Gerieben gekaufter Parmesan verhält sich etwa so wie gemahlener Pfeffer.
Chilischoten
Kaufen kann man die kleinen scharfen Dinger fast überall, aber wie scharf sie sind, findet man immer erst heraus, nachdem man sie zum ersten Mal ausprobiert hat. Und genaugenommen nicht mal dann, denn jede Einzelne ist unterschiedlich scharf. Aber genau diese Nichtreproduzierbarkeit eines Gerichts macht das Essen interessant. Mal weniger scharf, mal schärfer.
Petersilie
Nördlich der Alpen trifft man überwiegend auf die glattblättrige Petersilie, südlich dagegen findet man hauptsächlich die krause Petersilie. Geschmacklich unterscheiden sich die beiden Sorten nur wenig. Die glattblättrige ist vielleicht etwas intensiver. Dafür lässt sich die krause Petersilie besser aufbewahren. Wenn man das in einem Glas Wasser macht, dann sollte man das Wasser täglich erneuern und gelegentlich die Stängel zuschneiden. Krause Petersilie lässt sich auf diese Art durchaus eine Woche lang frisch halten. Neuerdings sieht man immer öfter Petersilie in Plastikbehältern. In einem modernen Kühlschrank mit einem 0 °C Gemüsefach kann man sie so auch über 2 Wochen aufbewahren. Eine sehr praktische Methode ist auch das Kleinhacken und Einfrieren. Allerdings geht dabei das wertvolle Vitamin K verloren, das in Petersilie reichlich vorhanden ist.
Wenn Sie Petersilie fein hacken müssen, dann fangen Sie um Himmels willen nicht damit an, die einzelnen Blätter abzuzupfen, sonst wird das ein Tageswerk. Nehmen Sie die Seite mit den Blättern in eine Hand (als Rechtshänder in die linke) und die Stängel in die andere Hand. Ziehen Sie dann die einzelnen Stängel etwas zurecht, so dass der Blattansatz des gesamten Büschels etwa auf der gleichen Höhe ist. Schneiden Sie dann an dieser Stelle die Stängel ab, und schneiden Sie, ohne die Blätter loszulassen, einfach bei den Blättern weiter. Natürlich müssen Sie am Ende irgendwann loslassen, wenn Sie Ihre Finger behalten wollen. Wippen Sie nun noch einmal kreuz und quer mit der Messerschneide drüber und fertig ist die fein gehackte Petersilie. Das Ganze darf bei einem Büschel Petersilie maximal eine Minute dauern.
Olivenöl
Über Olivenöl gibt es ganze Bücher. Wichtig ist aber vor allem, dass man immer mindestens zwei Sorten zu Hause hat. Ein billiges kaltgepresstes Olivenöl etwa, wie man es bei Lidl oder Aldi kriegt. Das nimmt man zum Braten, Kochen, Fleisch einlegen usw. Ein anderes Öl zum Braten oder Kochen braucht man nicht. Egal ob Pfannkuchen oder Bratwürste – Olivenöl kann man für alles verwenden. Und wenn jemand behauptet, es würde einen unangenehmen Geschmack hinterlassen, liegt es vermutlich nur daran, dass er minderwertiges Öl verwendet hat.
Für Salate, Dressings usw. dagegen sollte man ein wirklich gutes Olivenöl verwenden. Dieses wiederum sollte man nicht zum Braten verwenden – es wäre die reinste Verschwendung. Mit Butter sollten Sie es übrigens genauso handhaben: Immer zwei Sorten zu Hause haben – eine billige Sorte zum Backen und Kochen, eine gute zum aufs Brot schmieren.
Knoblauch
Das Gerücht, dass man am nächsten Tag stinkt, wenn man am Abend Knoblauch gegessen hat, hält sich so hartnäckig wie die Meinung, dass Olivenöl nicht zum Braten von Bratwürsten oder Pfannkuchen geeignet sei. Fakt ist, man stinkt nicht nach Knoblauch, allenfalls riecht man nach Knoblauch. Stinken tut, wer sich und seine Kleidung nicht wäscht. Und was oft als unangenehmer Knoblauchgeruch verurteilt wird, ist häufig eine unangenehme Körperausdünstung mangels morgendlicher Dusche und frischem Hemd. Generell kann man sagen, dass man beim Verzehr von gebratenem oder gekochtem Knoblauch alle Spuren beseitigt hat, wenn man sich am nächsten Morgen duscht und frisch anzieht. Beim Verzehr von rohem Knoblauch bleiben tatsächlich Spuren, die sich nicht so leicht beseitigen lassen. Beim Ausatmen riecht man das auch noch am nächsten Tag. Aber ehrlich gesagt, muss man niemandem so nahe kommen, dass er das riecht – zumindest niemandem, der das nicht riechen kann.
Knoblauch kann man entweder in kleine Stücke schneiden oder, wie das bei manchen Gerichten empfohlen wird, zerdrücken.
Tipp: Zerdrücken von Knoblauch macht man am einfachsten mit einem Messer, indem man den Knoblauch zunächst fein würfelt, reichlich Salz darüber gibt und dann das Ganze mit der Messerspitze zu einem feinen Brei zermanscht.
Aber Vorsicht: Machen Sie das nicht mit einem Messer, das hinterher noch sehr gut schneiden soll, denn die Salzkörner sind sehr hart und können das Messer stumpf machen. Das klingt etwas mühselig, trotzdem ist diese Methode, den Knoblauch zu zerstampfen, deutlich besser als die Verwendung einer Knoblauchpresse. Der Einsatz einer Knoblauchpresse lohnt sich erst, wenn Sie sehr viele Knoblauchzehen zerdrücken müssen, denn das Reinigen der Knoblauchpresse ist auch für Spülmaschinen immer noch eine Herausforderung. Und die Lösung mit dem Messer und dem Salz geht wirklich sehr schnell.
Es mag vielleicht an meiner Liebe zu diesem Gericht liegen, dass ich die Zutaten als Grundnahrungsmittel bezeichnen würde. Pasta, Parmesan, Olivenöl und Knoblauch dürfen in meinem Haushalt nie ausgehen.
Spaghetti mit Aglio & Olio ist also kein Gericht, bei dem Sie befürchten müssen, am nächsten Tag aufzufallen. Vielleicht tun Sie das, aber dann eher wegen der guten Laune. Ich kann es bis heute kaum eine Woche aushalten, ohne mir diese Leckerei zu gönnen und ich gebe zu, dass ich – als ich noch allein lebte – dieses Gericht auch viermal pro Woche zu mir genommen habe. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal beim Klettern einem flüchtigen Bekannten erzählte, dass ich das jeden Abend essen könnte. Er schaute mich überrascht an und meinte ganz ernst: „Warum nur jeden Abend? Ich könnte das zum Frühstück, zu Mittag und zu Abend essen – sieben mal pro Woche“. So hatte ich meinen Meister gefunden, denn ich könnte es ehrlich gesagt nicht zum Frühstück essen. Und erstaunlicherweise schmeckt mir dieses Gericht nur mit Spaghetti. Alle anderen Nudeln passen dazu nicht.
Im Biergarten
Der Biergarten war für mich schon immer etwas ganz Besonderes. Der Inbegriff von bayrischer Gemütlichkeit. Und tatsächlich reicht die Tradition der Biergärten viele Jahrhunderte zurück. Genaugenommen sind sie wie so viele guten Dinge eine Notlösung oder zumindest aus einer Not heraus entstanden. Schuld war angeblich die bayrische Brauordnung aus dem Jahr 1539, in der festgelegt wurde, dass Bier nur in der kalten Jahreszeit gebraut werden durfte, und zwar genau vom 29. September bis zum 23. April. Über den genauen Grund dieser Regelung ist man sich heute uneinig. In manchen Quellen heißt es, der Grund wäre die zu hohe Brandgefahr beim Brauen im Sommer gewesen. Andere dagegen meinen, es wäre der langsame Umstieg vom obergärigen zum untergärigen Bier gewesen. Weil untergäriges Bier nach dem Sieden stärker abgekühlt werden muss, war das Brauen im Sommer nicht möglich.
Wie auch immer – jedenfalls führte diese Regelung dazu, dass das Bier den ganzen Sommer über gelagert werden musste, denn die Leute wollten ja nicht nur im Winter, sondern vor allem im Sommer Bier trinken. Und um das Bier zu lagern, hob man tiefe Keller aus, die man im Winter mit Eis füllte. Das Eis wurde damals im großen Stil von Seen, Flüssen und sogar Gletschern abgetragen und in die Bierkeller gefüllt. Und als zusätzliche Abschattung pflanzte man über den Bierkellern Laubbäume, vor allem Kastanien.
Doch was haben diese Bierkeller nun mit den Biergärten zu tun? Zunächst noch gar nichts. Das Bier wurde gelagert, um es im Sommer an die Wirte zu verkaufen. Aber auch Privatpersonen konnten sich ihr Bier dort in Maßkrügen abholen. Und weil es im Sommer nicht möglich war, das Bier kühl nach Hause zu bringen, wurde es immer populärer, die frische Maß Bier gleich vor Ort zu trinken. Die Bierkeller wurden zu einem Ort der Begegnung und Gemütlichkeit, und die Brauereien reagierten darauf, indem sie immer mehr Tische und Bänke aufstellten. Das wiederum war natürlich den Wirten ein Dorn im Auge, weil es ihr Geschäft ruinierte, und so machten sie dem bayrischen König Ludwig I. mächtig Druck, er möge diesem Treiben Einhalt gebieten. Der fand einen guten Kompromiss, indem er den Biergärten verbat, Speisen anzubieten.
Heutzutage gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Biergarten und eine eindeutige Definition existiert leider nicht. Viele Menschen sind der Meinung, sie wären im Biergarten gewesen, wenn sie im Sommer bei einem Restaurantbesuch das schöne Wetter genutzt haben, um draußen zu sitzen – auf der Terrasse oder auf dem Platz vor der Wirtschaft, wo sie sich aus der Speisekarte ein Getränk und ein Gericht aussuchen und darauf warten, dass der Kellner es möglichst rasch serviert. Doch für mich hat das wenig mit Biergarten zu tun.
Wenn ich für ein Lexikon den Begriff Biergarten definieren müsste, würde ich das folgendermaßen formulieren: „Ein Biergarten ist ein ruhiger, mit vereinzelten, schattenspendenden Laubbäumen bewachsener Platz, auf dem zahlreiche Tische und Sitzgelegenheiten in Form von Bänken oder Stühlen aufgestellt sind, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Bierausschank gibt, wo man sich sein Bier in einem Maßkrug selbst abholt und seine Brotzeit selbst mitbringen darf.“
Diese Formulierung mag für viele etwas verwunderlich und kryptisch klingen. Zugegeben, sie erinnert ein wenig an Patentschriften. Aber sie enthält für meinen Geschmack alle wesentlichen Bestandteile des Biergartens. Erstens „ruhig“. Eine Wirtschaft, die an einer gut befahrenen Straße ein paar Tische nach draußen stellt, scheidet damit schon mal aus. Ein Biergarten muss im Grünen liegen, muss eine Oase der Ruhe sein. Vereinzelte schattenspendende Bäume könnten auch Fichten sein, aber ein echter Biergartler will auch im Frühling und im späten Herbst bei schönem Wetter draußen sitzen, und da will er eben keinen Schatten. Also können es nur Laubbäume sein. Und sie dürfen auch nicht zu dicht sein – man will ja nicht das Gefühl haben, im Wald zu sitzen.
Warum zahlreiche Tische und Sitzgelegenheiten? In einem Biergarten reserviert man nicht. Da geht man einfach hin und sucht sich einen Platz. Und wenn kein Tisch frei ist, fragt man halt, ob man sich irgendwo dazu setzen kann. Und somit scheiden sogenannte In-Treffs mit 10 Tischen aus – das ist kein Biergarten. Typischerweise hat ein richtiger Biergarten Platz für mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Leute.
Bänke oder Stühle – das ist eine Frage der Lebenseinstellung, des Alters und der Aufenthaltsdauer. In vielen Biergärten findet man nur Bänke ohne Lehne und Tische in Form von sogenannten Biertischgarnituren, manchmal auch Festzeltgarnituren genannt, weil sich genau diese Kombinationen dicht aneinander gereiht in Bierzelten (= Festzelten) findet. Diese Garnituren ermöglichen maximale Flächenausnutzung. Ein Tisch und zwei Bänke haben zusammen eine Fläche von genau 2 m2, mit etwas Abstand 2,5 m2. Da haben im Biergarten 8, im Festzelt sogar 10 Personen Platz. In den Bierzelten werden diese Garnituren auch gnadenlos aneinander gereiht mit nur minimalem Abstand. Im Biergarten ist das undenkbar. Doch auch wenn sie mit großzügigem Abstand aufgestellt werden, ermöglichen diese Garnituren immer noch eine relativ hohe Personendichte. Und sie haben einen weiteren Vorteil: Man sitzt eng und nahe zusammen und kann sich somit gut unterhalten. Sie haben aber auch einen großen Nachteil: Man kann sich nicht anlehnen. Und wenn man mehrere Stunden im Biergarten sitzt, dann wird das für die meisten Menschen irgendwann ziemlich anstrengend. Deshalb bevorzuge ich die Tische mit Stühlen – zumindest wenn man in kleinen Gruppen zusammen sitzen will. Ideal ist es, wenn ein Biergarten beide Möglichkeiten bietet, dann kann man sich je nach Gelegenheit die richtige Sitzmöglichkeit aussuchen.
Und nun zum vielleicht wichtigsten Teil der Beschreibung, „einen Bierausschank, wo man sich sein Bier in einem Maßkrug selbst abholt“. Dass es Bier geben muss im Biergarten, ist wohl für die meisten Menschen noch nachvollziehbar. Dass dieses Bier in Maßkrügen ausgeschenkt werden muss, ist dagegen für viele Leute in Bayern und vor allem außerhalb Bayerns schon nicht mehr so einfach nachvollziehbar. Aber dass man es auch noch selbst abholen muss – Selbstbedienung sozusagen – das verstehen die Wenigsten. Was soll das denn mit Gemütlichkeit zu tun haben, werden Sie sich fragen. Dabei ist es eigentlich nur ein logischer Baustein im ganzen Puzzle. Stellen Sie sich mal vor, wie viele Bedienungen Sie haben müssten, wenn mehrere tausend Leute bedient werden wollen! Und stellen Sie sich einmal vor, wie all diese Bedienungen schnell organisiert werden sollen, wenn es plötzlich an einem Sonntagnachmittag entgegen der Wetterprognose sonnig und warm wird, weil der Fön sich durchsetzt! Und wenn es dann mal andersrum ist, ganz ehrlich: Finden Sie es gemütlich, wenn alle 5 Minuten ein Kellner vorbeiläuft und fragt, ob Sie noch was trinken möchten und Sie schon ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie schon seit 10 Minuten vor einem leeren Maßkrug sitzen? Nein, mit Gemütlichkeit hat das nichts zu tun. Und deshalb kann und darf es in einem richtig gemütlichen Biergarten nur Selbstbedienung geben. Schließlich hat man ja auch deshalb Maßkrüge, damit man eben nicht alle paar Minuten um ein neues Bier laufen muss.
Und noch zu einem ganz wichtigen Baustein: „und seine Brotzeit selbst mitbringen darf“. Das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes in den bayrischen Biergärten und sogar mehr oder weniger gesetzlich geregelt. Der König selbst war es, der im 19. Jahrhundert festlegte, dass die Biergärten keine Speisen verkaufen durften, und die Besucher deshalb nur das essen konnten, was sie selbst mitbrachten. Was damals zum Schutz der Wirte eingeführt wurde, hat sich im Lauf der Zeit zu einem beliebten Brauchtum entwickelt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die einstige königliche Verordnung in die Bayrische Biergartenverordnung von 1999 eingeflossen ist. Gemäß dieser Verordnung handelt es sich nur dann um einen echten Biergarten, wenn die Gäste ihre Brotzeit selbst mitbringen dürfen. Ist das nicht der Fall, kann sich so eine Gastronomie zwar Biergarten nennen, genießt aber nicht die Vorteile desselben, wie etwa die längere Öffnungszeit oder der um 5 dB höhere zulässige Lärmpegel. Im Gegensatz zur königlichen Verordnung dürfen die Biergärten allerdings heute auch Speisen anbieten, und so findet man in guten Biergärten von Spareribs über Hendl bis hin zu Steckerlfisch ein ausreichendes Sortiment an kalten und warmen Speisen. Aber man muss darauf nicht zurückgreifen. Man darf sich seine Brotzeit von zu Hause oder woher auch immer mitbringen.
Und dann gibt es noch eine Besonderheit des Biergartens, die man schwer definieren kann und die vielleicht vielen Leuten auch gar nicht so bewusst ist: Man trifft sich nicht um 18:00 Uhr und wartet dann mit der Essensbestellung, bis alle eingetroffen sind, nein, man setzt sich, holt sich sein Bier, tischt auf und legt los. Und wenn man sich mit jemandem verabredet hat, dann kommt der halt irgendwann, und setzt sich dazu, isst mit, trinkt mit, und wenn einer gehen will, dann geht er. Völlig zwanglos und unkompliziert. Einfach gemütlich.
Und weil ich als echter Biergartler natürlich meine Brotzeit selbst mitbringe, dürfen die wichtigsten Brotzeit-Rezepte hier nicht fehlen.
Obazda
Einen „Obazdn“ oder „Obatztn“ (eine korrekte bayrische Schreibweise gibt es leider nicht) kriegt man in fast jedem Biergarten und sogar in jeder bayrischen Wirtschaft. Er gehört mittlerweile schon fast zum guten bayrischen Brauchtum. Trotzdem sind diese unter „Obazdn“ verabreichten Frischkäsezubereitungen eine Schande für einen verwöhnten Biergartler. Ein Obazda für 2 bis 3 Leute ist wirklich ruckzuck zubereitet. Einmal hab ich einen Obazdn für 20 Leute gemacht und dabei genau auf die Uhr geschaut. Es hat tatsächlich nur 20 Minuten gedauert. Natürlich ist die Menge nicht direkt proportional zur Zubereitungszeit und man kann somit nicht davon ausgehen, dass man die Menge für 2 Personen in 2 Minuten hat. Doch wenn man sein Handwerkszeug beherrscht, dauert es keine 10 Minuten.
Und nun kommen wir zurück zum Zwiebel würfeln, denn das ist der erste Schritt: Schneiden Sie dazu eine Zwiebel der Länge nach durch und entfernen Sie die Schale. Wenn Sie lieber erst die Schale entfernen und dann schneiden möchten, ist das auch in Ordnung, sofern Sie auch die ganze Zwiebel benötigen, denn eine halbe Zwiebel lässt sich nun mal mit Schale besser aufbewahren. Nun nehmen Sie die erste Zwiebelhälfte und schneiden sie – ebenfalls der Länge nach natürlich – in dünne Scheiben. Das geht am besten mit einem großen, sehr scharfen Messer. Aber halt – nicht ganz durchschneiden, denn sonst fallen die Scheiben auseinander. Heben Sie dazu an dem Ende, das Ihnen am nächsten ist, das Messer etwas an, so dass es keinen Kontakt zum Schneidebrett hat.
Jetzt drehen Sie die noch zusammenhängenden Scheiben um 90° und erledigen den Rest. Theoretisch hätten Sie die Zwiebel jetzt in Streifen geschnitten und wäre es z. B. eine Karotte, müssten Sie noch ein drittes Mal mit dem Messer ran, aber praktisch hat die Zwiebel den dritten Schnitt für Sie schon erledigt, weil sie ja aus Schalen aufgebaut ist. Am Ende des zweiten Schnitts fällt Ihnen natürlich das letzte Stück um, aber Sie können es auch in die andere Dimension schneiden – machen Sie dieses Gedankenexperiment doch mal mit einer Kugel.
Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir einmal erzählte, sie hätte in ihrer Ausbildung die ersten Tage immer nur Zwiebeln schneiden müssen, und sie hat es gehasst. Aber dafür hat sie es gelernt. Und weil Zwiebel würfeln für so viele Gerichte nun mal essentiell ist, kann ich Ihnen das nur empfehlen: Lernen Sie es! Lernen Sie es, indem Sie eine große Menge an Obazdn machen und ihre Freunde in den Biergarten einladen.
Das Zweite, was Sie für den Obazdn brauchen, ist Camembert. Der Camembert sollte nicht zu reif, aber auch nicht zu unreif sein. Am besten gelingt der Obazde, wenn der Camembert gerade keine weißen, unreifen Stellen mehr enthält. Doch das ist gar nicht so einfach, denn man kriegt mittlerweile in fast allen Supermärkten nur noch extrem frische Camemberts, die alle noch sehr unreif und weiß in der Mitte sind. Wie also lässt sich das Problem lösen? Das geht einerseits durch genaues Überprüfen des Haltbarkeitsdatums. So wie man beim Kauf von Mozzarella immer diejenigen aussuchen sollte, die das längste Haltbarkeitsdatum haben, so sollte man beim Kauf des Camemberts genau das Gegenteil tun. Suchen Sie immer die ältesten aus! Ein Haltbarkeitsdatum, das 1 bis 2 Wochen in der Zukunft liegt, ist ideal, 3 Wochen geht gerade noch, 4 Wochen ist definitiv zu jung. Eine andere Möglichkeit, den ideal alten Camembert zu verwenden, besteht in der Vorausplanung. Wenn Sie schon genau wissen, wann Sie Ihren Obazdn machen möchten, dann kaufen Sie ihn doch schon zwei Wochen vorher ein! Für einen Biergartenbesuch ist das allerdings etwas schwierig.
Als Drittes schließlich benötigen Sie noch etwas Butter. Und bei einem bayrischen Rezept kann damit nur DER Butter gemeint sein und niemals DIE Butter. Butter ist in Bayern nun mal männlich. Und genau dieser Butter sollte ein guter Butter sein. Nicht einer, den man zum Backen oder Kochen verwendet, sondern der gute Butter, denn man sich auch aufs Brot schmiert.
Doch nun zum genauen Rezept:
1 normalgroße Zwiebel fein würfeln, in eine Schüssel geben und leicht salzen. 2 Crème-Camemberts (je 125 g) grob würfeln, ¼ Butter (60 bis 70 g) grob würfeln. Die 3 Komponenten mit etwas Milch übergießen und alles mit einer Gabel fein zerdrücken – obazn halt. In Hochdeutsch würde vielleicht „zerstampfen“ das am besten beschreiben, dann hätte man aber keinen Obazdn, sondern einen „Zerstampften“. Am Ende noch mit reichlich gemahlenem süßen Paprikapulver würzen und fertig ist die perfekte Biergartenbrotzeit.
Im Original wird statt Milch Bier zum Verdünnen verwendet, was durchaus nicht schlecht schmeckt. Probieren Sie es ruhig einmal aus. Ich persönlich trinke das Bier lieber dazu, weil ich bei Bier – im Gegensatz zu Butter und Olivenöl – keine 2 Sorten zu Hause habe und mir die gute Sorte dafür zu schade ist. Abgesehen davon, schmeckt ein mit Milch zubereiteter Obazda auch am nächsten Tag noch sehr gut, was ich bei der Variante mit Bier nicht behaupten kann.
Neben Obazdn gibt es natürlich weitere Biergartenklassiker, die in den Brotzeitkorb dürfen. So wie z. B. der bayrische oder noch besser der Schweizer Wurstsalat.
Schweizer Wurstsalat
Der Schweizer Wurstsalat hat seinen Namen nicht von der Herkunft seines Rezeptes, sondern von der simplen Tatsache, dass er Käse enthält, und zwar Emmentaler. Und das Emmental liegt nun mal in der Schweiz. Weil aber in Bayern überwiegend Allgäuer Emmentaler gegessen wird, sind sowohl die Zutaten als auch das Rezept des Schweizer Wurstsalats in der Regel rein bayrisch.
Ein guter Wurstsalat braucht etwas Zeit zwischen Zubereitung und Verkostung, weil er „ziehen“ muss. Was genau beim sogenannten Ziehen passiert, kann ich schwer erklären, aber es hat sicher zum einen mit Osmose aufgrund des Salzes und zum anderen mit chemischen Reaktionen aufgrund des Essigs zu tun.
Und ein guter Wurstsalat braucht natürlich vor allem gute Wurst. Als Wurst verwendet man klassischerweise Lyoner, aber natürlich kann man dazu genauso Dicke, Knackwürste, Bockwürste oder sogar Wiener verwenden oder alle anderen Wurstsorten, die eine ähnliche Konsistenz haben. Dass die Wiener gar nicht in Wien erfunden wurden, sondern in Frankfurt (so gesehen haben die Österreicher hier mit Frankfurter die bessere Bezeichnung gewählt) und vielleicht sogar die Lyoner nicht wirklich aus Lyon stammt, ist dabei belanglos. Am besten schmecken all diese Würste, wenn sie sehr mager und gut geräuchert sind. In der Regel kann man das schon an der Farbe erkennen – sie sollte dunkel sein. Falls Sie Zweifel an der Qualität der Wurst haben, probieren Sie erst eine kleinere Menge, bevor Sie sich an die große Portion Wurstsalat wagen.
Schneiden Sie zunächst eine Zwiebel in Ringe oder Halbringe. Dass das genau andersrum geht, wie das Würfeln, erklärt sich eigentlich von selbst. Salzen Sie die Zwiebelringe ein wenig. Häuten Sie nun die Wurst und schneiden Sie sie entweder in dünne Scheiben oder, was mir persönlich wesentlich lieber ist, in Streifen. Streifen ist ein recht schwammiger Begriff. Mathematisch korrekt wäre der Begriff Quader. Schneiden Sie die Wurst in Quader mit den Ausmaßen 0,5 x 0,5 x 4 cm. Dazu schneiden Sie zunächst ca. 4 cm lange Stücke von der Wurst, schneiden diese Stücke dann in Längsscheiben und dann in Streifen. Wenn man Gemüse so schneidet, heißt das Julienne-Streifen. Für 1 Zwiebel würde ich ca. 200 bis 300 g Wurst empfehlen – aber das ist reine Geschmackssache. Schneiden Sie nun von einem Stück Emmentaler ebenfalls solche Streifen. Verwenden Sie dafür nur etwa die halbe Menge wie von der Wurst. Jetzt geben Sie alles in eine Schüssel, salzen und pfeffern kräftig und geben dann etwas Essig-Essenz zu. Nun füllen Sie die Schüssel mit so viel Wasser auf, dass der gesamte Inhalt gerade mit Wasser bedeckt ist, rühren ein wenig um und lassen es stehen. Probieren ist eigentlich fast unnötig – außer dem Essiggehalt können Sie jetzt nichts testen, weil sich der Geschmack erst später einstellt.
Ehrlich gesagt kostet es mich immer wieder eine gewisse Überwindung, die Wurst und den Käse zuerst mit Essig-Essenz zu überschütten und dann das Ganze auch noch in ein Wasserbad zu geben. Aber das Resultat beweist immer wieder, dass dieses Vorgehen korrekt ist. Nach etwa einer Stunde sollte man den fast fertigen Wurstsalat