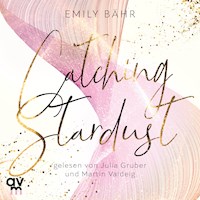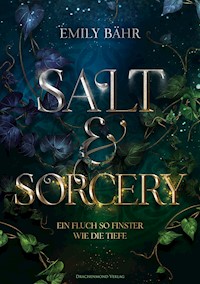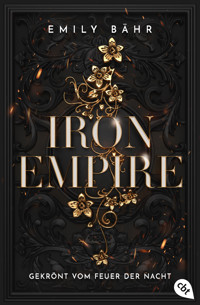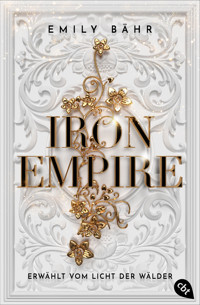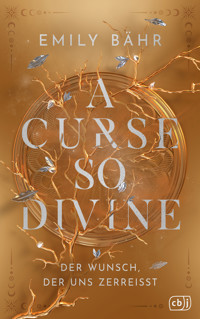
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die A-Curse-so-Divine-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eintausend Stimmen und doch höre ich nur dich ...
Spoiler Alert: Der nachfolgende Inhaltstext enthält Hinweise auf das Ende von »A Curse so Divine, Bd. 1«
Mit der Erkenntnis, dass sie die Welt in ewige Nacht getaucht haben, kehren Ligeia und Apsinthion an die Akademie zurück. Von ihren Schuldgefühlen erstickt, stößt Ligeia den Gott von sich und macht sich wie besessen daran, eine Lösung für den Fluch zu finden. Das Journal ihres Vaters führt sie schließlich auf eine heiße Spur – mitten hinein in das Königreich Euphon. Um endlich Antworten zu finden, lässt sie Apsinthion in der Letzten Stadt zurück. Doch in der goldenen Wüste wird ihr nicht nur bewusst, wie viel zerstörerischer der Fluch wirklich ist, sondern auch, dass sie einen weiteren riesigen Fehler begangen hat …
700 Jahre zuvor: Ein finsterer Gott schenkt der Königin der Menschen einen Wunsch, der den Untergang ihrer Welt bedeuten könnte …
Die mitreißende Fortsetzung der neuen Romantasy-Trilogie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Emily Bähr vereint Starcrossed Lovers, Fake Dating und Forced Proximity mit einem faszinierendem Academy-Setting in einer verfluchten Welt, in der die Nacht niemals endet.
Alle Bände der A-Curse-so-Devine-Reihe:
A Curse so Divine – Die Nacht, die uns verschlingt (Band 1)
A Curse so Divine – Der Wunsch, der uns zerreißt (Band 2)
A Curse so Divine – Der Fluch, der uns befreit (Band 3) erscheint im Frühjahr 2026
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Emily Bähr
A Curse so Divine –
Der Wunsch, der uns zerreißt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Coverkonzeption: Emily Bähr
unter Verwendung mehrerer Motive von © cgtrader (behsam, tspot3d); turbosquid (TopspoT3d, AAArtek); Shutterstock.com (merrymuuu, Murhena, Triff, Cyrustr, Ohishiapply)
FK · Herstellung: AnG
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-32533-6V001
www.cbj-verlag.de
Für Luth
Liebe*r Leser*in,
bitte beachte, dass dieses Buch bestimmte Themen behandelt, die ungewollte Reaktionen auslösen können. Deshalb findest du auf dieser Seite eine Content Note, in der diese Aspekte aufgelistet werden.
Hinweis: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte, daher entscheide für dich selbst, ob du sie lesen möchtest.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen!
Emily und das cbj-Team
Auf dieser Seite findet ihr außerdem ein Glossar mit allen wichtigen Begriffen aus der Welt von »A Curse so Divine«.
Prolog Eternity
Apsinthion, 366 Tage vor dem Fall
»Ab heute atmest du Sternenstaub.«
Ich erinnerte mich lebhaft an die Worte, die die körperlose Stimme des Pantheons mir zugeflüstert hatte, als ich aus dem Nichts erwachte. Eine Redewendung, denn streng genommen musste ich nicht atmen. Genauso wenig schlafen, essen, trinken. All die Belanglosigkeiten, mit denen die Menschen sich am Leben hielten, existierten in der Ewigkeit nicht.
Hier oben, unten, innen, außen, wo auch immer »Hier« war, gab es nur uns. Hatte es stets nur uns gegeben. Und würde es uns geben, bis auch der letzte Stern erloschen war.
Wir waren das Universum.
Wir waren die Unendlichkeit.
Wir waren Götter.
Obwohl wir uns damit brüsteten, das Wissen des gesamten Kosmos in uns zu tragen, gab es Dinge, die sich unserem Verständnis entzogen. Allem voran die Antwort auf die Frage, woher wir kamen. Wer oder was wir davor gewesen waren. Wer wir sein würden, wenn der Stern, an den unser Leben geknüpft war, eines Tages ins Nichts zerfiel.
Es war ein Rätsel. Unsere ganze Existenz. Und es gab niemanden, den wir danach fragen konnten. Vor allem nicht die Menschen. Ganz sicher nicht die Menschen.
Wenn man der jüngste Stern am Nachthimmel war, erinnerten einen die anderen Götter nur zu gern daran, obwohl es keinen Unterschied machte. Unser Wissen und unsere Erfahrungen waren eins. Ich war nicht weniger reif oder weniger klug. Lediglich an einen Himmelskörper gebunden, der erst vor ein paar Jahrhunderten das Licht der Welt erblickt hatte statt wie bei manchen von uns vor Jahrmilliarden. Keine Ahnung, ob sie sich dieses Denken von den Menschen abgeschaut hatten oder ob es einfach in unserer Natur lag, eine Art Rangfolge zu bilden, in der die Ältesten ganz oben standen.
Die meiste Zeit war das kein Problem. Wenn die anderen sich unterhielten, war es, als wäre ich ein Kind, das die Erwachsenen bei einem Thema belauschte, von dem es selbst kaum etwas verstand. Ereignisse aus der Vergangenheit, von denen ich wusste, die ich jedoch nicht selbst miterlebt hatte. Meistens drehten sich ihre Gespräche um Menschen. Vor allem um ihre Kriege. Ihre Konflikte. Um die Finsternis in ihren Herzen, die dafür sorgte, dass wir auch nach Jahrtausenden nicht müde wurden, sie zu beobachten.
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass wir nur dafür lebten. Für die Dunkelheit, an der es uns selbst fehlte.
»Hier bist du.« Euanthes Stimme drang zu mir herüber und riss mich aus dem ruhigen Strom meiner Gedanken. Argwöhnisch öffnete ich die Augen und sah sie an. Wie ich hatte sie menschliche Gestalt angenommen, um mich aufzusuchen. Gleich zwei äußerst ungewöhnliche Umstände. Normalerweise lief sie lieber als Fuchs herum, wenn sie sich einmal in den Astralen Feldern manifestierte. Und normalerweise sprach sie in Gedanken mit mir wie die anderen Götter auch, statt mich in der Einsamkeit meiner eigenen Welten aufzusuchen.
Ich blinzelte ein paarmal gegen den strahlend blauen Himmel an. Dann ließ ich den Baum, an dem ich lehnte, so weit wachsen, dass seine dichten weißen Blätter mir Schatten spendeten.
»Wo sollte ich sonst sein?«
Die Astralen Felder waren unser Zuhause. Eine Welt jenseits der, die die Menschen bewohnten. Eine Welt, in der wir alles sein und alles erschaffen konnten. Aber dieser Teil gehörte ganz allein mir.
Euanthe setzte ein Lächeln auf. »Liebst du die Einsamkeit so sehr, dass du sogar vor deiner Schwester flüchtest?«
»Eher die Stille.« Es war nicht meine Absicht, genervt zu klingen, aber so ganz ließ es sich nicht vermeiden. Obwohl Euanthes Stern im Drachen am weitesten von meinem entfernt war, stand sie mir von allen Göttern am nächsten. Dementsprechend ungerührt war sie von meinen harschen Worten.
»Habe ich dich bei etwas Wichtigem unterbrochen?«
»Nein«, log ich.
»Gut. Die anderen wollen, dass ich dir eine Nachricht überbringe.«
»Gibt es dafür einen Grund? Für die Förmlichkeit?«
»Ja.«
Ich seufzte und lehnte den Hinterkopf an die silberne Rinde des Baumes. Genervt ließ ich meinen Blick über das Fleckchen Land schweifen, das ich mir geschaffen hatte. Ein einsamer Silberdorn auf einem mit aschfarbenem Gras bewachsenen Hügel, umgeben von einem tiefblauen Meer. Die Wellen spiegelten die Farben seiner Blüten. Tiefer und dunkler als der Himmel. In der letzten Zeit war dies mein Platz zum Nachdenken geworden. Umgeben von der Wärme einer namenlosen Sonne und sanftem Wind, der das Gras bog und den Geruch von Vanille mit sich trug. Oder das, was ich mir darunter vorstellte.
Euanthe hatte recht, ich vermied die Gesellschaft der anderen und bevorzugte die Einsamkeit meiner eigenen Schöpfungen. Zumindest, bis ich mich daran sattgesehen hatte und eine neue Welt für mich kreierte. Eine neue Landschaft. Einen neuen Platz, an dem dieselben Gedanken ungebremst durch meinen Kopf rauschen konnten, die mich schon seit Jahrhunderten heimsuchten.
Da keine weitere Erläuterung folgte, fragte ich: »Wenn die anderen mit mir sprechen wollen, warum kommen sie nicht einfach vorbei?« Oder meldeten sich in meinen Gedanken, wie es unter unseresgleichen üblich war. Wozu teilte man sich schließlich ein einziges Bewusstsein, das weder Zeit noch Raum kannte?
»Sie dachten, es wäre besser, wenn ich mit dir spreche. Es ist eine … komplizierte Angelegenheit.«
»Aha.« Widerwillig richtete ich mich auf und sog ein letztes Mal den beruhigenden Duft dieses Ortes ein, ehe Euanthe ihn mit einer einzigen Handbewegung zunichtemachte. Vor meinen Augen zerbrach die Szene in eine Million Glasscherben. Das Singen der Wellen wurde von der erstickenden Leere des Universums verschlungen.
Einen Moment umgab uns Schwärze. Dann entstand aus der Dunkelheit ein neuer Ort, der mich stutzen ließ. Auch wenn ich mich im Vergleich zu den anderen kaum für die Menschen interessierte, war ich vertraut mit den Stätten, die sie uns zu Ehren erbauten. Wir befanden uns in einem perfekten Abbild des Tempels in Aethra. Ein gewaltiger Saal, dessen kuppelförmige Decke aus dunkelblauem Stein von goldverzierten Säulen getragen wurde. Auf riesigen Stufen, die an die Tribünen eines Amphitheaters erinnerten, befanden sich die Statuen aller Götter. Zwei davon fehlten. Meine. Und die von Euanthe. Die übrigen beobachteten uns aus verhüllten Gesichtern und ich wusste, dass sie jedem unserer Worte sorgfältig lauschten.
»Und?«, fragte ich ungeduldig. »Was soll das?«
»Wir haben einen Auftrag für dich.«
I Deterministic Chaos
Ligeia
Das Licht der roten Sonne fiel durch das riesige Fenster hinter dem Thron und tauchte das Podest, auf dem er stand, in ihren blutigen Schein. Stille hatte sich über den Saal gelegt, in der mir mein eigener Puls wie Donnerschläge vorkam. Laut. Viel zu schnell. Panisch.
Ich wusste nicht mehr, was ich fühlte oder dachte. Mein Inneres war ein Strudel aus Dunkelheit. Chaos. Unkontrollierter Energie, die ich mit aller Kraft versuchte, in den Griff zu bekommen, aus Angst mit meiner Magie ein Beben zu entfesseln, das das Fenster einfach zu Staub verwandeln würde.
Ich konnte den König nicht ansehen. Auch nicht Apsinthion. Stattdessen richtete ich meinen Blick geradeaus. Auf die Landschaft hinter dem Thron. Die Felder, Hügel und Berge Magaeas. Leer und verlassen. Kaum mehr als ein Echo, seit ich diese Welt verflucht hatte.
Und das hatte ich.
Ich hatte diese Welt verflucht, hatte sie vor die Hunde gehen lassen, ohne auch nur einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden.
Aus Egoismus. Leichtsinn. Und aus Liebe.
Ich wünsche mir, dass diese Nacht mit dir ein Leben lang anhält. Die Worte brannten auf meinen Lippen, als hätte ich sie eben erst selbst ausgesprochen. Dabei hatte der König die Geschehnisse nur zusammengefasst. Eine lose Rekonstruktion dessen, was sich vor über 700 Jahren zugetragen hatte. Doch mein Verstand war ausgezeichnet darin, seine Erzählung in lebhafte Bilder zu verwandeln wie ein gutes Buch.
Neben mir löste sich Thion als Erster aus der Starre, die uns beide befallen hatte. Er trat an meine Seite, legte mir einen Arm um die Schultern und zog mich an seine Brust. Sanft, liebevoll, während er mir gleichzeitig den Raum ließ, mich von ihm zu lösen, wenn ich das wollte. Zärtlich berührte er mit den Lippen meine Schläfe.
Ich ließ es einfach geschehen, weil ich mich weiterhin nicht rühren konnte. Weil ich nichts mehr verstand. Nicht, wieso ich hier war, wie das hatte geschehen können oder warum er mich immer noch hielt, als wäre ihm nicht gerade eröffnet worden, dass ich der schlechteste Mensch war, der je auf diesem Planeten gewandelt war.
Hatte er nicht zugehört? Hatte er nicht verstanden, was ich getan hatte?
Ich wollte ihn von mir stoßen, weil ich seinen Trost nicht verdiente. Wollte ihn näher an mich heranziehen, weil er alles war, das mich noch hielt. Am Ende blieb ich einfach stehen.
Chaos. So viel Chaos.
Der König räusperte sich. »Wenn ihr Fragen habt, dann …«
»Ja«, fiel ihm Apsinthion, ohne zu zögern, ins Wort. »Einige.«
Keine Ahnung, wie er das bewerkstelligte. Wie er es schaffte, so ruhig, besonnen und gleichzeitig streng zu klingen, während ich mich fühlte, als hätte ich den Kontakt zum Boden verloren. Wie er es schaffte, den König derart herausfordernd zu unterbrechen, während ich vergessen zu haben schien, wie man überhaupt redete.
»Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie euch zu beantworten.«
»Gut. Ich glaube dir nämlich kein Wort.«
Ich wollte ihm widersprechen, schließlich wusste ich es besser. Anders als er spürte ich, dass der König die Wahrheit sagte, aber kein Laut entkam meiner Kehle. Ich konnte mich nur vorsichtig von Thion lösen und die Arme vor der Brust verschränken, während mein Blick wieder zum zinnoberroten Himmel draußen wanderte.
»Bitte?«, stieß der König ungläubig aus.
»Du hast mich schon richtig verstanden: Ich glaube dir kein Wort.« Woher nahm Apsinthion diese Kraft?
»Ich sehe nicht, inwieweit das mein Problem ist«, erwiderte der König unbeeindruckt. »Ich gebe nur das Wissen weiter, das meine Familie seit Generationen bewahrt.«
»Also war deine Familie dabei? Dein Urururgroßvater oder wer auch immer hat alles mitangesehen?« Eine gefühlte Ewigkeit war vergangen, seit ich Apsinthion das letzte Mal derart aufgebracht erlebt hatte. Es war, als hätte er all die Dinge, die ich eigentlich spüren sollte, in sich aufgesaugt, während in meiner Brust nur Leere herrschte.
»Ja«, antwortete der König. »Meine Familie war schon damals im ganzen Land angesehen. Sie gingen am Hof ein und aus, waren enge Berater der Hohekönigin. Einer meiner Vorfahren war dort, als der Mond in jener Nacht verschwand, als ein Beben unsere Zivilisation in Schutt und Asche legte und sich eine rote Sonne aus ihren Trümmern erhob. Er hat alles mitangesehen und das Land aus dem Nichts wiederaufgebaut.«
»Was ist mit den anderen Königreichen?«, wollte Apsinthion wissen. »Euphon. Kyrines. Sie haben ihre ganz eigenen Flüche, oder?«
»Ja und Nein. Sie hatten ihre Wünsche. Wohldurchdachte, selbstlose Wünsche, aber als schließlich die Hohekönigin an der Reihe war, waren ihre Mühen umsonst. Und für ein Vergehen wie ihres, einen derartigen Verrat am eigenen Land, sah die Magie wohl eine besondere Strafe vor.«
Ein Vergehen wie ihres. Ich schluckte. Doch während ich mehr und mehr unter der Last meiner Fehler erstickte, gab Apsinthion keinen Millimeter nach. »Und die anderen Könige kamen nicht auf die Idee, sie aufzuhalten? Keiner von ihnen hat ihre Absichten durchschaut?« Er war wie ein Fels in der Brandung, nur dass auch er bald der Erosion zum Opfer fallen würde. Die Wahrheit war zu mächtig. Egal, wie sehr er sich dagegen wehrte.
»Die Königin hatte wohl eine Schwäche für ihren Dolch.« Mein Herz schien für einen Takt innezuhalten. »Anders wäre sie gar nicht erst ins Amt gekommen. Die übrigen Herrscher hatten keine Wahl.«
Thion schnaubte. »Jemand mit Rückgrat wäre eher gestorben.«
»Jemand mit Rückgrat hätte wegen einer kindischen Schwärmerei nicht unser ganzes Land dem Untergang geweiht. Dass du sie in Schutz nimmst, ehrt dich, Gott, aber es ändert nichts an der Realität. Wir können nicht beeinflussen, wer wir tief in unserer Seele sind. Die letzten 700 Jahre haben das bewiesen.« Er redete über mich, als wäre mein Wunsch, einfach nicht mehr zu existieren, Wirklichkeit geworden.
»Das bezweifele ich«, widersprach Thion, und die Überzeugung in seiner Stimme schürte meine Übelkeit. Die Reue. »Ich kenne Ligeia. Wenn du sie hier und jetzt vor dieselbe Wahl stellen würdest, würde sie sich immer für ihr Land entscheiden.«
»Ist das so, Ligeia?«
Ich spürte den Blick des Königs auf mir. Aus Reflex wollte ich Ja sagen, weil das meine Überzeugung war. Weil ich niemals mein Land für einen Gott verraten würde, egal, wie viel er mir bedeutete. Aber stimmte das? Konnte ich mir da sicher sein? Es war leicht, Dinge zu behaupten, wenn man sie nicht unter Beweis stellen musste. Und vielleicht war ich im tiefsten Herzen genauso verdorben, wie Apsinthion anfangs behauptet hatte. Vielleicht würde ich für ihn jede Grenze überschreiben, wenn ich mich nur lange genug der Angst hingab, ihn zu verlieren.
Als ich nicht antwortete, richtete er das Wort wieder an den König: »Und was willst du jetzt mit uns machen? Uns wegsperren? Uns umbringen?«
»Soweit ich weiß, bist du unsterblich. Und sie zu töten, führt nur dazu, dass sie in zehn, zwanzig Jahren wieder hier steht. Bisher haben meine Vorfahren daraufgesetzt, sie von dir und der Alten Kunst fernzuhalten, aber offenbar sind wir bei dieser Inkarnation zu spät.«
»Warum von mir fernhalten?«
»Weil sie durch dich erst so viel Macht bekommt. Es war ihr Wunsch, der uns beinahe vernichtet hat. Aber deine Magie.«
»Von der jetzt kaum noch etwas übrig ist«, knurrte Apsinthion. »Genauso wie von meinen Erinnerungen. Haben deine Vorfahren dafür auch eine Erklärung?«
»Bis eben wusste ich nicht einmal sicher, ob du überhaupt am Leben bist. Geschweige denn, wo du dich die letzten Jahrhunderte rumgetrieben hast.«
»Ligeia hat mich gefunden. Unter dem Oyranos.«
»Im Sanctum des alten Tempels?« Ich schaffte es nicht, danach zu fragen, von welchem Tempel er sprach. »Seit dem Fall hat niemand es geschafft, die Pforten zu öffnen. Damals wurde vermutet, dass das dein Werk sein könnte. Deshalb auch das Konstrukt, das den Eingang bewachen sollte.«
Sein Blick landete auf mir. Ich spürte es, brachte es aber nicht über mich, meinen eigenen zu heben. Selbst wenn ich es irgendwie durch diesen Tag schaffte, ohne im Meer meiner eigenen Schuld zu ertrinken, konnte ich wahrscheinlich niemandem mehr ins Gesicht schauen.
»Um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen«, fuhr der König nach kurzem Schweigen fort. »Ich nehme an, dass die schiere Belastung der drei Wünsche sogar deine göttlichen Kräfte verausgabt hat.«
»Was nicht erklärt, wie ich im Sanctum gelandet bin.«
»Nein. Aber das ist meine beste Vermutung.«
Wieder Stille und ich konnte weiterhin nur in den roten Himmel starren. Stehen. Warten. Worauf? Darauf, dass ich aus diesem Albtraum erwachte, obwohl ich wusste, dass es keiner war.
Das hier war so viel schlimmer.
»Was jetzt?«, wollte Apsinthion etwas ruhiger wissen. Erneut landete seine Hand auf meinem Rücken. Erneut fragte ich mich, wie er mich überhaupt noch anfassen konnte.
Die Art, wie der König Luft ausstieß, erinnerte entfernt an ein Lachen. »Du scheinst es kaum erwarten zu können, dass ich ein Urteil spreche.«
»Ich habe nur die vielen Geheimnisse satt.«
»Keine Geheimnisse mehr«, versicherte der Herrscher mit sanfter, beinahe entschuldigender Stimme. »Und es gibt auch keine Verurteilung, wenn ihr das befürchtet habt. Ihr kennt jetzt die Wahrheit. Das ist das Wichtigste.«
»Das war alles?«, bohrte Thion irritiert nach.
Jetzt lachte der König richtig. »Ich könnte euch wegsperren, aber ich bezweifele, dass wir damit etwas erreichen. Es war wohl schon in der Vergangenheit unmöglich, euch beide voneinander fernzuhalten. All die Jahrhunderte hat deine Geliebte nach Antworten und damit, ohne es zu ahnen, auch nach dir gesucht.«
Ich frage mich nur immer noch, ob es Schicksal war, dass du mich gefunden hast. Oder Zufall. Ausgerechnet du, wenn es da draußen eine Milliarde Universen gibt. Apsinthions Worte spukten durch meinen Kopf wie ein Geist aus einem vergangenen Leben. So fühlte es sich nämlich an. Als wäre ich heute gestorben und als jemand vollkommen anderes erwacht. Obwohl genau das Gegenteil der Fall war. Ich konnte zwar sterben, aber die Person, die wiedergeboren wurde, war dieselbe. Wieder und wieder dieselbe.
Dieselben Fragen. Dieselben Ziele. Dieselben Gefühle. Vorherbestimmt. Deterministisch. Ganz anders als das Chaos in meinem Inneren.
Ich sollte ihn finden und aus der Tiefe befreien, weil mein ganzes Sein darauf ausgerichtet war. Weil ich dazu verdammt war, dieselben Fehler zu wiederholen. Weil ich ihn liebte. So wie ich es schon vor 700 Jahren getan hatte.
»Daher schlage ich eine konstruktivere Lösung vor«, sprach der König weiter. »Niemand wird gefangen genommen oder in den Kerker geworfen, aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich euch nicht unbeaufsichtigt in die Welt hinausziehen lassen kann. Ihr werdet in der Stadt bleiben und sie nicht verlassen. Getrennt, zusammen, wie es euch beliebt, aber so, dass ich euch im Auge behalten kann.«
»Also doch Gefangene«, stellte Apsinthion grimmig fest.
»Ja und Nein.«
Ich musste es dem König hoch anrechnen, dass er nicht um den heißen Brei herumredete oder versuchte, seinen Vorschlag zu beschönigen. Wenn er nicht wollte, dass wir die Stadt verließen, waren wir Gefangene. Auch wenn ich ohnehin nicht wüsste, wohin wir gehen oder wie wir überhaupt weitermachen sollten.
»Und was erhoffst du dir davon?«
»Sicherheit«, antwortete der König, »die ich meinem Volk schulde, nach allem, was es durchgemacht hat. Ich sehe in euch aktuell keine Gefahr, aber die Vergangenheit hat bewiesen, dass wir nicht vorsichtig genug sein können. Ihr werdet also in der Stadt bleiben und euch regelmäßig im Palast einfinden. Meine Berater würden mich für dieses Risiko verurteilen, aber ich glaube, dass sich uns hier eine einzigartige Chance bietet, unsere Vergangenheit zu verstehen und Fehler wiedergutzumachen.«
Zum ersten Mal rührte sich noch etwas anderes als Leere in meiner Brust: Hoffnung. Nur ein winziger Funke. Ein verschwindend kleiner Lichtpunkt in einem Ozean aus Mitternacht. Aber er reichte, dass ich endlich den Blick vom Himmel abwandte und stattdessen auf die makellos weißen Schuhe des Königs richtete.
»Nur dazu müssen wir zusammenarbeiten«, ermahnte er uns. »Ich teile mein Wissen mit euch. Sämtliche Überlieferungen meiner Ahnen. Ich gewähre euch freien Zugang zur Zitadelle, allem, was die Stadt zu bieten hat, solange ihr im Gegenzug eure Erkenntnisse mit mir teilt.«
»Als Gefangene«, erinnerte der Gott und zum ersten Mal gelang es mir, etwas zu sagen.
»Thion.« Es war nur ein Flüstern. Heiser und schwach. Aber es reichte, dass er eine Winzigkeit vor dem König zurückwich, als hätte ich ihm einen Befehl gegeben. Dabei sollte er meinem Wort nicht folgen, vor allem nicht so bedingungslos. Niemand sollte das.
»Ich bin mir sicher, ihr beide habt einiges zu besprechen«, sprach der König sanft. »Und ihr braucht Zeit, um die Wahrheit zu verarbeiten, daher schlage ich vor, dass wir unsere Zusammenkunft für heute beenden. Geht nach Hause, kommt zur Ruhe, während ich mich um ein paar Formalitäten kümmere.«
Auf dem Boden neben uns war immer noch die Lache aus Aurelius’ Blut, deren Anblick auf dem weißen Quarz sich so tief in meine Sicht eingebrannt hatte, dass ich sie selbst hinter geschlossenen Augen zu sehen meinte. Aurelius. Er hatte dafür bezahlt, was er meinem Vater und Octavius angetan hatte. Hatte seine gerechte Strafe erhalten. Und trotzdem plagten mich die Schuldgefühle.
Wäre ich nicht so egoistisch gewesen, würden sie alle noch leben …
»Solltet ihr Fragen oder irgendein Anliegen haben, könnt ihr mich jederzeit aufsuchen. Die Zitadelle steht euch mit allen historischen Aufzeichnungen offen. Und wenn ich etwas tun kann, lasst es mich wissen. Ich bin nicht euer Feind. Und ich will die Vergangenheit mehr als jeder andere hinter uns lassen.«
Ich nickte abwesend. Thion sagte nichts mehr.
»Ansonsten werdet ihr von mir hören. Ligeia. Apsinthion.«
Danke, Majestät. Wir wissen Euren guten Willen zu schätzen. Die Worte wollten nicht heraus. Als hätte allein Thions Name mich zu viel Kraft gekostet. Stattdessen brachte ich nur ein weiteres Nicken zustande, ehe ich mich abwandte und aus dem Thronsaal lief.
Meine Füße trugen mich. Keine Ahnung wie, aber sie taten es. Durch die hohen Korridore der Zitadelle. Vorbei an schillernd weißen Säulen, goldenen Strebebögen und Centurions. Über den Vorplatz hinweg. Die Treppen hinunter. Durch die Straßen. Durch die Stadt.
Weiter, nur immer weiter, ohne dass ich wusste, wohin.
Ich schaffte es nicht, den Kopf zu heben. Wagte es nicht, irgendjemandem ins Gesicht zu sehen. Aus Reue. Scham. Angst.
Meine Füße schienen der einzige Teil meines Körpers zu sein, der noch funktionierte. Sie trugen mich. Weiter. Immer weiter. Weiter. Und weiter. Aber die größte Stadt des Landes reichte nicht, um genug Abstand zwischen mich und die Realität zu bringen.
Irgendwann zwang mich eine Sackgasse zum Anhalten. Der schmale Pfad entlang der Klippe endete abrupt im Nichts. Nur eine halb zerfallene Balustrade trennte mich vom Abgrund und hätte Apsinthion nicht seine Finger um mein Handgelenk geschlossen, hätten mich meine Füße vielleicht noch weitergetragen.
»Ligeia.« Selbst jetzt ließ er meinen Namen klingen, als würde ich etwas anderes als Abscheu verdienen.
Vor mir fiel der Fels, aus dem Aethra gehauen war, steil in die Tiefe. Eine Wand aus Weiß, an deren Fuß sich die Wellen brachen. Am Grund eingehüllt in Nebel konnte ich zwischen den Furchen vage einen Strand ausmachen, den ich noch nie gesehen hatte.
»Rede mit mir«, flüsterte der Gott über das ferne Rauschen des Ozeans hinweg, doch ich schüttelte den Kopf.
Ich hatte nichts zu sagen. Hatte keine Worte mehr. Der Versuch, zu erklären, was in mir vorging, wäre genauso zum Scheitern verurteilt wie jede der tausend Entschuldigungen, die auf meiner Seele brannten und nichts als Asche zurückließen.
Seufzend verstärkte er den Griff um mein Handgelenk. Trat einen Schritt näher, bis er unmittelbar hinter mir stand. »Dann lass mich dich wenigstens halten.«
Zögernd drehte ich mich zu ihm um. An seinem Hemd, das er vorhin in der Eile falsch zugeknöpft hatte, klebte getrocknetes Blut, das – wenn man es nicht besser wusste – aussah wie schimmernde Farbe. Es erschien mir vollkommen surreal. Vor kaum mehr als einer Stunde hatten wir noch nebeneinander im Bett gelegen in dem Glauben, dass nichts auf der Welt uns etwas anhaben könnte.
Und jetzt …
Und jetzt?
»Schau mich an, bitte.«
Ich konnte nicht. Mein Blick erreichte gerade so seinen Kragen. Danach weigerte sich mein Körper, ihn höher wandern zu lassen. Ich war nicht bereit für das, was ich in seiner Miene sehen würde. In seinen Augen. War weder bereit für Hass und Verurteilung noch für Liebe und Mitleid. Das hatte ich nicht verdient. Genauso wenig wie die Sanftheit in seiner Stimme, als er erneut meinen Namen seufzte.
»Ligeia.«
Ganz langsam, zögernd schloss er mich in seine Arme, drückte mich fest an sich und vergrub das Gesicht in meinen Haaren. Nur kaum merklich lehnte ich mich ihm entgegen, weil mir jeder Hauch Trost, den er mir schenkte, wie eine Sünde vorkam. Dabei sehnte sich gerade alles in mir nur danach. Nach ihm. Seiner Wärme. Der Illusion, dass das hier richtig war, obwohl ich von Anfang an gewusst hatte, dass wir einen Fehler begingen.
»Ligeia.«
Was mache ich jetzt?
»Ich bin hier.«
Was ist passiert?
»Ich lasse dich nicht los.«
Was habe ich uns angetan?
II Generous Gods
Dione, 365 Tage vor dem Fall
Ich vermisste die Stille.
Das war alles, woran ich denken konnte, während die Feier in vollem Gange war. Schon als Kind hatte ich die Esychia gerade deswegen geliebt. Wegen der geisterhaften Ruhe, die sich nach Sonnenuntergang über Aethra legte, sodass man das Gefühl bekam, die Welt atmen zu hören. Doch Punkt Mitternacht war es damit vorbei. Die Lichter der Stadt wurden entfacht und fraßen nicht nur die Dunkelheit und den Winter, sondern auch die Stille. Und danach wurde gefeiert.
Das Volk blieb bis in die frühen Morgenstunden wach. Und nach kurzem Schlaf ging das Fest noch den ganzen Tag weiter, um den Frühling so zu begrüßen, wie er es verdiente.
Und ich saß hier und vermisste die Stille. Genau wie den Winter. Die Kälte. Die langen Nächte unter einem Meer aus Sternen. Nicht den Trubel, den Lärm, die lachenden Gesichter, die mich mit aller Macht daran zu erinnern schienen, wie einsam das Leben einer Herrscherin war.
Es war bitter. Ich war umgeben von meinem Hofstaat, von Gästen und den Königen aus Euphon und Kyrines, die mich immer wieder in lockere Konversation verwickelten, und trotzdem fühlte ich mich allein.
Nach dem Festmahl hatten wir uns zum Ballsaal begeben, wo ich nun mit aufgesetzt heiterer Miene auf meinem Thron saß, der von einem leicht erhöhten Podest den Raum überragte. Die beschwingten Klänge von Leiern, Auloi, Trommeln und Panflöten erfüllten die Luft, eine Einladung zum Tanz, der die Gäste nur zu gern folgten.
Ich beobachtete ihr munteres Treiben, dankbar dafür, dass der Tag bislang so ereignislos verlaufen war. Ich war erst seit zehn Monaten Hohekönigin Magaeas, doch ich hatte rasch gelernt, dass Ereignisse, zu denen die anderen Herrscher und ihr Gefolge eingeladen waren, unvermeidbar unsere Differenzen hervorbrachten.
Die freiheitsliebenden Menschen aus Kyrines warfen den Euphoniern ständig vor, ihre Liebe zum Reichtum würde über alles gehen. Die Leute aus Euphon hatten eine Abneigung gegen die bürokratieliebenden Magaei. Und in unserem Königreich galten die Kyriäer als regellose Barbaren. Es war ein ewiger Kreis aus Vorurteilen, die wir noch immer nicht hatten ablegen können, obwohl wir seit dem Ende der Kristallkriege als gemeinsames Staatenbündnis agierten.
Immerhin heute schienen sie friedlich. Am Rande meines Sichtfelds sah ich Georgios, den König Euphons, zusammen mit Kleitos, dem Herrscher Kyrines’, lachend neben einer der mit Gold besetzten Säulen stehen. Eine willkommene Abwechslung dazu, dass sie sich sonst wegen jeder Kleinigkeit die Köpfe einschlugen.
»Du solltest auch tanzen.«
Erschrocken zuckte ich zusammen. Ich war so in Gedanken versunken gewesen, dass ich nicht bemerkt hatte, wie Pelagios neben mich getreten war. Ein besorgtes Lächeln lag auf seinen schmalen Lippen, das seine Augen nicht ganz erreichte.
»Ich bin mir sicher, unsere Gäste können sehr wohl auf diesen Anblick verzichten.« Es war nicht so, dass ich eine schlechte Tänzerin war, nur ertrug ich den Gedanken kaum, dabei von sämtlichen Anwesenden beobachtet zu werden. Davon hatte ich heute schon genug gehabt.
»Man könnte das als Unhöflichkeit auslegen«, warnte mich Pelagios.
»Wenn ich allen auf die Schuhe trete?«
»Wenn du dich nicht unters Volk mischst.«
Ich seufzte ergeben. Pelagios war der Vizekönig und somit mein oberster Berater und in Momenten wie diesen erinnerte er mich immer wieder daran, wie verdammt unerfahren ich doch war. Ich war mit zwanzig eigentlich zu jung für dieses Amt und die Regeln der feinen Gesellschaft Aethras waren mir so fremd, dass ich dankbar war, ihn an meiner Seite zu wissen. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren.
Geschlagen richtete ich mich auf und strich das fließende violette Kleid zurecht, das ich zur Feier des Tages trug. Feine Edelsteine schimmerten in dem luftigen Stoff, der mir bis zu den Knöcheln reichte, jedoch meine Arme komplett frei ließ. Langsam, abwägend bewegte ich mich auf die Tanzfläche zu und wurde prompt daran erinnert, wer ich war. Alle starrten mich erwartungsvoll an.
Ich versuchte, mich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, als ich mich in die Formation eingliederte, aber es war unmöglich, das feine Prickeln im Nacken zu ignorieren. Meine erste Tanzpartnerin war Kleonike, die Tochter von Kleitos, von der ich wusste, dass sie in meinem Alter war, eine vorlaute Klappe besaß und wenig davon hielt, dass ihr Vater seit Jahren versuchte, sie zu verheiraten. Pelagios hatte mal erwähnt, dass sie sehr belesen war.
Ich erwischte mich bei dem Gedanken daran, dass wir unter anderen Umständen vielleicht hätten befreundet sein können, doch hier und jetzt waren wir in erster Linie Diplomatinnen. Sie hielt gebührenden Abstand zu ihrer Hohekönigin und unser kurzes Gespräch beschränkte sich darauf, ob ich die Feierlichkeiten genoss und wie ihr Aethra gefiel. Danach wechselte die Formation.
Ich tanzte als Nächstes mit einem Herrn aus Euphon, von dem ich meinte, dass er der Schatzmeister der königlichen Familie dort war. Danach mit einem Mann aus Kyrines. Dann mit dem Dekan der Academia. Bis plötzlich jemand vor mir stand, den ich noch nie gesehen hatte. Und damit war ich nicht allein. Während ich getanzt hatte, hatte sich die Sensationsgier der anderen Gäste langsam gelegt, doch jetzt waren ihre neugierigen Blicke wieder präsent. Nur galten sie neben mir auch dem Mann, der in diesem Moment die Hände auf meine Hüften legte, ohne auch nur die Andeutung einer Verbeugung, wie es eigentlich üblich war.
Er begegnete meiner verwirrten Miene mit Amüsement. Ein schmales Lächeln lag auf seinen geradezu unverschämt vollen Lippen, die mir als Erstes an ihm auffielen. Zusammen mit seiner Statur. Es gab nur wenige Leute, die größer waren als ich, dazu war er aber auch noch breit gebaut, sodass ich problemlos in seinem Schatten versinken könnte. Seine goldbraune Haut bildete einen sanften Kontrast zum edlen weißen Stoff seiner Toga.
Am Rande bekam ich mit, wie die Musiker das nächste Lied anstimmten, und während mein Verstand noch verarbeitete, was ich sah, bewegten sich meine Beine und Hüften von allein im Takt. Ich legte die Arme auf die Schultern des Fremden, spürte, wie er mich kaum merklich näher an sich heranzog, und ließ es geschehen.
Im Kopf ging ich die Gäste durch und versuchte, den Mann zuzuordnen. Trotz aller Bemühungen im Vorhinein kannte ich zwar nicht die komplette Liste auswendig, aber zumindest eine Ahnung, wer mein ominöser Tanzpartner war, sollte ich haben. Doch die hatte ich nicht. Der Kleidung nach stammte er aus Aethra. Nur war ich mir sicher, ihn noch nie gesehen zu haben. Die leichte Krümmung seiner Nase war mir ebenso fremd wie die Linie seines glatt rasierten Kinns oder sein zur Seite gekämmtes schwarzes Haar.
»Es tut mir leid«, sagte ich schließlich, »mir muss Euer Name entfallen sein, seit wir einander vorgestellt wurden.«
Sein Mundwinkel hob sich und wieder erwischte ich mich dabei, wie mein Blick genau dort hängen blieb.
»Das könnte daran liegen, dass wir einander bisher noch nicht vorgestellt wurden.« Seine Stimme klang genauso dunkel, wie es seine Erscheinung war. Gleichzeitig weich und irgendwie … verführerisch.
Ich runzelte die Stirn. »Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Jemandem, der unbedingt mit dir tanzen wollte.«
Kaum merklich schluckte ich. Ich spürte, wie Hitze in mir Aufstieg. Nervosität. Aufregung. Und eine Spur Angst.
Ich war die Hohekönigin Magaeas. Ein Fremder war mir so nah, dass es nur eine Bewegung seinerseits bräuchte, um mein Leben zu beenden. So, wie es schon einige versucht hatten.
Doch das hier war eine geschlossene Veranstaltung. Meine Wachen hätten ihn ohne Einladung nicht reingelassen. Und sicher wäre niemand so töricht, der Hohekönigin auf ihrer eigenen Feier etwas anzutun. Ich sollte mir keine Sorgen machen.
Dazu war die Neugier zu groß, das Prickeln auf meiner Haut, das mich sämtliche Warnungen meines Unterbewusstseins ignorieren ließ, zu angenehm.
Dir nicht Euch … Seit meiner Krönung lag ich allen damit in den Ohren, dass ich nichts von Titeln oder höflicher Anrede hielt. Dass ich keine Majestät oder meine Königin war, sondern einfach nur Dione. Doch die meisten ignorierten diese Bitte oder brauchten zumindest lange, ihr nachzukommen.
Aber diesen Mann musste ich nicht dazu auffordern. Beim Pantheon, er hatte sich nicht einmal vor mir verbeugt. Eine Unverfrorenheit, für die ich ihm insgeheim sogar dankbar war.
»Und was verschafft mir die Ehre?«, fragte ich weiter. »Auf dieser Feier gibt es weitaus begnadetere Tänzerinnen als mich.« Und unterhaltsamere …
»Dein Blick.«
»Was ist damit?«
»Du hast ausgesehen, als wartest du darauf, dass dich jemand rettet.«
»Und dieser jemand willst ausgerechnet du sein?«
Er zuckte mit den Schultern. »Zumindest wirkst du jetzt nicht mehr so, als würdest du am liebsten wegrennen.«
Nein, das wollte ich in der Tat nicht mehr. Das konnte ich nicht leugnen. Wenn meine Miene mich nicht verriet, dann auf jeden Fall die Hitze, die sich in meinen Wangen sammelte.
Ich hob das Kinn an, um ihm zum ersten Mal richtig ins Gesicht zu sehen, und hatte plötzlich das Gefühl in flüssiger Nacht zu ertrinken. Seine Augen waren von einem dunklen Blau, das im kühlen Licht der magischen Lampen wirkte, als hätte er die Sterne darin eingefangen. Sein intensiver Blick schien mich festzunageln, während mich der sanfte Druck seiner Hände in eine Drehung führte. Magie schien unter meiner Haut zu fließen, dort wo er mich berührte.
»Darf ich denn wenigstens den Namen meines Retters erfahren?«
Er stieß amüsiert Luft aus, wodurch sein Atem über mein Gesicht strich. Dabei stieg mir sein Duft in die Nase. Blumig, schwer, nach Veilchen und etwas, das ich nicht genau benennen konnte.
»Apsinthion.«
»Wie der Stern?«, bohrte ich überrascht nach.
»Genau. Der Name steht für Bitterkeit.«
»Und bist du das? Bitter?«
Einen Moment wirkte er überrascht. »Manchmal.«
»Da haben wir wohl etwas gemeinsam …«, erwiderte ich, wobei mein Blick über die Menge der Tanzenden glitt, die sich kaum darum bemühten, uns nicht unverhohlen anzustarren. In einer weiteren Drehung verschwamm der Saal mit dem spiegelglatten Boden aus weißem Quarz kurzzeitig zu einem Meer aus Licht.
Keine Ahnung, wieso ich dem Fremden das sagte. Keine Ahnung, wieso ich überhaupt mit ihm redete. Weiter mit ihm tanzte, obwohl ich längst hätte den Partner wechseln müssen. Es war, als würde Gravitation mich an ihn binden. An ihn, an dieses halbe Lächeln auf seinen Lippen, den samtigen Klang seiner Stimme, die für Versprechen gemacht schien, die er niemals würde halten können.
»Welchen Grund hat eine Königin für Bitterkeit?«
Ich erschauderte, als er sanft die Finger an meine Wange legte, um mein Gesicht zurück in seine Richtung zu drehen. Wieder drohte ich zu versinken. Seine ganze Präsenz war wie ein schwarzes Loch, aus dem nicht ein Funke Licht entkam. Auch nicht ich.
»Sicher werde ich meinen Gast nicht mit den Sorgen einer Königin langweilen.«
»Was, wenn er dich darum bittet?«
Seine Hand landete wieder auf meiner Hüfte.
»Warum werde ich das Gefühl nicht los, es mit einem Spion zu tun zu haben?«
Wieder das Lächeln. Ein leichtes Ziehen in meinem Magen. Die schiere Wirkung, die dieser Mann auf mich hatte, sollte mir eine Warnung sein, doch ich hörte nicht auf sie.
»Ich wäre ein bescheidener Spion, wenn ich dich einfach so nach deinen Geheimnissen fragen würde. Aber lass es mich anders formulieren: Wieso will eine Königin von ihrer eigenen Feier davonrennen?«
»Ich wollte nicht davonrennen«, beteuerte ich.
»Aber bleiben wolltest du auch nicht.«
Wollte …
Das nächste Lied begann und noch immer hielt er mich fest. Oder ich ihn. So genau konnte ich das nicht sagen. Die anderen Gäste schienen zu verschwimmen. Aus edlen, tuchartigen Kleidern wurden bunte Schlieren. Die Lichter in den hohen, weiß-goldenen Säulen zu Stäben. Nur der magische Nachthimmel über unseren Köpfen blieb.
Apsinthion, dachte ich, wie der Stern.
»Vielleicht habe ich einfach nur wenig Spaß an solchen Feiern.« Keine Lüge, aber auch nicht die ganze Wahrheit. »Vielleicht ist mir Stille lieber als dieser Trubel.«
»Gibt es das überhaupt, wenn man Königin ist? Ein Leben ohne Trubel?«
»Nein«, gestand ich.
»Was, wenn du keine sein müsstest?«
Ich runzelte die Stirn. »Es ist nicht so, als könnte ich einfach meine Krone absetzen und den Palast verlassen. Ich habe eine Verantwortung.«
»Aber wenn du könntest. Würdest du es dir wünschen?«
Kaum merklich verstärkte er seinen Griff an meiner Hüfte. Er zog mich noch ein Stück näher, sodass ich gar nicht anders konnte, als ihm in die dunklen Augen zu sehen.
Ein Meer aus Sternen, schoss mir durch den Kopf.
»Ob ich mir wünschen würde, keine Königin zu sein?«
»Ja.«
Einen Moment ließ ich den Gedanken zu. Ich konnte nicht leugnen, dass die Vorstellung verführerisch klang. Einfach aufzuwachen und wieder ich selbst zu sein. Ohne die Last eines ganzen Königreichs auf meinen Schultern. Ich könnte studieren. Das Land bereisen. All die Dinge tun, von denen ich ein Leben lang geträumt habe, aber welchen Preis würde ich dafür zahlen?
Würde ich es mir wünschen?
Apsinthion. Wie der Stern.
Mit einem Mal dämmerte es mir. Ich riss die Augen auf, sog scharf Luft ein und der Mann merkte sofort, dass ich ihn durchschaut hatte. Erschrocken wich ich vor ihm zurück. Entzog mich seiner Berührung. Seiner Nähe. Seinem Zauber und verschränkte die Arme vor der Brust. Reflexartig griff ich nach dem Dolch, den ich versteckt unter dem Rock meines Kleides trug.
»Wer bist du?«, stieß ich aus.
Der Tumult ließ die anderen Tanzenden innehalten und die Musiker erstarren. Stille hatte sich über den Ballsaal gelegt und am Rande bekam ich mit, wie Pelagios an meine Seite trat und beschützend die Hand auf meine Schulter legte.
»Du hast deine Königin gehört«, zischte er, »antworte ihr.«
Apsinthions Grinsen wurde breiter. Verriet seine Gedanken, ohne dass er sie aussprechen musste.
Nicht meine Königin.
»Mein Name ist Apsinthion«, antwortete er schließlich verzögert. »Aus dem Sternbild des Drachen.« Wie zur Untermalung seiner Worte fegte eine Welle aus Magie durch den Raum. Knisternd legte sie sich auf meine Haut, brachte die Lampen zum Flackern und die Menge zum Raunen. Der ganze Saal schien zu beben, als plötzlich ein Strahlen seine Erscheinung begleitete, dass seine Dunkelheit dennoch nicht ganz ersticken konnte.
»Und ich bringe euch ein Geschenk der Götter.«
Der Reihe nach fielen die Anwesenden auf ihre Knie. Angestellte. Politiker. Adelige. Selbst die Könige aus Euphon und Kyrines gingen zu Boden, um dem leibhaftigen Gott in unserer Mitte die ihm gebührende Ehre zu erweisen. Nur meine Beine weigerten sich, dem Gott auch nur einen Hauch Respekt entgegenzubringen. Sehr zu Apsinthions Belustigung.
Auge in Auge stand er mir gegenüber. Von seinem Charme eben war keine Spur übrig geblieben. Zweifelsohne ein Trick, auf den ich beinahe hereingefallen wäre.
»Willst du nicht auch auf die Knie gehen, Königin?«
»In meinem Palast kniet niemand vor einem anderen nieder.«
»Das scheint dein Volk anders zu sehen.«
Zorn wallte in mir auf. Niemand sollte über einem anderen Menschen stehen. Keine Königin. Und erst recht kein Gott, dessen Sippschaft uns in der Vergangenheit nichts als Ärger beschert hatte.
»Was willst du von uns?«
Neben mir richtete sich der Vizekönig wieder auf und mit ihm auch Georgios und Kleitos. Wenigstens sie schienen sich an ihre Würde zu erinnern. Der Rest blieb starr in der demütigen Haltung, Unglaube und Schock stand in ihren Gesichtern. Kaum jemand in der Geschichte unserer Welt konnte behaupten, einem leibhaftigen Gott gegenübergestanden zu haben. Es geschah nicht häufig, dass sie uns Besuche abstatteten. Lieber lenkten sie unsere Geschicke aus der Ferne. Weit weg von den Konsequenzen ihrer eigenen Eingriffe.
»Wie gesagt«, antwortete Apsinthion. »Ich bringe Geschenke. Im Namen des Pantheons.«
»Und welche?«
»Drei Wünsche. Einen für jedes Königreich unter dem Banner Anthusias, um eure Fortschritte und eure Errungenschaften zu würdigen.« Aus seiner Toga holte er drei Gegenstände hervor, die mich an Amulette erinnerten. Ineinander verschlungene Zweige aus Gold umrahmten einen silbernen Edelstein. Es waren drei Stück, die reglos zwischen mir und dem Gott in der Luft schwebten, als warteten sie nur darauf, dass ich nach ihnen griff. Aber ich rührte mich keinen Millimeter.
»Drei Wünsche?«, bohrte ich nach.
Apsinthion nickte. »Drei Königreiche. Drei Wünsche. Drei einmalige Chancen, eurem Land zu nie da gewesenem Glanz zu verhelfen.«
»Was, wenn wir ablehnen?« Erneut ein Raunen. Ich spürte deutlich die missbilligenden Blicke von Kleitos und Georgios auf meiner Wange.
Apsinthions Braue schoss irritiert in die Höhe. »Du würdest ein Geschenk der Götter ablehnen?«
»Ein schönes Geschenk«, zischte ich. »Nachdem du eben noch versucht hast, mir mit süßen Worten einen Wunsch zu entlocken. Das sind doch die Bedingungen, oder? Ein egoistischer Wunsch wird zum Fluch. Wie schon bei unseren Vorfahren.«
»Sieh an, du hast im Geschichtsunterricht aufgepasst. Aber ja, das ist richtig. Daher solltet ihr eure Wahl weise treffen und nichts überstürzen.«
Es widerte mich an. Dass er weiter mit schmeichelnder Stimme sprach und so tat, als wäre nichts gewesen. Als hätte er nicht eben versucht, mir eine Falle zu stellen. Wahrscheinlich hätte er die unschöne Kehrseite nicht einmal erwähnt, hätte ich sie nicht zur Sprache gebracht.
Jedes Kind wusste, wie gefährlich Wünsche sein konnten. Sie kannten die Märchen, Sagen, Erzählungen aus unserer Vergangenheit. Von Heldinnen und Helden, deren tiefste Sehnsüchte die Götter gestillt hatten, nur um sie am Ende zu verraten. Wer nicht vollkommen selbstlos und uneigennützig handelte, zahlte den Preis mit einem Fluch.
»Nun?«, horchte Apsinthion nach, nachdem ich eine Weile geschwiegen hatte. »Wie lautet deine Antwort?«
»Die hattest du bereits. Wir lehnen euer Geschenk ab.«
»Das würdest du nicht wagen.«
»Oh doch, das tue ich. Glaub ja nicht, dass ich mich oder mein Volk ins Verderben stürze, bloß weil ein Gott mir etwas von einer goldenen Zukunft verspricht. Das haben deinesgleichen schon so oft getan und schau, wohin es uns geführt hat. Krieg. Krankheit. Hunger. Tod. Wir wollen keinen Wunsch, Gott. Wir brauchen keinen Wunsch.«
Eine ganze Weile starrte er mich an. Unglaube, Zorn und Verblüffung gingen in seinem Blick Hand in Hand. Er wirkte fast so, als würde er mich am liebsten töten und ein Teil von mir fragte sich ernsthaft, warum er es nicht tat. Er war ein Gott. Es reichte ein Fingerschnippen von ihm, um aus mir ein Häufchen Asche zu machen. Ein Atemzug, um mir das Genick zu brechen. Doch ihm musste klar sein, dass er damit nicht weiterkäme. Dass ein solcher Akt der Grausamkeit bloß bestätigte, was wir längst wussten.
Die Götter waren nicht unsere Freunde. Keine Helfer. Keine Verbündeten. Keine glorreichen Lichtgestalten, die uns in den dunkelsten Stunden in die Dämmerung leiteten.
Nein. Die Götter waren kein Heilmittel für all unsere Sorgen. Sie waren das Gift, das unsere Welt verrotten ließ. Die Pest, die das Schlimmste in uns hervorbrachte.
Es gab nichts, was sie uns geben konnten. Nur Lügen.
Ein Räuspern durchbrach die Stille, als Georgios, der König von Euphon, zwischen Apsinthion und mich trat und mir beschwichtigend die Hand auf die Schulter legte. »Was unsere junge Hohekönigin damit sagen möchte, ist, dass wir uns geehrt fühlen, ein derart großzügiges Geschenk von den Göttern zu erhalten.«
Was?
»Das stimmt«, mischte sich Kleitos mit ein. »Wir sind überaus dankbar für diese Chance.«
Ich starrte die beiden finster. Dafür, dass sie derart öffentlich meine Autorität als Hohekönigin untergruben, die ihnen laut Gesetz überstand, müsste ich sie bestrafen. Aber das würde ich nicht tun. Ich war nicht wie meine Vorgänger, skrupellos, herrisch, und das wussten die beiden zu nutzen.
»Dankbar sind wir in der Tat«, versuchte ich dieses Gespräch wieder an mich zu reißen, obwohl das Grinsen des Gottes verriet, dass er genau verstanden hatte, was gerade passiert war. »Aber das bedeutet nicht, dass wir unvorsichtig sein werden, wenn es um eine derart gravierende Entscheidung geht. Da stimmt ihr mir doch zu, oder?«
Die beiden Könige nickten.
»Ich schlage vor, dass wir uns in Ruhe besprechen. Unsere Optionen durchgehen, damit wir am Ende zu einem Entschluss kommen, von dem das ganze Land profitiert.«
»Das klingt äußerst vernünftig«, bestätigte Apsinthion, aber mir entging das warnende Funkeln in seinen Augen nicht.
»Freut mich, dass du das genauso siehst. Du hast doch Zeit, oder?«
»Die ganze Unendlichkeit, wenn es sein muss.«
»So lange wird es hoffentlich nicht dauern.« Ich setzte ein Lächeln auf. »Und bis es so weit ist: Bitte, sei unser Gast. Genieß die Feier und die Annehmlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Ich bin mir sicher, einige brennen darauf, einen echten Gott kennenzulernen, während ich mich mit dem Triumvirat bespreche.«
»Eine Besprechung, der dein Ehrengast nicht beiwohnen darf?«, fragte der Gott scharf und verschränkte die Arme vor der Brust. Aber mich schüchterte er so nicht ein. Auch wenn mir insgeheim klar war, dass ich verdammt gefährlich lebte.
Er war kein Mensch. Er musste meinen Anweisungen nicht Folge leisten. Und mein einziges Druckmittel war meine Macht als Hohekönigin, mit der ich Georgios und Kleitos theoretisch verbieten könnte, sich auf das Geschenk der Götter einzulassen. Doch ich traute ihnen nicht über den Weg. Niemandem. Das Funkeln in ihren Augen verriet, dass sie sich bereits den Kopf darüber zerbrachen, was sie sich wünschen sollten – wenn sie es nicht ohnehin längst wussten. Und ich musste irgendwie sicherstellen, dass wir keinen Fehler begingen, der uns am Ende alles kostete.
Kurz ließ ich meinen Blick über meine Gäste schweifen, von denen einige noch immer knieten. Ein paar murmelten lautlose Gebete. Andere betrachteten mich missbilligend. Wieder andere mit Anerkennung.
»Ich kann dich nicht davon abhalten, unserer Besprechung beizuwohnen«, erwiderte ich schließlich, »aber wie gesagt: Ich möchte dich ungern mit den Sorgen einer Königin langweilen, Gott. Pelagios?«
Der Vizekönig sah mich mit ausdrucksloser Miene an. »Ja?«
»Sei so gut und sorg dafür, dass unser Gast sich hier wie zu Hause fühlt.«
»Soll ich dir nicht lieber bei der Besprechung zur Seite stehen?«
Ich schüttelte den Kopf und legte die Hand auf seine Schulter, in der Hoffnung, dass der sanfte Druck zusammen mit meinem Blick ihm Warnung genug war, dass ich diesen Gott weder in meiner Besprechung noch in der Stadt haben wollte. Seine Ankunft bereitete uns schon jetzt zu viele Probleme. Nicht auszudenken, welchen Schaden er und sein Geschenk anrichten könnten, wenn wir ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen ließen.
»Apsinthion?«, wandte ich mich an ihn, wobei meine Mundwinkel vom aufgesetzten Lächeln wehtaten.
»Ja?«
»Das hier ist Pelagios, der Vizekönig und somit mein Stellvertreter. Er wird dich herumführen und dich den Herrinnen und Herren der Stadt vorstellen.« Ich sah ihm den Protest bereits an, aber ich ließ ihn nicht zu Wort kommen, sondern drehte mich stattdessen zu den beiden Königen um. »Hoheiten? Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Wir haben einiges zu besprechen.«
III Risen in Heresy
Apsinthion, 364 Tage vor dem Fall
Ich hatte mir nie die Mühe gemacht, mir eine eigene Meinung über die Menschen zu bilden. Die meiste Zeit seit meinem Erwachen hatte ich sie und ihre Probleme ignoriert, hatte nur hin und wieder den Erzählungen der anderen Götter gelauscht und selbst kaum das Geschehen auf diesem armseligen Planeten verfolgt.
Sie interessierten mich nicht. Ihr Leben, ihre Sterblichkeit, ihre Existenz. Welchen Einfluss sollten ein paar jämmerliche Gestalten, die an die Endlichkeit gebunden waren, schon im großen Ganzen haben? Was kümmerte es einen Stern, mit welchen Problemen sich der Staub herumschlug? Ich hatte meine eigenen …
Trotzdem war ich hier. Seit Stunden bereits und verstand mit jeder Sekunde mehr, wieso einige von uns die Menschheit verachteten und nur zu gern dabei zusehen würden, wie sie endgültig fiel. Sterbliche waren laut, eigenbrötlerisch, irritierend. Allem voran ihre Hohekönigin, die sich ernsthaft einbildete, sie könnte sich dem Willen der Götter widersetzen.
Aber egal, was sie auch tat. Egal, wie sehr sie versuchte, das Unausweichliche hinauszuzögern, sie würde scheitern. Die Menschen waren egoistisch. Die Könige der anderen Länder, die Gäste auf dieser Feier, sogar sie, auch wenn sie ihre Selbstsucht unter der Fassade der gerechten Herrscherin begraben hatte. Tief in ihrem Inneren sehnte sie sich trotzdem nach etwas. Freiheit von ihren Pflichten. Anerkennung. Liebe. Wahrscheinlich gab es eine ganze Liste an Dingen, die sie begehrte und die wir Götter ihr nur zu gern schenken würden. Ihr und ihrem Triumvirat.
Dione war weniger naiv, als ich vermutet hätte. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, im Vorhinein mehr über sie herauszufinden, und da ich nicht davon ausgegangen war, längere Zeit hier unten zu verbringen, hatte ich die anderen Götter auch nicht nach ihr gefragt. Ich wusste nur, dass sie jung war. Die jüngste Hohekönigin, die die Bevölkerung Magaeas je in dieses Amt gewählt hatte.
Es war mein Fehler gewesen, mir einzubilden, es wäre ein Leichtes, ihr einen Wunsch zu entlocken. Der Versuch hatte ihr Vertrauen in mich von vornherein erschüttert, aber ich ließ mich davon nicht beeindrucken. Nicht von ihr. Die anderen Könige würden sich ihrer Sturheit schon entgegenstellen. Und dann bekamen wir alle, was wir wollten.
Drei Wünsche für die Menschen.
Eine Rückkehr zu den Sternen für mich.
Und Unterhaltung für die anderen Götter, sobald die Gier der Menschen ihren Preis forderte.
Es war perfekt. Ich musste mich nur ein wenig gedulden. Ein wenig … zu lange für meinen Geschmack.
Am Anfang fand ich es noch amüsant. Mich unters Volk zu mischen. Ihre demütigen Blicke, ihre Bewunderung, ihr Wohlwollen dem Gott in ihrer Mitte gegenüber war angenehm. Eine willkommene Abwechslung zu meinem sonstigen Dasein als jüngster Stern am Himmel, doch schon bald wurde ich ihrer überdrüssig. Ihre Gespräche langweilten mich. Ihre Sorgen interessierten mich nicht. Hin und wieder bat mich jemand aus dem Nichts um eine Einschätzung zu einer geplanten Heirat, einer Investition oder der kommenden Ernte, als wüsste ich, wie das alles hier funktionierte. Ich antwortete trotzdem. Zog mir eine Meinung aus den Fingern, um den Eindruck des wohlwollenden Gottes zu verstärken, den ich der Hohekönigin gegenüber gehörig vermasselt hatte, bis ich es irgendwann nicht mehr aushielt.
Es war weit nach Mitternacht, als ich es schaffte, den Vizekönig abzuschütteln und mich aus dem opulenten Ballsaal zu schleichen. Eine der Palastwachen wies mir, ohne zu zögern, den Weg zur Besprechung und es amüsierte mich, welch willenlose Kreaturen diese Menschen im Angesicht eines Gottes doch waren. Keiner hinterfragte mich. Niemand stellte sich mir in den Weg. Und kurz bevor ich die Hand auf die Türklinke legte, drang mir die Stimme der Hohekönigin bereits aus dem angrenzenden Raum entgegen.
»Es hat Jahrhunderte gedauert, aus den Ruinen der Kristallkriege zu unserer alten Stärke zurückzukehren! Wer weiß, ob es überhaupt Rettung gibt, wenn die Götter dieses perfide Spiel gewonnen haben?«
»Völliger Quatsch«, erwiderte der König von Kyrines. »Dass die Götter hinter den Kristallkriegen stecken, ist nichts als eine Verschwörungstheorie.«
»Es ist wissenschaftlicher Konsens. Jeder renommierte Historiker wird dir das bestätigen.«
»Scheiß auf die Wissenschaft. In ihren Büchern können sie gar nicht herausfinden, was einen das echte Leben lehrt. Denk doch nur mal an die Chance, Mädchen, und hab ein wenig Vertrauen.«
»Vertrauen in einen Gott? Sicher nicht, nachdem er versucht hat, mir eine Falle zu stellen.«
»Auslegungssache«, mischte sich der andere König mit ein. »Ihr habt euch kurz unterhalten. Bei einem Tanz noch dazu – da kann man viel in Worte hineininterpretieren.«
Mir entwischte ein Grinsen. Ich konnte nicht behaupten, dass alles nach Plan lief, aber offenbar hatte ich mich in den beiden Königen nicht getäuscht. Sie waren auf meiner Seite. Jetzt mussten sie nur die Dritte im Bunde überzeugen.
Vermutlich wäre es klug, ihrem Gespräch weiter zu lauschen, doch meine Geduld war an ihrem Ende angelangt. Ich war schon viel zu lange hier unten. Und es wurde Zeit, dass ich diesen Auftrag erfüllte.
Im Gegensatz zu den anderen beiden schien Dione nicht im Geringsten überrascht, als ich den Raum betrat. Ein opulentes Arbeitszimmer mit hohen, bis unter die Decke reichenden Bücherregalen. Durch ein Spitzbogenfenster konnte ich einen Teil der Stadt und den fernen Ozean erkennen, in dem sich das silberne Licht des vollen Mondes spiegelte. Ich gab es nicht gern zu, aber die weißen Türme Aethras waren durchaus ansehnlich – vor allem wenn man bedachte, dass sie von Menschen erbaut worden waren.
»Sieh an«, begrüßte mich Dione mit neutraler Miene. »Du überraschst mich, Gott. Ich hätte schon früher mit dir gerechnet.«
Für ihre vermeintlich unbeeindruckte Reaktion auf meine Anwesenheit hatte sie sich einen Funken Anerkennung verdient. Vor allem wenn ich sie mit den besorgten Blicken der anderen Könige verglich.
Der Herrscher Euphons, ein hagerer Mann mit schneeweißer Haut und markanter Nase, die mich an einen Raubvogel erinnerte, räusperte sich. »Wie schön, dass Ihr uns Gesellschaft leistet. Wir haben gerade …«
»Eine Entscheidung getroffen«, fiel die Hohekönigin ihm ins Wort und schoss den anderen einen warnenden Blick zu.
Ich hob skeptisch die Brauen. Danach hatte es eben aber nicht geklungen. Ein lautloses Seufzen kam über ihre Lippen und sie strich sich beinahe fahrig eine Strähne ihres langen braunen Haares hinters Ohr, die sich seit unserem Tanz aus ihrer Flechtfrisur gelöst hatte. Es war offensichtlich, dass sie mit den Worten rang, auch wenn sie sich bemühte, ihrer Stimme einen festen Klang zu verleihen.
»Nach eingehender Besprechung haben wir entschieden, euer Geschenk anzunehmen.«
Na also. Ich setzte ein charmantes Lächeln auf, was sie jedoch nicht beeindruckte. Nicht wie vorhin, als sie während des Tanzes förmlich an meinen Lippen gehangen hatte. Zu schade aber auch.
»Allerdings«, machte sie meine Euphorie bereits zunichte, »ist uns klar geworden, dass wir eine derart schwerwiegende Entscheidung unmöglich über Nacht treffen können. Wie du es selbst gesagt hast: Wünsche sollten weise gewählt und auf keinen Fall überstürzt werden. Wir dürfen nicht nur an uns denken, sondern an das ganze Volk.«
Mir entging der warnende Unterton in ihrer Stimme nicht, der sicher nicht nur mir, sondern auch den beiden anderen galt. Sie trat auf mich zu, die Hände vor dem Bauch verschränkt. Dabei schlug sie die langen Wimpern auf.
»Wir hätten daher gern etwas mehr Bedenkzeit, um sicherzustellen, dass wir die richtige Wahl für unsere Wünsche treffen.«
»Natürlich«, erwiderte ich irritiert darüber, was das Ganze sollte. Wieso sie mir plötzlich so nah war. Und wieso sie auf einmal nicht mehr verunsichert wirkte. »Aber …«
»Die Wünsche können nicht verfallen, oder?«, bohrte sie nach.
»Nein.«
»Also haben wir Zeit, uns darüber Gedanken zu machen.«
»Ja.« Mein Blick blieb ein paar Sekunden zu lange an ihren eindringlichen hellgrünen Augen hängen. Dann an ihrem Lächeln, ehe sie sich abwandte.
»Sehr schön. Dann werden wir morgen früh gleich alles in die Wege leiten, wie es dein Vorschlag war, Georgios.«
Der König Euphons wirkte kaum weniger verwirrt als ich. »Du willst …«
»Herausfinden, was unsere Völker am dringendsten brauchen. Etwas, das wir nicht in den Hauptstädten in Erfahrung bringen können.«
»Du willst dich unters Volk mischen?«, fragte der König Kyrines’. »Ich glaube, Georgios meinte das eher …«
»Als Scherz? Das mag vielleicht die Intention gewesen sein, aber ich finde den Vorschlag tatsächlich sehr einleuchtend. Wir drei bereisen unsere Königreiche, mischen uns unters Volk und lernen Anthusia von innen heraus kennen – nicht von oben herab. Danach fällen wir eine Entscheidung zum Wohle aller.«
Das klang tatsächlich … unerwartet vernünftig, das musste ich der Sterblichen lassen. Sie versuchte, wirklich jede Eventualität zu bedenken. Ich konnte es kaum erwarten, sie scheitern zu sehen, wenn ihr Triumvirat sie betrog oder sie unweigerlich feststellen würde, dass es nichts gab, das wahrhaft selbstlos war. Egal, was die drei sich für ihr Volk wünschten, am Ende würden auch sie als Könige davon profitieren. Genau so, wie wir es vorgesehen hatten.
Nur eine Sache störte mich. »Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich die nächsten Tage …«
»Das nächste Jahr«, verbesserte sie mich. »Ein paar Tage reichen kaum, um die Bedürfnisse unseres Landes zu verstehen.«
»Ein Jahr?! Als ob ich mich dazu herablasse, so lange auf diesem Planeten zu warten.«
»Du kannst in der Zwischenzeit gern zu deinesgleichen zurückkehren und uns nach Ablauf der Frist besuchen. Am Morgen nach der nächsten Esychia im Thronsaal.«
Wütend ballte ich die Hände zu Fäusten. Das konnte ich eben nicht. Aber das wusste sie nicht, oder? Das konnte sie nicht ahnen. Es war, als hätte sie uns Götter belauscht. Als wäre sie uns einen Schritt voraus. Aber das war unmöglich. Sie spekulierte nur. Und das mit viel zu hohem Einsatz.
»Ich bin an den Auftrag gebunden. Solange ich ihn nicht erfüllt habe, bleibe ich auf der Erde.«
Ein Funkeln legte sich in ihren Blick, das beinahe triumphierend wirkte. »Umso besser, dann kannst du mich begleiten.«
»Sicher nicht.«
»Was spricht dagegen? Du wirst wohl kaum ein Jahr lang in der Zitadelle herumsitzen wollen. Und überhaupt scheint dir ebenso viel daran zu liegen, dass wir unsere Wünsche sinnvoll verwenden, wie uns. Dementsprechend wäre ich äußerst dankbar, dich an meiner Seite zu wissen. Ich bin mir sicher, deine Gedanken, werden meine eigenen bereichern.«
Zorn brodelte in mir. Eine Empfindung, die dieser menschliche Körper um ein Vielfaches verstärkte. Hitze stieg in meiner Brust auf. Übelkeit schien mir den Magen zu verknoten und ein Schleier legte sich über mein Denken.
»Was sagen die anderen Könige dazu?«
Entgegen meiner Erwartung positionierten sie sich hinter Dione. In ihren Mienen stand Entschlossenheit. Offenbar hatte ich die Macht dieser Frau gehörig unterschätzt.
»Das Triumvirat hat entschieden«, bestätigte der König von Kyrines und strich sich durch den rostfarbenen Vollbart.
Ich heftete meinen Blick wieder auf Dione. »Was, wenn ich euch die Frist verweigere?«
»Du hast selbst gesagt, dass Wünsche kein Ablaufdatum haben und dass du ›die ganze Unendlichkeit‹ Zeit hast, oder nicht?«
»Eine Unendlichkeit, die ich nicht hier unten verschwenden möchte.«
»Was ich dir nicht verübeln kann. Wie gut also, dass es nur ein Jahr ist.«
In diesem Moment beschloss ich, dass ich die Menschen hasste. Allen voran sie, die Hohekönigin, die es schaffte, jedes meiner Worte zu einer Waffe zu formen und gegen mich zu richten.
»Ich könnte mich trotzdem weigern.«
»Dann müssen wir euer großzügiges Geschenk wohl leider ablehnen.«
Dieses Mal widersprach ihr niemand. Eisern hielten die Herrscher ihre Position an Diones Seite, mit einem Mal genauso unerschütterlich wie ihre Hohekönigin. Unweigerlich fragte ich mich, was sie in meiner Abwesenheit besprochen hatten. Ob sie ihnen vielleicht gedroht hatte. Oder ob die Männer tatsächlich ihrem Urteil vertrauten.
»Schön«, stieß ich aus, als mir keine Widerworte mehr einfielen. »Ein Jahr. Dann trefft ihr eure Entscheidung.«
Wütend stürmte ich aus dem Saal.
Meine Beine fanden von allein den Weg zu einem Balkon, der den Platz vor der Zitadelle überblickte. Dreizehn Centurions waren dort stationiert, menschenähnliche Konstrukte mit Speeren, deren Augen im friedlichen Blau leuchteten. Sofort fiel mir die Kälte auf, die auf meiner erhitzten Haut prickelte. Eine vollkommen neue Empfindung, wie so vieles andere auch.
Trotz unserer beinahe grenzenlosen Macht konnten wir Götter die Brücke zwischen den Sternen und dieser Welt nicht ohne Weiteres überwinden. Es brauchte uns alle als Kollektiv. Nicht nur, um überhaupt die Entscheidung zu treffen, jemanden hierher zu senden, sondern auch, um die nötige Energie zu wirken, diese Reise zu ermöglichen. Magie und ein Auftrag, der sich statt der geplanten Stunden plötzlich auf ein ganzes Jahr erstrecken würde, sollte mir nicht bald etwas einfallen, wie ich die Meinung der Hohekönigin doch noch änderte.
Ein Jahr auf diesem Planeten.
Ein Jahr in dieser Gestalt.
Ein Jahr, in der nur ein Funke Sternenfeuer in meiner Brust schwelte.
Außerhalb der Astralen Felder wirkten meine göttlichen Kräfte anders. Sie waren da. Immer noch bedrohlich und mächtig, weit jenseits der Magie, die wir einst den Menschen geschenkt hatten. Aber sie waren eingeschränkt. Ich konnte mich nicht verwandeln, konnte meine Umgebung nicht nach meinem Willen formen. Himmel, ich konnte nicht einmal mehr mit meinesgleichen kommunizieren.
Die körperlose Stimme des Pantheons, die sonst immer wie ein Flüstern durch mein Unterbewusstsein hallte, war mit einem Mal erstickt. Die Verbindung gekappt. Wenn ich eine Frage hatte, musste ich sie selbst beantworten. Wenn es mir an Wissen fehlte, konnte ich nicht einfach in die bodenlose Quelle des Kollektivs eintauchen, wo die Erinnerung der Sterne aus den letzten Jahrmilliarden gespeichert waren.
Ich war auf mich allein gestellt. Und dabei einem Menschen so ähnlich, dass ich mich selbst anwiderte. Das Gefühl der Kälte, die unter meine Haut kroch. Das Rauschen des Zorns in meinen Venen. Der Gestank dieser Stadt nach Algen und Metall. Auf der Erde und in menschlicher Gestalt war plötzlich alles Hunderte Male intensiver. Weil ich nichts hiervon selbst aus den Erinnerungen des Pantheons kreiert hatte. All die Welten, die ich mir in den letzten Jahrhunderten erschaffen hatte, wirkten verglichen mit meinem kurzen Eindruck dieser wie eine Kopie.
Nein, keine Kopie.
Meine Schöpfungen waren das Ideal, nach dem diese Welt streben sollte.
Und diese hier ein einziger Albtraum.
Lange stand ich auf dem Balkon, ließ zu, dass die nächtliche Kälte bis in meine Knochen sickerte, während ich zu den wenigen sichtbaren Sternen starrte und auf ein Zeichen wartete. Ich selbst konnte die anderen nicht kontaktieren, aber ich war mir sicher, dass sie jeden meiner Schritte genauestens beobachteten.
Ob sie sich über meine Misere amüsierten? Oder blickten sie den Ereignissen des heutigen Abends mit Sorge entgegen? Ihr perfekter Plan, vereitelt von einer sturen Sterblichen.