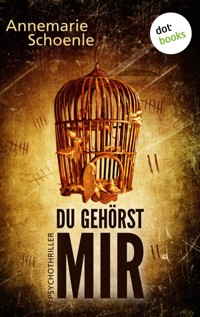Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heitere Frauen-WG statt drögem Familienalltag – entdecken Sie Annemarie Schoenles "Abends nur noch Mondschein" jetzt als eBook bei dotbooks. Marie ist fast 40. Sie hat alles, was frau sich wünscht … oder auch nicht: einen gutaussehenden Ehemann – der sie betrügt –, eine ganz entzückende Tochter – mitten in der Pubertät – und eine fürsorgliche Schwiegermutter – die alles besser weiß. Fast wie gerufen, erbt sie ein altes Haus, packt ihre sieben Sachen und verlässt die Familie. Doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Haus muss renoviert werden, die Erbschaftssteuer fällt auch noch an und so häufen sich die Schulden. Maries Lösung: Untermieter müssen her! Aber bitte nur Frauen, denn das sind sowieso die besseren Menschen. Wenn sich Marie da mal nicht täuscht … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Abends nur noch Mondschein" von Annemarie Schoenle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Marie ist fast 40. Sie hat alles, was frau sich wünscht … oder auch nicht: einen gutaussehenden Ehemann – der sie betrügt –, eine ganz entzückende Tochter – mitten in der Pubertät – und eine fürsorgliche Schwiegermutter – die alles besser weiß. Fast wie gerufen, erbt sie ein altes Haus, packt ihre sieben Sachen und verlässt die Familie. Doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Haus muss renoviert werden, die Erbschaftssteuer fällt auch noch an und so häufen sich die Schulden. Maries Lösung: Untermieter müssen her! Aber bitte nur Frauen, denn das sind sowieso die besseren Menschen. Wenn sich Marie da mal nicht täuscht …
Über die Autorin:
Die Romane Annemarie Schoenles werden millionenfach gelesen, zudem ist sie eine der begehrtesten Drehbuchautorinnen Deutschlands (u. a. Grimme-Preis). Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von München.
Bei dotbooks erschienen bereits Annemarie Schoenles Romane »Frauen lügen besser«, »Frühstück zu viert«, »Verdammt, er liebt mich«, »Nur eine kleine Affäre«, »Du gehörst mir«, »Eine ungehorsame Frau«, »Ringelblume sucht Löwenzahn«, »Ich habe nein gesagt«, »Familie ist was Wunderbares« und die Sammelbände »Frauen lügen besser & Nur eine kleine Affäre« »Ringelblume sucht Löwenzahn & Abends nur noch Mondschein« sowie die Erzählbände »Der Teufel steckt im Stöckelschuh«, »Die Rache kommt im Minirock«, »Die Luft ist wie Champagner«, »Das Leben ist ein Blumenstrauß«, »Dreitagebart trifft Minirock«, »Tanz im Regen« und »Zuckerherz und Liebesapfel«.
Die Website der Autorin: www.annemarieschoenle.de
***
eBook-Neuausgabe März 2015
Copyright © der Originalausgabe 1989 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Atelier Nele Schütz, München, unter Verwendung von shutterstock/pushkin, shutterstock/SiuWing
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-803-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Abends nur noch Mondschein« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annemarie Schoenle
Abends nur noch Mondschein
Roman
dotbooks.
Eins
München, heiter, sechzehn Grad, sagte der Radiosprecher. Und dass Freitag, der Dreizehnte sei, ein herrlicher Maientag mit einem Föhnhimmel, der sich bis ins Gebirge hinein erstrecke, und einem so lauen, verheißungsvollen Lüftchen, dass gar nichts anderes bleibe, als sich und die Umwelt zu lieben und sich voller Elan ins pralle Leben hineinzustürzen.
Marie schepperte mit dem Frühstücksgeschirr, in ihrem Inneren plätscherte sanfte Ironie. Sie wusste nicht, was dem Rest der Menschheit blühte an diesem herrlichen Maientag, was ihr jedoch bevorstand war klar: eine Menge Arbeit zu Hause, eine Menge Arbeit im Büro, eine Warteschlange im Supermarkt und ein angebrannter Apfelstrudel. Weil nämlich im Supermarkt die Warteschlangen immer endlos waren und ihre Strudel immer anbrannten.
»Marie? Ich brauche dringend neue Hemden«, sagte Werner. Werner war ihr Mann und seit Tagen gereizt. Midlife-Crisis offenbar.
»Es gibt Läden, da stapeln sie die Dinger. Man geht hin, sucht sich was raus, bezahlt ...« Das war typisch für Marie. Auch sie war seit Tagen gereizt. Weil überarbeitet.
»Ich habe doch keine Zeit für Einkäufe! Kannst du nicht ...«
»Nein, kann ich nicht. Ich bin Hausfrau. Und Bürofrau. Eine mit Aufstiegschancen.«
»Na! Mein Job dürfte ein bisschen anstrengender sein als deine Tretmühle in der Firma Gottschalk.«
Sein Job, ja, ja! Marie warf Werner einen bösen Blick zu und wunderte sich, dass ihr immer noch gefiel, was sie da sah. Die straffe Haltung, die etwas massigen Schultern, das braune Haar, das an den Schläfen ergraute, die feinen Fältchen um die bernsteinfarbenen Augen – oh, was für Augen! Und was für ein Mann! Einer, der den Erfolg liebte und das Leben genoss und den weder Selbstzweifel noch übertriebene Bescheidenheit anfochten, wollte er etwas erreichen. Und ein Mann, nach dem die Frauen sich umdrehten, Gott sei’s geklagt. Er drehte sich auch sehr oft um. Nach jungen Mädchen. Er war nämlich in dem gewissen Alter.
»Wir können gerne tauschen«, sagte sie. »Ich bleibe immer bis acht Uhr abends an meinem Schreibtisch hocken, und du hetzt nach Hause, kochst das Essen und rufst mich dann an. Dass die Luft rein ist, beziehungsweise die Arbeit erledigt.«
»Sehr witzig.«
»Nicht wahr? Stand früher schon immer in meinen Zeugnissen: ›Maries heiteres Wesen ist sehr zu loben.‹ Also: Ich kann dir keine neuen Hemden besorgen, weil ich total überlastet bin.«
»Dann bemüh dich um einen Halbtagsjob! Oder bleib ganz zu Hause!«
»Warum soll ich meinen Beruf aufgeben und du nicht?« Das leidige Thema. Zu Tode geschunden wie ein alter Ackergaul.
»Nun gut, dann behalte ihn, deinen Beruf. Aber bitte, mache mir keinen Vorwurf, dass du überarbeitet bist.«
Werner zurrte seine Krawatte fest. Es wurde ein höchst ärgerlicher Knoten. »Außerdem hast du noch eine sechzehnjährige Tochter. Lass dir helfen von ihr.«
»Ich nehme an, du sprichst von jenem elfenhaften Wesen, das inzwischen einen Meter fünfundsechzig groß ist, dunkle Locken hat und eine entzückende Figur. Nun, dieser Engel kann nicht helfen. Dieser Engel ist immer unterwegs. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und wenn ich ihn sehe, klappt er seine Flügel zusammen und pennt bis in die Puppen.« Ich rede schon wie meine Mutter früher, dachte Marie erschrocken.
Nun wurde Werner sadistisch. »Ich bringe heute Abend einen Kollegen mit zum Essen«, sagte er.
»Wenn er angebrannten Apfelstrudel mag ...«
»Wir können auch gerne ins Gasthaus gehen.«
»Und mit der Bedienung flirten. Das könnte dir so passen.«
Seine bernsteinfarbenen Augen taxierten sie, abschätzend und kühl. »Wenngleich es natürlich blamabel wäre«, sagte er. »Ich wurde nämlich bei diesem Kollegen erst vor kurzem sehr köstlich bewirtet. Aber du hast mich schon öfters blamiert in letzter Zeit.«
»Ich? Nun sag bloß. Wann denn?«
»Als wir bei meinem Firmentreffen waren, beispielsweise. Du hast eine Diskussion begonnen über unbeschäftigte grüne Witwen und egoistische Weibchen, die sich auf dem Tennisplatz tummeln, während ihre Männer dem ersten Herzinfarkt entgegenkeuchen.«
Marie kicherte. »Es war aber doch sehr lustig. Euer Gewäsch bekam plötzlich Farbe, und der neue Verkaufsleiter geriet in Streit mit seiner jungen Frau. Er nannte sie eine hirnlose Zicke und sie ihn einen Schwächling. Sie ging nach dem dritten Whisky sogar sehr ins Detail, wenn ich mich recht erinnere.«
»Du bist ja schon wieder so witzig.«
»Du weißt genau, dass ich mich an jenem Abend nur gewehrt habe«, sagte Marie beleidigt. »Weil dieser aufgeblasene Pimpf behauptete, jede berufstätige Ehefrau treibe Harmonie und Eintracht aus dem Hause. Harmonie und Eintracht! Klingt wie der Gesangsverein von Hintertupfing.«
»Es war entsetzlich peinlich für mich und auch nicht sehr förderlich. Ich bin Vertriebsleiter und arbeite eng mit ihm zusammen.« Jetzt betrachtete er sie stirnrunzelnd. Als sei sie ein äußerst seltsames Exemplar der menschlichen Rasse, das eigentlich hinter schützende Mauern gehörte und nur zufällig noch so fröhlich und frei herumlief. Er streckt wieder seine Fühler aus nach einer anderen, dachte Marie. Da kriegt er immer diesen starren Blick.
»Ich beeile mich heute Abend«, sagte sie hastig. »Und ich lasse auch keinen Strudel anbrennen. Sondern ein Schnitzel.«
Er nickte gnädig. Mehr nicht. Und Marie spürte, wie ihr Herz bis zum Hals klopfte. Ob er jetzt wieder losging und einer den Kopf verdrehte? Mit seinen grauen Schläfen und den Leopardenaugen und der tiefen Stimme, die immer tiefer wurde, je jünger die Mädchen waren?
»Was ist los?«, fragte Werner.
»Nichts«, antwortete Marie.
Als Angelika Winter mit zwei Koffern und einer großen Umhängetasche aus dem Zug kletterte, der sie von einer kleinen oberbayerischen Stadt nach München gebracht hatte, atmete sie so erleichtert auf, als sei sie mit Mühe und Not einer langen Kerkerstrafe entronnen. Nie mehr wollte sie nach Grabenkirchen zurückkehren. Nie mehr das Geräusch der Schleifmaschinen, der elektrischen Schraubendreher und der Abschmierpressen hören. Nie mehr die dreckigen Monteuranzüge ihrer Brüder waschen. Nie mehr an dem wackeligen Tisch in Vaters Reparaturwerkstatt sitzen, Rechnungen tippen und die anzüglichen Witze über sich ergehen lassen, die in dieser nach Öl und Benzin stinkenden, ausschließlich den Männern vorbehaltenen Welt gediehen wie Champignons im Keller. Und auch Walter Prielmaiers selbstzufriedenes Gesicht wollte sie nicht mehr ertragen müssen, wenn er von Heirat sprach und von Kindern und davon, bald Filialleiter der örtlichen Raiffeisenbank und Vorsitzender des Schützenvereins zu werden.
Sie verstaute ihre Koffer in einem großen Schließfach, kaufte sich einen Arm voller Zeitungen und setzte sich in ein Café.
»Fahr du nur nach München!«, hatte ihr Vater hämisch gemeint. »Nach ein paar Monaten wirst du doch wieder reumütig angekrochen kommen. Einen Mann wie Walter lässt man nicht sausen, bloß weil man Flausen im Kopf hat.«
Die Flausen, die ihn irritierten, waren ihr eiserner Wille, auf eigenen Füßen zu stehen, und ihr Bedürfnis, pro Woche mindestens ein gutes Buch zu lesen und sich stets nach der neuesten Mode zu kleiden. Sie hatte vor zwei Monaten ihr Studium der Betriebswirtschaft mit glanzvollem Ergebnis beendet und vorgehabt, sich in der nächstgrößeren Kreisstadt um eine Anstellung zu bemühen. Doch Walter, der ihr Studium und ihre damit verbundenen täglichen Ausflüge nach München stets mit ironischem Lächeln betrachtet hatte, war mit einem großen Rosenstrauß aufgetaucht und hatte, ihre drei Brüder, den Vater und die Mutter um den festlich gedeckten Kaffeetisch, kundgetan, dass er es unsinnig finde, wenn sie ein paar Monate vor der Hochzeit noch auf Stellensuche gehe. »Wozu?«, hatte er gemeint. »Wenn wir verheiratet sind, wirst du genug Arbeit mit dem Einrichten haben, und später dann ...«
»Und später?«, hatte Angelika ruhig gefragt.
»... gehen wir an eine umfangreiche Familienplanung.« Hätte er sie besser gekannt, hätte er das verächtliche Kräuseln ihrer Lippen bemerkt und zu deuten gewusst. So aber ließ er sich lediglich von Angelikas Mutter noch ein Stück Torte vorlegen und unterhielt sich mit seinen zukünftigen Schwägern über die neuesten Fußballergebnisse.
Angelika plagten keinerlei Gewissensbisse, als sie daranging, Maßnahmen zu ergreifen. Warum auch? Walter wollte sich nicht an die Abmachung halten. Abmachung war gewesen, dass sie nach der Hochzeit berufstätig sein und jederzeit auch eigene Interessen verfolgen konnte. Glaubte er tatsächlich, dass sie gelernt, gebüffelt und nach guten Noten gegiert hatte, nur um sich dann einsperren zu lassen in eine adrette Dreizimmerwohnung, mit adretten Vorhängen und adretten Kinderzimmern, die sich nach und nach füllen sollten wie die Gänge in einem Kaninchenbau? Angelika konnte nur lachen, wenn sie daran dachte. Sie bat eine entfernte Kusine, ihrer Mutter im Haushalt zu helfen, tröstete ihre verheiratete Schwester, deren Mann jeden Abend beim Kartenspiel in der Wirtschaft saß und deren einzige Freude Angelikas gelegentliche Besuche waren, und brachte Vaters Buchhaltung ein letztes Mal in Ordnung. Dann löste sie ihr Bankkonto auf, packte ihre Koffer und sandte Walters Verlobungsring zurück. Ohne jeden Kommentar.
»Ich gehe, weil ich nicht so enden will wie Mutter«, sagte sie kalt. Als ihr Vater ihr eine Ohrfeige gab, sah sie ihn an mit Augen, die so eisig waren wie zwei grüne Bergseen.
»Mach das nie wieder!«, flüsterte sie. Und zu ihren Brüdern gewandt, sagte sie: »Vielleicht könnt ihr in Zukunft ein bisschen mehr Rücksicht auf Mutti nehmen.« Aber sie wusste, dass sie nicht verstanden, was sie meinte. Die Männer ihrer Familie waren so. Die Männer einer Kleinstadt waren so. Wahrscheinlich waren alle Männer so.
Angelika entfaltete eine der Zeitungen und suchte nach dem Annoncenteil. Was sie als Erstes brauchte war ein billiges Zimmer in einer billigen Pension. Und dann einen guten Job. Einen, der Aufstieg garantierte. Sie lächelte. Sie hatte keine Angst. Sie hatte eher das Gefühl, erst jetzt wirklich zu leben.
Die Firma Gottschalk & Co war ein Familienunternehmen in der Metallbranche, das in den vergangenen zehn Jahren rasch expandiert hatte. Es beschäftigte rund tausend Arbeiter und Angestellte und betrieb seit mehreren Monaten schon Verkaufsbüros in etlichen Großstädten Europas. Der Gründer der Firma war längst verstorben, und es waren die beiden Enkel, die nun der Geschäftsführung angehörten und abwechselnd versuchten, ihre oft recht unterschiedlichen Meinungen durchzusetzen. Als Marie an diesem Morgen ihr Büro betrat, wartete die Abteilungssekretärin bereits auf sie.
»Du sollst zur Semmel kommen«, sagte sie unheilschwanger. Die Semmel hieß eigentlich Gerhard Semmering und war Maries Chef. »Irgendetwas geht vor. Ich habe gehört, dass ein neuer Personalchef kommen soll und der alte Franke geht.«
Marie zog ihren Mantel aus und atmete tief durch. Zwar war an manchen Tagen ihr Büro ein ruhiger Hafen, in den sie einlief wie ein im bösen häuslichen Alltag gestrandetes Segelboot. Doch dann wieder glich es einem Hexenkessel mit gefährlich zischender Gerüchteküche, mit mörderischer Hektik und mit Kollegen, die man fast so gut kannte wie die eigenen Angehörigen. Und die einem genauso auf den Wecker fielen.
»Tatsächlich?«, fragte sie lustlos und hängte ihren Mantel auf einen Bügel.
»Du siehst schlecht aus«, meinte die Sekretärin, die alle Welt Miss Elli nannte, weil sie so etwas Mütterliches an sich hatte und ähnlich lange in der Firma war wie die bewusste Ewing-Dame auf der Southfork-Ranch.
»Ich habe Ärger mit Werner«, erwiderte Marie seufzend. »Ich glaube, er schielt schon wieder nach einer anderen. Und in solch kritischen Zeiten nörgelt er nur noch an mir herum.«
»An dir? Du bist doch die Tüchtigkeit in Person! Bist hier Abteilungsleiterin, hast Familie, Haushalt ...«
»Klingt ziemlich trostlos, nicht? Würdest du am Abend gern heimkommen zu einer Tüchtigkeit in Person?«
»Aber früher, als er studiert hat, war es natürlich gut, dass du berufstätig warst und anständig verdientest. Hast du nicht seinetwegen auch das Medizinstudium aufgegeben?«
»Ja. Weil Petra unterwegs war. Und weil nur einer zur Uni konnte im Hause Mangold. Der andere musste arbeiten.« Marie seufzte. »Und als ich dann hier meine Minikarriere startete, war Werner noch ein kleiner Sachbearbeiter und heilfroh über mein zusätzliches Einkommen. Mein Gott, was hatten wir lustige Zeiten! Wir tranken billigen Landwein und kochten jeden zweiten Tag Spaghetti, und unsere Freunde wurden noch nach Sympathie ausgewählt. Und nicht danach, ob sie nützlich waren ...« Sie zuckte die Achseln. »Jetzt aber ist Herr Mangold auf dem besten Weg, Karriere zu machen. Eine viel größere natürlich als ich, da er ja einen akademischen Grad besitzt. Und nun guckt er sich um in den anderen Managerhaushalten, und was sieht er? Er sieht Frauen, so samtweich wie Katzenpfoten, sie gehen vormittags shoppen, verbringen ihre Zeit beim Friseur, im Fitness-Studio oder in der Sauna, sie sind gestylt, charmant, gepflegt und vollkommen hirnlos. Sie würden einen Schreikrampf kriegen, solltest du ihnen zumuten, einen Pullover oder eine Hose ohne das entsprechende Etikett zu tragen, und bei den Theaterpremieren verstehen sie nur etwas vom Champagner, der in der Pause ausgegeben wird.«
»Wohingegen du auch billiges Brausewasser trinkst und von der Stange kaufst.«
»Amen.« Marie grinste. »Und auch mein Ton passt ihm nicht mehr, meine rüde Art. Ich bringe ihn ständig in Verlegenheit. Werde bei der Hausarbeit renitent. Ist das nicht ungezogen von mir?«
»Und warum spielst du nicht auch Kätzchen im Lacoste-Look und gehst in die Sauna, anstatt dich hier abzurackern?«
Marie sah Miss Elli nachdenklich an. »Ja, warum? Weil ich meine Unabhängigkeit liebe? Ich bin nicht unabhängig. Ich habe nicht einmal ein eigenes Bankkonto. Und wenn ich alleine zum Essen gehen müsste, würde ich meinen Teller nicht finden vor lauter Verlegenheit. Zum Teil ist es Gewohnheit. Zum Teil das Gefühl, Kontakt zu halten mit ... draußen.« Sie lächelte. »Eines ist gewiss: Solltest du es je wagen, einem Mann vorzuschlagen, er möge von heute auf morgen seinen Beruf aufgeben, um sich der Familie zu widmen, würde er dich betrachten wie eine total Bekloppte.«
»Leb doch einfach mal eine Weile allein!«
»Spinnst du? Ich habe eine Tochter.«
»Na und? Sie ist sechzehn. Wird Zeit, dass sie ein bisschen selbstständig wird. Ich halte überhaupt nichts von diesen neuen Nesthockern, die bis dreißig bei Muttern wohnen und sich bedienen lassen.«
»Das verstehst du nicht«, sagte Marie schockiert.
»Oh, ich versteh’s schon, nur du nicht, wie mir scheint. Und wie wär’s mit einer Haushaltshilfe? Könnt ihr euch doch spielend leisten.«
»Nein. Unser Geld wandert in eine Bausparkasse. Werner spart auf ein Haus. Er will einen Bungalow, zum Repräsentieren.«
»Und du?«
»Ich?« Marie sah aus dem Fenster. Weiße Wölkchen schwammen am Himmel, Kastanienbäume beschatteten den bepflasterten Weg, der ein paar Werkshallen miteinander verband. »Ich möchte einfach nur leben«, sagte sie. Lachte. »Und weißt du, was ich noch möchte? Mich verlieben. Abheben. Flügel kriegen. Komisch, nicht? Wenn man bedenkt, dass ich in zwei Monaten vierzig werde?«
»Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass du verheiratet bist«, antwortete Miss Elli, und Marie wurde rot.
Gerhard Semmering war ein kleiner, fülliger Mann, dessen dünnes Haar quer über seinen Schädel gezogen war und dessen Miene sich nur dann aufheiterte, wenn er Grund zur Schadenfreude hatte. Heute war so ein Tag.
»Bitte nehmen Sie Platz, Frau Mangold!«, sagte er und schob Marie einen Stuhl zurecht. Er verzog seine feucht glänzenden Lippen zu einem höflichen Lächeln. Er mochte Marie nicht. Er mochte überhaupt Frauen nicht, die es im Berufsleben zu etwas brachten. Frauen taugten in seinen Augen bestenfalls noch zur Sekretärin, weil eine gut funktionierende Sekretärin etwas Dienendes hatte. Marie aber hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie ehrgeizig war und sich durchsetzen konnte, und Gerhard Semmering verspürte wie alle schwachen Vorgesetzten großes Unbehagen beim Anblick weiblicher Wesen, die Verstand und Charme benützten, um etwas mehr zu werden als eine moderne Geisha am PC.
»Unser Personalchef, Herr Franke, wird in den vorzeitigen Ruhestand treten«, sagte er. »Die Position ist momentan kommissarisch besetzt von Herrn Direktor Gottschalk, bis feststeht, wer Nachfolger von Herrn Franke wird.«
»Hat man eine Ahnung, warum Franke geht?«
Semmering sah an ihr vorbei. »Ich nehme an, er geht aus Gesundheitsgründen.«
»Das dürfte die offizielle Version sein.«
»Nun ...« Auf seinem Hals zeigten sich rote Flecken.
Eher stirbt er, dachte Marie respektlos, bevor er zugibt, dass ein leitender Angestellter an die Luft gesetzt wird, was dem Einverständnis gleichkommt, dass er nicht so tüchtig oder so rigoros war, wie man sich das vorgestellt hatte. »Hängt es vielleicht damit zusammen, dass an Personalreduzierung gedacht wird und Herr Franke ein paar der Entschlüsse nicht mittragen will?«
»Das entzieht sich meiner Kenntnis. Meine Aufgabe war nur, Sie in meiner Eigenschaft als Bereichsleiter zu informieren. Eine innerbetriebliche Mitteilung in dieser Sache erfolgt nächste Woche.« Das Gespräch war beendet.
Marie erhob sich. »Tja«, sagte sie süffisant. »Dann wird nun als Nachfolger wohl ein Mann mit der nötigen Konfliktakzeptanz und der Mentalität eines Bluthundes eingestellt werden. Man weiß ja, wie so etwas geht.«
Semmering schwieg. »Ach, übrigens«, sagte er dann. »Die Chefin vom Dienst, Frau Kaffke, hat mich informiert, dass Frau Lorenz gestern unentschuldigt fehlte und auch heute noch nicht zur Arbeit erschienen ist. Sie wissen davon?«
Marie nickte.
»Nun. Wir werden wohl um eine schriftliche Abmahnung nicht herumkommen. Wenn Sie so gut sein würden, sich darum zu kümmern ...«
»Muss es denn gleich ein so offizieller Schritt sein?«, fragte Marie zögernd.
In Semmerings Augen schlich sich ein schwacher Triumph. Er kannte Maries Scheu, schriftliche Beschwerden an die Personalabteilung zu geben. »Ja, das muss sein. Wo kämen wir hin, wenn jede unbedeutende Tippse hier machen könnte, was sie will?«
Die so Geschmähte und als unbedeutende Tippse bezeichnete Hanna Lorenz lag zu diesem Zeitpunkt noch im Bett und starrte mit weit offenen Augen zur Decke. Seit zwei Jahren wohnte sie schon bei Joe Parker, in einem Haus, dessen schäbige Eleganz nur sehr romantische Gemüter atmosphärisch fanden und dessen verwinkelte Wohnungen dringend einer Renovierung bedurften. Hanna besaß ein romantisches Gemüt; ihr gefiel es bei Joe. Im Wohnzimmer stand ein altes Cello, das der Vormieter untergestellt und nie mehr abgeholt hatte, und in der Küche ein gemütlicher Kachelofen. In dessen schachtförmige Öffnung schob Hanna immer Töpfe mit Speiseresten oder Brot oder Schüsselchen mit Rahm. Der Kachelofen erinnerte sie an ihre Kindheit in Travemünde und das Cello an ihren Großvater, bei dem sie aufgewachsen war. Joe lag neben Hanna und schnarchte. Er war ein untersetzter Mann, gebräunt, schwer, mit muskulösen Armen und einem dunklen Bart, der sein Gesicht einrahmte und es runder erscheinen ließ, als es war. Joe war fünfundvierzig Jahre alt, ein Jahr jünger als Hanna. Er wurde in Freundeskreisen »Hemingway« genannt und arbeitete an einem Buch, den »Memoiren des Joe P.« Ansonsten war Joe Versicherungsvertreter. Aber darüber sprachen beide nie. Hanna gähnte. Nur sehr verschwommen dachte sie an die Firma Gottschalk & Co, in der sie seit einem Jahr arbeitete und deren grau verputzte Jugendstilgemäuer ihr immer vorkamen wie eine ganz besondere Art von Gefängnis. Mit der kleinen Besonderheit, dass die Gefängnisordnung Arbeitsvertrag hieß und das Wachpersonal Vorgesetzte. Aber Hanna betrachtete ihre Tätigkeit als Schreibkraft sowieso nur als vorübergehenden Zustand. In Wirklichkeit sah sie sich anders: als kreativen Menschen, den nur eine Kette misslicher Umstände und Schicksalsschläge dazu verdammt hatten, mit Realitäten konfrontiert zu werden, die ihr Leben zu einem Labyrinth aus Irrwegen machten. Aber am Ende, hinter der letzten Hecke, so viel war gewiss, stand eine kleine rosenbekränzte Bank. Und auf dieser Bank saß ihr Traummann. Ihr Märchenprinz, der sie dem Grau des Alltags enthob, sie verwöhnte und auf Händen trug. Und der mit ihr nach Paris ging. Denn Hanna malte. Aquarelle. Leuchtende Farben, vorwiegend azurblau, tizianrot und ockergelb.
Als sie die Küche betrat, fielen Sonnenstrahlen in den dunklen Schacht des Kachelofens. Es musste also schon spät sein, zehn Uhr vormittags vielleicht. Die tüchtige Marie Mangold, ihres Zeichens Gefängniswärterin der Anstalt Gottschalk, und die olle Kaffke, Chefin vorn Dienst und Stiefelweib, würden kräftig Ärger machen. Die eine, indem sie ironisch die Augenbrauen hob und mit sehr kühler Stimme sehr kühle Dinge sagte. Die andere, indem sie keifte und aus ihrem bösen Mund gallebittere Worte bellte. »Nur keine Aufregung, people!«, murmelte Hanna in dem Versuch, sich selbst zu beruhigen. Doch sie fühlte sich unbehaglich.
»Ist Brot da?«, fragte Joe und schlurfte ins Zimmer.
Hanna warf zwei Teebeutel in eine schmutzige Kanne. »Wenn du welches geholt hast ...«
Sie sah eine kleine Ader auf Joes Stirn pochen. In letzter Zeit wurde er immer so schnell gereizt. Genau genommen, seit er Agnetas Brief erhalten hatte.
»Könntest du vielleicht irgendwann einmal den Saustall hier ein bisschen aufräumen?« Joe blickte sich angewidert um.
»Künstlerisch begabte Menschen neigen eben zur Unordnung.«
Hanna sagte es in leicht ironischem Ton, um anzudeuten, dass sie sich selbst nicht so ernst nahm. Und sie vermied es, Joe anzusehen. Denn ihr großflächiges Gesicht mit den blauen Augen und den schwarzen Augenbraven wirkte, da sie noch nicht geduscht und sich zurechtgemacht hatte, schlaff und müde, und die Fältchen um ihre fein gezeichneten Lippen verliefen wie feine Sprünge bis hin zu Kinn und Wangen.
»Du bist nicht unordentlich, du bist schlampig. Ich hab noch keine Frau getroffen, die so schlampig ist wie du.«
»Agneta war natürlich ein Engel gegen mich.«
»Agneta hatte immer alles tipptopp.«
»Sie hatte nur einen Fehler. Sie ist mit einem griechischen Gott durchgebrannt. Obwohl sie deine Frau ist.«
Das hatte gesessen. Joe starrte sie wütend an. »Sie kommt zurück«, sagte er langsam. »Sie hat mir geschrieben.«
»Ich weiß.«
»Soll das heißen, du hast meine Post durchstöbert?«
»Der Brief lag ganz offen auf dem Küchentisch.«
»Nun gut. Dann weißt du, was drinsteht. Sie hat Sehnsucht.«
»Nach Deutschland. Das stand drin. Von dir hat sie kein Wort geschrieben.«
»Weil ich zwischen den Zeilen lesen kann.«
»Ich auch. Und ich denke, Agneta ist Pleite, und ihr Galan hat die Nase voll von ihr.«
Als er schwieg, warf sie ihm einen liebevollen Blick zu und fragte: »Willst du ein Tässchen Tee?«
»Aus dieser Dreckskanne? Nein, danke.« Er stieß einen Stuhl mit dem Fuß zur Seite und ging aus dem Zimmer. Hanna blickte ihm kopfschüttelnd nach. Dieser Joe. Er hatte eine Krise, wahrhaftig. »Ich werde ein paar Semmeln auf den Toaster legen!«, rief sie ihm nach. Und sie beschloss, heute nicht mehr ins Büro zu gehen. Weil Joe sie brauchte. Und weil es sich sowieso nicht mehr rentierte, jetzt, wo die Sonnenstrahlen schon das ganze Zimmer durchfluteten.
In der Kantine diskutierte man die brennende Frage, warum sich Frauen mit vierzig bereits auf der Schwelle zum Greisentum, gleichaltrige Männer jedoch in ihren besten Jahren befanden. Marie schwieg verdrossen. Sie empfand das Gespräch, zwei Monate vor ihrem vierzigsten Geburtstag, als äußerst rücksichtslos. Bevor sie in ihr Büro zurückkehrte, suchte sie einen der Waschräume auf. Die Fenster waren weit geöffnet, aus den Werkshallen drang Lärm. Marie stellte sich vor einen der großen Spiegel und betrachtete sich. Sie war mittelgroß, schlank, hatte dunkle Locken, die ihr in die Stirn fielen und die Ohren bedeckten, und ein rundes Gesicht mit einer pfirsichfarbenen Haut, vollen Lippen und hellgrauen Augen. Die Augen waren das Schönste an ihr. Mariechen mit dem hellen Blick, hatte Werner früher immer gesagt. Ach ja. Früher. Der Urlaub in Irland fiel ihr ein und der alberne Zigeunerwagen und der alte Klepper, der ständig Werners Zigaretten fraß. Mariechen mit dem hellen Blick ... Sie trat an eines der großen Fenster und stützte ihren Kopf in beide Hände. Ein Hüne von Mann, dessen rotblondes Haar in der Sonne glänzte, kletterte aus seinem Sportwagen, band eine Krawatte um, zog ein Jackett an, nahm seine Aktentasche und strebte dem Eingang zu. Marie beugte sich weit hinaus, weil es so spaßig war, dass einer sich auf der Straße anzog, und da schaute er zu ihr herauf und grinste. Maries Kopf fuhr zurück, und sie trat gegen ein kantiges Wasserrohr. Es tat teuflisch weh.
Als sie zum Lift humpelte, begegnete ihr der Hüne. Er sah aus wie ein Baseballstar, den die Jahre nicht verschont hatten. Wie ein Germane, der die Streitaxt schwingt. Große Nase, gescheite Augen, ein eher grobes Gesicht.
»Nun sagen Sie bloß, mein Anblick hat Sie so aus den Pantinen gehoben, dass Sie gleich humpeln müssen?«
Marie lachte. »Warum haben Sie sich erst auf der Straße die Krawatte umgebunden?«
»Ich habe was gegen Krawatten. Aber ich muss ins Personalbüro. Zeigen Sie mir den Weg?«
»Dritter Stock, zweite Tür links.«
»Ich glaube kaum, dass ich das finde.«
»Sie sehen nicht so aus, als würden Sie schluchzend die Flure entlanglaufen und dann irgendwo um Einlass betteln.«
»Nein? Wie sehe ich denn aus?«
»Wie einer, der die Tür eintritt. Wollen Sie sich vorstellen hier?«
»Ja. So in etwa.«
»Wie alt sind Sie?«
»Wie bitte?«
»Na, ich schätze Sie auf Mitte vierzig. Sie werden kein Glück haben. Wir kriegen einen neuen Personalchef, er soll eine Verjüngungskur starten für dieses ehrwürdige Unternehmen. Eingestellt werden nur noch Frischlinge von der Uni. Die sind so schön doof und billig.«
»Ich versuch’s trotzdem«, entgegnete er heiter. »Und ich bin erst ein paar Monate über vierzig.«
»Sie sehen aber älter aus«, sagte Marie und humpelte den Flur hinunter.
Am nächsten Tag, es war Samstag, fand Marie das Schreiben von Dr. Beisele, Rechtsanwalt und Vermögensverwalter, vor, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre vor zwei Monaten verstorbene Patentante Bibiane Barras ihr Haus in der Rotkehlchenallee mit sämtlichem Inventar »der lieben Marie, dem einzigen Menschen, der sich um mich gekümmert hat«, vermacht habe. Auflage und Bitte sei lediglich, Dackel Isidor, der momentan in einer Tierpension sein Dasein friste, zu sich zu nehmen und bis zu seinem Tode zu hegen und zu pflegen.
Marie erinnerte sich ihres letzten Besuches bei Bibiane, an ihr müdes Lächeln, die heisere Stimme, die taubenrunden Augen, mit braunem Lidstift umrandet, grotesk, bemitleidenswert, der Versuch einer alten Frau, Attraktivität hineinzumalen in ein Gesicht, das aufgedunsen war, blass und krank. Und an die weichen Hände, die nach den ihren griffen. »Lass dich nicht so ausnützen, Marie! Zeig einmal Zähne! Deine lausige Familie ist dich gar nicht wert.« Und nun hatte sie sie zur Alleinerbin eingesetzt. Marie war viel zu traurig, um sich freuen zu können.
Sie erzählte Petra von Dr. Beiseles Brief. Und Petra sagte: »Ist doch prima. Du kannst das grässliche Mausoleum verscherbeln. Die Lage ist sowieso beschissen. Wer will schon wohnen in der östlichen Peripherie, wie es so schön heißt?«
»Die Rotkehlchenallee liegt in einem netten alten Viertel. Und das Haus in einem netten alten Garten.«
»Aber denk doch bloß, was allein das Grundstück Kies bringt. Da kann man schon verschmerzen, dass der alte Kasten abgerissen wird.«
»Bibiane hat mir das Haus sicherlich nicht vermacht, damit ich es abreißen lasse.«
»Was willst du denn sonst machen? Vermieten? Zieht doch kein Aas ein in diese Gruft. Hat man ja Angst, dass Bibiane darin zur Geisterstunde herumspukt.«
»Bitte, Petra. Rede nicht so! Bibiane hat uns alle sehr lieb gehabt. Und wir haben uns eigentlich viel zu wenig um sie gekümmert die letzten Jahre.«
»Sie war aber auch irgendwie komisch. Immer diese wallenden Gewänder und das ganze Getue.«
»Operettensängerinnen sind nun mal ein bisschen theatralisch. Sing du jeden Abend die Gräfin Mariza und bürste deinen Verwalter herunter. Irgendwo bleibt das hängen.«
»Ist aber ‘ne Ewigkeit her, seit Bibiane gesungen hat und berühmt war.«
»Wir werden alle älter. Auch du.«
»Na, hoffentlich. Was ist das für ein Kuvert?«
»Ist auch vom Anwalt. Bibiane hat mir noch einen Brief hinterlassen. Ich werde ihn später lesen.«
»Wie in einer Edelschnulze. Wann essen wir zu Abend? Ich bin mit Monika verabredet.«
»Wenn du mir hilfst, schaffen wir es heute schneller«, meinte Marie spitz.
»Ich? Ich bin Schülerin. Ich muss noch lernen.«
»Und ich bin Büroangestellte.«
»Na und? Ist doch nicht meine Schuld. Du machst mir Spaß!«
»Wie kann man nur so egoistisch sein? Und wenn ich daran denke, wie dein Zimmer wieder aussieht! Du bist ein Ferkel, weißt du das? Und ein weiblicher Macho!«, rief Marie erbost.
»Ich tue nichts anderes als Paps. Dass er ein Macho ist, weiß ich. Aber ist er auch ein Ferkel?«, fragte Petra grinsend zurück.
Also gab sich Marie alleine dem Hausputz hin. Sie beeilte sich, denn sie freute sich auf ein ruhiges Wochenende, auf ein nettes Essen beim Italiener, auf einen guten Film im Fernsehen, falls so etwas möglich war am Samstagabend, und auf Bibianes Brief. Die Beerdigung fiel ihr ein, die zweieinhalb Leute, die am Grab gestanden und in ihre Taschentücher geschnäuzt hatten. Sogar Werner und Petra hatten sich geweigert hinzugehen. »Ich hasse Beerdigungen«, hatte Werner gesagt. »Außerdem hat mich Bibiane nie leiden können. Sie würde es nur begrüßen, wenn sie wüsste, dass ich fernbleibe.«
Und Petra hatte lediglich ihre dunkle Lockenpracht aus der Stirn geschüttelt und gemeint: »Auf den Friedhof latschen? Nein, danke. Davon wird sie erstens nicht wieder lebendig, und zweitens ist der ganze Zinnober sowieso überholt.«
Und nun wollte sie Bibianes altem Haus mit seinen Erkern und Giebeln und den schmiedeeisernen Gittern den Garaus machen. Es verscherbeln, wie sie es nannte. Sicher würde auch Werner dazu raten. Marie spürte eine heiße Welle des Zorns. Konnten die beiden das? Wohl nicht, da sie Alleinerbin war. Wie war eigentlich die Rechtslage? Sie und Werner lebten in gesetzlicher Zugewinngemeinschaft. Gehörte also Werner die Hälfte des Mausoleums?
Marie erschrak.
»Marie? Ich fahre noch schnell ins Büro. Könnte etwas später werden. Notfalls esst ohne mich.« Werner stand gut gelaunt in der Badezimmertür und zupfte seine Manschetten zurecht.
»Heute ist Samstag«, sagte Marie.
»Ich habe eine Unmenge zu tun. Und samstags ist es ruhig dort. Kein Telefon stört, keine Besucher ...«
»Du hättest auch zu Hause arbeiten können.«
»Hier? Wo du mit dem Staubsauger herumfuchtelst und Petra ihre Affenmusik aufdreht, dass die Wände wackeln?«
»Ich nehme an, irgendeine attraktive Mitarbeiterin steht dir hilfreich zur Seite?«
Er würdigte sie keiner Antwort. Warum auch? Wo sogar schon große Philosophen der Meinung waren, dass Schweigen besser sei als Reden ...
Am Nachmittag mixte sie sich einen Cocktail, legte eine Tschaikowsky-CD auf und öffnete Bibianes Brief.
»Meine liebe Marie,
nun brich bloß nicht in Tränen aus, wenn du noch einmal von mir hörst! Aber gewisse theatralische Anwandlungen gehören zu meinem Genre, wie du weißt. Nun, wie auch immer ... Ich habe, wenn du diesen Brief liest, Gott sei Dank alles hinter mir, und ich bin froh darüber, dass ich auf Wolke siebzehn sitze, ein Zigarettchen rauche und nicht mehr meine tägliche Wanderung in die Vergangenheit antreten muss. Ich vermache dir das Mausoleum, ich wollte immer, dass du es kriegst. Ich habe keine Erben, sie gingen alle drauf, damals, zur Stunde X, als die Menschen verrückt spielten und sich gegenseitig totschossen. Ich würde dir gerne viel Glück wünschen, Marie, aber Glück ist ein so leeres Wort, und ich fürchte, ehrlich gesagt, dass dir noch allerlei Ärger bevorsteht. Nein, nein, ich wettere nicht mehr gegen Werner und Petra und die Art, wie sie dich behandeln. Aber vergiss die beiden eine Weile, und hol dir einen fürs Herz, du brauchst das. Einen Mann, meine ich. Und merk dir: Das Wichtigste auf der Welt sind sie sowieso nicht, die Männer. Das Wichtigste sind die Frauen, damit sie aus den Männern Menschen machen. Nun, Marie, hab es ein bisschen lieb, mein Mausoleum, und meine Möbel und den Garten. Und Isidor. Obwohl er schon furchtbar alt ist. Und furchtbar fett. Und furchtbar müde. So wie ich.
In Liebe – deine Bibiane«
Die Schrift war krakelig, und Marie weinte natürlich doch. Nicht nur Bibianes wegen. Auch wegen Petra, die ihr so distanziert und kalt das Gefühl gab, alles falsch gemacht zu haben, und wegen Werner, der – darauf mochte sie wetten – im Augenblick wohl alles andere tat, als sich den Kopf über betriebliche Probleme zu zerbrechen.
Sie trank ihren Cocktail aus und mixte sich einen neuen. Nun werde bloß nicht sentimental, Mariechen!, dachte sie. Mach lieber, was Bibiane sagt! Handle! Lass Petra verrotten in ihrem Saustall, und verschaff dir Gewissheit wegen Werner! Fahr zu seiner Firma! Guck nach! Mach Randale, wenn eine auf seinem Schoß sitzt!
Der Pförtner tat erstaunt. Aber seine Augen glitzerten. Dieses Gespräch bedeutete einen kleinen Farbtupfer im grauen Gewebe des tristen Wochenenddienstes.
»Oh, Frau Mangold. Nein, Ihr Gatte hat schon vor ein paar Stunden das Haus verlassen. Er war nur kurz hier.« Maries cocktailfröhliches Lächeln gefror. »Ja, das kann gut möglich sein. Ich komme gerade vom Tennisplatz. Ich war noch gar nicht zu Hause.« Sie nickte ihm kurz zu und sah, wie er die Nase rümpfte. Kein Wunder! Bei der Fahne, die sie hatte! Sie wusste nicht, wohin mit sich. Stand auf der Straße und hatte sehr viel Phantasie, Vorstellungen, die sie plagten und verhöhnten. Er ist sicher in einem Edelschuppen und schaufelt sich den Bauch voll mit seiner neuen Tussi, dachte sie. Schenkt ihr Aufmerksamkeit, die eigentlich mir gehört. Warum? Weil uns beide der Alltag aufgefressen hat? Weil ich bald vierzig werde und die andere jung ist? Weil ich ein Stück Landkarte bin, das er in- und auswendig kennt?
Auch er war eine Landkarte, die sie kannte. Mit furchtbar viel Tälern und Schluchten. Und recht öden Gestaden, wenn sie es sich genau überlegte.
Es mochte kurz vor Mitternacht sein.
»Einen doppelten Cognac«, sagte Marie zu einem hemdsärmeligen Barkeeper. Rotgesichtige Männer umstanden sie, ein paar Frauen in kurzen Röcken und weiten Pullovern, riesige Ringe in den Ohren und mit Ketten wie Fahrradklingeln um den Hals, lachten und riefen sich derbe Bemerkungen zu.
»Ganz allein, meine Hübsche?« Der so fragte, glich Werner. Ob er auch eine Frau zu Hause hatte, die ihre Falten zählte und nach der Tür lauschte?
»Sind Sie verheiratet?«
»Schon ewig. Ewig.« Er bezwang seinen Schluckauf.
»Warum sind Sie dann nicht zu Hause bei Ihrer Frau?«
»Du machst mir Spaß, Mädchen. Hei, Philip, komm doch mal! Ich hab einen kleinen Moralapostel aufgetan, was sagst du dazu?«
Marie drehte sich um. Der rotblonde Hüne von neulich grinste von einem Barhocker herunter. Er hatte eine Pfeife im Gesicht und einen offenen Hemdkragen und sah schon wieder aus, als würde er demnächst alle Türen eintreten.
»Wo ist Ihre Krawatte?«
»In der Hosentasche.«
»Scheint eine Manie zu sein. Hat’s geklappt mit dem Job?«
»Tja. Es hat geklappt. Am Montag starte ich.«
»Obwohl Sie so alt sind?«
»Wie alt sind Sie denn?«
»So etwas fragt man eine Dame nicht«, erwiderte Marie. Auch sie hatte Mühe mit ihrem Schluckauf.
»Und was suchen Sie in dieser Pinte hier?«
Sie überlegte. Was suchte sie hier? Ach ja: »Meine Tante hat gemeint, ich brauche einen fürs Herz. Was meinen Sie? Ist gerade eine gute Zeit für Herzen?«