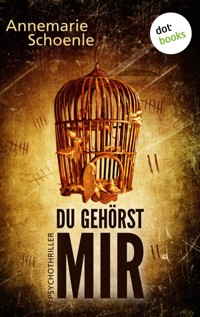
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Feind ist näher als du denkst – Annemarie Schoenles "Du gehörst mir" jetzt als eBook bei dotbooks. Das Paradies auf Erden hatte Wolf ihr versprochen. Das sichere Gefühl der Geborgenheit, er hatte es ihr mit dem Eheversprechen gegeben. Doch nun hat er es ihr genommen. Schlimmer noch: Melanies Beschützer ist zum Verfolger, zu ihrem schlimmsten Albtraum geworden. Seine brennende Eifersucht treibt ihn immer weiter an. Auf Schritt und Tritt folgt er ihr, beobachtet sie, überwacht sie – ja, er jagt sie. Sie muss raus aus dieser Falle, sie braucht einen Plan. Doch schafft sie es, den Mann zu täuschen, der sie besser kennt als jeder andere? Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Du gehörst mir" von Annemarie Schoenle. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das Paradies auf Erden hatte Wolf ihr versprochen. Das sichere Gefühl der Geborgenheit, er hatte es ihr mit dem Eheversprechen gegeben. Doch nun hat er es ihr genommen. Schlimmer noch: Melanies Beschützer ist zum Verfolger, zu ihrem schlimmsten Albtraum geworden. Seine brennende Eifersucht treibt ihn immer weiter an. Auf Schritt und Tritt folgt er ihr, beobachtet sie, überwacht sie – ja, er jagt sie. Sie muss raus aus dieser Falle, sie braucht einen Plan. Doch schafft sie es, den Mann zu täuschen, der sie besser kennt als jeder andere?
Über den Autor:
Die Romane Annemarie Schoenles werden millionenfach gelesen, zudem ist sie eine der begehrtesten Drehbuchautorinnen Deutschlands (u. a. Grimme-Preis). Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von München.
Bei dotbooks erschienen bereits Annemarie Schoenles Romane »Frauen lügen besser«, »Frühstück zu viert«, »Verdammt, er liebt mich«, »Nur eine kleine Affäre«, »Eine ungehorsame Frau«, »Ringelblume sucht Löwenzahn«, »Ich habe nein gesagt«, »Familie ist was Wunderbares«, »Abends nur noch Mondschein« und die Sammelbände »Frauen lügen besser & Nur eine kleine Affäre« »Ringelblume sucht Löwenzahn & Abends nur noch Mondschein« sowie die Erzählbände »Der Teufel steckt im Stöckelschuh«, »Die Rache kommt im Minirock«, »Die Luft ist wie Champagner«, »Das Leben ist ein Blumenstrauß«, »Dreitagebart trifft Minirock«, »Tanz im Regen« und »Zuckerherz und Liebesapfel«.
Die Website der Autorin: www.annemarieschoenle.de
***
eBook-Neuausgabe Januar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2004 Droemer Verlag, ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Atelier Nele Schütz, München unter Verwendung eines Motivs von thinkstock.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-773-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Du gehörst mir« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Annemarie Schoenle
Du gehörst mir
Psychothriller
dotbooks.
Jeder Mensch ist ein Abgrund,
es schwindelt einem,
wenn man hinabsieht.
Georg Büchner
Erster Teil
1
Es war auf der Neujahrsparty, die Melanies Freundin Sarah in Jimmys Kneipe gab. Im Hintergrund dudelte Countrymusic, und Sarahs Cousine sagte, Männer und Frauen seien nicht kompatibel, man müsse sie separieren, so wie die Briten und Iren, die Israelis und Palästinenser. Und schon landete man bei der Weltpolitik. Ein Lachsbrötchen in der einen und ein Glas Prosecco in der anderen Hand gab man Schlagzeilen und Leitartikel wieder. Ging es nun darum, die Welt zu retten, oder darum, an Öl zu kommen? Oder um beides, wie Frank, Melanies Kollege, erklärte. Aber hatte es jemals einen Krieg gegeben, der die Welt rettete?
Melanie redete sich in Eifer, war sich aber nicht sicher, ob man ihr nur aus Höflichkeit oder aus Interesse zuhörte. Jede Gelegenheit ergreifen, um sich einzumischen und gegen Missverständnisse zu protestieren – ein Standardsatz ihres Vaters. Nicht Missstände: Missverständnisse. Auch Kriege stellten zeitgebundene Missverständnisse dar, wenn man das Wort zerlegte und auf die wahre Bedeutung zurückführte.
Das sei kleinkariertes Denken, dieses schwammige Antikriegsgeschwätz, meinte ein langer blonder Mensch, den Melanie noch nie bei Sarah gesehen hatte und den sie sich weiß Gott nicht in einem Kampfanzug im Dreck liegend vorstellen konnte. Und doch nahm er eine lächerlich kriegerische Haltung ein, die Beine gespreizt und fest am Boden, ganz Mann, der wusste, dass der blaue Planet ein gefährlicher Ort war und ohne Kriege nicht auskommen konnte. Brandherde könne man nicht löschen mit einem Ölzweig in der Hand und der Friedenstaube auf der Schulter.
»Ach«, sagte Sarah spöttisch. »Du wärst also bereit, durch fremde Kontinente zu marschieren und dir ein Bein abschießen zu lassen oder gar deinen Kopf?«
»Er hat Diabetes, er wird nirgendwohin marschieren«, erwiderte die Freundin des blonden Menschen ironisch. Melanie wanderte mit ihrem Glas weiter zu einer Gruppe von Leuten, die sie aus der Redaktion kannte. Sie arbeitete als freie Journalistin für Tageszeitungen und einen Rundfunksender. Schrieb Artikel über Autoren, verfasste Fernseh- und Filmkritiken und machte Rundfunkinterviews, das letzte mit einem jungen Schriftsteller, der ein Buch über Dreißig- bis Vierzigjährige und ihr neues Lebensgefühl herausgab. Melanie war es schwer gefallen, sich mit ihm zu unterhalten, obwohl sie genau in die Sparte derer fiel, die er angeblich so genau studiert und seziert hatte.
»Wir wollen doch weder was zu tun haben mit den Revoluzzern von achtundsechzig noch mit den infantilen Spaßtrotteln der neunziger Jahre«, argumentierte er zufrieden. »Wir leben in einer Medienwelt und sind pragmatisch geworden.«
»Pragmatiker haben keine Visionen«, wandte Melanie ein.
»Hitler hatte eine Vision, und wohin hat's geführt?«
Eine so dumme Antwort war es nicht wert, kommentiert zu werden, und Melanie erinnerte sich, dass sie, wie oft in letzter Zeit, das Gefühl hatte, sich unendlich zu langweilen. Größtenteils hatte sie es nur noch mit den selbstgefälligen Angehörigen diverser Egowerkstätten zu tun, die das eigene Ich genauso inbrünstig anbeteten wie fromme Christen die Heilige Dreifaltigkeit. Und die inzwischen medial so abgeklärt waren, dass sie weder kritisierten noch etwas verändern wollten, sie wollten nur noch profitieren. Gott sei Dank arbeitete sie nicht nur als Journalistin, sondern auch als Assistentin ihres Vaters. Kümmerte sich um seinen Bürokram, um Pressetermine und um seine Werkstatt, die überquoll von all den Utensilien, die er als politischer Aktionskünstler in seinen Regalen hortete.
Die Erinnerung an jenes Autorengespräch deprimierte sie so sehr, dass sie von Prosecco zu Wodka wechselte. Sie war eine leidenschaftliche Wodkatrinkerin. Da die Leute immer annahmen, sie habe lediglich Wasser in ihrem Glas, hielten sie sie für eine Abstinenzlerin und für stocknüchtern, auch wenn sie es gar nicht mehr war. Das barg Vorteile, und sei es nur, dass sie dann hemmungslos werden und Dinge sagen konnte, die ihr sonst nicht über die Lippen kamen. Dass sie es in nüchternem Zustand nicht tat, lag an der Zwiespältigkeit ihrer Erziehung. Ihre Mutter, eine zurückhaltende und sehr idealistisch geprägte Frau, hatte nie etwas anderes getan, als ihren Mann umsorgt, ihn in all seinen künstlerischen Belangen unterstützt und ihm in schlechten Zeiten Mut zugesprochen. Sie malte und zeichnete und war mit ihrer sanften Stimme und den ruhigen, fließenden Bewegungen wie ein warmes weiches Tuch, in das man sich behaglich kuschelte. Während ihr Vater das Feuer im Hause war. Der innerlich Zornige. Ein Provokateur, der die Meinung vertrat, dass man in diesen Zeiten nicht in einem Atelier sitzen und Blümchen malen konnte, sondern dass man im Gegenteil in das tägliche Geschehen ringsum eingreifen und mitreden musste. Als Aktionskünstler wirkte er mit der ständigen Absicht zu konfrontieren. Nach außen hin sehr freundlich, redegewandt und seinem jeweiligen Gegenüber zugetan, war er doch in seinem Inneren von kristallklarer Härte. Er benutzte seine Kunst unverhohlen als Instrument. Eine Jahrhundertspur zum Beispiel, die sich als blutiger Kunstschleim über die Straße und über Bodenplatten mit Totenzahlen vom ersten Kreuzzug bis zum letzten Golfkrieg zog. Am Ende ein Triptychon aus drei Stahlkreuzen, an denen jeweils ein Gerippe mit Stahlhelm hing. Das war seine Art, sich einzumischen. Die Provokation unter die konservative Gürtellinie. Ja – und zwischen diesen beiden Menschen Melanie. So redegewandt wie der Vater, so leicht entflammbar und empört über Ungerechtigkeit und Heuchelei, und dann wieder weich und nachgiebig wie die Mutter. Unsicher, wenn sie auf Menschen traf, die sehr viel stärker waren als sie. Trotzdem zäh und ausdauernd, sodass sie leicht unterschätzt wurde.
Sie nahm einen großen Schluck Wodka, der Alkohol erwärmte sie. Sie gesellte sich zu Sarah, die neben Jimmy stand, der einen Kopf kleiner war als Sarah, ebenholzschwarz und kraushaarig. Er betrieb seine Kneipe, die in der Innenstadt lag, schon seit Jahren. Er war ein beträchtliches Stück älter als Sarah und sprach akzentfrei Deutsch. Was Wunder – er war in Deutschland geboren und in einem Heim in Berlin aufgewachsen. Mehr wusste man nicht, er sprach nicht darüber, nicht einmal mit Sarah. Sarah prostete Melanie zu, sie lächelten sich an, und Melanie wurde warm ums Herz, wie immer, wenn sie sich in ihrer Nähe befand. Sarah arbeitete in der Rechtsabteilung des Rundfunksenders, für den Melanie ihre kleinen Interviews machte. Sie hatten sich kennen gelernt, als Melanie einen Vertrag unterschrieb. Sarah bugsierte sie in ihr enges Büro und tat alles gleichzeitig. Mit ihr reden, telefonieren, Stapel von Papier vom Fußboden auf ihren Schreibtisch hieven und einem Kollegen zurufen, dass seine Tochter unten am Empfang stehe und heule, Liebeskummer, wahrscheinlich. Sie blies ihren rotblonden Pony aus der Stirn und meinte: »Gehen wir doch einen Kaffee trinken.« Sie sagte »Kaffee«, meinte aber Rotwein. Nach drei Gläsern wussten sie alles Wesentliche voneinander. Dass Melanie dreißig war und Sarah drei Jahre älter. Dass Melanie in einem zentral gelegenen Apartment lebte und Sarah und Jimmy in einer großen Wohnung, wenige Straßen entfernt. Dass Sarah sich mit ihren Eltern nicht verstand und Melanies Mutter an Krebs gestorben war. Dass Sarah Jimmy von dem Moment an geliebt hatte, als er ihr in seiner Kneipe ein Glas Rotwein zuschob und sagte: »Kommen auch bessere Tage«, gerade in dem Augenblick, als Sarah wieder einmal beschlossen hatte, ihrem Leben ein Ende zu setzen – ein Entschluss, den sie nach jeder Liebesenttäuschung gefasst hatte und der eher als Rettungsring diente nach dem Motto: Diese letzte Konsequenz bleibt dir immer noch. Und dass Melanie sich seit Monaten von Philip trennte, Auslandskorrespondent, in Hamburg lebend und verheiratet. Fast jeden Freitagabend trafen sie sich in einer kleinen Rushhour-Bar, um ihre Trennung zu besprechen.
»Moralische Bedenken, oder wird er versetzt?«
»Keine moralischen Bedenken«, sagte Melanie und fügte seufzend hinzu, sie sei lediglich eine schlechte Geliebte. Wolle den anderen spontan auch mitten in der Nacht sehen können und nicht so viele komplizierte Pläne machen müssen.
»Bin zu schusselig für eine solche Geliebte. Weiß nie, wann ich ihn anrufen kann und wann nicht, ob seine Frau immer mittwochs oder donnerstags beim Jazztanz ist, und ich verwechsele ständig seine zwei Handynummern. Die für sein bürgerlich-ordentliches Leben und jene für die Seitensprünge.«
»Und? Wann wird die Trennung endgültig?«
»Wir trennen uns eigentlich schon, seit wir uns kennen. Unvereinbarkeit der Lebensplanung. Er liebt so viele andere Dinge. In erster Linie seinen Beruf. Dann seine Frau, weil sie ihn grenzenlos bewundert und sehr eifersüchtig ist. Das schmeichelt ihm. Ich bin auch eifersüchtig, aber ich schmeichle ihm damit nicht, es amüsiert ihn höchstens. Das ist auch der Grund, warum er in mich verliebt ist. Weil ich ihn amüsiere und weil ich noch so unfertig bin, wie er sagt, und alles Unfertige den Mann in ihm herausfordert, den Professor Higgins, nur, dass er nicht meine Sprache verbessern muss, sondern mein Selbstwertgefühl. Das meint er durchaus ironisch, aber er hat Recht. An einem Tag will ich so stark sein und so viel bewirken wie mein Vater und am nächsten mir eine grüne Wiese und einen blauen Himmel malen und mich mitten reinsetzen in diese Idylle. Nicht anecken. Von allen gemocht werden.«
»Heiliger Strohsack! Das klingt ja wirklich bedenklich«, hatte Sarah damals gemeint.
Melanie goss sich ihr Wodkaglas nochmals voll und setzte sich auf eine Bank, die gleich neben der Eingangstür zwischen zwei Zimmerpalmen stand. Sie saß wie in einem schattigen Hain und widmete sich ihrem Wodka. Ihre Augen maßen Gruppe um Gruppe der Leute, die in Jimmys Kneipe herumstanden, die redeten, lachten, tranken und rauchten. Gern hätte sie mehr über diese Menschen gewusst, aber die meisten kannte sie nur flüchtig. Die schlanke Dunkelhaarige dort drüben zum Beispiel. Sie arbeitete im Vorzimmer des Rundfunkchefs, und man erzählte sich, sie sei geschieden und habe ein behindertes Kind. Aber dort drüben Frank. Den kannte sie ein bisschen besser. Er wohnte im Haus seiner verwitweten Mutter und hatte gestern erfahren, dass die kleinen Vergesslichkeiten, mit denen sie ihn oft erheiterte, gar keine Vergesslichkeiten waren. Dass die Mutter vielmehr alle Anzeichen der Alzheimer-Krankheit zeigte und sich deswegen in den kommenden Tagen testen lassen musste. Und dort Jimmy, Sarahs Freund. Er trug ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose, war wie ein schwarzes Fanal in der bunt gewürfelten Gesellschaft und wirkte fröhlich und ausgelassen. Doch in seiner Post befand sich seit Wochen jeden Morgen ein Drohbrief, eher ein Drohzettel, auf dem stand, er solle mit seiner Negerkneipe aus der Gegend verschwinden und dorthin gehen, wohin er gehöre: in den afrikanischen Busch.
Bedeutsame Schicksale also, sodass sich Melanie vorkam wie ein biografisches Leichtgewicht. Was hatte sie schon vorzuweisen? Eine seit Monaten unglücklich endende Beziehung? Lächerlich! Sie saß in ihrer netten Wohnung, konnte von ihrer Arbeit leben und hatte in ihrem Vater einen Menschen, der ihr wirklich nahe stand. Nicht nur, weil sie miteinander verwandt waren, sondern weil sie an die gleichen Dinge glaubten. Allerdings verteidigte ihr Vater seine Überzeugungen mit einer Vehemenz, die sie manchmal erschreckte.
Diese Leidenschaft fehlte ihr, oder, besser gesagt, sie ließ sie nicht zu. Sie versteckte sich hinter Kulturberichten, hinter fein geschliffenen, humorvollen Rundfunkbeiträgen, hinter der journalistischen Arroganz, jede Meinung angreifen, aber keine eigene preisgeben zu müssen. Doch ihr Vater machte ihr das nie zum Vorwurf. Ja, und große Laster plagten sie auch nicht, ihre Wodkatrinkerei mal ausgenommen. Auch keine Krankheiten, nicht einmal Fußpilz oder ein Hühnerauge. Nie fiel sie unangenehm auf, war auch bei den politischen Kunstaktionen ihres Vaters eher eine Handlangerin, die sich verlegen zurückzog, wenn aufgebrachtes Publikum protestierte.
»Ich bin eine Null«, sagte sie zu Sarah, die sich zu ihr setzte.
Sarah blickte auf das Wodkaglas und verzog den Mund.
»Wenn je einer kommt und erkennt, wie ängstlich und schwach ich bin, dann rette mich vor ihm!«
Sarah nickte und ahnte nicht, dass der Tag, an dem Melanie gerettet werden musste, schon fast vorbei war.
2
Wolf Eckart befand sich nur zufällig auf Sarahs Party. Er war mit einer Frau da – Vanessa –, die in seiner Kanzlei arbeitete und die ihn gebeten hatte, sie zu begleiten. Eigentlich ging Wolf nur mit Frauen aus, die potentielle Anwärterinnen auf eine Ehefrau waren, und Vanessa gehörte mit Abstand nicht dazu. Sie hatte wechselnde Liebespartner, nahm es also mit der Treue nicht so genau, sie war ehrgeizig, auf ihren eigenen Vorteil bedacht und wusste nie, wann es einfach besser war, den Mund zu halten. Aber er war mitgegangen. Es war ein kühler Abend, kurz nach Neujahr, die Straßen glänzten vor Nässe, er lief mit Vanessa über diesen kalten, abweisenden Asphalt und ärgerte sich, dass er sich von ihr hatte überreden lassen, eine Ansammlung von Menschen aufzusuchen, die er gar nicht kannte. Als sie ankamen, warf Vanessa sich sofort ins Getümmel, und er stand da, ein Glas in Händen, und überlegte, ob er nicht lieber sofort wieder verschwinden solle.
Da sah er sie. Sie saß auf einer niederen Bank und sprach mit einer überschlanken, rotblonden Frau. Sie hatte einen hellen Teint und Augenbrauen, die sich fast bis zu ihrem Haaransatz hochschwangen. Etwas in seinem Inneren sagte ihm, er müsse sofort zu ihr gehen, sie an der Hand nehmen und aus diesem Raum führen. Das war natürlich albern, also näherte er sich den beiden Frauen, die tief im Gespräch waren, Schrittchen für Schrittchen und kam sich vor wie ein nächtlicher Unhold, der seine Opfer umkreist und sich harmlos verkleidet zu ihnen schleicht.
»Wenn je einer kommt und erkennt, wie ängstlich und schwach ich bin, dann rette mich vor ihm!«, sagte die junge Frau gerade, die er so gern an der Hand nehmen wollte.
Er lachte im gleichen Moment, da sie lachte, und sie sah erstaunt zu ihm hinüber, während die andere Frau, vielleicht ihre Freundin, vielleicht nur eine Bekannte, etwas sagte.
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht belauschen.«
»Wer sind Sie?«
»Wolf Eckart. Ich bin mit Vanessa hier.« Er deutete vage auf eine Gruppe von Leuten, die am Korken einer Rotweinflasche rochen.
»Ich bin Melanie Wagner. Und das ist meine Freundin Sarah. Sie ist die Gastgeberin.«
»Die sich jetzt wieder um ihre Gäste kümmern muss«, sagte Sarah und zwinkerte ihm zu. Er sah, wie sie zu einem Schwarzen ging und ihren Arm um seine Hüften legte. Unbehagen regte sich in ihm. Diese rotblonde große schlanke Frau und daneben dieser schwarze Mann. Was trieb Menschen dazu, kulturelle Ketten zu sprengen? Er hing der tiefen Überzeugung an, dass Rassenunterschiede nicht zu überbrücken waren.
»Darf ich mich setzen?«, fragte er.
»Aber ja doch. Passen Sie aber auf! Diese Bank ist so niedrig, dass nur Menschen, die den freien Fall beherrschen, damit zurechtkommen.«
Er setzte sich neben sie, und der erste Eindruck, den er von ihr hatte, da er ihr jetzt so nahe gekommen war, bestand in einer geradezu naiven Freundlichkeit.
Sie trug ihr Haar zu einem braunen Pagenkopf geschnitten, ihre Augen, ebenfalls braun, schimmerten wie dunkler Honig. Ihr Gesicht war schmal, die Lippen zart und so fein gezeichnet, dass die Konturen sich in einem dunkleren Rot abhoben. Wenn sie lächelte, bildeten sich kleine Fältchen neben dem Mund. Sie war nicht schön, nicht einmal hübsch im landläufigen Sinn, aber sehr apart.
Ihm gefiel auch, dass sie nur Wasser trank und nicht rauchte.
»Kennen Sie all die Leute hier?«, fragte sie.
»Nein. Ich bin nur ein Anhängsel, das auf diese Party mitgeschleppt wurde.«
»Also auch nicht beim Rundfunk beschäftigt?«
»Anwalt. Ich arbeite in einer Sozietät in der Innenstadt. Eine große Kanzlei, sehr angesehen.«
»Strafrecht?«
»Patentrecht.«
»Dafür gibt es eigene Kanzleien?«
»Natürlich. Es kommen vorwiegend Firmen zu uns, deren Mitarbeiter Erfindungen gemacht haben, und wir haben die Aufgabe, den Erfindungsgedanken korrekt zu formulieren und beim Patentamt anzumelden.«
»Ist das nicht schrecklich trocken?«
»Aber nein, gar nicht. Sehen Sie ... ich bin in erster Linie Elektroniker. Ohne ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium können Sie gar nicht Patentanwalt werden.«
»An was arbeiten Sie gerade?«
»Es gehen wöchentlich Dutzende von Anmeldungen über meinen Tisch. Aber das Interessanteste, das ich momentan bearbeite, sind neue Peilsysteme. Black Boxes, die verdeckt an Autos oder anderen Gegenständen angebracht werden. Das BKA und das LKA arbeiten mit solchen Systemen.«
»Klingt nach James Bond«, sagte Melanie.
Wolf lachte. »Und Sie? Lassen Sie mich raten. Ein sehr weiblicher Beruf. Ärztin. Krankengymnastin. Stewardess.«
»Ganz falsch. Ich bin Journalistin. Ich interviewe Autoren, schreibe Film- und Fernsehkritiken und mache Rundfunkbeiträge. Sie wissen schon: Beinhaltet Ihr neuer Roman eine Botschaft? Oder: Ihr neues TV-Melodram ›Liebe auf dem Prüfstand‹ hatte ja sensationelle Einschaltquoten.« Sie seufzte. »Ich wollte mal politische Journalistin werden. Blieb aber hängen bei den kulturellen Themen. Aus Neigung und auch, weil es mir an Ellbogen fehlt. Die braucht man nämlich, wenn man sich in einer männlichen Domäne wie der Politik behaupten will.«
»Ja, ja ... Frauen und Politik ...« Er lächelte.
»Oh, bitte«, sagte sie. »Sie haben einen so netten Eindruck auf mich gemacht. Zerstören Sie ihn nicht!«
Er suchte ihren Blick. »Ich verbinde mit Frauen sehr positive Dinge, ich halte sie sogar die meiste Zeit für die besseren Menschen. Politik aber ist in meinem Kopf negativ besetzt.«
»Mein Vater würde sagen, man kann die Verhaltensweisen der Politiker nur ertragen, wenn man die geschaffenen Realitäten ständig infrage stellt. Wenn man mitredet und mithandelt und somit selbst dazu beiträgt, die Politik positiver zu gestalten. Tja ...« Sie seufzte. »In diesem Zusammenhang hätte er mich gern etwas mutiger.«
Daraufhin meinte Eckart, sie könne mit dem Mutigsein sofort beginnen und mit ihm anderswo einen Kaffee trinken gehen.
»Nach dem ganzen Wasser, das Sie da in sich hineinschütten ...«
Sie kicherte. »Sie haben Recht. Zu viel Wasser ist ungesund.«
Er half ihr hoch, sie holten ihre Mäntel und verließen die Party. Es schneite. Entzückt sah er, wie sie ihr Gesicht dem Schnee entgegenhob, die Augen schloss und tief durchatmete. Sie hatte etwas Unschuldiges an sich, auch etwas sehr Weiches, Frauliches, und die Ahnung stieg in ihm auf, dass er vielleicht gefunden hatte, was er suchte.
3
Am nächsten Abend bereits trafen sie sich in einem Lokal, das sie nicht kannte und das sie unter anderen Umständen nicht besucht hätte. Zu teuer, und das Ambiente zu kühl. Sie gestand sich ein, dass sie beeindruckt war von seinem Aussehen – er trug Anzug und Krawatte – und angetan von seinen guten Manieren. Er half ihr aus dem Mantel, er rückte ihren Stuhl zurecht, er benutzte seine Serviette, bevor er einen Schluck Wein nahm, und zerlegte seinen Fisch so gekonnt, als habe er nie etwas anderes getan. Er entpuppte sich auch als guter Unterhalter. Er war lässig, witzig. Wie er sein Elternhaus beschrieb ... Sein Vater, ebenfalls Ingenieur, war nach einem zweiten Herzinfarkt Frührentner geworden, worauf seine Mutter, die bis dahin Hausfrau gewesen war, berufstätig wurde. Sie arbeitete in einer auf biologische Präparate spezialisierten Kosmetikfabrik und füllte den lieben langen Tag Cremes in winzige Plastiktöpfchen, die dann den diversen Kosmetiksalons als Proben überlassen wurden, um in Wettstreit mit den Massenprodukten der Großfirmen zu treten. Er sprach mit so viel Liebe und Enthusiasmus von seiner Mutter, das nahm sie für ihn ein. Mit seinem Vater schien er weniger zurechtzukommen. Sie entnahm das dem kaum verhohlenen Sarkasmus, mit dem er von ihm erzählte. Der Vater würde seine Frau nicht so respektieren, wie sie es verdiene. Das liege an der Herkunft der beiden. Sein Vater entstamme einem wenn auch verarmten, aber großbürgerlichen Haus, auf das er und seine Schwestern sich eine Menge einbildeten, was lächerlich sei, wenn man genauer hinsehe. Sein Großvater, ein Apotheker, sei nämlich im Alter von sechzig Jahren mit einer Hausangestellten durchgebrannt, habe die Apotheke verkauft, seine restlichen Tage in Italien verlebt und das gesamte Vermögen durchgebracht. Und die beiden unverheirateten Schwestern des Vaters, die so hochnäsig auf seine Mutter herabsähen, hätten es nicht weiter gebracht als zu kleinen Büroangestellten. Seine Mutter, die Tochter eines Handwerkers und aufgewachsen auf dem Dorf, sei dazu erzogen worden, eine gute Ehefrau zu werden und es ihrem Mann und ihrem Kind behaglich zu machen. Dass sie kein Abitur, keine akademische Bildung besaß, habe sein Vater doch von Anfang an gewusst. Aber da habe das rassige Aussehen seiner Mutter – sie sei in früheren Jahren eine dunkelhaarige Schönheit gewesen – die größere Rolle gespielt. Inzwischen, und das sei die eigentliche Ironie, sei seine Mutter dem Vater an Allgemeinbildung weit überlegen. Denn sie habe all die Jahre so viele Bücher gelesen, so viele Theaterstücke und Konzerte besucht – allein, wohlgemerkt, da ihr Gatte bei kulturellen Veranstaltungen regelmäßig einschlief –, dass sie ihn inzwischen auf diesem Terrain in die Tasche stecken konnte. Sein Vater habe nur seine Fachzeitungen gelesen oder in den Fernsehapparat geglotzt. Und am Ende sei seine Mutter auch noch berufstätig geworden, weil die Rente ihres frühpensionierten Mannes viel zu knapp war, um einen gewissen Lebensstandard aufrechtzuerhalten.
Melanie lauschte fasziniert. Sie liebte Familiengeschichten, sie stellte sich Wolfs Vater vor, seine Mutter, seine Tanten und sah diese Menschen dank seiner Schilderung sehr deutlich vor sich. Sie war überzeugt davon, dass sie mit ihnen würde auskommen können. Jedermann kam im Grunde sehr gut mit ihr zurecht, was – wie Sarah meinte – nicht unbedingt für sie sprach. Das zeige nur, dass sie den anderen immer Recht gebe und sich nie auf die Hinterbeine stellte, wenn sie anderer Meinung war oder wenn man sie schlecht behandelte. Was natürlich Unsinn war. Es lag vielmehr daran, dass sie, da ihr Vater ständig Konfrontationen schaffte, quasi als Puffer zur Umwelt diente. Und ein Puffer federt ab, dämpft.
»Und Ihre Eltern?«, fragte er.
Schwierige Frage. Instinktiv ahnte sie, dass dieses zarte Pflänzchen Zuneigung, das hier zwischen ihnen beiden heranwuchs, allzu scharfen Wind nicht vertrug. Sie kannte Wolfs Einstellung zu den wichtigen Dingen des Lebens, zum Beispiel zur Politik, nicht. War er eher konservativ oder sehr liberal? Wahrscheinlich konservativ in gutem Sinne, so wie er über Frauen dachte. Dieser etwas untersetzte, kräftige Mann mit dem markanten Gesicht, den dunklen Haaren – die hatte er wohl von seiner rassigen Mutter geerbt – und den exzellenten Manieren war ihr noch fremd, also beschloss sie, etwas allgemein zu bleiben. »Meine Mutter ist vor sechs Jahren an Krebs gestorben. Magenkrebs. War eine sehr schlimme Zeit. Im Januar, kurz nach Silvester, erfuhren wir die Diagnose, im September starb sie. War nichts mehr zu machen. Sie war zu spät zum Arzt gegangen, weil mein Vater im Jahr zuvor eine große Kunstaktion vorbereitete und sie deshalb verschwieg, dass sie sich nicht wohl fühlte. Sie wollte ihn schonen und ihn unter keinen Umständen bei seinen Planungen stören. Mein Vater hat sich hinterher verrückt gemacht mit Vorwürfen.«
»Ihr Vater ist Künstler?«
»Er war früher Steinmetz und wurde dann Bildhauer«, sagte sie einsilbig.
Wolf war fasziniert. »Erzählen Sie weiter!«
»Er hat, als er noch jung war, Gedenkstätten gestaltet, Kriegermonumente. Namenslisten in Granit gehauen. Solche Sachen.«
Wolf sah sie so interessiert und fragend an, dass sie die Biografie ihres Vaters hier unmöglich abbrechen und von Belanglosem sprechen konnte. Sie fühlte sich unbehaglich. Aber warum wollte sie ihm nicht von Jobst Wagner erzählen, wenn sie doch sonst so stolz auf ihn war?
»Na ja ... er hat damals gut verdient, obwohl er noch nicht einmal fünfundzwanzig war. Aber dann hatte er eine Krise ... Hier.« Sie deutete auf die Stirn. »Die Bundeswehr kam. Er ist Pazifist. Und deshalb gelangte er zu der Auffassung, dass er mit seinen Denkmälern eine Art Vorschub leiste für konservative Weihen. Dass Gedenken dem Denken häufig im Weg stehe.« Sie hätte nun fortfahren können, dass er sich deshalb vom Denkmalbauer zum Denkmalzersetzer entwickelt hatte. Dass er mit seinen Aktionen gegen Kriege, Umweltkatastrophen und Konsummanipulation kämpfte. Stattdessen sagte sie nur: »So veranstaltet er nun Kunstaktionen, die zum Nachdenken anregen sollen.«
»Und wie macht er das?«
Sie entschied sich, vage zu bleiben. »Er kreiert Bildkästen mit Zeitbezug. Umwelt, Wiedervereinigung. Oder er arbeitet mit Metallprofilen, mit Holz ... Auch mit Originalteilen. Orden. Waffen. Fahnen. Und mit Überresten. So heißt eine seiner Arbeiten. ›Über-Rest‹. Was bleibt übrig bei der ›freien Fahrt für freie Bürger‹. Autoschrott, die Uhr des toten Vaters, das Parfüm der toten Mutter, die zerstörte Puppe des Kindes.«
»Hoffentlich lerne ich ihn einmal kennen.«
Sie lächelte ihn an. »Aber sicher. Wenn Sie das wollen ...«
Er brachte sie nach Hause, und sie bot ihm an, ihm ihre Wohnung zu zeigen. Eine eindeutige Sache, diese Einladung, und sie gestand sich ein, dass sie schon so in seinem Bann stand, dass es ihr einerlei war, ob es sich schickte, bereits nach dem ersten Treffen mit ihm zu schlafen. Sie wollte es, basta, und da herkömmliche moralische Grundsätze nicht zum Repertoire ihrer Erziehung gehört hatten, fand sie nichts dabei, sich ganz offen zu geben.
Seine Reaktion überraschte sie. Sie standen vor ihrem Haus, der Schneefall vom Vortag war wieder in Regen übergegangen. Sie malte sich bereits aus, wie sie die Treppe zu ihrer Wohnung hinaufstiegen, wie sie in den Flur traten, sich zum ersten Mal küssten, wie sie Tee kochte, sich mit ihm unterhielt, vielleicht über ihren neuen Artikel »Welchen Weg nimmt eine Hose, bis ein deutscher Verbraucher in sie hineinschlüpft«, der natürlich etwas mit Globalisierung zu tun hatte und vielleicht ein erster Schritt dazu war, sich von der rein kulturellen zur politischen Journalistin zu mausern. Er würde von ihr allerdings so berauscht sein, so verzaubert, dass er nichts von Globalisierungsthemen wissen wollte.
Doch er reagierte anders, als sie erwartet hatte. Er strich ihr sehr zärtlich übers Gesicht, das feucht vom Regen war, und blickte ihr in die Augen. »Ich glaube«, sagte er, zum Du übergehend, »dass ich mich in dich verlieben werde. Ich bin noch nicht verliebt ... denn das Wort ›Liebe‹ bedeutet sehr viel für mich. Und deshalb möchte ich, dass wir uns Zeit lassen.«
Sie nickte. Überwältigt. Er schien aus einer anderen Sphäre, einem anderen Kosmos zu kommen. Aber ihr gefiel es. Aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass Männer nun mal aggressiver, aktiver und lüsterner als Frauen sind (wer aber war in diesem Moment eigentlich lüstern?), empfand sie sich plötzlich als sehr kostbar, sehr geschätzt.
Er küsste sie auf die Stirn, auf beide Augen und zog sie für einen Moment an sich.
»Bis bald?«
Wieder nickte sie, bevor sie ins Haus schlüpfte und für einen Moment am Fuß der Treppe stehen blieb. Was war ihr da über den Weg gelaufen? Ein Asexueller? Ein Romantiker? Sie dachte an die vielen Wochen, die sie sich unentwegt schon von Philip trennte. Er hatte sie, als sie ihn während eines Symposiums kennen lernte, zuerst mit Penne arrabiata gefüttert und dann mit auf sein Hotelzimmer genommen. Da gab es keine Romantik, keine hehren Worte, denn Philip scheute große Begriffe. Da existierten lediglich geistige Verwandtschaft und körperliches Begehren, was, wie Philip argumentierte, die beste Voraussetzung für eine dauerhafte Verbindung bedeutete. Aber war sie ihm je kostbar gewesen? Lächerlicher Gedanke!
Als sie im Bett lag, sehr unruhig, zugegeben, denn ihre letzte Nacht mit Philip lag einige Zeit zurück, verlangte es sie, sofort mit Sarah zu telefonieren. Sie konnte dies getrost tun, denn Sarah ging nie vor Mitternacht zu Bett, und Jimmy war sicherlich noch nicht zu Hause, seine Kneipe schloss erst in einer Stunde.
Sarah zeigte sich nur mäßig interessiert, ließ sich aber dennoch zu einem Kommentar herbei. Sie habe, nachdem sie gesehen hatte, dass Melanie mit Wolf die Party verließ, Vanessa über ihn ausgefragt und erfahren, er gelte als unnahbar und sehr schwierig. Er habe ein verqueres Weltbild. Es sei recht vergnüglich, mit ihm darüber zu diskutieren, aber seine Ansichten seien schwer integrierbar ins tägliche Leben.
»Nur weil er Frauen achtet und nicht sofort mit jeder in die Kiste springt?«, fragte Melanie verärgert.
»Schätzchen, ich weiß es nicht. Ich gebe nur wieder, was sie mir erzählt hat.«
»Was ist los? Du bist so kurz angebunden.«
»Ich mache mir Sorgen um Jimmy. Immer diese Drohungen in seinem Briefkasten ... und jetzt erhält er auch noch Nacht für Nacht seltsame Anrufe.«
»Er muss zur Polizei gehen.«
Sarah lachte verächtlich. »Die werden doch erst tätig, wenn sie ihm das Lokal zertrümmert haben und er im Krankenhaus liegt.«
»Hat er eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte?«
»Er hat mal zwei Glatzköpfe hinausgeworfen, die ein paar Türken anpöbelten. Im Lokal war zuvor nur seine Bedienung Lisa, du weißt ja, blond, stämmig und ausgesprochen deutsch. Er kam von einer Einkaufstour zurück. Als sie mitkriegten, dass nicht Lisa, sondern ein Schwarzer der Pächter der Kneipe ist, wollten sie eine Rauferei anzetteln. Aber Lisa rief die Polizei. Kurz darauf begann der Terror.«
»Das hast du mir nie erzählt.«
»Wir hatten den Vorfall vergessen. Gibt immer ein paar Blöde, die man vor die Tür setzen muss.«
Nachdem sie sich von Sarah verabschiedet hatte – nicht, ohne ihr nochmals ans Herz zu legen, die Polizei einzuschalten, blieb Melanie lange wach. Sie dachte an Philip. An Wolf Eckart. An sich. An die Zeit, die verging. Schon kurz nachdem sie Philip Rosin kennen gelernt hatte, fragte sie ihn, ob er und seine Frau Kinder wollten. Er hatte verneint. Sie sah ihn noch vor sich. Er saß im weißen Bademantel des Hotels auf dem Bett, die Arme leicht gebräunt, das blonde Haar lockenverfilzt, und drehte sein Weinglas in den Händen. »Früher vielleicht«, sagte er, »als die Familien noch elternkonzentriert waren. Aber heute? Heute kreist doch die ganze Familie um das Kind. Wie ich meine Frau kenne, würde sie ein Prestigeobjekt daraus machen. Ein vorzeigbares kleines Monster, das zu den Klavierstunden, zum Judounterricht und zu Geburtstagspartys chauffiert wird. Ich lasse mir aber von einem Kind nicht die Müslisorte vorschreiben, auch nicht, welches Auto ich mir kaufe oder welche Turnschuhe man trägt.« Sie hatte gelacht damals. Und war innerlich froh gewesen. Sich seine Frau vorzustellen, wie sie Nobelboutiquen besuchte und Friseurtermine wahrnahm, war wesentlich leichter, als sie gleichsam als Muttermythos vor Augen zu haben. Denn ein Kind würde auch Philip verändern, da mochte er, noch kinderlos, sagen, was er wollte. Sie hatte das zu oft erlebt. Menschen, die ihr auf eine unkomplizierte Weise als weltoffen und vernünftig erschienen waren, mutierten als Eltern zu engstirnigen Ratgebern in Kinderfragen. Mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Begeisterung, mit der sie früher über Weltpolitik oder Theaterpremieren gesprochen hatten, redeten sie nun über die Konsistenz des Babystuhlgangs und gezuckerte Kindertees.
Ob Wolf Eckart heiraten und Kinder haben wollte? Das wäre nicht gut. Denn sie hatte sich zur Kinderlosigkeit entschlossen, obwohl es wieder ausgesprochen schick geworden war, Mutter zu werden. Eine Flucht vor der harten Berufswelt, in die viele junge Frauen mit den gleichen Qualifikationen eingestiegen waren wie ihre männlichen Kollegen, ohne je die Karriereleiter hochzukommen. Und der Wind blies scharf. Also zurück zu den fünfziger Jahren und zu einer neuen Mystifizierung der Mütter. Deutschland hatte sowieso zu wenig Kinder. Melanie erkannte sehr wohl, dass die Wirtschaft auf Kindersegen hoffte, schließlich benötigte man neue Konsumenten, neue Arbeitskräfte, neue Rentenbeitragszahler. Nichts für sie. Sie besaß eine recht klare Vorstellung, wie sie ihr Leben einrichten wollte: als Journalistin weiterkommen, ihrem Vater zur Seite stehen und mit einem emanzipierten Partner zusammenleben, der sie ernst nahm und respektierte. Wenn sie ein Kind wollte, dann ein adoptiertes. Schließlich neigten nur die Wohlstandsländer zur Kinderlosigkeit. Ansonsten erfreute sich die Menschheit einer Fruchtbarkeit, die katastrophal war.
Heiliger Strohsack!, wie Sarah sagen würde. Es konnte ihr doch egal sein, ob Wolf Eckart Kinder wollte oder nicht. Sie kannte ihn ganze zwei Tage! Allerdings fand sie ihn sehr attraktiv und reizvoll. Reizvoll vielleicht gerade deshalb, weil er sie so sehr achtete, dass er ihre kaum verhüllte Einladung zu sexuellem Handeln abgelehnt hatte. Gab es das, dass man von heute auf morgen dem Richtigen begegnete? Sie erinnerte sich, dass sie nach einer Vernissage, auf der ihr Vater einen Bildkasten zum Thema »Die Würde des Menschen ist unantastbar« gezeigt hatte, mit ihm in einer Frankfurter Weinkneipe gesessen und über das Zusammenleben von Mann und Frau gesprochen hatte. Er wusste von Philip und enthielt sich jeglichen moralisch verbrämten Kommentars. Er legte ihr nur ans Herz, auf dreierlei zu achten, wenn sie sich einmal ernsthaft binden würde: Der Mann sollte ihre Ansichten und politischen Überzeugungen achten, auch wenn sie nicht in seinem Sinne waren, er sollte ihr im täglichen Leben größtmögliche Freiheit zugestehen, und er sollte unter keinen Umständen über das normale Maß hinaus eifersüchtig sein. Ob solch ein Heiliger existierte? Wahrscheinlich nicht. Also am besten gar nicht heiraten, dachte sie und kuschelte sich in ihr Kopfkissen. Einzelbetten hatten schließlich auch etwas für sich!
4
Wolfs Sonntagsbesuche bei seinen Eltern Ruth und Alfred waren ein Ritual, das er auf der einen Seite hinnahm als eine alle Zeiten überdauernde Pflicht, andererseits aber auch genoss. Schon wenn er die Wohnung betrat, durchflutete ihn tiefe Zufriedenheit. Der große Flur, die Türen, die zu den einzelnen Zimmern führten, Wohnzimmertür und Küchentür stets geöffnet, die Lämpchen an der Wand, ein freundliches, warmes Licht verströmend, das Gutbürgerliche der Räume, das war es, was ihn anzog und sofort wieder zum Kind werden ließ. Während er seinen Mantel auszog, atmete er den köstlichen Geruch des Bratens ein und hörte mit tiefer Befriedigung aus der Küche das leise Brutzeln des Buttergemüses. Seine Mutter in einem engen schwarzen Rock und einer pastellfarbenen Bluse umarmte ihn, während sein Vater vom Wohnzimmer aus zwei Schrittchen in den Flur tat, stehen blieb und ihn ansah, als wundere er sich, dass schon wieder ein Sonntag ins Land gezogen war, wo der letzte doch erst einige Stunden entfernt schien.
»Hallo! Wie geht's euch?«
Er umarmte seine Mutter und sog den feinen Duft, der ihrer Kleidung entströmte, genauso behaglich ein wie vorher den Geruch des Bratens. Sie benutzte noch immer das gleiche Parfüm wie zu der Zeit, als er ein Junge war. Ein klassischer Duft, teuer, eigentlich konnte sie ihn sich nicht leisten. Aber in solchen Kleinigkeiten zeige sich, ob man Stil habe, hatte sie einmal behauptet. Also schenkte Wolf ihr jedes Weihnachten eine Flasche ihres Lieblingsparfüms, so wie er seinem Vater jedes Jahr eine teure Strickweste überreichte, braun, mit V-Ausschnitt, nicht zu dick, nicht zu dünn; denn sein Vater, der immer noch Tag für Tag am Schreibtisch saß, obwohl er nichts mehr zu tun hatte, liebte seine Strickwesten.
Er ging zu ihm, legte ihm eine Hand auf die Schulter, seine Art der Begrüßung. Nie wäre es ihm eingefallen, seinen Vater zu umarmen. Einmal hatte er es getan, schon vor Jahren, als er erfuhr, dass er sämtliche Prüfungen mit erstklassigen Noten bestanden hatte. Da war er in die Wohnung gestürmt, hatte seine Mutter in die Luft gehoben und seinen Vater umarmt. Er spürte noch heute, wie dieser von ihm abgerückt war, während rote Flecken sich auf seinen Wangen ausbreiteten. Wolf hatte ihn sofort losgelassen und nur gesagt: »Ich habe bestanden.« Aber seine überschwängliche Freude war dahin gewesen.
Während sie am Tisch saßen und den knusprigen Braten, den mit Butter sämig geschlagenen Kartoffelbrei und das mit frischen Kräutern und einem Hauch von Muskatnuss gewürzte Gemüse aßen, erinnerte sich Wolf der unzähligen Sonntagmittagessen der vergangenen Jahre, und es schien ihm, als liefen sie alle nach dem gleichen Schema ab. Seine Mutter erkundigte sich nach seinem Berufsalltag, nach den Arbeitskollegen und mit einem unruhigen Zwinkern in den Augen nach dieser oder jener weiblichen Kollegin. Der Vater aber schob vorsichtig kleine Bratenstückchen und etwas Kartoffelbrei auf die Gabel, führte sie zum Mund, kaute und schwieg. Über seine rechte Wange verlief eine lange Narbe – er war in seinen Studentenzeiten in einer schlagenden Verbindung gewesen. Als Kind hatte Wolf sich vor dieser Narbe, die sich rot verfärbte, wenn sein Vater zornig wurde, gefürchtet. Geschämt hatte er sich für ihn, als habe der Vater ein Gebrechen. Bis zu jenem Tag, da ihm seine Mutter erklärte, dass der Schmiss im Gesicht des Vaters etwas Besonderes darstelle. Da war er ihm eine Zeit lang wie ein Held erschienen, aber das Heldenhafte konnte er leider seinen Schulkameraden schwer verständlich machen, und wenn er es dennoch versuchte, waren sie nur mäßig beeindruckt. Deren Väter hatten anderes aufzuweisen: ein neues Auto, ein größeres Fernsehgerät, eine Karibikreise. Wolf war siebzehn, als sein Vater mit fünfzig den ersten Herzinfarkt erlitt, der zweite, der ihn zum Frührentner machte, ereilte ihn fünf Jahre später. Dann war seine Mutter auf den Plan getreten. Nach außen hin sollte alles bleiben, wie es war, das Gutbürgerliche, das sie so schätzte, sollte unter keinen Umständen verloren gehen. Sie kaufte heimlich in billigeren Läden ein und änderte ihre Garderobe jedes Jahr mit einem Geschick, das Wolf tief beeindruckte. Das blaue Kleid erhielt einen cremefarbenen Kragen und einen modischen Ledergürtel, und schon wirkte es wie neu. Ein Seidenschal veränderte die Kostüme und Hosenanzüge, ein neuer Pelzkragen den Wintermantel. Abends aß man jetzt kalt, aber sie verstand es, die im Großmarkt gekaufte Wurst, die billigen Tomaten und Radieschen so phantasievoll auf den Tellern anzurichten, dass man nie das Gefühl hatte, ein Armeleuteessen zu sich zu nehmen. Sie kündigte ihr Theater- und Konzertabonnement und stellte sich Woche für Woche an der Vorverkaufskasse an, um preiswerte Plätze in den oberen Rängen oder Stehplatzkarten zu ergattern. Auch Bücher kaufte sie nicht mehr neu, sondern wurde Mitglied der Städtischen Bibliothek, die beitragsfrei war. Sie sparte an allen Ecken und Enden, und trotzdem verlief ihrer aller Leben nach außen hin wie immer. Das Geld, das sie in der Kosmetikfirma verdiente, wurde größtenteils für Wolfs Studium verwendet. Natürlich arbeitete Wolf ebenfalls, er nahm jeden Job an, der sich ihm bot. Eilbriefzusteller, Möbelpacker, Kellner in einer Studentenkneipe.
Sein Vater allerdings tat nichts. Er saß den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer, an seinem Schreibtisch, er sprach wenig und wenn, dann schwang vor allem seiner Frau gegenüber in seinen Worten ein gewisser ironischer Ton, was Wolf noch mehr gegen ihn aufbrachte. Welche Arbeiten sein Vater an dem alten Schreibtisch verrichtete, blieb ein Rätsel. Die kleine dürftige Steuererklärung, die einmal im Jahr abzugeben war, erledigte Wolf für seine Eltern. Berufliche Unterlagen benötigte sein Vater nicht mehr, wenn man davon absah, dass er alte Konstruktionspläne geordnet und katalogisiert, in Sichthüllen gesteckt und in einer Schublade vergraben hatte. Die rechte Seite des Schreibtisches war stets verschlossen. Wenn man fragte, welche wichtigen Dokumente er hier aufbewahre, meinte er nur einsilbig, da drinnen lägen Unterlagen für seine Arbeit am Stammbaum der Eckarts. Denn dies war die einzige Beschäftigung, der sich Wolfs Vater mit Leidenschaft hingab. Bis ins achtzehnte Jahrhundert zurück reichten seine Ermittlungen schon, die er über Behörden und Pfarreien anstellte, wenngleich im Moment die Forschungen etwas stagnierten. Denn einer der Ahnen, der für recht gewichtig und angesehen gehalten worden war, hatte schlicht und einfach eine Menge Dreck am Stecken gehabt. Er war damals aus dem Dorfleben ausgeschlossen und wegen Betrügereien in die Einöde verdammt worden, ein schwarzes Schaf im Stammbaum. Ein Betrüger, während es doch sonst nur so wimmelte vor reichen Kaufleuten, Priestern und Großbauern.
»Ich habe am Dienstagabend bei dir angerufen, aber du warst nicht zu Hause«, sagte Wolfs Mutter.
»Ich war eingeladen. Eine Party in einem kleinen Lokal.«
»Bist du alleine hingegangen?«
»Mit Vanessa.«
Neugierde blitzte in den Augen seiner Mutter auf. »Nettes Mädchen?«
»Kein Mädchen, Mutter. Eine Frau. Sie ist nur eine Arbeitskollegin.«
Ihr Interesse erlosch. Er wusste, sie wartete schon lange darauf, dass er heiratete. Ihr Enkelkinder schenkte. Im Gegensatz zu seinem Vater, dem das vollkommen gleichgültig schien, verwunderlich für einen, der am Familienstammbaum arbeitete. Aber im Grunde wollte er mit seinen Nachforschungen nur beweisen, welch erfolgreiche Ahnenkette er besaß. Ob diese Kette fortgesetzt oder durch Wolfs Untätigkeit jäh abreißen würde, bedeutete ihm anscheinend nicht sonderlich viel. Nur einmal ließ er eine Bemerkung in Sachen »Eheschließung« fallen. Wolf solle sich in Acht nehmen., Als gut verdienender Anwalt sei er ein gefundenes Fressen für Frauen, die nur darauf warteten, ihn einzufangen und ihm ein Leben lang auf der Tasche zu liegen. Dieser Satz galt mehr seiner eigenen Frau, aber Ruth hatte eine bewundernswerte Geduld an den Tag gelegt und mit feiner Ironie erwidert: »Hoffentlich hast du nicht den Eindruck, dass ich dich und deine kleine Rente ausbeute? Aber nein, das kann nicht sein. Ich verdiene inzwischen ja selbst, nicht wahr? Und mehr als die paar Kröten, die dir der Staat zugesteht.«
Um seiner Mutter eine Freude zu machen, sagte Wolf: »Aber ich habe eine ganz reizende Frau kennen gelernt.«
»Wirklich?«
»Sie ist Journalistin.«
»Für welche Zeitung schreibt sie?«
»Freie Journalistin. Sie arbeitet für verschiedene Tageszeitungen, für Frauenmagazine und einen Rundfunksender.«
»Freie Journalistin bedeutet, dass sie kein regelmäßiges Einkommen besitzt«, spöttelte sein Vater.
»Bitte, Alfred. Warum machst du immer alles von vornherein schlecht, was man dir erzählt? Warum siehst du nie etwas Positives in den Dingen?«
»Weil es wenig Positives gibt. Und positive Partnerschaften ganz selten, wie wir wissen. Denk an diese Anna! Da hatte man zuerst auch gedacht, sie sei die ideale Schwiegertochter. Und wie hat's geendet? Katastrophal, wenn ich mich recht erinnere.«
»Anna war eine durchtriebene Person. Gott sei Dank hat Wolf das noch rechtzeitig bemerkt! Nein, nein ...« Sie tätschelte die Hand ihres Sohnes. »Heiraten liegt wieder im Trend. Das könnte es doch nicht, wenn man es nicht als etwas sehr Positives empfinden würde.«
»Modeerscheinung«, sagte Alfred. »Außerdem ... die Frauen heutzutage sind doch nur mehr gestresste und erschöpfte Möchtegernmanagerinnen. Und die Männer weinerliche Waschlappen. Was kann schon dabei rauskommen, wenn sich zwei Menschen solchen Typs zusammentun?«
Ruth winkte verächtlich ab und wandte sich wieder Wolf zu. »Willst du sie nicht einmal mitbringen?«
»Nein, Mutter. Dazu ist es noch zu früh. Obwohl ich glaube, dass sie dir gefallen würde.«
Später saßen sie allein in der Küche und tranken Kaffee. Alfred lag im Wohnzimmer auf der Couch, ein Kissen im Rücken, und hatte den Fernsehapparat laufen. Wenn er seine Zeit nicht am Schreibtisch verbrachte, sah er fern, sehr zum Abscheu seiner Frau, die sich nicht viel aus Fernsehen machte. Politische Sendungen interessierten sie nicht, die immer härter werdenden Kriminalfilme lehnte sie ab, Kitsch mochte sie auch nicht. Ihre Lieblingsfilme liefen unter der Sparte »Der Topfilm der Woche«, aber auch da hatte sie in letzter Zeit bei der Auswahl der Themen signifikante Änderungen feststellen müssen. Unterschwellig wurde ihr bewusst, dass es um Dinge ging, mit denen sie sich eigentlich nicht mehr befassen mochte. Vorwiegend Beziehungsgeschichten mit den ewig alten Fragen und Verwicklungen, aber in Hochglanz und höchst modernem Gewand präsentiert. Sie wunderte sich zum Beispiel, dass die Menschen in diesen Geschichten in keinen normalen Wohnungen oder Häusern mehr lebten. Alle besaßen sie, unabhängig von ihrem Einkommen, Villen und Lofts, oder aber sie hausten in alten Fabrikgemäuern oder Werkstätten, die zu einer modernen Bleibe umgestaltet waren. Realistisch war das nicht. Außerdem ertranken die Bilder in süßlicher Musik und den kitschigsten Farben, selbst Büros, in denen manche Szenen spielten, erinnerten an bunte Kindergärten. Die Krimivariante dagegen gefiel sich ausschließlich in düsteren Grautönen. Die Schauspieler schleppten sich durch triste Straßen, verwüstete Industriegelände, und alles legte sich in seiner Endzeitstimmung dermaßen aufs Gemüt, dass man direkt froh war, in der Tagesschausprecherin wieder ein Normalwesen auf dem Bildschirm begrüßen zu dürfen. Nein. Ruth las lieber, nähte oder hörte Musik.
»Was ist mit diesem Kollegen geworden, der den Skiunfall hatte?«, fragte sie, während sie Wolf ein Stück Apfelkuchen auf den Teller legte.
»Er ist immer noch im Krankenhaus. Ein Blutgerinnsel im Gehirn. Die Lähmungen gehen allmählich zurück, aber das Sprachzentrum ist gestört. Er wird wie ein kleines Kind wieder lernen müssen zu sprechen.«
Seine Mutter fragte nicht aus reinem Mitgefühl, das wusste er sehr wohl. Dieser Kollege, Knut Weller, war Anwalt wie er und der aufstrebende Mann der Kanzlei. Die anderen beiden Anwälte, ein Ingenieur. und ein Chemiker, waren Inhaber der Kanzlei und näherten sich bereits dem Pensionsalter. Deshalb hatte man vor kurzem noch einen jungen Anwalt eingestellt, ebenfalls einen Chemiker. Knut Weller aber hatte wie Wolf ein Elektronikstudium hinter sich, sodass zwischen den beiden ein erbitterter Konkurrenzkampf schwelte. Nicht offen ausgetragen, aber latent vorhanden. Natürlich konnte die Kanzlei gut und gerne zwei Fachanwälte der gleichen Sparte vertragen. Die ganz großen Elektrokonzerne hatte jedoch Knut Weller betreut. Der jetzt nicht mehr sprechen konnte. Und vielleicht nie mehr arbeiten. Das war auch Ruth bekannt.
»Ich habe seine Aufgaben übernommen. Man weiß ja nicht, ob er wiederkommt. Man wird vorübergehend noch einen jungen Ingenieur einstellen, der die Firmen bearbeitet, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte.«
»So traurig der Anlass ist ... für dich ist es eine große Chance.«
»Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich nie in der Lage sein werde, mich in die Kanzlei einzukaufen. Knut Weller hätte dies gekonnt. Und andere werden es auch können«, sagte er. Als er das unglückliche Gesicht seiner Mutter sah, tat ihm seine Bemerkung sofort Leid. »Aber darauf kommt es nicht an«, fügte er schnell hinzu. »Sie zahlen mir ein sehr, sehr gutes Gehalt, und Geld ist schließlich nicht alles.«
Sie nickte.
Er ergriff ihre Hand. »Wie geht es dir? Ich meine ... Wie geht es dir wirklich?«
Sie setzte ihr tapferes Gesicht auf. So nannte er es immer bei sich – ihr tapferes Gesicht. Eine Miene, die besagte, dass große Lasten auf ihren Schultern ruhten, dass sie diese Lasten aber tragen wolle und nur eins im Sinne habe: dass es ihrem Jungen, ihrem Wolf, an nichts mangele.
»Du weißt ja«, sagte sie, »Vater.« Sie verdrehte ein bisschen die Augen, um anzudeuten, dass sie einiges auszuhalten habe, es aber mit Geduld und Humor nehme.
»Was ist los mit ihm?«, rätselte Wolf. »Er macht einen so ... apathischen Eindruck. Nein ...«, er verbesserte sich, »eher einen missmutigen. Ist es, weil er nicht mehr arbeitet? Aber er arbeitet schon seit Jahren nicht mehr.«
Sie blickte ihn sinnend an, als wisse sie nicht, wie viel sie erzählen solle und wie viel nicht. Sie errötete.
»Er hat auch noch andere Probleme.«
»Geld?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Was dann? Mir kannst du es doch sagen.«
»Nein, das ist ...« Abermals schüttelte sie den Kopf und spielte mit ein paar Krümeln auf der Kuchenplatte. Dann straffte sie die Schultern, als habe sie sich doch entschlossen, darüber zu sprechen. »Er hat Probleme ... auf sexuellem Gebiet.« Nun färbte sich ihr Gesicht noch dunkler.
Wolf traf es wie ein Schlag. Nicht die Tatsache, dass sein Vater anscheinend sexuelle Defizite erlitt, sondern dass er, der Sohn, damit konfrontiert wurde, schockierte ihn zutiefst. An seine Mutter als eine Frau zu denken, die nachts bei seinem Vater lag, unter ihm lag – oder auf ihm saß? –, schwer atmend, stöhnend ... Nein, das verbat er sich. Natürlich gestand er sich im gleichen Augenblick ein, dass man heute in aufgeklärten Zeiten lebte, seine Empfindungen also absolut verklemmt waren. Überdies war seine Mutter immer noch eine attraktive Frau. Aber er wollte sie unter keinen Umständen – unter keinen Umständen, wiederholte er in Gedanken – sexualisieren. Sie war seine Mutter. Sie trug nette Röcke, gediegene Blusen, sie roch angenehm, und ihre Hände fühlten sich sanft und weich an, wenn sie ihm übers Gesicht strichen. Aber andererseits – er war kein Kind mehr. Seine Mutter sprach zu ihm als Mann. Und als Mann hatte er jetzt zu bemerken, dass sein Vater vielleicht ärztliche Hilfe benötige, einen Urologen, Medikamente ... aber er brachte es nicht über sich, sich sachlich zu äußern. Er ärgerte sich, dass sie ihn damit belastete. Er wollte sich diesen dicklichen, kleinen Mann, der meist in seiner braunen Strickjacke am Schreibtisch oder im Wohnzimmer auf der Couch saß, nicht als Liebhaber vorstellen. Und seine Mutter nicht als Frau, die ihn umarmte. Und er hatte deswegen noch lange keinen Ödipuskomplex; denn er begehrte seine Mutter nicht. Er wollte ganz einfach nur die Begriffe »Eltern und Sohn« und »Mann und Frau« fein säuberlich getrennt wissen. Er fand es einfach nicht fair, dass seine Mutter ihn wie einen alten Schulfreund behandelte, dem sie gestand, ihr Mann sei impotent. Der alte Schulfreund konnte zweierlei tun. Er konnte ihr mit feinem Lächeln erklären, dass dies Probleme waren, die ältere Männer oft betrafen und mit denen sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch zu kämpfen hatten, oder er konnte die Situation ausnützen und beginnen, um diese immer noch rassige Person zu werben. Aber er, der Sohn? Sollte er seine Mutter fragen, ob es vielleicht an den Praktiken lag, die sie beide anwandten? Sollte er ihr raten, mit aufreizender Wäsche den lustlosen Gatten auf Trab zu bringen? Er wusste nicht einmal, welche Wäsche seine Mutter bevorzugte. Wenn er ihr in früheren Jahren beim Abnehmen der Wäsche zur Hand gegangen war, hatte er nicht darauf geachtet. Die Farbe Weiß war ihm in Erinnerung geblieben, mehr nicht.
»Das tut mir Leid«, sagte er lahm.
»Ja. Ist auch für mich nicht einfach. Ich meine ... ich bin ja noch nicht so alt.«
Das wurde ja immer besser! Er schwieg.
»Aber bei ihm ist es etwas anderes. Er ist besessen von Sex.«
Wolf traute seinen Ohren nicht. Sein Vater? Schütteres Haar, schlaffe Wangen, die Missmut in Person – sexbesessen?
»Wie meinst du das?«
»Er sieht nachts Erotikfilme. Einmal, als ich zur Küche ging, um mir ein Glas Wasser zu holen, sah ich durch die offene Tür, dass er solch einen Film sah und ...« Jetzt wurde sie wieder glutrot. »Na, ja ... du weißt schon.« Wollte sie damit sagen, sein Vater onanierte, während er Sexfilme sah?
»Und auf der Straße guckt er in jeden Ausschnitt und auf jeden jungen Po in Jeans«, fuhr sie fort.
»Mein Gott, Mutter. Das tun neunundneunzig Prozent der anderen Männer auch.«
»Aber die tun es, weil es ihnen Spaß macht. Er tut es, weil er ... gierig ist. Wie ein alter Mann ohne Zähne, der unbedingt nochmals harte Brotrinde essen möchte.«
Wolf schwieg erschüttert. Ein gemütlicher Sonntagnachmittag driftete ab und stürzte ihn in so große Verlegenheit, dass seine Nackenhaare sich sträubten. Er blickte durch die geöffnete Balkontür auf den gepflegten Hinterhof, der noch mit leicht vertrockneten Erikagewächsen in Terrakottatöpfen winterlich geschmückt war.
»Das ist nur eine Phase, das geht vorüber«, sagte er, wohl wissend, dass er die nahe liegende Frage, wie seine Mutter denn mit der Impotenz ihres Mannes umgehe, ob sie mit ihm darüber spreche, ihn tröste, ihm gut zurede, nicht stellte. Das würde noch fehlen, dass sie sich in Details erging! Trotzdem wirkte ihr Gesicht ganz so, als ob sie diese Frage erwartet und sich schon darauf vorbereitet habe. Er stand auf. »Wird Zeit für mich. Hab mir Arbeit vom Büro mit nach Hause genommen.«
Sie sah ihn enttäuscht an und erhob sich auch. »Schade«, sagte sie. »Die Sonntagnachmittage mit dir sind noch meine einzige Freude.«
Wolf verkniff sich ein Lächeln. Emotionalen Druck auszuüben, das beherrschte sie wie keine andere. Er trug ihr das nicht nach, er bewunderte dieses Talent. Es hatte etwas Weibliches. Er ging ins Wohnzimmer. Sein Vater wandte seinen Blick nur kurz vom Fernsehschirm, auf dem halb nackte Frauen in schwindelerregend hohen Sandaletten an muskelbespannten Beinen mit ihren Partnern über die Tanzfläche stoben.
»Weltmeisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen«, sagte sein Vater in einem Anfall von Kommunikationsbereitschaft. Wolf argwöhnte, dass es weniger die sportlichen Leistungen waren, die seinen Vater interessierten, als die aufdringliche Körperlichkeit der Frauen.
»Na, dann viel Spaß noch!«
Sein Vater nickte und wandte sich wieder dem Bildschirm zu. Wolf verließ das Zimmer, schlüpfte in seinen Mantel und umarmte wie vor ein paar Stunden mit herzlicher Geste seine Mutter. Aber die Umarmung geriet anders. Das ganze Gerede um sexuelle Probleme legte sich wie Blei auf seine Muskeln. Er umfasste da nicht eine Mutter, sondern eine Frau, deren Mann keinen mehr hochbrachte. Sofort verbot er sich diesen Ausdruck. Er hasste die Fäkalsprache, mit der heute der Liebesakt bedacht wurde. Er mochte weder das Wort »ficken« noch »vögeln« noch »bumsen«. Aber fest stand, dass seine Mutter gefickt werden wollte, sein Vater ficken wollte, aber wegen Fehlfunktion seines Schwellkörpers dazu nicht in der Lage war, zumindest ohne Fernsehschirm nicht. Er erinnerte sich, dass ihm ein Kollege einmal grinsend eine Patentanmeldung zugeschoben hatte, in der es um eine mechanische Erektionshilfe ging. Mein Gott, es waren seine Eltern! Was taten sie ihm an? War das Leben um ihn herum nicht ernüchternd genug? Sie hatten ihm etwas geraubt, das hieß, in diesem Fall hatte seine Mutter, indem sie aus ihrer Intimsphäre plauderte, ihm etwas Wichtiges, Grundlegendes genommen. Nämlich ruhige, friedliche Sonntage, an denen er wieder Kind sein durfte. Wenn er in einer Woche hier in dieser Wohnung am Tisch sitzen und sein krosses Bratenstück schneiden würde, würde er zugleich herumrätseln, ob sein Vater sich die Nacht vorher erfolgreich oder erfolglos an die Mutter herangemacht hatte. Ob die permanent schlechte Laune Alfreds der Tatsache entsprang, dass er's wieder nicht gebracht hatte – grässlicher Ausdruck – oder dass einfach der Magen drückte oder die Prostata nicht richtig arbeitete? Was zu der weiteren Frage führte, ob es nicht auch an seiner Mutter lag? Gehörte sie zu den Frauen, die alles nur über sich ergehen ließen? Entmannte seinen Vater enttäuschte Erwartung? Oder war sie aktiv? Er sah sie vor sich, wie sie seinen Vater streichelte, seinen Penis in den Mund nahm – auch das Wort »Schwanz« war ihm zuwider –und wie sie versuchte, ihn zu stimulieren. Übelkeit stieg in Wolf auf.
»Bis nächsten Sonntag«, sagte Ruth und strich ihm mit ihrer weichen Hand übers Gesicht.
»Bis nächsten Sonntag«, erwiderte er angestrengt und fühlte sich so matt, dass er am liebsten in sein ehemaliges Jungenzimmer gegangen und sich aufs Bett geworfen hätte.
Sie winkte ihm nach, er winkte zurück, immer noch todmüde, obwohl er sich ein Lächeln abrang, damit sie keinen Verdacht schöpfte und sich Sorgen machte.
Mitten in der Nacht wachte er auf. Drei Uhr vierzig, zeigte sein Wecker. In einem der Heizungsrohre tuckerte und vibrierte es. Sein Schlafanzug fühlte sich am Rücken feucht an, und er erinnerte sich schwach an einen Traum, in dem er sich, eingeschlossen in großen Röhren, kriechend vorwärts bewegt hatte in der furchtbaren Gewissheit, dass ihm etwas folgte, etwas Schreckliches, aber er wusste nicht, ob Mensch oder Tier. Darüber war er aufgewacht. Er mühte sich aus dem Bett, einen bitteren Geschmack im Mund, und holte sich eine Flasche Mineralwasser aus der Küche. Stand dann fröstelnd in seinem feuchten Schlafanzug im Flur, trank in kleinen Schlucken, und eine Leere dehnte sich wie schwerer Nebel in seinem Inneren aus, drückte gegen sein Herz, den Magen und schnürte ihm die Luft ab. Er trippelte mit kleinen, alten Schritten, fast wie sein Vater, ins Wohnzimmer und ließ sich in einen kalten Ledersessel fallen. Vor den Fenstern dämmeriges Dunkel. Seltsam, wie sehr Dunkelheit ein Zimmer veränderte. Die wuchtige Couch, glatt und zierlos, der niedrige Glastisch, dessen Platte auf einem Metallsockel ruhte, der alte Sekretär aus einem der teuersten Antiquitätenläden der Stadt – bei Tag Behaglichkeit verströmend und Zeugen seines Wohlstands, verloren die Möbel ihre Konturen an die Dunkelheit und wurden eins mit ihr. Sein Herz begann gegen die Rippen zu pochen, er legte erschrocken seine Hand darauf und spürte die dumpfen, schnellen Schläge, als wollten sie seinen Brustkorb dehnen und ausweiten, um Raum und Luft zu schaffen. Sein Herz. Zuverlässig sogar nach zwei Stunden schweißtreibenden Squashspiels. Er war noch nicht einmal vierzig! Hatte seine Laborwerte im Kopf. Hämoglobin, Leukozyten, Thrombozyten, Calcium, Kalium, Gamma-GT. Er war kerngesund.





























