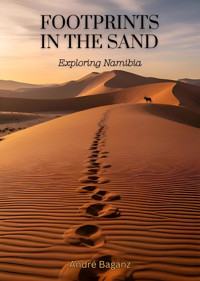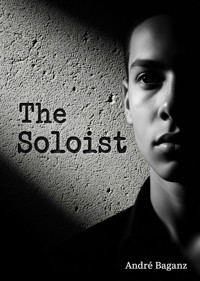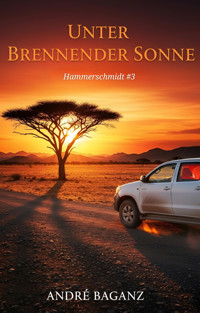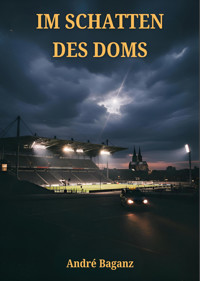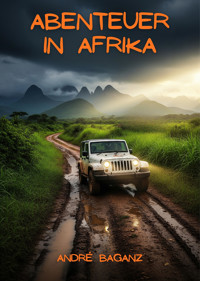
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Abenteuer in Afrika” erzählt die Geschichte von Martin, einem jungen Mann aus Deutschland, der sich auf ein ungewöhnliches Abenteuer in Liberia einlässt. Nach der überraschenden Begegnung mit seinem lange verschollenen Vater Amadou beschließt er, gemeinsam mit ihm ein Geschäft mit gebrauchten Reifen aufzubauen. Doch schnell wird klar, dass die Realität in Afrika weit von seinen Erwartungen entfernt ist. Korruption, kulturelle Missverständnisse und die Folgen des Bürgerkriegs stellen Martin vor immense Herausforderungen. Zwischen familiären Verwicklungen, riskanten Geschäften und der Begegnung mit einer fremden Welt muss er lernen, sich anzupassen – oder scheitern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zwei Welten
Der Duft von Afrika
Mit dem Lkw nach Ganta
Gefahren für einen Fremden
Flucht
Epilog
Auch von diesem Autor
Guide
Contents
Start of Content
Abenteuer in Afrika
André Baganz
Copyright © 2025 André Baganz
Alle Rechte vorbehalten.
Impressum
André Baganz c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
*
Covergestaltung mit NightCafé Studio
ZWEI WELTEN
ICH KLINGELTE UND wartete. Hinter der Tür waren Geräusche zu hören. Schließlich wurde geöffnet und Jasmin stand da. Sie blickte mich überrascht an.
»Ich glaube, ich habe mein Portemonnaie vergessen«, sagte ich, trat ein und steuerte direkt auf die Küche zu. Dabei bahnte ich mir den Weg vorbei an den Kisten und Kartons, die im Flur abgestellt waren. Ich hörte, wie Jasmin hinter mir fluchte. Ich drehte mich um und sah, wie sie sich mit dem Handballen ihr Knie rieb: Sie war über einen Elefantenstoßzahn gestolpert. Sie stieß das Elfenbein wütend zur Seite.
Ich ging weiter und betrat die Küche. Auf dem Tisch standen leere Bierdosen und drei Pappteller mit Pizzaresten. Mein Portemonnaie war nicht zu sehen. Ich bückte mich und suchte mit den Augen den Fußboden ab: nichts. Während ich mich wieder aufrichtete, rekonstruierte ich: Als der Pizzabote kam, hatte ich das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen, bezahlt, und es dann auf den Tisch gelegt, und nach dem Essen muss ich dann vergessen haben, es wieder einzustecken – oder?
Ich blickte zu Jasmin. Wenn sie die aufblitzende Skepsis in meinen Augen bemerkte, verriet ihre Mimik nichts davon, im Gegenteil. Sie stand lässig, mit verschränkten Armen, gegen den Türrahmen gelehnt, und beobachtete mich. »Wie viel Geld war denn drin?«, fragte sie.
»Zweihundert Mark. Ich wollte nachher noch zum Saturn.«
Jasmin kam nun ebenfalls zum Küchentisch und suchte selbst alles ab, war aber auch nicht erfolgreicher als ich. »Ausweis und Führerschein auch?«, fragte sie besorgt.
Ich schüttelte den Kopf. »Meine Papiere habe ich immer separat.« Ich klopfte, wie um sicherzugehen, die Gesäßtasche meiner Jeans ab: Ausweis und Führerschein waren da.
Jasmin ging zurück zur Küchentür und nahm ihre vorherige Pose wieder ein. »Vielleicht hat Reuter es eingesteckt?«
»Das trau‛ ich ihm nicht zu«, sagte ich.
»Hm.« Jasmin zuckte mit den Schultern. »Dann weiß ich auch nicht.«
Ich verharrte noch einen Moment nachdenklich, machte eine Geste der Hilflosigkeit und wandte mich zum Gehen.
Als ich mich an Jasmin vorbei zwängte, schlang sie ihre nackten Arme um meinen Hals und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Wenn du’s hier liegen gelassen hast, werde ich’s finden. Aber ich muss erst mal aufräumen.«
Mir stieg der aufreizende Duft ihres Parfüms in die Nase. Ich zögerte unwillkürlich und schaute in ihre dunklen Augen. Mein Blick wanderte von ihrem hübschen Gesicht abwärts. Da standen 170 Zentimeter geballte Weiblichkeit direkt vor mir. Sie trug keinen BH; ihre Brustwarzen zeichneten sich deutlich unter dem T-Shirt ab.
Jasmin senkte ebenfalls den Blick und wir beide fingen an zu lachen.
»Ich habe keine Lust, bis in die Südstadt zu laufen«, sagte ich. »Kannst du mir zwei Mark für die Straßenbahn geben?«
Jasmin nickte, fuhr mit einer Hand in ihre Jeanstasche und gab mir die Münzen. Dann trat sie zur Seite, um mich vorbeizulassen. »Tschüs, Bruderherz. Und vielen Dank nochmal für die Hilfe beim Umzug.«
#
Auf der Fahrt nach Hause ging mir die Sache nicht aus dem Sinn. Wenn ich das Portemonnaie nicht verlegt hatte, gab es nur die Möglichkeit, dass entweder Reuter oder Jasmin es eingesteckt hatte. Doch keinem von beiden traute ich das zu.
Reuter war ein Philanthrop. Er unterstützte afrikanische Asylbewerber bei der Erledigung von Formalitäten sowie bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Dafür verlangte er keine Gegenleistung. Warum sollte ausgerechnet der mein Portemonnaie einstecken? Das passte nicht zusammen.
Und Jasmin? – Während des Umzugs hatte ich gestaunt, dass jemand, der mit nichts vor einem reichlichen Jahr nach Deutschland gekommen war, derart viel Kram besaß. Überhaupt war es mir ein Rätsel, wie sie an dieses Apartment in der Kölner Innenstadt gekommen war. Das heißt, natürlich konnte ich mir zusammenreimen, dass ihr Freund Jens etwas damit zu tun hatte. Der war Manager bei einer großen Firma und hatte eine lockere Brieftasche. Letzteres war wohl ausschlaggebend für Jasmin.
Dennoch schob ich den Gedanken, sie könnte mein Portemonnaie genommen haben, von mir. Sie war immerhin meine Schwester, okay, Halbschwester, aber ich hielt sie dennoch im Grunde für einen ehrlichen Menschen. Aber angenommen, sie hatte es eingesteckt, wollte ich nicht zu hart mit ihr ins Gericht gehen, denn sie hatte mit ihren jungen Jahren bereits einiges hinter sich.
Jasmin war nicht so ganz freiwillig in Deutschland. Die miserablen Lebensbedingungen infolge des Bürgerkriegs waren der Grund, weshalb sie das Land, das sie als ihre Heimat betrachtete, verlassen hatte. Wir waren, wie gesagt, Halbgeschwister. Wir hatten den gleichen Vater und wurden auch beide in Deutschland geboren. Doch während ich auch in Deutschland, genauer gesagt in Ostdeutschland, aufwuchs, hatte Jasmin den größten Teil ihres Lebens in Afrika verbracht.
Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Liberia nahm sie Kontakt zu mir auf, um den Weg für eine Rückkehr nach Deutschland zu ebnen. Natürlich war ich bereit, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Als ich sie dann vom Frankfurter Flughafen abholte, stand zu meiner Überraschung eine äußerst attraktive junge Frau vor mir. Mit 27 war sie fünf Jahre jünger als ich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, dass es Momente gab, in denen ich es bereute, dass ich ihr Bruder war.
#
Während es in Deutschland wärmer wurde und alles grünte, begann 5000 Kilometer weiter südlich die Regenzeit. Die wolkenbruchartigen Regenfälle dauerten oft Stunden, manchmal Tage, wobei alles von den vom Himmel stürzenden Wassermassen überflutet wurde. Doch die monatelange Trockenzeit hatte den Boden derart ausgedörrt, dass er nun unersättlich war und wie ein Schwamm binnen kürzester Zeit alles wieder aufsaugte. Die Menschen hassten es, während der Schauer ihre Häuser und Hütten zu verlassen. Doch oft genug kamen sie nicht umhin und mussten es tun, um Besorgungen zu machen.
Broadstreet, die Hauptgeschäftsstraße von Monrovia, stand an den meisten Stellen unter Wasser. Nur wenige der gelb lackierten Taxis bahnten sich ihren Weg durch das Wasser. In einem von ihnen saß Amadou, eingezwängt auf dem Rücksitz. Der Regen trommelte wild gegen die beschlagenen Scheiben des kleinen Toyotas, in dem, einschließlich Fahrer, sieben Personen saßen.
»Halten Sie bitte vor dem KLM-Büro«, sagte Amadou.
Der Fahrer stoppte vor dem genannten Gebäude, allerdings mitten auf der Fahrbahn, da die rechte Spur zugeparkt war. Sofort kam ein nur mit Shorts bekleideter Junge angelaufen und schüttete Waschpulver auf die Windschutzscheibe. Noch bevor der Fahrer protestieren konnte, war alles eingeseift und voller Schaum. Während eine korpulente Frau umständlich aus dem Taxi stieg, um Amadou durchzulassen, bezahlte der den Fahrer. Die Frau rief ihm von draußen zu, dass er sich beeilen soll, war im selben Moment aber schon durchgeweicht.
Nachdem Amadou sich aus dem kleinen Auto gehievt hatte, versuchte er erst gar nicht, seinen Regenschirm aufzuspannen. Es wäre nutzlos gewesen, denn binnen weniger Sekunden war er bis auf die Haut durchnässt. Doch das hatte auch einen Vorteil: Nun sah man seinem Anzug die Schäbigkeit nicht mehr auf den ersten Blick an.
Der Junge wollte das Taxi nicht weiterfahren lassen, weil der Fahrer sich weigerte, ihm die geforderten fünf Liberty für die verrichtete Arbeit zu geben. Amadou ließ die beiden diskutieren und machte sich auf den Weg. Er zog instinktiv die Hosenbeine hoch und watete durch den Sturzbach, der den Bordstein entlangschoss. Das Wasser reichte ihm bis weit über die Knöchel. Er sprang auf den hohen Bürgersteig und bahnte sich einen Weg durch die Menschen, die Schutz vor dem Schauer unter dem hervorspringenden Dach des Gebäudes gefunden hatten. Als er sich durchgezwängt hatte, drückte er auf einen Klingelknopf. Sekunden später war ein Summen zu hören und die Glastür konnte aufgestoßen werden. Die kalte, klimatisierte Luft, die Amadou entgegenschlug, ließ ihn frösteln. Hinter einem Schreibtisch saß eine junge Frau. Sie wandte sich ihm freundlich zu.
»Ich will den Flugpreis nach Köln in Deutschland wissen«, sagte Amadou, während er sich mit einem Taschentuch Gesicht und Hände trockenrieb. Dabei rutschte ihm fast sein silberner Siegelring vom Finger. Den trug er, seit er ihn vor vielen Jahren von einem Medizinmann geschenkt bekommen hatte. Früher saß er stramm, jetzt ließ er sich mit Leichtigkeit hin- und herschieben.
Die Frau, die Miss Shaw hieß, wie ihr Namensschild verriet, blickte ihren Kunden fragend an. »Hin und zurück?«,
Amadou nickte.
Miss Shaw schlug in einer Broschüre nach. Dann tippte sie auf die Tasten eines Taschenrechners. »1875 Dollar, einschließlich Monrovia-Abidjan. Die Flüge gehen montags, donnerstags und samstags. Soll ich’s Ihnen aufschreiben?«
Amadou zog skeptisch die Augenbrauen zusammen. »Monrovia-Abidjan?«
Miss Shaw nickte. »Roberts International ist noch nicht wiederhergestellt. Deshalb können wir zurzeit keine Direktflüge nach Europa anbieten. Sie starten mit einer kleinen Maschine von Spriggs Payne und fliegen nach Abidjan. Von da geht’s dann weiter.«
Amadou zischte verärgert. »Dieser verdammte Krieg hat alles kaputt gemacht.«
Miss Shaw machte eine Geste des Bedauerns, als ob sie persönlich dafür verantwortlich wäre.
»Ja, schreiben Sie’s auf«, brabbelte Amadou.
Miss Shaw tat wie geheißen und reichte ihm den Notizzettel.
Amadou bedankte sich. Er wandte sich zum Gehen, drehte sich aber noch einmal um. »Kann ich hier drin warten, bis der Regen vorbei ist?«
Miss Shaw lächelte und zeigte ihre blendend weißen Zähne. »Selbstverständlich.«
Amadou ging hinüber zur breiten Glasfront. Während er nachdenklich hinausblickte, stützte er sich auf seinen Regenschirm. Die Menschen auf der anderen Seite der Scheibe verdeckten ihm die Sicht auf die überflutete Straße mit den verstopften Abflüssen. So etwas hatte es früher nicht gegeben. Damals wurden die Abzugskanäle vor jeder Regenzeit gereinigt, damit das viele Wasser abfließen konnte. Jetzt kümmerte sich kein Mensch mehr darum. Jeder hatte mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Aber nicht mehr lange und er würde hier raus sein, in Deutschland, einem Land, das er bewunderte. In seinen Zwanzigern hatte er mehrere Jahre dort gelebt. Als er wieder zurück in die Heimat kam, brachte er nicht nur viel Geld mit, sondern auch eine blonde, hübsche Frau und das süßeste Kind, das man sich vorstellen kann. Die kleine Familie ließ sich in der boomenden Stadt Yekepa nieder. Seiner Frau war dort als gelernter medizinisch-technischer Assistentin eine Stelle im Krankenhaus des Bergwerks angeboten worden. Dieses Beschäftigungsverhältnis brachte eine Menge Vorteile und für afrikanische Verhältnisse viel Geld. So konnten sie schon bald ein Grundstück kaufen und ein Haus darauf bauen. Dieser Hausbau war einzig und allein sein Werk gewesen. Er hatte von früh bis spät geschuftet. Und dann, als alles fertig war, wollte diese weiße Frau nichts mehr von ihm wissen. Sie behauptete, nur sie hätte das Geld verdient, das in den Bau des Hauses gesteckt worden war. Die von ihm geleistete Arbeit fand überhaupt keine Würdigung. Sie hatte ihn nach 20 Jahren Ehe verlassen, oder treffender gesagt, ihn gezwungen, aus dem gemeinsamen Heim auszuziehen. Er ging dann nach Monrovia, wo er Unterschlupf bei seiner inzwischen erwachsenen Tochter fand. Er wusste genau, dass seine Frau seit Langem ein Verhältnis mit dem Polizeichef von Yekepa hatte. Womöglich lebten die beiden inzwischen zusammen auf seinem Grundstück – in dem Haus, das er gebaut hatte. Doch er war nicht gewillt, sich auf diese Art abspeisen zu lassen. Er war ein echter Mandingo, ein Kämpfer. Amadou lächelte gedankenversunken vor sich hin: Seine Frau hatte er verloren. Aber sein Haus würde er nicht verlieren. Dessen war er sich gewiss.
Als der Regen nachließ, löste sich die Menschenmenge vor dem Eingang auf. Amadou verließ das KLM-Büro und machte sich auf den Weg zu seinem nächsten Ziel. Es lag nur wenige Straßen entfernt. Das Leben begann urplötzlich wieder zu pulsieren. Die Straßenhändler, Schuhputzer und Geldwechsler kamen hervor wie emsige Ameisen aus ihren Nestern. Die Sonne brannte erbarmungslos. In kurzer Zeit war wieder alles trocken. Nur einige riesige Pfützen zeugten noch von dem heftigen Regen wenige Minuten zuvor.
Amadou ging vorbei an halb zerstörten Häusern, an einem ausgebrannten Supermarkt, dessen verkohlte Mauern vom Unkraut zugewachsen waren. Er empfand eine starke Liebe zu seiner Heimat und es tat ihm weh, zu sehen, was die eigene Bevölkerung, angestiftet von einem schamlosen, machthungrigen Klüngel, aus ihr gemacht hatte. Dieses Land muss malerisch gewesen sein, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts Schiffe aus dem fernen Amerika vor der Küste ankerten und die ersten befreiten Sklaven auf Providence Island landeten, um ein Leben in Freiheit zu beginnen. Noch vor nicht allzu langer Zeit nannten die Liberianer ihr Land voller Stolz »Kleines Amerika«. Doch jetzt existierte nur noch die Erinnerung daran. Dieser schreckliche Krieg hatte das Land in seiner Entwicklung um Jahrzehnte zurückgeworfen.
Amadou betrat das Anwaltsbüro M & M. Im Vorraum standen zwei wackelige Stühle und ein kahler Tisch, hinter dem eine ältere Dame saß. Sie war damit beschäftigt, ihre Fingernägel zu lackieren. Amadou räusperte sich, um ihre Aufmerksamkeit zu erringen. Sie blickte auf und bedeutete ihm mit einem unfreundlichen Kopfnicken, durchzugehen.
Mr. Washington S. Matthews Jr., der für das eine M im Kanzleinamen stand, begrüßte seinen Besucher mit kühler Höflichkeit. »Guten Tag, Mr. Touré. Bitte nehmen Sie Platz.« Der Anwalt deutete mit seiner von Messingringen verzierten Hand auf einen Sessel, dessen Polster fehlten.
Seit Amadous letztem Besuch hatte sich nichts verändert. Die Büroeinrichtung war immer noch alles andere als üppig, um nicht zu sagen, schäbig. Ein leerer Schreibtisch, ein eiserner, abschließbarer Aktenschrank, eben jener ramponierte Sessel, auf dem er selbst tief und unbequem saß, sowie ein weiterer Sessel hinter dem Schreibtisch, auf dem Matthews saß, und dessen Zustand er nicht einschätzen konnte, waren das einzige Inventar.
Der Anwalt kam ohne Vorrede zur Sache. »Ihre Frau hat die besseren Karten, die Immobilie zu bekommen. Alle Verträge laufen auf ihren Namen.«
Amadous Blick drückte Protest aus. »Aber das Haus habe ich gebaut. Da steckt mein ganzer Schweiß und jahrelange Arbeit drin.«
»Gewiss doch, Mr. Touré. Aber was zählt, sind, wie bereits erwähnt, die Verträge. Und die tragen nun mal die Unterschrift Ihrer geschiedenen Gattin.«
»Diese Scheidung habe ich nie anerkannt.«
Der Anwalt kommentierte diese Aussage nicht. Stattdessen lehnte er sich zurück, wobei sein Sessel ein ächzendes Geräusch von sich gab. Dann fuhr er mit einem Streichholz unter die Nägel seiner beringten Finger.
»Sie ist eine Weiße. Normalerweise dürfen die doch gar keinen Grundbesitz in Liberia haben«, setzte Amadou seine Argumentation fort.
Matthews schmunzelte. »Ich bitte Sie. Sie selbst haben sie zu einer Liberianerin im rechtlichen Sinne gemacht, indem Sie sie hierhergeholt und geheiratet haben.« Die Wahrheit war, dass er kein großes Interesse an diesem Fall hatte, denn da gab es nichts zu holen. Auch er war abgerutscht. »M & M«, vor dem Krieg eine renommierte Kanzlei, war Opfer der Plünderer geworden. Deshalb brauchte er nun zahlungskräftige Klienten und nicht solche Habenichtse wie diesen hier. Matthews musterte geringschätzig sein Gegenüber in dem Dritte-Wahl-Secondhand-Anzug. Touré hatte ihm zwar Geld in Aussicht gestellt, falls der Prozess gewonnen werden sollte, aber wer konnte sich heutzutage noch darauf verlassen? Der Krieg hatte die Menschen verdorben, und man konnte niemandem mehr trauen. Abgesehen davon: Wie sollte er den Prozess ohne Geld gewinnen? Den Richtern musste etwas zugesteckt werden, dem Anwalt der Gegenpartei möglicherweise auch. Dieser 50-Dollar-Vorschuss, den er bekommen hatte, war einfach lächerlich. Damit konnte man nicht einmal einen Termin ansetzen. Es ging schließlich um ein Haus mit riesigem Grundstück im Wert von vielen tausend Dollar.
Amadou blickte den Anwalt mitleidheischend an. »Kann man denn da gar nichts machen?«
Matthews beugte sich nach vorn und verschränkte die Arme über dem Schreibtisch. Dabei schien er angestrengt nach einer Möglichkeit zu suchen. »Sehen Sie, Mr. Touré, ich –«, setzte er an.
»Ich habe jetzt eine Möglichkeit, an Geld zu kommen«, unterbrach Amadou. »Und ich rede nicht von Peanuts, sondern von einer richtig großen Summe.«
Matthews‛ Augen blitzten auf und sein Ton änderte sich schlagartig. »Natürlich gibt es immer Wege. Wenn Sie Geld haben, können wir das Problem auf afrikanische Weise lösen. – Aber das wissen Sie ja selbst.« Er lehnte sich wieder zurück, begleitet von dem ächzenden Geräusch, und überlegte laut. »Wenn wir den Gerichtstermin jetzt beantragen, wäre er in etwa zwei Monaten. Bis dahin ließe sich einiges zu unseren Gunsten bewegen. Wann hätten Sie denn das Geld zur Verfügung?«
Amadou überlegte kurz. »Spätestens in einem Monat.«
Der Anwalt nickte wohlwollend und drehte an einem seiner Messingringe.
#
Amadou stand für einige Minuten nachdenklich auf dem Bürgersteig. Jetzt musste das Geld fürs Flugticket her. Wenn er seine momentane finanzielle Situation betrachtete, waren die 1875 Dollar eine astronomische Summe. Aber er hatte einen Plan.
Er stoppte ein Taxi und fuhr »across«. Sie bogen von der Broadstreet ab auf die Brücke, die den Mesurado River überspannt und Downtown Monrovia mit Bushrod Island verbindet, und folgten dem United Nations Drive durch Vai Town. Kurz nachdem sie den Hafen passiert hatten, ließ Amadou den Taxifahrer vor einem Gemischtwarenladen halten. In großen Lettern stand »Singh Brothers« über die Fassade des Gebäudes geschrieben.
Rashid, ein gertenschlanker Mann in den Fünfzigern, bediente einen Kunden, als Amadou ihn ansprach. Die Freude, seinen alten Freund wiederzusehen, stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Mensch, Amadou. Ist ja eine Ewigkeit her. Komm, lass uns nach hinten ins Büro gehen. Da können wir ungestört reden.«
Rashid sprach das typische Englisch eines Inders, obwohl er sein ganzes Leben in Liberia verbracht hatte. Er gab den Angestellten rasch einige Anweisungen, dann führte er seinen Gast in den hinteren Teil des Ladens. Das kleine Büro war durch die Klimaanlage erfrischend kühl. Rashid klopfte seinem Freund jovial auf die Schulter. »Setz dich, Amadou. – Kaffee?« Ohne eine Antwort abzuwarten, goss er Wasser in die Maschine. Dann nahm er auf dem Drehstuhl hinter dem Schreibtisch Platz und betrachtete Amadou wohlwollend. »Ich habe wirklich geglaubt, dass es dich erwischt hat.«
»Hat nicht viel gefehlt«, sagte Amadou. »Ich war ein paar Monate drüben in Freetown. Die Sache hier wurde mir zu heiß.«
Rashid nickte nachdenklich. »Ja, hier war die Hölle los. Mein Geschäft ist auch geplündert worden. Die haben alles mitgenommen, sogar das Wellblech vom Dach.«
»Bist aber wieder gut auf die Beine gekommen.« Aus Amadou sprach ehrliche Bewunderung.
»War nicht einfach, aber –«
»Aber du bist eben der geborene Geschäftsmann wie alle Inder«, vollendete Amadou den Satz.
Beide Männer lachten.
Die Kaffeemaschine röchelte, als Zeichen dafür, dass das Wasser durchgelaufen war. Rashid stand auf und goss zwei Tassen ein. Dann setzte er sich wieder und zündete sich eine Zigarette an.
»Gib mir auch eine«, sagte Amadou.
»Nanu. Hattest du nicht damals geschworen, nie wieder zu rauchen?«
Amadou winkte ab. »Das war damals.«
Rashid schmunzelte und schob die Schachtel über den Tisch. Er lehnte sich zurück und inhalierte genüsslich den Zigarettenrauch. Dann nahm er einen Schluck aus seiner Kaffeetasse.
»Mensch, die alten Zeiten«, sagte Amadou. »Ob die nochmal wiederkommen? – Weißt du noch, damals unsere abenteuerliche Fahrt von Yekepa nach Monrovia?«
Rashid lachte. »Damals waren wir noch jung und knackig. Es ist so schade, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann.« Einen Moment gab er sich mit verträumtem Blick seinen Erinnerungen hin. Doch dann wurde er ernst. »Was macht Jasmin?«
Genau auf diese Frage hatte Amadou gewartet. »Wir haben gestern miteinander telefoniert. Sie ist in Deutschland.«
»In Deutschland, eh«, wiederholte Rashid für sich selbst. Von seiner anfänglichen Fröhlichkeit war nichts mehr übrig.
Amadou wurde ebenfalls ernst. »Rashid, du weißt, ich war immer dafür, dass ihr zusammenbleibt. Aber der Krieg hat alles zerstört.«
»Ich weiß nicht, was der Krieg damit zu tun hat«, sagte Rashid, darum bemüht, die Ruhe zu bewahren. »Solange ich Geld hatte, war ich gut genug. Und als diese Schweine dann alles ruiniert haben, war sie weg.«
Amadou blickte ihn eindringlich an. »Sie war und ist ein dummes Mädchen. Aber sie liebt dich immer noch – glaub‛ mir.«
»Liebe.« Rashid drückte verbittert die Zigarette aus. »Liebe ist für mich was anderes. Wir waren fünf Jahre zusammen. Die schmeißt man nicht einfach so weg.«
Rashid war ein knallharter Geschäftsmann, doch in Bezug auf Jasmin weich wie Butter. Das wusste Amadou. »Ich kann sie zu dir zurückbringen«, sagte er.
Rashids dunkle Augen blitzten auf. »Will sie denn zurückkommen?«
Amadou lächelte und blickte seinem Freund fest in die Augen. »Ich mach’ das für dich.«
#
»Zum Abschluss machen wir Kettenfauststöße«, rief der Sifu.
Die Kampfsportler nahmen Grundstellung ein und warteten auf das Kommando.
»Links, rechts. Links, rechts …« Das von den Ellbogen verursachte Geräusch, wenn sie beim Anziehen und Ausstrecken den Rumpf streiften, hörte sich an, wie eine im Gleichschritt marschierende Kompanie.
Der Sifu beobachtete seine Schützlinge aufmerksam. Obwohl dreißig Schüler vor ihm standen, entging ihm nichts. Er merkte es immer sofort, wenn jemand schlappmachte und dann versuchte, zu betrügen, wie dieser Bursche in der zweiten Reihe zum Beispiel. Er machte nur jede zweite Bewegung mit.
»Du da«, schrie der Sifu und ging wie eine Furie auf den Ertappten zu. »Bist du taub oder willst du meine Kommandos nicht hören?«
Der Junge wurde krebsrot und versuchte, trotz seiner offensichtlichen Erschöpfung wieder in den Takt zu kommen.
»Stopp!«, schrie der Sifu, der nun in seinem Element war, denn er liebte es, den Schülern zu zeigen, dass er die unumschränkte Herrschaft in dieser Übungshalle hatte. »Alles hinsetzen.«
Die dreißig Mann reagierten wie einer.
»Beine ausstrecken und anheben. Halten.«
Ich versuchte, ruhig zu atmen. Ich war lange genug dabei, um zu wissen, was uns bevorstand: So schnell würde der Sifu das Kommando zum Absetzen der Beine nicht geben. Der Mann war ein Schleifer. Er wollte seine Leute schwitzen und gegen den Schmerz ankämpfen sehen. Diejenigen, die zuerst schlappmachten, würde er mit Worten erniedrigen. Keuchen und Stöhnen war zu hören und natürlich die donnernde Stimme des Sifus. »Wer aufgibt, dem trete ich in den Arsch.«
Nach zwei Minuten gaben die Ersten auf.
Der Sifu fluchte und fragte sich laut, warum er seine kostbare Zeit mit solchen Waschlappen verplemperte. Ich ließ meinen Oberkörper etwas nach hinten fallen, sodass ich für einen Augenblick auf die stützende Hand verzichten und mir den Schweiß von der Stirn wischen konnte. Ich wusste, ich konnte locker zehn Minuten durchhalten.
Immer mehr Männer gaben auf. Der Sifu schaute auf die Uhr und schenkte denen, die durchhielten, ein aufmunterndes Lächeln. Nach sieben Minuten gab er das erlösende Kommando. Er war zufrieden. Wieder einmal hatte sich die Spreu vom Weizen getrennt. »Das war’s für heute«, sagte er und nickte dem Sihing zu, der daraufhin das Kommando übernahm.
»Aufstellung!«
Alle erhoben sich.
Als die Gruppe stillstand, verbeugte sich der Sihing vor dem Sifu und grüßte ihn.
Entsprechend dem Ritual grüßte der Sifu zurück.
Damit war das Training beendet. Von den Schülern, die schon länger bei ihm Unterricht nahmen, wie ich, verabschiedete sich der Sifu persönlich.
Der Klub in der Kölner Südstadt lag nicht weit entfernt von meiner Wohnung. Wie immer ging ich zu Fuß vom Training nach Hause. Ich fühlte mich gut – zwar matt und abgekämpft, aber total entspannt. Inzwischen war ich fast zwei Jahre dabei. Vorher war ich jahrelang ins Fitnessstudio gerannt, um mich abzureagieren. Doch das wurde eines Tages zu eintönig. Außerdem waren die Zeiten, in denen jeder aussehen wollte wie Arnold Schwarzenegger, vorbei.
Als ich aus dem Fahrstuhl kam, hörte ich schon das Klingeln des Telefons. Ich schloss schnell die Tür auf, rannte ins Wohnzimmer und nahm den Hörer ab. »Ja?«
»Martin?«, sagte eine unbekannte Männerstimme.
Ich schluckte. »Bist du das, Amadou?«
»Ja.«
Obwohl ich nie richtigen Kontakt zu meinem leiblichen Vater gehabt hatte, war mir sofort klar, dass nur er am anderen Ende der Leitung sein konnte. Er war zuletzt immer wieder Gesprächsthema zwischen mir und Jasmin gewesen. Wahrscheinlich hatte ich deshalb so schnell geschaltet.
Als kleiner Junge war mein Wunsch, einen Vater zu haben, riesengroß gewesen. Doch diese Zeit lag lange zurück. Im Laufe der Jahre hatte ich mich mit der Realität arrangiert. Meine Gefühle waren zwiespältig. Einerseits war mir dieser Mann gleichgültig. Andererseits war ich aufgewühlt, hörte ich doch zum ersten Mal in meinem Leben bewusst die Stimme meines Vaters – eine tiefe, nicht unangenehme Stimme.
»Ich bin heute Morgen in Deutschland angekommen und jetzt hier bei Jasmin. Sie hat mir gesagt, dass du praktisch um die Ecke wohnst. Kannst du heute noch kommen?« Er sprach ein gutes Deutsch, obwohl der Akzent eines Englischsprachigen herauszuhören war.
Ich zögerte. »Heute ist es schlecht. Ich muss gleich noch was erledigen.« Ich log, weil ich völlig unvorbereitet war.
»Und wann kannst du kommen?«
»Am Sonntag?«, schlug ich vor. Diese geistige Vorbereitungszeit wollte ich mir zugestehen.
»Das sind ja noch vier Tage.« Amadou klang enttäuscht. »Kannst du nicht schon am Samstag kommen?«
Als das Gespräch beendet war, starrte ich minutenlang vor mich hin. Mir schossen tausend Gedanken durch den Kopf. Irgendwann ging ich hinüber zum Wohnzimmerschrank, setzte mich auf den Fußboden und zog eine mit Fotos vollgestopfte Schublade heraus. Nach kurzer Suche wurde ich fündig: Ich hielt ein Schwarz-Weiß-Foto von meiner Mutter und Amadou in der Hand. Es war das einzige Bild, das ich hatte, auf dem meine Eltern gemeinsam zu sehen waren. Ich betrachtete es lange.
#
Als ich am Samstag zu Jasmin ging, hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. Warum ich solche Angst davor hatte, meinem Vater zu begegnen, war mir schleierhaft. Ich nahm mir dennoch vor, das Beste aus der Situation zu machen. Sollten wir uns verstehen – prima. Doch wenn nicht, wäre es auch kein Beinbruch. Ich war 32 Jahre ohne meinen Vater ausgekommen und wäre auch zukünftig dazu in der Lage. Ich atmete tief durch und drückte den Klingelknopf. Als Sekunden später die Tür aufging, stand ein kleiner, extrem dunkelhäutiger Mann vor mir. Ich wurde von meinem Vater in die Arme geschlossen. Nach kurzem Zögern erwiderte ich die Umarmung.
»Ich freue mich so«, sagte Amadou und wischte sich mit dem Handrücken die Tränen weg.
In mir stieg unwillkürlich ein Gefühl der Wärme auf. Ich war gerührt. Eine so emotionale Begrüßung hatte ich nicht erwartet.
Jasmin saß im Wohnzimmer. Sie begrüßte mich mit einem Wangenkuss. »Willst du vor dem Essen noch was trinken? Bier oder einen Kaffee?«
Ich entschied mich für Kaffee. Ich war gehemmt. Normalerweise hätte ich, ohne zu zögern, ein Bier genommen.
Jasmin verschwand in der Küche und Amadou setzte sich neben mich auf das Sofa. Er konnte den Blick nicht von mir lassen. »Du bist ja riesengroß«, sagte er bewundernd.
Ich zuckte verlegen mit den Schultern. Angesichts meiner 1,85 m hielt ich diese Aussage für arg übertrieben. Die Situation war komisch. Keiner wusste so recht, was er sagen sollte.
Das änderte sich, als Jasmin zurück ins Zimmer kam. Ihre Anwesenheit lockerte die Atmosphäre auf, und es entwickelte sich eine Unterhaltung, in deren Verlauf ich von mir und Amadou aus seinem Leben erzählte. Nach weniger als einer Stunde kam es mir so vor, als ob ich den Mann, der da neben mir saß, schon seit Langem kennen würde. Und das Wichtigste: Er war mir sympathisch. Für mich gab es nur ein Problem: Das Wort »Vater« wollte mir nicht über die Lippen gehen. Stattdessen redete ich Amadou mit „Du“ und einige Male sogar in der dritten Person an.
Amadou wirkte drahtig und fit. Für sein Alter schien er definitiv gut drauf zu sein. Was mir ebenfalls auffiel, war der etwas protzig wirkende Siegelring an Amadous rechter Hand, was dem positiven Gesamteindruck jedoch keinen Abbruch tat.
Der Nachmittag verging wie im Flug und als ich am Abend Abschied nahm, war ich glücklich, meinen Vater kennengelernt zu haben.
#
Die Hunde liefen wild bellend neben dem Toyota Land Cruiser her. Der fuhr langsam durch die von Kokospalmen gesäumte Allee. In dem von einer hohen Mauer umgebenen Grundstück hätten locker drei Fußballfelder Platz gehabt. Die Hütten der Arbeiter standen direkt am Eingangstor, während sich das Herrenhaus am anderen Ende des Anwesens befand.
Die Hunde sprangen knurrend und bellend an dem Fahrzeug hoch, als es davor hielt. Colonel Junior Wonkpa – seines Zeichens Polizeichef von Yekepa, Nimba County – zog es vor, nicht auszusteigen. »Drück mal auf die Hupe«, befahl er seinem Fahrer.
Kurz darauf kam eine Frau mittleren Alters aus dem Haus. Sie trug Shorts und ein T-Shirt. Ihr kurz geschnittenes Haar war von der Sonne gebleicht. Die von unzähligen Sommersprossen übersäte Haut ließ sie gesund und sportlich erscheinen. »Babette, Dodo, Rico. Los, rein mit euch«, rief sie autoritär.
Die Hunde ließen widerwillig von dem Land Cruiser ab und verschwanden.
Nun traute sich der Colonel. Er stieg aus und ging mit ausgebreiteten Armen auf die Hausherrin zu. »Claudia, wie geht es dir?« Er sprach Gio, die Sprache einer der in dieser Region ansässigen Stämme.
»Hallo, Junior. Schön, dass du so schnell kommen konntest«, sagte Claudia ebenfalls auf Gio und ließ sich drei Begrüßungsküsse auf die Wangen drücken.
Der Colonel drehte sich um und beschrieb mit dem Arm einen Halbkreis. »Dein Grundstück ist ein Paradies. Und du hast wirklich gute Wächter. Ich möchte deinen Hunden nicht ausgeliefert sein.«
Claudia lachte. »Wenn ich dabei bin, tun sie nichts. Übrigens, Babette wird bald werfen. Ich kann dir einen Welpen geben.«
»Das wäre zu schön«, sagte der Colonel.
Claudia machte eine einladende Geste. »Komm. Lass uns reingehen. Hier draußen ist es zu heiß.« Sie führte ihren Gast in das große, einfach eingerichtete Wohnzimmer. Obwohl die Klimaanlage nicht lief, hatte sich eine wohltuende Kühle gehalten. »Willst du ein Bier?«
Junior bejahte.
Claudia verschwand kurz und kam mit zwei Dosen in der Hand zurück.
Die beiden verdankten sich gegenseitig einiges. Claudia hatte ihn nach einem schweren Arbeitsunfall lange gepflegt und wieder aufgepäppelt. Ende der Achtzigerjahre verschwand Junior plötzlich. Er war von den Rebellen angeworben worden und verbrachte einige Jahre in militärischen Ausbildungscamps in Mali und Libyen. Mit dem Krieg kam auch er wieder zurück nach Yekepa. Er gehörte zum harten Kern der Charles-Taylor-Truppe. Diesem Umstand verdankte Claudia möglicherweise ihr Leben, mit Sicherheit aber die Tatsache, dass sie immer noch ihr Hab und Gut besaß, denn Junior stellte seine »zweite Mutter« unter seinen persönlichen Schutz. Durch ihn wurde der Krieg für sie zum Glücksfall. Als die Einheimischen ihre Städte und Dörfer nur noch mit Sondererlaubnis der Rebellen verlassen durften, holte sie Waren aus dem benachbarten Guinea und verkaufte sie in Nimba County. Den Erlös investierte sie in die Plantage und in ein Fuhrunternehmen.
Claudia war glücklich mit dem Leben, das sie führte. Sie hatte die afrikanische Mentalität vorbehaltlos angenommen. Gleich als sie sich mit Amadou in Yekepa niederließ, fing sie an, Gio zu lernen. Schon wenige Jahre später beherrschte sie die Sprache, ein Umstand, der ihr den Respekt der Einheimischen einbrachte.
»Willst du ein Glas?«
Junior machte eine abwehrende Geste. »Aus der Dose schmeckt’s immer noch am besten.« Er zog den Verschluss zurück, was von einem zischenden Geräusch begleitet wurde, führte die Dose zum Mund und ließ den herrlich kalten Gerstensaft genüsslich seine Kehle hinunterlaufen. Dann betrachtete er die Beschriftung der Dose. »Deutsches Bier ist einfach köstlich. Wie läuft das Geschäft?«
»Alles bestens. Ich schicke jede Woche zwei Ladungen nach Monrovia«, sagte Claudia.
»Kommt man denn jetzt noch durch bei diesem Schlamm?«, fragte Junior.
»Ich habe mir vor der Regenzeit einen DAF-Allrad gekauft. Der kommt überall durch«, sagte Claudia.
Junior nickte zustimmend und nahm einen weiteren Schluck aus der Bierdose. »Was kann ich für dich tun?«
Claudia deutete auf den Brief, der auf dem Tisch lag.
Junior nahm ihn und las. Als er fertig war, schüttelte er missmutig den Kopf. »Er hat also schon wieder einen Termin ansetzen lassen. Unglaublich.«
Wie die meisten Bürger von Yekepa konnte auch er Claudias Ex-Ehemann nicht ausstehen. Amadou hatte sich immer als etwas Besseres gefühlt und dies die Leute auch spüren lassen. Schon allein deswegen standen später, als der Rosenkrieg zwischen Claudia und ihm öffentliches Gesprächsthema wurde, alle auf ihrer Seite. »Dieser Spinner gibt wohl nie auf.«
»Das war schon immer sein Problem«, sagte Claudia. »Der Mann weiß nie, wann er verloren hat.« Sie führte nachdenklich die Bierdose zum Mund.
#
Der Chef kam aus dem Büro, durchquerte die Halle und kam herüber zu der Hebebühne, an der ich arbeitete. »Die Leute rennen mir die Bude ein. Wir müssen die Mittagspause verschieben«, sagte er mit einer dramatischen Geste und sah mich an, um meine Reaktion abzuwarten. Ich setzte meine Arbeit fort, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
»Was hast du an dem hier noch zu machen?«
»Bremsklötze vorn und Ölwechsel«, sagte ich.
Der Chef seufzte und blickte auf die Uhr. »Kannst du mit dem in einer halben Stunde fertig sein?«
»Glaub’ schon.«
»Das ist gut. Ich habe noch ein Taxi mit vier Reifen. – Du weißt ja, die haben’s immer eilig. Danach kannst du von mir aus in die Pause gehen.« Nach diesen Worten hetzte der Chef zurück in sein Büro.
Ich grollte vor mich hin. Diese Arbeit machte mir keinen Spaß mehr. Ich kam zwar im Großen und Ganzen gut mit meinem Chef aus, doch inzwischen wurde zu viel als selbstverständlich angesehen. Ich arbeitete lustlos weiter und holte das Taxi rein. Als ich damit fertig war, ging ich hinauf in den Aufenthaltsraum, um meine Mittagspause nachzuholen. Ich saß noch nicht lange, als ein Kollege heraufkam. »Da will dich einer sprechen – ein, ähm, Neger.«
Ich wusste sofort, wer das nur sein konnte. Als wir am Wochenende zuvor über meine Arbeit gesprochen hatten, deutete Amadou an, dass er mal vorbeischauen wolle.
Ich musste ihn einige Minuten suchen; fand ihn schließlich vor einem der Ablageboxen für die Altreifen.