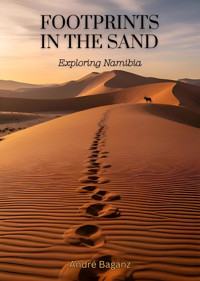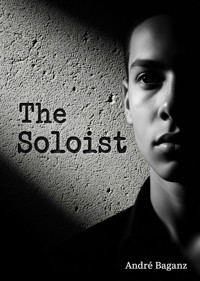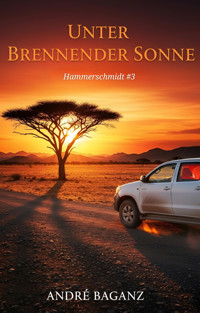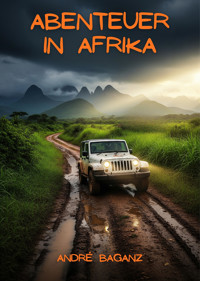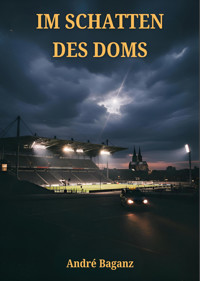4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Max Hammerschmidt, ein vom Leben gezeichneter Mann, dessen Seele immer noch von der schmerzhaften Ungewissheit über das Schicksal seiner Tochter Anne-Marie gezeichnet ist, versucht, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch die Geister der Vergangenheit lassen ihn nicht los. Als er den Auftrag erhält, eine vermisste Person aufzuspüren, ahnt er nicht, dass dieser Fall ihn direkt in die Abgründe seiner eigenen Vergangenheit katapultiert. Im Angesicht des Todes ist der packende zweite Teil der Hammerschmidt-Reihe, ein atemloser Thriller, der Sie bis zur letzten Seite fesseln wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Title Page
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Alte Wunden
Ein Wiedersehen
Galway
Tödlicher Verrat
Connemara
Überlebenswille
Ein Schritt nach vorn
Im sicheren Versteck
Familien-Bande
Neue Energie
Auf der Zielgeraden
Ohne Rücksicht auf Verluste
Unerwartete Wendung
Ermittlungen in Belgien
Dem Ziel so nahe
Ein unberechenbarer Gegner
Auch von diesem Autor
Guide
Contents
Start of Content
Impressum
André Baganz c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
*
Covergestaltung mit NightCafé Studio
Im Angesicht des Todes
Hammerschmidt #2
André Baganz
Copyright © 2025 André Baganz
Alle Rechte vorbehalten.
DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT
ICH BLINZELTE IN der Dunkelheit und versuchte, meine Umgebung zu erkennen. Ich lauschte und suchte nach Konturen. Nach etwa hundert Metern traten die schemenhaften Silhouetten einiger flacher Gebäude hervor – still wie verlassene Kulissen. Es waren die Souvenirläden. Als wir noch ein paar Meter weitergegangen waren und ich den Blick hob, sah ich einen monumentalen Eingang. Über diesem prangte der Schriftzug „Besucherzentrum“ – eingefasst in den Hang, als wäre er selbst ein Echo der Gesteinsformation. Alles sah genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Gedanken an den Tag, an dem Antoine mich hierherbrachte, durchfluteten meinen Geist. Damals, als ich die gewaltige Klippenlandschaft zum ersten Mal sah, war ich beeindruckt von der schieren Unendlichkeit und der unbändigen Kraft der Natur.
Was ich nicht in meinen kühnsten Träumen für möglich gehalten hatte, war nun Realität. Getrieben von den Launen eines unbarmherzigen Schicksals fand ich mich genau an diesem Ort wieder. Der Wind zerrte gierig an meiner Kleidung, Regentropfen peitschten quer durch die Finsternis und trafen mein Gesicht, während ich die Betonstufen hinaufstieg, die zur Aussichtsplattform führten. Die Luft wurde im Aufstieg rauer, und ein stürmischer Aufruhr brachte mich beinahe aus dem Gleichgewicht. Meine Gedanken rasten – ein wilder Strudel voller Reflexion und Antizipation, als ich die Umstände evaluierte, die mich hierher zum möglichen Finale meiner Odyssee gebracht hatten. Konnte es sein, dass gerade an diesen schroffen Klippen mein letzter Akt gespielt werden würde? War das das Ende meiner Reise?
Doch mitten im Aufruhr dieses inneren Monologs fand ich eine Art Trotz, eine feurige Glut. Verdammte Heidi, schimpfte ich innerlich, du bist an allem schuld. Sie war es, die mich in diese Situation hineinmanövriert hatte, aber ich widersprach mir sofort und erkannte mich als Gestalter meines eigenen Schicksals. Die Schuld bei anderen zu suchen, war zu billig. Außerdem war es noch nicht vorbei. Meine Entschlossenheit zum Überleben war nicht gebrochen; solange ich atmete, war ich der Regisseur meines nächsten Schrittes. „Deine Geschichte ist noch lange nicht zu Ende geschrieben“, murmelte ich trotzig gegen den wütenden Sturm. Während ich mich entschloss, nicht aufzugeben, hörte ich ein rüdes Kommando über den pfeifenden Wind: „Geh schneller, Nigger! Beweg deinen verdammten Arsch!“ Eine brutale, drängende Gewalt schubste mich vorwärts – ein kränkender Aufprall, der jedoch nur meine Entschlossenheit stählte.
ALTE WUNDEN
DIE VENLOER STRASSE in Köln-Ehrenfeld war wie immer belebt. Ich saß in meinem geparkten Auto, meine Aufmerksamkeit auf ein Geschäft etwa 30 Meter entfernt gerichtet. Über dem Schaufenster prangte der Schriftzug Bernies Magazin. Kunden betraten und verließen den Laden. Gelegentlich warf ich einen Blick auf mein Handy, in der Hoffnung, dass es endlich klingeln würde. Als ein Umzugswagen an mir vorbeifuhr, wanderten meine Gedanken zu dem Thema, das mich in den letzten Tagen am meisten beschäftigt hatte: mein Umzug. Das Haus, in dem Claudia, Anne-Marie und ich gewohnt hatten, war endlich verkauft. Nun wollte ich ernsthaft den Erwerb einer Wohnung, vielleicht sogar eines Hauses, in Angriff nehmen. Während ich weiterhin auf den Eingang von Bernies Magazin starrte, lauschte ich meinem inneren Dialog.
Du lebst schon viel zu lange bei deinen Eltern.
Willst du damit sagen, dass es dir bei ihnen nicht mehr gefällt?
Im Gegenteil. Mir gefällt's dort hervorragend. Ich muss mir um nichts Sorgen machen: Mutter kümmert sich um alles. Sie kauft ein, wäscht meine Wäsche und putzt sogar mein Zimmer.
Und was genau passt dir dann nicht? Warum willst du ausziehen?
Weil ich finde, dass ein Mann von Anfang 40 nicht bei seinen Eltern, sondern in seinen eigenen vier Wänden leben sollte. Außerdem möchte ich auch weg aus Köln.
Weg aus der Stadt, in der du geboren und aufgewachsen bist? Der Ort, mit dem dich so viele schöne Erinnerungen verbinden? Was hast du gegen die Stadt?
Nur die Kleinigkeit, dass sich in ihr die größte Tragödie meines Lebens abgespielt hat und ich ständig daran erinnert werde. Ich kann einfach nicht länger hier sein. Es passiert so oft, dass ich eine Straße entlanggehe und plötzlich an Anne-Marie denken muss. Dann höre ich ihre kindliche Stimme in meinem Kopf. Einfach aus dem Grund, weil wir zusammen irgendwann mal dort waren: tausend Orte. Da ist das italienische Eiscafé, das wir so oft besucht haben, oder der Puppenladen, den sie so liebte, der Botanische Garten, der Zoo, die Seilbahn, die Rheinpromenade … verdammt, ich spüre schon wieder, wie meine Augen feucht werden. Diese ganze verdammte Stadt erinnerte mich an sie. Aber ich möchte diese Erinnerungen endlich hinter mir lassen, weil sie mir nichts als Schmerz bringen. Obwohl mir die Idee nicht gefällt, muss ich in meinem eigenen Interesse das Thema Anne-Marie endlich abschließen. Es sind jetzt vier Jahre.
Du glaubst also nicht, dass sie noch lebt?
Lass mich verdammt noch mal in Ruhe! Was soll diese Frage?
Ich spürte, wie sich meine Hand zur Faust ballte. – Vier lange Jahre. Jeden Tag sagte ich mir, dass ich die Hoffnung nicht aufgeben darf, aber gleichzeitig war es genau diese Hoffnung, die mich nicht vergessen ließ, die mich lähmte und immer wieder nach unten zog. Es war wie ein nie endender Kreislauf, den ich endlich durchbrechen musste. Mittlerweile hatte ich gelernt, mit diesem Dauerschmerz zu leben. Ich hatte alles relativ gut im Griff. Aber es war klar, dass dieses schwarze Loch, diese Leere, die Maries Verschwinden in mir hinterlassen hatte, niemals ganz verschwinden würde. Dennoch wollte ich gegensteuern und alles vermeiden, was die alten schmerzhaften Erinnerungen zurückbrachte. Ein Umzug aus der Stadt wäre eine Art Selbstüberlistung. Außerdem brauchte ich die Stadt nicht mehr. Ich brauchte kein Büro mehr in bester Lage, da ich inzwischen über einen großen Kundenstamm und hervorragende Bewertungen bei Google verfügte. Den Großteil meiner Aufträge bekam ich ohnehin von der Versicherungsgesellschaft, bei der mein Schwager arbeitete. Und soweit ich wusste, hatte er nicht vor, dort in absehbarer Zeit aufzuhören. Inzwischen musste ich sogar öfter Jobs ablehnen, weil ich die viele Arbeit kaum noch bewältigen konnte. Die Miete für das teure Büro konnte ich mir auf jeden Fall sparen. Praktisch alles konnte ich von zu Hause erledigen. Das Einzige, was ich brauchte, waren mein Handy und das Internet … Ein Pington meines Handys riss mich aus den Gedanken. Ich schaute auf den Bildschirm und öffnete die E-Mail, die gerade angekommen war. Sie war von meinem Makler. Er hatte mir ein Dutzend Angebote geschickt. Ich scrollte sie ziemlich schnell durch, weil keins dabei war, das mein Interesse weckte. Beim letzten Angebot blieb ich jedoch hängen – ein Einfamilienhaus in Eupen. Obwohl die Stadt direkt hinter der belgischen Grenze mit Sicherheit nicht zum Kölner Raum gehörte, was eigentlich eine meiner Bedingungen gewesen war, war sie dennoch gut erreichbar. Praktisch die gesamte Strecke von Köln nach Eupen ist Autobahn. Du fährst einfach nur die A4 Richtung Aachen und dann noch ein paar Minuten auf der A44. Und schon bist du am Ziel. Ohne Stau schaffst du das locker in 40 Minuten. Hmm … Ich schwelgte in Erinnerungen. Eupen kannte ich aus meiner Kindheit und ich hatte nur schöne Erinnerungen an die Weserstadt. Meine Eltern waren oft mit mir zum Wandern und Skifahren im Hohen Venn, das nur wenige Kilometer hinter der Stadt beginnt. Als Stadtkind war ich von der urigen Natur fasziniert. Ich dachte verträumt an unsere Ausflüge zurück, bei denen wir über endlose Stege im Hochmoor gelaufen waren und dann irgendwann Halt machten, um zu picknicken. Damals war ich zwischen 10 und 13 Jahre alt. Die Erinnerung an diese Zeit war märchenhaft. Während ich vor meinem geistigen Auge alles in leuchtenden Farben sah, lächelte ich vor mich hin. Wenn du in Eupen wohnen würdest, hättest du das Venn direkt vor der Haustür. Und was Belgien betrifft – immerhin bist du ein halber Belgier.
Als ich mir die Fotos von dem Haus und dem Grundstück ansah, war ich begeistert. Das Haus hatte zwei Stockwerke und einen ziemlich großen Garten auf der Hinterseite. Am interessantesten war jedoch der Preis. Der war für diese Größe und zentrale Lage ungewöhnlich niedrig. Im Raum Köln kostete die gleiche Immobilie fast das Doppelte. Ich entschloss mich sofort, das Haus zu besichtigen. Also schrieb ich dem Makler sofort eine E-Mail mit der Bitte um einen Termin. Ich hatte die E-Mail gerade abgeschickt, als mein Handy klingelte. Der Anruf kam von Bernie. Endlich! Ich drückte die Annahmetaste.
„Junger Mann, Türke. Er verlässt gerade den Laden; hat das Gewehr bei sich.“
Ich nahm den Blick nicht von der Eingangstür von Bernies Magazin. Wenige Sekunden später trat ein fitter junger Mann mit zurückgekämmten schwarzen Haaren heraus. In der Hand hatte er eine Gewehrtasche. Wegen des starken Verkehrs musste er eine Weile warten, bis er die Straße überqueren konnte. Ich sah, wie nur wenige Meter von mir entfernt die Warnblinker eines tiefergelegten Audi V8 aufleuchteten. Auf den ging er auch zu. Der Wagen passte zu ihm. Ich war überrascht, dass ich ihn nicht bemerkt hatte, als er den Laden betrat. Wahrscheinlich war er hineingegangen, als ich mit meinen Gedanken im Hohen Venn gewesen war. Als ich den Motor startete, hörte ich Bernies Stimme über die Lautsprecheranlage.
„Es ist definitiv die G 98, von der Sie mir erzählt haben. Ich habe die Markierung am Kolben gesehen. Er sagte, dass es ein Erbstück seines Urgroßvaters sei und wollte 1500 Euro dafür. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Waffe nur unter Vorlage des Waffenscheins kaufen kann. Ich könnte mich aber umhören nach Käufern, die die Waffe auch ohne Papiere kaufen würden. Er hat mir seine Nummer gegeben, damit ich ihn kontaktieren kann, sobald ich einen Käufer gefunden habe.“
Ich hatte nicht wirklich gedacht, dass ich dem Täter so schnell auf die Spur kommen würde. Das mit Bernie war mehr oder weniger ein Versuch gewesen. Ich machte die Beckerfaust. Ein super Start in die neue Woche. „Gut gemacht, Bernie. Du kannst dir sicher sein, dass nichts darauf hindeuten wird, dass du mir den Tipp gegeben hast. Musst also keine geschäftlichen Nachteile befürchten.“
„Danke, Herr Hammerschmidt, das weiß ich und deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen. Wenn Sie meine Hilfe erneut benötigen, bin ich jederzeit für Sie da.“
Nachdem der junge Mann die Waffentasche im Kofferraum des Audis verstaut hatte, stieg er ein und fuhr davon.
Ich folgte ihm. Da er einen flotten Fahrstil hatte, war es nicht so einfach, mit ihm mitzuhalten. Es gelang mir jedoch. Irgendwann, nachdem er durch halb Köln gefahren war, blieb er vor einer Spielhalle stehen. Er stieg aus und ging hinein – ohne das Gewehr, was mich beruhigte.
Nach ein paar Minuten folgte ich ihm in die Spielhalle. Der junge Mann unterhielt sich mit der Kassenaufsicht, einer gut aussehenden Dame. Die beiden schienen sich zu kennen. Aus dem Gespräch entnahm ich, dass der junge Mann offensichtlich Stammkunde war. Später unterhielt er sich mit einigen anderen Leuten, die ziemlich zwielichtig aussahen. Dann setzte er sich an einen Automaten und spielte mit angespanntem Gesichtsausdruck.
Um nicht aufzufallen, stellte ich mich selbst eine Weile vor einen Automaten und spielte. Anschließend ging ich zurück zu meinem Auto in der Hoffnung, dass ich nicht allzu lange warten müsste. Mein Plan war, dem jungen Mann weiter zu folgen und ihm bei der erstbesten Gelegenheit das Gewehr ohne viel Aufhebens abzunehmen. Aufgrund seines Zwischenstopps in der Spielhalle war es nahezu unmöglich, dass er meine Aktion mit Bernies Magazin in Verbindung bringen konnte. Insofern war ich auf der sicheren Seite. Während ich im Auto wartete, hörte ich einen weiteren Pington von meinem Handy. Es war die Antwort-E-Mail meines Immobilienmaklers. Er schlug einen Besichtigungstermin für den nächsten Tag um 14 Uhr vor, den ich bestätigte.
Die Zeit verging und meine Hoffnung erfüllte sich nicht, denn meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Der junge Mann kam einfach nicht wieder aus der Spielhalle heraus. Sein geparktes Auto hatte ich im Auge, sodass ich sicher sein konnte, ihn beim Verlassen der Spielothek nicht zu verpassen. Nach drei langen Stunden war es endlich so weit: Der junge Mann kam heraus. Für mich war klar, dass er an Spielsucht litt. Er stieg in seinen Audi und schlug mehrmals wütend mit den Fäusten aufs Lenkrad, bevor er mit quietschenden Reifen wegfuhr. Ich ging davon aus, dass er verloren hatte. Anschließend fuhr er erneut durch die halbe Stadt, dieses Mal allerdings auf die andere Rheinseite. In Westhoven erreichte er endlich sein Ziel. Dort fuhr er auf den Parkplatz eines Apartmenthauses. Ich tat es ihm gleich und parkte direkt neben ihm. Als er ausstieg, schaute er wütend zu mir herüber. Es sah so aus, als wollte er etwas sagen, doch dann änderte er seine Meinung.
Lächelnd neben meinem Auto stehend, beobachtete ich, wie er den Kofferraum öffnete und die Gewehrtasche herausholte. Schließlich trafen sich unsere Blicke. Es hatte den Anschein, als würde er vor Wut explodieren, als er mich ansprach. Seine Worte schnitten wie ein Messer durch die Luft. „Was glotzt du so? Hast du nichts Besseres zu tun?“
„Vielleicht“, sagte ich.
„Hör zu, Alter, ich habe dich hier noch nie gesehen. Also gehe ich davon aus, dass du auch nicht hierhergehörst. Das hier ist ein Privatparkplatz! Den dürfen nur Bewohner des Hauses benutzen.“
Weiterhin lächelnd trat ich näher an ihn heran. „Ich bin hier, um etwas abzuholen. Bin gleich wieder weg“, sagte ich ruhig.
„Dann beeil dich und verpiss dich wieder!“, knurrte er und fügte leise hinzu: „Arschloch!“
Ich spürte einen Adrenalinstoß, als ich mich auf ihn stürzte und meine Faust gegen seinen Unterkiefer rammte. Bei ihm gingen direkt die Lichter aus und er fiel zu Boden. Während er fiel, riss ich ihm die Gewehrtasche aus der Hand. „Der Eigentümer möchte seinen Besitz zurück haben. Vielen Dank.“ Ich beugte mich über ihn und fügte hinzu: „Und übrigens, wir haben noch nicht zusammen Schweine gehütet. Also duze mich nicht.“
Als er versuchte, mit einer Hand nach mir zu greifen, packte ich sie und verdrehte sie. „Hast du das kapiert?“
Er schrie vor Schmerz auf.
„Antworte mir“, sagte ich und verdrehte ihm das Handgelenk weiter.
„Ja, ja. Ich hab's kapiert“, schoss es aus ihm heraus.
Ich ließ ihn los, drehte mich um und ging zu meinem Auto. Als ich eingestiegen war, sah ich, wie er versuchte aufzustehen, was ihm allerdings nicht gelang. Im Rückspiegel sah ich, wie er mit verwirrtem Gesichtsausdruck hinter mir herschaute.
*
Schröders Blick wanderte zu der schmalen Gewehrtasche in meiner Hand, und ein ungläubiges Lächeln breitete sich in seinem runden Gesicht aus. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. „Nein“, sagte er mit ehrfürchtiger, fast flüsternder Stimme.
Ich nickte. „Doch.“
„Das ging ja verdammt schnell“, sagte er und schüttelte langsam den Kopf. Ein paar graue Haarsträhnen fielen ihm in die Stirn.
Ich zuckte bescheiden mit den Schultern. „So arbeite ich.“
Er bedeutete mir mit einer ruckartigen Handbewegung, einzutreten und machte Platz, dass ich an ihm vorbeikam. Der Geruch von Bohnerwachs und altem Holz lag in der Diele. „Wie haben Sie das geschafft?“
Ich überlegte einen Moment, ließ den Blick durch den hohen Flur schweifen. Dann sagte ich: „Man hat so seine Strategien, um die Herausforderungen zu meistern, die auf einen zukommen.“
Er lächelte vielsagend, ein Glitzern in den Augen. „Die haben Sie wohl.“
„Es hilft, wenn man versucht, sich in die Kriminellen hineinzudenken“, fügte ich hinzu und klopfte mir unbewusst die Staubkörner vom Ärmel meiner Jacke. „Außerdem habe ich ein paar Verbindungen in gewisse Kreise.“
Schröders Augen verengten sich noch mehr bei dem Versuch, zu entschlüsseln, was ich meinte. „Ach ja?“
Ich räusperte mich, bevor ich fortfuhr. „Die Einbrecher konnten das Ding nicht über das Internet verkaufen – zu riskant, zu auffällig. Deshalb war ich mir sicher, dass sie sich an einen Hehler wenden würden. Jemanden mit einem stillen Lager und diskreten Kunden.“
Er nickte als Zeichen, dass er verstanden hatte, die Hände in den Hosentaschen vergraben.
„Zufälligerweise kenne ich einen solchen Hehler, der mir noch einen Gefallen schuldet“, sagte ich. „Und den habe ich gebeten, mich sofort zu kontaktieren, falls ihm jemand ein Gewehr dieses speziellen Modells und Kalibers anbieten würde. Ich hatte nicht viel Hoffnung, es könnte Wochen dauern... aber das Gewehr wurde ihm tatsächlich gestern Abend angeboten.“
„Glück gehört dazu“, sagte Schröder mit einem deutlichen Anflug von Bewunderung. Er war offensichtlich beeindruckt, sein Blick hing an der schwarzen Tasche.
Ich zuckte erneut mit den Schultern. „Man macht sein eigenes Glück.“
„Kommen Sie“, sagte er und winkte mich energisch weiter. „Ich will Ihnen mal was zeigen. Ich meine, wenn Sie etwas Zeit haben.“
„Die habe ich“, sagte ich und folgte ihm durch den Flur mit seinen dunkel gestrichenen Türen. Das Parkett knarrte leise unter unseren Schritten.
Schröder öffnete die erste Tür links und gab den Blick auf eine großzügige Wohnküche frei. Ich ging hinein und ließ den Blick neugierig schweifen. Der Raum war geschmackvoll mit hellen Hölzern und gedeckten Tönen eingerichtet, strahlte eine warme, heimelige Atmosphäre aus. Auf dem Herd stand ein großer, blauer Emaille-Topf.
„Sehr schön“, sagte ich, nicht nur, weil ich mir sicher war, dass er das von mir hören wollte. Es war wirklich gemütlich.
Schröder bedankte sich mit einem kurzen Lächeln. Dann führte er mich zurück in den Flur und öffnete die nächste Tür mit einem leisen Knarren der Angeln. Dieses Mal betraten wir eine alte, aber gut erhaltene Bibliothek – Bücherregale aus dunklem Eichenholz säumten alle vier Wände vom Boden bis zur Decke. Eigentlich sah es so aus, als seien die Bücher die Wände. Der Geruch von Leder und altem Papier war intensiv. Ich stieß einen anerkennenden Pfiff aus. „Echt beeindruckend!“
Schröder nickte stolz. „Die meisten dieser Bücher sind noch von meinem Vater. Der hat unwahrscheinlich viel gelesen“, sagte er, bevor er sich abrupt zu mir umdrehte und erwartungsvoll seine Hand ausstreckte. Die Spannung stand ihm plötzlich wieder ins Gesicht geschrieben. „Ich nehme das Gewehr.“
Ich reichte ihm ohne Zögern die Gewehrtasche. Seine Finger umschlossen sie fest. Er zog die Waffe vorsichtig heraus, fast ehrfürchtig, und drehte sie sofort, um nach den drei kleinen, unscheinbaren Kerben im dunklen Holz des Gewehrkolbens zu suchen – den Markierungen, die zweifelsfrei bestätigten, dass es sich tatsächlich um sein gestohlenes Familienerbstück handelte. Sie waren da, eingraviert wie winzige Narben. Für einen Moment herrschte Stille, während Schröder regungslos auf die Kerben starrte. Seine Atmung schien angehalten. „Ja... das ist es“, sagte er schließlich und stieß einen tiefen, zittrigen Seufzer der Erleichterung aus. Einen Moment lang betrachtete er die Waffe liebevoll, strich fast zärtlich mit dem Daumen über den Lauf. Dann inspizierte er sie fachmännisch von allen Seiten, prüfte den Verschluss, richtete die Kimme, um sicherzugehen, dass die Diebe auch nichts beschädigt hatten. Das war offensichtlich nicht der Fall. Schließlich schloss er die Augen, presste die Lippen fest auf den kühlen Stahl des Laufs, bevor er es vorsichtig, fast andächtig, zurück in die gepolsterte Tasche schob. Dann sah er mich an, und ein breites, echtes Grinsen überzog sein Gesicht. „Sie können sich nicht vorstellen, wie dankbar ich Ihnen bin ... Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Rest des Hauses. Seit dem Auszug unserer Tochter lebe ich hier allein mit meiner Frau. Sie ist im Moment nicht da ... Die wird staunen, wenn sie zurückkommt.“ Er führte mich eine knarzende Holztreppe hinauf ins Obergeschoss. An der Wand hingen mehrere gerahmte Fotos in ungleichmäßigen Abständen. Oben angekommen, blieb Schröder vor einem schmalen Fenster im Flur stehen. Ich schaute hinaus und sah den großen, leicht verwilderten Garten auf der Rückseite des Hauses und das flache, mit Bitumenbahnen gedeckte Dach eines niedrigen Schuppens, der an das Haus angebaut war.
„Die sind über das Dach da gekommen“, sagte Schröder und deutete auf den Schuppen, „und haben dieses Fenster aufgehebelt.“ Er drückte den weißen Griff nach unten und öffnete das Fenster knarrend. Nun war der frische Schaden am äußeren Rahmen sichtbar – tiefe Kratzer und abgesplittertes Holz um das Schloss. „Morgen früh wird ein neues Fenster eingebaut. Mit der Versicherung gibt es Gott sei Dank keine Probleme. Die ersetzen alles.“
Ich sah ihn überrascht an. „Warum haben Sie mich dann beauftragt, wenn Sie ohnehin alles ersetzt bekommen?“
„Fast alles“, korrigierte Schröder und schloss das Fenster wieder mit einem entschiedenen Ruck. „Wir hatten zwei Laptops, einen Computer und drei Flachbildschirme. Die und ein paar andere Elektrogeräte haben sie mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass sie darauf spezialisiert sind. Ansonsten haben die sich für nichts interessiert – außer für das hier.“ Er klopfte auf die Gewehrtasche. „Es stand in einer Ecke meines Arbeitszimmers. Ich schätze, dass sie es zufällig gesehen haben. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Wie gesagt, die Versicherung hätte das bezahlt. Der tatsächliche Wert liegt aber viel höher. Für mich ist das Gewehr unersetzlich, weil es ein Erbstück von meinem Urgroßvater ist. Der hat damit im Ersten Weltkrieg gekämpft.“ Er öffnete die Tür direkt gegenüber dem Fenster. „Das ist das Zimmer unserer Tochter. Sie studiert in Berlin und lebt dort in einer Wohngemeinschaft. Wir lassen alles hier so, wie es ist, damit sie sich wohlfühlt, wenn sie nach Hause kommt. Sie hätte hier in Köln studieren können, aber sie wollte unbedingt weg.“ Er winkte ab, ein Hauch von Resignation in seiner Stimme. „Na ja, die jungen Leute von heute sind anders als wir. In unserem Fall kommt noch dazu, dass wir erst mit Mitte vierzig Eltern geworden sind. Vom Alter her könnten wir locker ihre Großeltern sein.“
Ich nickte als Zeichen, dass ich zuhörte, und blickte mich im schmalen Zimmer um. Es war nichts Besonderes: ein typisches, in der Zeit stehengebliebenes Mädchenzimmer mit vielen Plüschtieren auf dem Bett und Postern von Bands an den Wänden. Die vorherrschende Farbe war ein verblasstes Rosa. Staub lag auf den Regalen.
„Heutzutage können sich junge Menschen nicht mehr vorstellen, dass es früher kein Internet gab“, fuhr Schröder fort, als stünde er noch unter dem Eindruck des Gewehrs und brauche nun den Redefluss. „Ohne ihre Handys können sie überhaupt nicht mehr leben. Sie starren den ganzen Tag darauf. Eine Freundin unserer Tochter wurde vor einem Jahr von einem Auto angefahren und schwer verletzt, weil sie beim Überqueren der Straße gebannt auf ihr Handy geschaut hat. Soweit ist es schon gekommen.“
Ich nickte erneut, ein kurzes, knappes Kopfnicken, was er als Aufforderung zum Weiterreden auffasste. „Vor dem Einbruch mussten wir schon einen anderen Schock verarbeiten“, fuhr Schröder fort und lehnte sich gegen den Türrahmen. „Ich meine mich und meine Frau. Vor etwa zwei Monaten. Nach einem großen Einkauf sind wir am Neumarkt in ein Taxi gestiegen – ich vorn neben dem Fahrer, meine Frau hinten. Dem Fahrer habe ich in diesem Moment keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe die Adresse genannt, ohne ihn richtig anzuschauen. Er rührte sich nicht. Als er nicht losfuhr, schaute ich schließlich zu ihm hinüber. Es sah so aus, als würde er schlafen, den Kopf nach vorn gesunken. Also räusperte ich mich laut, um ihn aufzuwecken. Keine Reaktion. Da ich nicht wusste, wie ich ihn wachbekommen soll, stupste ich ihn leicht an der Schulter an. Da fiel er einfach nach vorn und schlug mit der Stirn hart auf das Lenkrad auf. Der war tot – also nicht, weil er mit dem Kopf aufgeschlagen war, sondern schon vorher. Der hatte eine ganze Weile tot in seinem Auto gesessen. Stellen Sie sich das mal vor.“
Ich verstand den Zusammenhang nicht ganz, heuchelte dennoch Interesse und runzelte die Stirn: „Das ist ja unglaublich.“
„Nicht?“, sagte Schröder und schien die Szene noch einmal vor sich zu sehen. „Ich hatte die Sache relativ gut weggesteckt, aber meine Frau... die hat fast einen Herzinfarkt bekommen. Sie kann heute noch nicht richtig schlafen, wegen der Sache. Ich meine, er war nicht mehr der Jüngste … Mitte sechzig vielleicht … aber trotzdem. Einfach so.“
Ich erinnerte mich dunkel, über den seltsamen Vorfall im Express gelesen zu haben. Dennoch wusste ich nicht, warum er mir das alles erzählte. Aber ich hatte so etwas schon öfter erlebt: Wenn ich einen Fall zügig und erfolgreich abschloss, waren viele Klienten so euphorisch und erleichtert, dass sie manchmal nicht aufhören konnten zu reden, als müssten sie die angestaute Anspannung loswerden. Was mich betraf, so interessierten mich Schröders persönliche Geschichten nicht wirklich. Gleichzeitig kostete es mich aber nichts, ihm ein paar Minuten lang geduldig zuzuhören oder zumindest so zu tun. Es gehörte zum Service.
Schröder schloss die Zimmertür mit einem sanften Klick und führte mich zurück zum Treppenabsatz. Als wir die Treppe halb runter waren, blieb er plötzlich stehen und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf eines der gerahmten Fotos an der Wand. „Das ist übrigens mein Urgroßvater. Der Eigentümer des Gewehrs.“
Ich trat eine Stufe höher und schaute interessiert auf das vergilbte Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigte einen jungen Mann in einer Uniform, die ich nicht genau einordnen konnte, mit präzise gescheiteltem, an den Seiten geschorenem Haar und einem schmalen Hitler-Schnurrbart. Er blickte ernst in die Kamera.
„Das Foto ist aus den späten Zwanzigern“, erklärte Schröder. „Mein Urgroßvater lebte praktisch ein ganzes Jahrhundert, von 1898 bis 1997. Ein zäher Hund. Im Ersten Weltkrieg war er bei der Kavallerie ... Hier, sehen Sie die Narbe?“ Er deutete mit dem Finger auf eine feine, helle Linie, die sich vom Kinn seines Uropas bis fast zum Ohr zog. Ich nickte. „Da ist er von einem durchgehenden Pferd getreten worden. Splitterbruch. Das war sein Markenzeichen. Im Zweiten Weltkrieg war er beim Volkssturm. Er hat sich sein ganzes Leben lang bester Gesundheit erfreut. Rauchte wie ein Schlot, trank Schnaps zum Frühstück. Erst mit fast hundert wurde er gebrechlich. Nach zwei Wochen im Bett starb er an einer Lungenentzündung.“
„Wow, da hat er ja eine Menge erlebt“, sagte ich. Das klang nach einem Klischee, aber in diesem Fall stimmte es wohl.
Schröder nickte zustimmend. „Das können Sie laut sagen.“ Während wir die restlichen Stufen hinunterstiegen, gab er mir fast beiläufig mehr Informationen. „Der Einbruch hier ereignete sich, als wir auf Malle im Urlaub waren. – Waren Sie schon mal da?“
„Ja“, sagte ich und erreichte den Flur. „Ist mir aber zu touristisch da. Ich hab's lieber etwas ruhiger.“
„Ich rede jetzt nicht vom Ballermann“, sagte Schröder abwehrend. „Darauf stehen wir auch nicht. Wir fahren schon seit Jahren auf die andere Seite der Insel, nach Osten. Da ist es schön ruhig, mehr Fischerdörfer... Jedenfalls“, er holte tief Luft, „Sie können sich vorstellen, was das für ein Schock war, als wir zurückkamen. Zuerst ist es uns gar nicht aufgefallen. Aber als wir uns ins Wohnzimmer setzen wollten, sagte meine Frau plötzlich: 'Wo ist denn der Fernseher?' Dann haben wir die ganze Bescherung gesehen. Das Gefühl... plötzlich fühlt man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Als ob jemand in dein Innerstes eingedrungen ist.“
Ich nickte verständnisvoll. Das war ein Gefühl, das ich von vielen Opfern kannte. „Kann ich nachvollziehen. Hatten Sie schon einmal einen Einbruch?“
„Noch nie“, sagte Schröder entschieden. „Und wir leben seit fast 25 Jahren in diesem Haus. Das ist eigentlich eine sehr sichere, ruhige Wohngegend – dachten wir zumindest. Meine Frau... die denkt jetzt ernsthaft daran, von hier wegzuziehen. In eine Wohnung mit Portier.“
Ich schüttelte nachdenklich den Kopf. „Das kann Ihnen überall passieren. Es ist völlig normal, dass Sie im Moment verunsichert sind. Aber ich würde die Sache nicht zu sehr dramatisieren. Wahrscheinlich hatten Sie einfach nur Pech und sind durch Zufall Opfer geworden. Professionelle Einbrecher erkennen, ob jemand längere Zeit weg ist. Indikatoren sind ein überquellender Briefkasten, ständig geschlossene Rollläden oder geleerte Mülltonnen, die tagelang in der Einfahrt stehen.“
„Hm.“ Schröder dachte einen Moment nach, strich sich über das Kinn. Dann nickte er zustimmend. „Hat die Polizei auch gesagt. Aber ich habe noch einen anderen Verdacht. Kurz bevor wir wegfuhren, hatten wir hier eine Firma, die Dachdeckerarbeiten am Schuppendach durchgeführt hat. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass die oder zumindest einer von denen etwas damit zu tun hat... dass die das Haus ausgekundschaftet haben. Na ja“, er zuckte hilflos mit den Schultern, „vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Die Hirngespinste eines Verunsicherten.“
Ich zuckte mit den Schultern. „Wir werden's wahrscheinlich nie herausfinden. Wichtig ist, dass Sie Ihr Gewehr zurückhaben. Der Rest ist Sache der Polizei und der Versicherung.“
„Da haben Sie absolut recht“, sagte Schröder, und seine Entschlossenheit kehrte zurück. Er klopfte wieder auf die Tasche. „Was schulde ich Ihnen eigentlich?“
„Fünfhundert Euro“, sagte ich. Der übliche Satz für eine zügige Rückführung.
„Ich habe nicht so viel Bargeld im Haus. Nicht nach dem Urlaub und der Renovierung. Akzeptieren Sie PayPal?“
„Natürlich.“ Ich griff in meine Innentasche und holte mein Smartphone hervor.
„Okay“, sagte Schröder erleichtert. „Dann erledigen wir das gleich.“ Er holte sein eigenes, etwas klobiges Handy hervor, tippte konzentriert und schickte mir das Geld. Einen Moment später hörte ich den vertrauten Bestätigungs-Pington und sah die Eingangsbestätigung auf dem Display.
„Alles ist angekommen. Wir sind quitt“, sagte ich zufrieden und streckte meine Hand aus. „Das war's dann, Herr Schröder. Viel Freude mit dem Erbstück.“
Wir verabschiedeten uns mit einem festen Handschlag. Seine Handfläche war etwas feucht. Ich ging, spürte seinen dankbaren Blick im Rücken, während ich die Haustür hinter mir schloss. Die frische Luft draußen tat gut nach der stickigen Atmosphäre der Erzählungen.
Ich war gerade in meinen Wagen gestiegen und hatte den Motor angelassen, als mein Handy auf dem Beifahrersitz klingelte. Nachdem ich den Anruf über die Freisprechanlage angenommen hatte, meldete sich eine klare, leicht angespannte Frauenstimme. „Hallo, mein Name ist Reichelt. Ich habe Ihre Kontaktdaten aus dem Internet. Da Sie sehr gut bewertet sind, würde ich Sie gern mit etwas beauftragen.“
„Können Sie mir sagen, worum es geht?“ Ich legte den Gang ein und rollte vom Bordstein.
„Eine vermisste Person ausfindig machen ... So was tun Sie doch, oder?“
„Sicher“, sagte ich und blickte in den Rückspiegel. Schröder stand noch immer hinter dem Finster in seiner Haustür und winkte. Ich hob kurz die Hand.
„Sehr gut.“ Die Frau klang spürbar erleichtert. „Ich würde die Angelegenheit gern von Angesicht zu Angesicht besprechen. Kann ich heute in Ihrem Büro vorbeischauen?“
„Im Moment bin ich noch unterwegs“, sagte ich und bog auf die Hauptstraße ein. „Müsste aber in etwa einer halben Stunde im Büro sein.“
„Perfekt“, sagte die Frau. Ein Hauch von Dringlichkeit lag in ihrer Stimme. „Dann bis gleich.“
*
Ich war erst ein paar Minuten im Büro, hatte gerade meine Jacke über die Stuhllehne geworfen, als es klopfte und sie hereinkam. Das Licht der Nachmittagssonne fiel schräg durch die Jalousien und tauchte sie für einen Moment in Silhouette. Ich musste blinzeln, weil ich meinen Augen nicht traute. Das konnte nicht wahr sein. Während ich schluckte, kam es mir so vor, als würde mir der Adamsapfel aus dem Hals springen. Ich hätte alles erwartet – einen neuen Fall, einen unzufriedenen Klienten, den Steuerberater – aber nicht das. Obwohl ich sie fünfundzwanzig Jahre nicht gesehen hatte, erkannte ich sie sofort. Die hohen Wangenknochen, der spezifische Schwung der Lippen, selbst die Art, wie sie den Kopf leicht schief hielt, als sie mich musterte. Nur die Haare waren kürzer, ein praktischer Bob, der ihr bis zum Kiefer reichte. Meine Gedanken überschlugen sich wie gestörte Ameisen. Die Szene vor der Diskothek ging mir unwillkürlich durch den Kopf: Ich sah Ingo neben ihr stehen; seinen Blick der Erleichterung, die heimliche, triumphierende Freude in seinen Augen, als ihm klar wurde, dass der bullige Türsteher mich nicht durchlassen würde. Die Erinnerungen an diese letzte, demütigende Sommernacht kamen mit brutaler Klarheit wieder hoch. Ich musste an meine ersten qualvollen Jahre in der Fremdenlegion denken. Damals, in der Hitze der Wüste oder der Stickigkeit der Kasernen, verging kein Tag, an dem ich nicht an sie dachte. Ich war unsterblich verliebt gewesen, besessen, und zwar so sehr, dass es körperlich weh tat. All die langen, einsamen Nächte, die ich damit verbracht hatte, endlose, verzweifelte Briefe an sie zu kritzeln; ihr zu sagen, wie sehr ich sie vermisste, wie leer alles ohne sie war. Keinen von diesen beschämend offenherzigen Briefen schickte ich je ab. Sie blieben in einem verschlossenen Koffer unter meinem Feldbett. Obwohl ich mich mit den Jahren weiterentwickelte, härter wurde, die Vergangenheit wie ein altes Foto verblasste, blieb dieses dumpfe, sentimentale Gefühl in mir ihr gegenüber erhalten – ein ungelöster Rest. Wir hatten nur diese eine Nacht miteinander verbracht, und dabei hatte sie mir, fast beiläufig, das Herz gebrochen. Ich spürte, wie eine plötzliche, ungewollte Welle der Wärme durch meinen Körper schwappte, ein Echo der alten Verwirrung. Wenn ich ehrlich war, musste ich mir eingestehen, dass ich nie wirklich aufgehört hatte, sie zu lieben. Oder zumindest das Phantom, das ich von ihr erschaffen hatte.
Doch unmittelbar nach der ersten Überraschung, vielleicht einen Sekundenbruchteil später, kam die kalte Ernüchterung. Sie schlug ein wie ein Eiswürfel in den Magen. In meiner Erinnerung war sie die schönste, strahlendste, begehrenswerteste Frau der Welt gewesen. Eine Art Göttin. Allerdings war die Frau, die jetzt vor meinem schlichten Büroschreibtisch stand, meilenweit davon entfernt. Sie sah aus wie eine leicht ausgeblichene Kopie meiner Heidi von damals. Wie eine gut gemeinte, aber letztlich enttäuschende Billigversion. Ich kritisierte mich sofort innerlich für diesen gehässigen Gedanken. Sie war nicht hässlich oder unattraktiv, durchaus gepflegt in ihrem beigen Trenchcoat, aber ich konnte einfach nicht verstehen, warum ich einmal so absolut, so selbstzerstörerisch verrückt nach ihr gewesen war. Wie bei jedem Menschen hatten die Jahre ihre Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen: feinste Fältchen um die hellblauen Augen, die jetzt weniger strahlten, und einige dezente silberne Strähnen an den Schläfen, die sich gegen das dunklere Blond abhoben. Sie war jetzt eine reife Frau, der man unbestreitbar noch ansah, wie bezaubernd schön sie einst gewesen sein musste. Und genau diese Tatsache, dieser melancholische Abglanz von Vergangenem, ließ mein Herz für einen irrationalen Moment höher schlagen. Mir wurde mit erschreckender Deutlichkeit klar, dass ich bis zu diesem genauen Moment, bis sie diese Tür geöffnet hatte, noch immer in sie verliebt gewesen war. Und nun fiel es mir wie schwere Schuppen von den Augen: Ich hatte nie die reale Heidi geliebt. Ich hatte eine Illusion angebetet, dieses eine, perfekt konservierte Jugendbild von ihr, das ich über die Jahrzehnte in der Vitrine meiner Erinnerung bewahrt und poliert hatte. Ich mahnte mich, nicht unfair zu sein, denn die Zeit nagt an uns allen. Aber die Erkenntnis war da, klar und kalt: Nun war ich definitiv, endgültig geheilt. Der letzte Rest der Fessel war gesprengt.
Sie blickte mich erwartungsvoll an, ein leicht höfliches, geschäftsmäßiges Lächeln auf den Lippen. Es war ein freundliches Lächeln, aber keins, das auch nur die geringste Tiefe oder das winzigste Fünkchen des Wiedererkennens zeigte – nicht im Geringsten. Ihr Blick blieb neutral, der eines Klienten, der einen Dienstleister betritt.
„Hallo Heidi“, sagte ich. Meine Stimme klang rauer als beabsichtigt.
Sie zog überrascht die perfekt gezupften Augenbrauen hoch. „Kennen wir uns?“ Ein leichtes Stirnrunzeln erschien zwischen ihnen.
„Ich glaub’ schon.“ Ich blieb hinter dem Schreibtisch stehen, eine Barriere zwischen Vergangenheit und Gegenwart. „Max Hammerschmidt.“
Sie betrachtete mich intensiv einen langen Moment, ihr Blick wanderte über mein Gesicht, suchte nach Anhaltspunkten. Dann schien ein schwaches Licht der Erinnerung einzusetzen, gefolgt von einem schnellen, unsicheren Blinzeln. „Natürlich ... ähm ... Mein Gott, wie lange ist das her?“ Sie schnippte mit den Fingern, eine nervöse Geste, während sie offensichtlich nach meinem Vornamen suchte. „Mats – richtig?“
„Max“, korrigierte ich knapp, ohne mir die plötzliche, absurde Enttäuschung anmerken zu lassen. Sie kannte nicht einmal mehr meinen Namen. Damit war endgültig klar, was ich eigentlich schon immer geahnt hatte: Das damals war nichts anderes als eine peinliche Einbahnstraße gewesen. Ich hatte ihr in all den Jahren des Schmerzes und der Sehnsucht absolut nichts bedeutet. Eine Randnotiz ihrer Jugend.
„Max! Ja, natürlich!“ Sie nickte etwas zu heftig, als wolle sie ihre kleine Blamage überspielen. „Schön, dich wiederzusehen.“ Sie trat auf mich zu, die Arme für eine vage Umarmung leicht ausgebreitet.
Wir umarmten uns kurz, steif, mehr eine Berührung der Schultern. Ihr Parfüm roch blumig, unvertraut. Nichts von dem süß-herben Duft, den ich in Erinnerung hatte.
„Setz dich“, sagte ich und deutete mit einer knappen Handbewegung auf den schwarzen Ledersessel vor meinem Schreibtisch. Meine Professionalität war ein willkommener Schutzpanzer. Während sie sich setzte, den Trenchcoat sorgfältig glattstreifend, ließ ich mich schwer in meinen Drehstuhl sinken. „Erzähl“, sagte ich, die Hände vor mir auf der Schreibtischplatte gefaltet. „Wie ist es dir in den letzten... fünfundzwanzig Jahren ergangen?“ Die Zahl klang surreal.
Heidi zuckte mit den Schultern, ein elegantes, gleichgültiges Auf und Ab. „Nichts Spektakuläres. Es ist alles so gekommen, wie es kommen musste. Ich habe geheiratet. Rechtsanwalt. Netter Mann, falsches Leben.“ Sie presste die Lippen für einen Moment zu einer schmalen Linie zusammen und lachte dann kurz und bitter auf. „Nach zehn Jahren war Schluss. Kein großer Knall, nur eine große Leere. Wir haben eine Tochter.“ Ein kurzer, fast schmerzhafter Blick flackerte in ihren Augen auf. „Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich mich damals, jung und dumm wie ich war, für die falsche Person entschieden habe.“
„Sprichst du von Ingo?“ Die Frage rutschte mir heraus, scharf wie ein Messer. Ich wollte sehen, wie sie reagierte.
„Wer ist das denn?“, fragte sie stirnrunzelnd, echte Verwirrung in der Stimme. Dann, ein Sekundenbruchteil später: „Ah!“ Ein schnelles, fast belustigtes Nicken folgte. „Ich weiß. Dein Kumpel. Der mit den blonden Locken? – Gott, nein.“ Die Erinnerung daran schien sie eher zu amüsieren als zu bewegen. „Diesen aufgeblasenen Idioten hätte ich nie geheiratet. Ein Sommerflirt, mehr nicht.“
Unglaublich! Sie hatte uns damals tatsächlich nur als vergängliches Spielzeug betrachtet, als Staffage ihrer Jugend. Mit einer fast unheimlichen Genugtuung stellte ich fest, dass ich nicht den geringsten Schmerz, keine Eifersucht, nicht einmal Groll empfand. Nur eine kühle, klare Leere.
„Und wie ist es bei dir gelaufen?“ Sie lehnte sich zurück, musterte mich mit neuem, leicht neugierigem Interesse. „Bist du nicht irgendwohin ins Ausland gegangen? Ich glaube, ich habe so etwas am Rande gehört. Legion oder so?“
Ich nickte kurz. „Ja. War ein paar Jahre weg. Frankreich, Afrika. Bin dann aber zurückgekommen. Seit zehn Jahren habe ich diese Bude hier.“ Ich deutete mit dem Kinn in den Raum.
„Verheiratet? Kinder?“ Ihre Frage war höflich, aber nicht wirklich interessiert.
Ich zögerte. Ein Bild von Anne-Marie tauchte auf, wie sie am Sonntagmorgen in der Küche lachte. Dann schüttelte ich den Kopf, ein knappes Nein. „Nein.“ Ich wusste selbst nicht genau, warum ich log und ihr nichts von meinem Leben erzählen wollte. Vielleicht, um diese neue, unverletzliche Distanz zu wahren. Ich hatte mich so oft gefragt, wie es wohl wäre, wenn ich sie eines Tages wieder treffen würde. Nun wusste ich es: schmerzfrei, seltsam leer und zutiefst ernüchternd. Ich fühlte mich lediglich minimal in meiner Ehre gekränkt, da sie offensichtlich im krassen Gegensatz zu mir keinen einzigen Gedanken mehr an mich verschwendet hatte, nachdem wir uns aus den Augen verloren hatten. Ich war für sie einfach verschwunden gewesen. Ich holte tief Luft, der Geruch von altem Leder und Staub füllte meine Nase, und versuchte, sie endgültig als das zu sehen, was sie jetzt war – eine Klientin. Nichts weiter. „Wen soll ich für dich finden, Heidi?“ Meine Stimme klang jetzt ruhig, geschäftsmäßig.
Heidis zuvor fast gleichgültiger Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig. Alle Masken der Höflichkeit und Reife fielen ab, zurück blieb nackte, verletzliche Angst. Ihre Finger krallten sich in die Armlehnen des Sessels. „Meine Tochter.“
Ich gab ihr mit einer knappen Geste zu verstehen, dass ich bereit war, zuzuhören. Schweigend. Professionell.
„Ihr Name ist Vanessa“, fuhr sie fort, die Worte kamen jetzt gehetzt und gepresst, als würde sie gegen einen unsichtbaren Widerstand ankämpfen. „Sie ist neunzehn Jahre alt. Eigentlich studiert sie Englisch und Medienwissenschaften... in Irland.“ Sie griff mit zitternden Fingern in ihre Handtasche, fummelte einen Moment lang, bis sie ihr Smartphone hervorholte. Ihr Daumen tippte flink auf den Bildschirm, bis sie das Richtige gefunden hatte. Dann hielt sie das Handy mit leicht zitternder Hand über den Schreibtischrand, so dass ich den grell leuchtenden Bildschirm sehen konnte. Eine kurze Videobotschaft begann zu spielen.
Ich war sprachlos. Das hübsche Mädchen mit den langen, blonden Haaren, die zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden waren, war ein frappierendes Ebenbild der Heidi, die ich vor knapp 30 Jahren kannte. Dieselben großen, hellbraunen Augen, dieselbe Nase, sogar der schelmische Zug um die vollen Lippen, wenn sie lächelte. Und dann sprach sie: „Heute sind wir in Moore Hall“, sagte sie mit einer Stimme, die mich um Jahrzehnte zurückwarf – warm, melodisch und mit diesem unverkennbaren, leichten Stimmbruch in der Höhe. Sie drehte sich um, die Kamera wackelte kurz, um zu zeigen, was sich hinter ihr befand. Die mit dichtem, dunkelgrünem Efeu bewachsene Mauer, die aus großen, moosbewachsenen alten Steinen bestand, sah aus, als stünde sie seit mindestens tausend Jahren an diesem Ort, unerschütterlich und vom Wetter gezeichnet. „Was du hier siehst, sind die Überreste eines alten Herrenhauses. Es gehörte einem englischen Lord und wurde 1923 von der IRA niedergebrannt. Das ist schade, denn in einem Raum dieses Hauses soll sich eine unersetzliche Bibliothek befunden haben – Manuskripte und alles.“ Sie schwenkte die Kamera langsam, um die Umgebung zu zeigen – eine von Brombeerranken und jungen Eschen überwucherte Allee, die sich schlängelnd durch den dämmrigen Wald zog. Die einstige Pracht, die Geometrie der alten Bäume, war noch schemenhaft zu erahnen. „Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Kutschen damals hier lang gefahren sind ... die Damen in ihren Krinolinen, die Herren zu Pferd.“ Ein Windstoß rauschte durch die Blätter und wirbelte eine Strähne in ihr Gesicht, die sie mit einer schnellen Handbewegung zurückstrich. „Heute übernachten wir in Claremorris. Das ist eine Kleinstadt ganz in der Nähe. Und morgen besteigen wir den Croagh Patrick. Das ist der heilige Berg hier in Irland. Sie sagen, wenn man da oben ist, den weiten Blick über Clew Bay hat und ein echtes Gebet spricht oder sich etwas aufrichtig wünscht... dann soll das in Erfüllung gehen.“ Sie lachte, ein helles, ungekünsteltes Geräusch, das mich direkt traf. „Ich werd's ausprobieren. Okay, Heidi, ich melde mich von dort wieder. Bis morgen! Ich liebe dich!“ Sie warf der Kamera einen flüchtigen Kuss zu, dann wurde das Bild schwarz.
„Das... das ist ihre letzte Nachricht“, sagte Heidi, und ihre Stimme brach fast. Sie drückte das Handy so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. „Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Keine Nachricht. Kein Anruf. Nichts. Und das macht mir schreckliche Sorge, Max. Das ist nicht Vanessa.“
„Wie lange ist das her?“, fragte ich und rückte auf meinem Drehstuhl unwillkürlich vor.
„Das war vorgestern. Also am Sonntag. Du hast selbst gehört, dass sie sich am nächsten Tag, also gestern, vom Gipfel des Croagh Patrick, melden wollte. Aber das hat sie nicht getan.“
„Zwei Tage“, sagte ich, mehr zu mir selbst. „Hm ... eigentlich noch kein Grund zur Panik, Heidi. Ich meine, wir müssen nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Du weißt doch, wie wir in diesem Alter waren. Den Kopf voller Abenteuer.“
Heidi sah mich mit einem Blick an, der jede weitere Beschwichtigung im Keim erstickte. Ernst, tief besorgt und mit einem Unterton von Panik, den sie mühsam kontrollierte. Sie schüttelte energisch den Kopf. „Nein, Max. In diesem Fall muss man vom Schlimmsten ausgehen. Das ist nicht irgendeine Laune. Meine Tochter und ich haben eine klare Vereinbarung. Die besagt, dass sie mich jeden einzelnen Tag kontaktiert. Jeden. Egal, wo sie ist. Sie braucht mir nicht zu sagen, was sie tut oder mit wem sie ihre Zeit verbringt – ich respektiere ihre Privatsphäre –, aber sie muss sich jeden Tag bei mir melden. Ein kurzer Text, ein Emoji, ein einminütiges Video... Hauptsache, ich weiß, dass es ihr gut geht. Und das hat sie, ohne eine einzige Ausnahme, seit sie vor einem Jahr nach Irland gezogen ist, getan. Selbst als sie mal mit einer Grippe im Bett lag. Jeden Tag. Wenn sie nicht antwortet, muss etwas passiert sein. Etwas Ernstes.“ Sie holte tief Luft. „Aber da ist noch etwas anderes, das mir noch mehr Angst macht: Sie geht nicht mehr ans Handy. Es klingelt nicht mal mehr durch. Wenn ich anrufe, höre ich sofort diese... diese verdammte Computerstimme: The person you are calling is not available... Als wäre das Handy ausgeschaltet. Oder...“ Sie dachte den Gedanken nicht zu Ende.
Ich fand ihre Besorgnis übertrieben, behielt meine Meinung jedoch für mich. „Vielleicht hat sie ihr Handy verloren oder es ist kaputtgegangen –“ Ich zuckte nach Worten suchend mit den Schultern. „Oder sie ist in einem Funkloch. Ich weiß nicht, wie gut das Handynetz in Irland ist.“
Heidi schüttelte erneut den Kopf, ungeduldig, fast verzweifelt. „Max, glaub mir, dafür gibt's keine vernünftige Erklärung, die zu Vanessa passt. Ich bin ihre Mutter. Ich kenne sie. Sie weiß genau, was diese Stille bei mir auslöst. Selbst wenn ihr Handy in tausend Teile zersprungen wäre, sie hätte mich von einem anderen Handy, einer Telefonzelle, einer Tankstelle, einem Pub aus angerufen. Irgendwie hätte sie mich kontaktiert. Weil sie weiß, dass ich dann schlaflose Nächte habe und mir den Kopf zerbreche. Das hat sie noch nie getan. Nie!“ Ihre Augen glänzten feucht.
„Hm.“ Ich lehnte mich zurück, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und versuchte, logisch zu denken. „Sie sagte, wir. Heute sind wir in Moore Hall. Heute übernachten wir in Claremorris. Mit wem ist sie denn unterwegs? Wer ist dieses Wir?“
Heidi zuckte hilflos mit den Schultern. „Das weiß ich nicht. Sie ist nicht besonders kommunikativ, wenn es darum geht, mit wem sie ihre Zeit verbringt. Sie sagt Freunde oder Leute vom Kurs. Ich frage nicht zu sehr nach, weil ich weiß, dass sie das nicht mag und ich ihr nicht auf die Nerven gehen will. Sie ist erwachsen.“
„Hat sie einen Freund?“, fragte ich direkt. „Einen festen?“
„Nein. Hat sie nicht. Das hätte sie mir gesagt. Bestimmt.“ Heidis Ton war absolut, endgültig. Das stand für sie überhaupt nicht infrage. Vanessa würde ihr so etwas mitteilen.
„Okay“, sagte ich und schob meinen Notizblock zurecht. „Wie genau kann ich dir helfen, Heidi? Was erwartest du von mir?“
„Indem du nach Irland fliegst. Sofort. Und herausfindest, was los ist. Wo sie ist. Warum sie sich nicht meldet.“
Mein Unterkiefer klappte buchstäblich herunter. „Das kann nicht dein Ernst sein! Heidi, ich... Gibt's in Irland keine Polizei? Ich meine –“ Ich schüttelte verständnislos den Kopf und stand auf, brauchte die Bewegung. „Ich versuche mich wirklich in deine Situation hineinzuversetzen, und ich verstehe, dass du dir schreckliche Sorgen machst. Man muss aber trotzdem auf dem Teppich bleiben und die Sache rational betrachten. Hast du dich schon an die irischen Behörden gewandt? Von welcher Stadt reden wir überhaupt? Wo genau wohnt sie?“
„Galway. Die Stadt heißt Galway. Sie liegt im äußersten Westen des Landes, direkt am Atlantik.“ Heidi wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. „Ich habe gestern bei der Polizeistation dort angerufen, aber die haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten, sie könnten den Fall nicht verfolgen oder Vanessa als vermisst registrieren, weil sie erwachsen ist und freiwillig verschwunden sein könnte. Heute Morgen habe ich wieder angerufen. Da haben sie sich zumindest den Namen und Vanessas Adresse aufgeschrieben. Sie sagten, sie würden sich um die Angelegenheit kümmern und mich zurückrufen. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Kein Anruf. Nichts.“ Sie presste die Lippen zusammen. „Ich würde mich sofort selbst in den nächsten Flieger setzen, Max, ich schwöre es dir. Aber ich kann hier nicht weg, weil ich mich um meine Mutter kümmern muss. Sie hat Alzheimer, Max. Stadium drei. Es geht ihr von Tag zu Tag schlechter. Sie erkennt mich kaum noch, ist oft verwirrt, manchmal aggressiv. Ich habe eine Pflegekraft, die tagsüber kommt, aber nachts... nachts bin ich allein mit ihr. Ich kann sie auf gar keinen Fall allein lassen. Nicht eine Nacht. Es wäre unverantwortlich.“ Heidi sah mich mit einem flehenden Blick an, der mich bis ins Mark traf. „Bitte, Max. Bitte hilf mir. Ich zahle dir alles. Flug, Hotel, Spesen, deinen Tagessatz – Geld spielt wirklich keine Rolle. Ich brauche nur Gewissheit. Ich brauche jemanden, der dort hingeht und sich umschaut.“
Ich wich ihrem Blick aus und starrte auf die Risse im Linoleum meines Bürobodens. Was hinderte mich eigentlich daran, den Auftrag anzunehmen? Dass es Irland war? Die Entfernung? Die Tatsache, dass ich dafür ins Ausland reisen musste? Würde Vanessa in Berlin oder München studieren, hättest du sofort angefangen zu recherchieren. Ob man zwei Stunden im Auto oder zwei im Flugzeug verbringt, spielt letztlich keine Rolle. Nimm an! Eine andere Stimme in mir meldete sich: