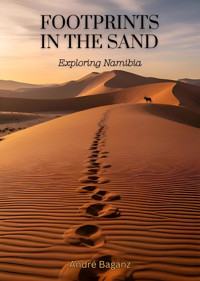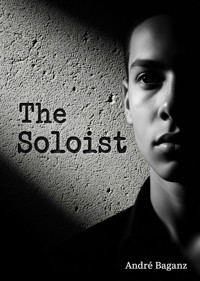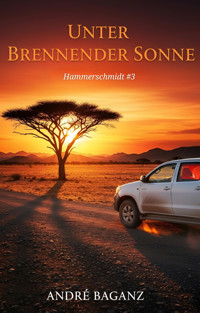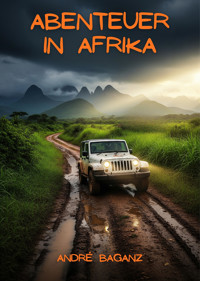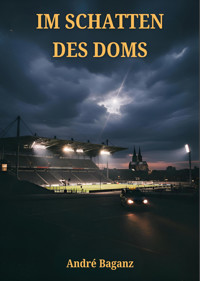Der Solist
André Baganz
Copyright © 2025 André Baganz
Alle Rechte vorbehalten.Cover- und Bilderzeugung von: Canva
Impressum
André Baganz c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
Contents
Title Page
Copyright
Impressum
Vorwort 2023
Der Ausbruch
Stasi-U-Haft und Gerichtsverhandlung
Kein Vergleich mit dem Jugendhaus
Die Menschenfreunde
Das Haftkrankenhaus
Harte Zeiten
II West
Die Wende
Epilog 2023
YouTube-Video zum Buch
Books By This Author
Vorwort 2023
Ich schätze, dass in der DDR zu der Zeit, in der ich aufwuchs, also in den Sechziger- und Siebzigerjahren, einige hundert Afrodeutsche lebten. Sie waren größtenteils Nachkommen von jungen Männern, die aus sozialistisch orientierten Staaten wie Äthiopien, Angola, Mosambik oder Guinea kamen und im Rahmen der „sozialistischen Bruderhilfe“ eine Ausbildung in der DDR absolvierten. Hinzu kamen die sogenannten „Festivalkinder“. Diese waren eine Hinterlassenschaft der 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten, die 1973 in Ostberlin abgehalten wurden und an denen ca. 8 Millionen Besucher aus aller Herren Länder teilnahmen. Bei einer Bevölkerung von 17 Millionen waren die wenigen hundert Dunkelhäutigen also eine verschwindend kleine Minderheit, wobei selbst dieser Begriff noch übertrieben scheint.
Mein Vater, Sékou Camara, stammte aus Guinea. Ich habe keine persönliche Erinnerung an ihn, weiß nur von meiner Mutter, dass er ein „ganz lieber Mensch“ war. Er gehörte zu den Glücklichen seines Landes, die im „reichen“ Ostdeutschland eine Berufsausbildung absolvieren durften. Seine erste Station in der DDR war das Herder-Institut in Leipzig, wo er in einem Intensivkurs die deutsche Sprache erlernte. Dort traf er auch meine Mutter. Über den Grund, warum meine Eltern nicht zusammengeblieben sind, kann ich lediglich spekulieren. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass die Ablehnung von anders Aussehenden innerhalb der durchweg weißen DDR-Bevölkerung eine große, wenn nicht entscheidende Rolle spielte. Dies scheint auch die Tatsache zu bestätigen, dass es nahezu kein Beispiel dafür gibt, dass solch eine Beziehung jemals von Dauer war.
Meine Mutter heiratete später einen Deutschen, der mich adoptierte und mit dem sie noch zwei Kinder bekam. Meine Eltern – solange ich denken kann, betrachtete ich meinen Adoptivvater als meinen richtigen Vater – waren Lehrer und ich wuchs in einer absolut intakten Familie auf. Dieser sichere Raum innerhalb der Familie und des Bekanntenkreises schützte mich jedoch nicht vor der Außenwelt. Sobald ich es mit Menschen zu tun hatte, die mich nicht kannten, was mit zunehmendem Alter häufiger geschah, gab es Probleme, wobei das Verhalten meiner Person gegenüber zwischen freundlicher Akzeptanz, Gleichgültigkeit, Unfreundlichkeit und Feindseligkeit variierte. Letzteres mit unproportionaler Häufigkeit. Für jemanden, der sich nicht tagtäglich mit solchen Problemen auseinandersetzen muss, ist es unmöglich nachzuvollziehen, was so etwas in einem jungen Menschen auslöst und dass dieser sich unter solchen Umständen nicht normal entwickeln kann. Erst viel später erfuhr ich, dass es mir in der damaligen Bundesrepublik mit meiner Hautfarbe möglicherweise nicht viel besser ergangen wäre, allerdings hätte ich diesen Staat problemlos verlassen können. Das war der Unterschied.
Was sich am 20.9.1981 in Frankfurt (Oder) ereignete, lässt sich nicht mehr ändern. Das trifft allerdings nicht auf die Betrachtungsweise und Bewertung des Geschehenen zu. Wenn ich mich heute, über 40 Jahre später, als jungen Menschen im Alter zwischen 17 und 20 sehe, schockiert mich die Gewaltbereitschaft, die ich zu jener Zeit an den Tag legte. Gleichzeitig habe ich aber Verständnis für diesen jungen Menschen, war seine Tat doch nichts anderes als ein Akt der Verzweiflung und eine Reaktion auf das Umfeld, in dem er leben musste. Dieses Umfeld brachte ihn dazu, seine Herkunft vor sich selbst zu verleugnen, denn von klein auf hatte er gelernt, dass „Deutschsein“ das Beste auf der Welt ist und insbesondere Afrikaner minderwertig sind. Und da er nicht minderwertig sein wollte, strengte er sich ganz besonders an, wobei er oft sogar sein wirkliches Ich verleugnete. Der unschuldige Junge wusste nicht, dass er sich noch so anstrengen konnte, denn für die Menschen, die ihn ablehnten, würde er nie dazugehören. Es ist unglaublich, aber erst mit über fünfzig fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und von jenem Tag an fühlte ich mich innerlich frei.
In diesem Buch geht es nicht um Schuldzuweisungen. Ich will einfach nur meine Geschichte erzählen, in der Hoffnung, dass andere Menschen in ähnlichen Situationen etwas Positives daraus mitnehmen können. Ich finde, gerade in einer Zeit von Fake News und ständiger Desinformation auf allen Gebieten und in einem Ausmaß, das viele von uns nicht für möglich gehalten hätten, ist es wichtig, Dinge aus erster Hand zu erfahren.
Der Ausbruch
Als das Licht ausgeschaltet wurde, fingen wir an zu reden. Zum allerersten Mal tauschten wir uns aus, ohne Rücksicht auf den Kinderschänder. Dieser tat unser Gerede als absoluten Quatsch ab und glaubte keine Sekunde daran, dass wir es ernst meinten. Je näher der Morgen rückte, desto öfter mussten wir drei auf die Toilette. Irgendwann trat Ruhe ein, weil jeder versuchte, wenigstens etwas Schlaf zu bekommen. Ich zählte immer wieder von 20 nach unten, doch ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich war zu aufgewühlt; meine Gedanken überschlugen sich. Während ich überzeugt davon war, dass es diesmal klappen würde, redete ich mir ein, dass aller guten Dinge drei sind, und lauschte meinem inneren Dialog: Ist das nicht eigentlich schon das vierte Mal? – Nein, das gehört noch mit zum dritten Mal. Es muss dazugehören. Hör auf, bist du jetzt auf einmal abergläubisch? In meinen Gedanken liefen meine ersten beiden Fluchtversuche wie ein Film ab.
Als uns das Taxi abgesetzt hatte, gingen wir in die Richtung, von der wir glaubten, dass dort die Mauer sei. Nach einer Viertelstunde Fußmarsch sahen wir tatsächlich Wachtürme in der Ferne. Irgendwann hörten wir näherkommendes Motorengeräusch. Als wir uns umdrehten, sahen wir Scheinwerfer. Wir schlugen uns sofort in die Büsche. Aus sicherer Deckung beobachteten wir, wie ein Militärjeep an uns vorbeifuhr. Wir waren also richtig. Als der Jeep außer Sicht war und ich weitergehen wollte, sagte Tommy plötzlich: „Ich glaube, das war eine blöde Idee.“
Ich hatte eine böse Vorahnung. „Was … meinst du?“, fragte ich zögerlich.
„Hierherzukommen und in den Westen abhauen zu wollen. Das schaffen wir nie. Die knallen uns doch ab –“
Ich schaute ungläubig zu ihm hinüber. Das fiel dem jetzt ein?
Tommy schüttelte zweifelnd den Kopf. „Ich hatte ein bisschen zu viel getrunken. Nur deshalb habe ich mich auf den Scheiß eingelassen.“
„Scheiß?“ Ich spürte, wie die Wut in mir aufstieg. Sicher hatten wir einiges getrunken, aber obwohl der Entschluss, „abzuhauen“, mehr oder weniger ein spontaner gewesen war, hatte bei mir der Alkohol keine Rolle gespielt. Bei Tommy war das offensichtlich anders gewesen, und dafür verachtete ich ihn. „Du hast damit angefangen und konntest den Mund nicht voll genug nehmen.“ Ich spürte, wie sich meine Nasenlöcher blähten, während ich ihn wütend anstarrte. „Du bist so eine verdammte Flasche. Große Fresse, aber nichts dahinter.“
„Ich weiß“, sagte er und blickte verschämt auf den Boden.
Die Tatsache, dass er nicht einmal versuchte, sich zu verteidigen, entwaffnete mich total. Andererseits wurde mir einmal mehr bewusst, wie verschieden wir waren, obwohl wir seit ca. einem Jahr beste Kumpel waren. Wobei der Drang, Zeit miteinander zu verbringen, eher von Tommy ausging, denn er bewunderte mich wegen meiner Kraft und Schnelligkeit, die ich bei unseren häufigen Prügeleien an den Tag legte. Oft hatte ich sogar das Gefühl gehabt, dass er extra Streit mit anderen provozierte, nur um mich in Action sehen zu können. Dass er nun, wo es drauf ankam, den Schwanz einzog, überraschte mich nicht wirklich, denn er war nicht halb so motiviert wie ich, endlich aus der DDR wegzukommen. Warum auch? Warum sollte er sich in Lebensgefahr begeben, war er doch ein normaler ostdeutscher Jugendlicher, ganz im Gegensatz zu mir. Mein Vater stammte aus Afrika und meine dunkle Hautfarbe stempelte mich in der weißen DDR-Gesellschaft zum totalen Außenseiter. Seit frühester Kindheit hatte ich den Wunsch gehabt, dort wegzukommen, weil ich immer wieder spürte, dass ich nicht dorthin gehörte. In letzter Zeit hatten Tommy und ich oft über das Thema gesprochen. Und nach dem Gespräch mit den beiden Jungs entschlossen wir uns spontan, die Sache „heute noch“ durchzuziehen. Wir trafen die beiden in einer Disco, hatten vorher aber schon von ihnen gehört. Sie waren in Eisenhüttenstadt so was wie Superstars, zumindest in der Jugendszene, denn es war ihnen zwei Monate zuvor tatsächlich gelungen, in den Westen abzuhauen, und zwar in der Nähe von Boizenburg/Elbe. Einer von den Jungs hatte Verwandte im Sperrgebiet. Da er als Kind mehrmals dort gewesen war, hatte er die nötige Ortskenntnis, um mit seinem Freund den richtigen Weg über die Grenze zu finden. Im Westen angekommen, wurde den Jungs jedoch nahegelegt, wieder in die DDR zurückzukehren, weil sie noch nicht volljährig waren. Ihre Eltern handelten mit den DDR-Behörden einen Deal aus, der ihren Söhnen Straffreiheit zusicherte, wenn sie freiwillig zurückkämen, was diese nach einigen Wochen auch taten. Nach ihrer Rückkehr zogen sie dann durch die Discos und Kneipen von Eisenhüttenstadt und prahlten mit ihrer Erfolgsgeschichte. Unter anderem auch damit, wie sehr die „Westweiber“ auf ostdeutsche Jungs stünden. Wie viel von ihren Geschichten stimmte, vermag ich nicht zu sagen. Fakt war jedoch, dass sie es geschafft hatten und Tommy und ich uns sagten: Was die zwei können, können wir auch.
Was mich betraf, so verschwieg ich mein wahres Motiv und schloss mich dem der Allgemeinheit an: Ich hatte die Nase voll vom restriktiven Leben in der DDR und wollte endlich meine Freiheit haben. Ich wollte das genießen, was ich täglich im Westfernsehen sah: Meinungsfreiheit, Reisefreiheit und auch die Freiheit, nicht arbeiten gehen zu müssen. Letzteres ist aus heutiger Sicht eher peinlich, aber ich war damals noch ziemlich jung. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, aus der DDR abzuhauen, wenn ich aufgrund meiner Hautfarbe nicht so ein Außenseiter gewesen wäre, denn am Leben dort an sich hatte ich nichts auszusetzen.
Nachdem Tommy und ich uns theatralisch von unseren Freunden verabschiedet hatten, natürlich mit dem Versprechen, sie nicht zu vergessen und ihnen regelmäßig Pakete zu schicken, fuhren wir mit dem Bus zum Eisenhüttenstädter Bahnhof und nahmen den Zug nach Berlin. Es war der letzte, der an diesem Tag ging. Knapp anderthalb Stunden später stiegen wir am Ostbahnhof aus. Von dort nahmen wir ein Taxi nach Alt-Glienicke. Uns war gesagt worden, dass die Chancen, rüberzukommen, dort am besten seien.
Ich war unsagbar enttäuscht von Tommy. „Okay, dann fahre zurück nach Hütte“, sagte ich und ging weiter, in der Hoffnung, er würde seine Meinung doch noch ändern und mir folgen. Das hatte er bisher immer getan. Aber diesmal tat er es nicht. Verdammter Feigling, dachte ich und setzte meinen Weg fort, ohne mich umzudrehen.
Nach etwa 500 Metern erreichte ich offenes Gelände. Ich legte mich flach auf den Boden und beobachtete die Umgebung. Das Areal wurde von Scheinwerfern, die immer wieder hin und her schwenkten, ausgeleuchtet. Um mein Vorhaben umzusetzen, hätte ich zuerst etwa hundert Meter freies Feld überqueren, dann über einen Zaun klettern und schließlich die Mauer überwinden müssen. Das schaffst du nie im Leben. Sobald du aufstehst, bist du wie auf dem Präsentierteller und die knallen dich ab. Tommy hatte recht gehabt und ich war zu stur, mir das einzugestehen. Ich robbte langsam immer näher an einen der Wachtürme heran. Plötzlich schwenkte wieder ein Scheinwerfer. Für einen Moment war ich voll im Licht. Ich lag wie erstarrt und konnte mich nicht bewegen. Ich erwartete irgendeine Lautsprecherstimme oder dass der Scheinwerferkegel zurückkommen würde. Aber nichts passierte. Hatten die mich wirklich nicht gesehen? Das konnte nicht sein! Der gespenstische Lichtkegel wanderte weiter, als sei nichts gewesen. Ich spürte, wie ich den Schock langsam überwand und mich wieder bewegen konnte. Erschossen zu werden, war die Sache nicht wert. Dann lieber weiter in der DDR leben. Ich sprang auf und sprintete zurück. Ich hatte es versucht und gelernt, dass es zumindest für mich ein Ding der Unmöglichkeit war, die Berliner Mauer zu überwinden.
Einige Wochen später versuchte ich es an anderer Stelle erneut, diesmal zusammen mit einem anderen Kollegen. Wir fuhren mit dem Trabi seines Vaters in die Tschechoslowakei nach Franzensbad. Dort stellten wir den Wagen ab und machten uns auf den Weg zur Grenze nach Bayern. Obwohl wir eine Karte dabeihatten, irrten wir die halbe Nacht umher; hatten keine Ahnung, in welcher Richtung Bayern lag. Der Wald wurde immer dichter. Bald war es so dunkel, dass man die Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte. Irgendwann ging es steil bergauf. Plötzlich hörte ich die erschrockene Stimme meines Kollegen: „Verdammt. Ich habe einen Draht berührt.“
Im selben Moment sahen wir den Lichtkegel einer Taschenlampe die Dunkelheit durchschneiden. Schnelle Schritte und Keuchen waren zu hören. Wir standen da, wie gelähmt. Sekunden später traf uns der Strahl der Taschenlampe. Eine Waffe wurde durchgeladen. Ein Mann brüllte etwas auf Tschechisch. Wir verstanden kein Wort, warfen uns aber auf den Boden, da wir dachten, dass er das meinte. Andere Soldaten mit Taschenlampen kamen. Jetzt, im vollen Licht, sahen wir, dass um uns herum auf Kniehöhe, alles mit Signaldrähten abgesteckt war. Es war ein Wunder, dass wir sie nicht früher berührt hatten. Handschellen klickten. Mir wurde eine Kapuze über den Kopf gezogen. Arme zerrten an mir. Ich wurde in ein Fahrzeug gesetzt und weggebracht.
Als mir die Kapuze wieder abgenommen wurde, befand ich mich in einem kleinen Raum. Ich wurde stundenlang mithilfe eines Dolmetschers verhört, blieb aber bei unserer zuvor abgesprochenen Version: Wir waren Touristen, die sich verlaufen hatten.
Irgendwann zogen sie mir die Kapuze erneut über. Als sie wieder abgenommen wurde, befand ich mich an dem Grenzübergang, über den wir am Tag zuvor in die Tschechoslowakei eingereist waren. Mein Kumpel stand neben mir. Die Tschechen übergaben uns den DDR-Behörden. Die verhörten uns erneut und ließen uns schließlich mit der Auflage gehen, uns am nächsten Tag bei der Polizei in Hütte zu melden. Unsere Ausweise blieben eingezogen.
Im Volkspolizeikreisamt Eisenhüttenstadt wurde mir ein sogenannter PM 12 ausgehändigt. Das war ein Sonderausweis, mit dem ich die DDR nicht mehr verlassen konnte und der bei jedem kontrollierenden Genossen die Alarmglocken schrillen ließ.
Ich ging nicht mehr arbeiten und hatte nur noch die eine Sache im Kopf: in den Westen abzuhauen. Zwei Wochen nach dem Misserfolg an der tschechisch-bayerischen Grenze stieg ich am frühen Morgen mit einem anderen Kollegen, Andreas, in die Bahn. Wir kamen direkt von der Disco, hatten noch eine Menge Restalkohol im Blut und waren fest entschlossen. Wir fuhren Richtung Nordwesten und wollten versuchen, bei Boizenburg über die Grenze zu kommen. Und zwar dort, wo es den beiden Superstars zuvor gelungen war.
Kurz hinter Schwerin kam eine Streife der Transportpolizei durch den Zug. Als die Beamten mich nach meinem Ausweis fragten und ich den PM 12 präsentierte, waren sie alarmiert. Am nächsten Bahnhof mussten Andreas und ich den Zug verlassen. Zwei Männer in Zivil nahmen uns in Empfang. Ich versuchte mich rauszureden, doch diesmal klappte das nicht.
Nach zehn Tagen in der dortigen Untersuchungshaftanstalt wurden Andreas und ich in unseren Heimatbezirk nach Frankfurt (Oder) überführt. Während der Fahrt in einem zum Gefangenentransporter umgebauten W50 wurde strengstens darauf geachtet, dass Andreas und ich weit auseinander saßen, sodass wir nicht miteinander sprechen konnten. In dem Fahrzeug befanden sich etwa 30 Gefangene, die nach und nach an verschiedenen Haftanstalten abgesetzt wurden. Als es in der Strafvollzugsanstalt Rüdersdorf ziemlich leer wurde, positionierte mich einer der begleitenden Strafvollzugs-Angehörigen plötzlich neben Andreas. Nun konnten wir flüsternd miteinander kommunizieren. Dabei versicherten wir uns gegenseitig, dass wir, wie zuvor abgesprochen, aus der U-Haft ausbrechen und es anschließend erneut versuchen würden. Kurz vor Frankfurt fiel den Beamten auf, dass sie einen Fehler gemacht hatten, und sie setzten uns wieder auseinander. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits alles besprochen.
In der Frankfurter U-Haft angekommen, kam ich in eine Zelle, in der bereits drei andere Jungs in meinem Alter untergebracht waren. Einer saß wegen Diebstahls, ein anderer wegen Kfz-Delikten und versuchter Republikflucht und der Dritte wegen Kindesmissbrauchs. Mit zweien, Jörg und Burkhard, verstand ich mich von Anfang an gut. Der, der wegen Kindesmissbrauchs saß, wurde entsprechend den Knastgesetzen von uns ignoriert.
Ich wurde hellhörig, als Burkhard davon sprach, dass er aus der U-Haft ausbrechen könnte, wenn er es denn wollte. „Ich bin das zweite Mal hier“, sagte er. „Damals war ich in einem Bautrupp. Wir haben Renovierungsarbeiten durchgeführt. Ich kenne jeden Winkel im Gebäude.“
„Und warum haust du dann nicht ab?“, fragte ich.
Er sah mich stirnrunzelnd an. „Na, weil man so ein Ding nicht allein durchziehen kann.“
„Warum nicht?“, fragte Jörg, den dieses Thema ebenfalls zu interessieren schien.
„Guck mich an. Sehe ich so aus, wie jemand, der drei Knastwärter ausschalten kann?“ Burkhard war schmächtig und sah keinesfalls so aus. Aber mich interessierte, was er unter „ausschalten“ verstand. Also fragte ich nach.
Er verzog vielsagend den Mund und zuckte mit den Schultern. „Erst mal muss man denen ohne viel Lärm die Schlüssel abnehmen und sie wegschließen, damit sie keinen Alarm auslösen können. Dann muss man sich an das Wachhäuschen vom Freihof heranschleichen und dem Fettsack da drin die Maschinenpistole abnehmen.“
„Vorher musst du aber erst mal aus dem Gebäude herauskommen“, sagte Jörg.
Burkhard winkte ab. „Das ist einfach. Neben der Tür, die zum Hof führt, ist ein Klingelknopf. Den braucht man nur zu drücken.“
„Und was ist mit dem Posten in der Schleuse? Der überprüft doch, wer da durchgeht.“
Burkhard schüttelte überzeugt den Kopf. „Sollte er, macht er aber nicht. Sobald es klingelt, drückt er ohne nachzuschauen den entsprechenden Knopf auf seinem Pult und die Tür lässt sich öffnen. Das ist totale Routine. Ich habe das damals beim Renovieren zigmal selbst erlebt. Hier ist noch nie jemand ausgebrochen, und die sind überzeugt davon, dass das so bleibt.“
Ich kratzte mir nachdenklich das Kinn. Sollte das tatsächlich zutreffen, wäre es ein Kinderspiel, aus der U-Haft auszubrechen. Ich blickte zum Kinderschänder hinüber. Er hatte unserem Gespräch gelauscht und verzog geringschätzig den Mund. „Ihr habt sie doch nicht alle“, murmelte er und wandte sich ab.
Ich nahm mir vor, Burkhards und Jörgs Entschlossenheit zu testen, sobald sich eine Gelegenheit bot. Dies geschah schon am nächsten Tag, denn der Kinderschänder wurde für ein Verhör aus der Zelle geholt. Die beiden waren sehr entschlossen und sagten, ohne zu zögern, Ja.
Auch an den folgenden Tagen musste der Kinderschänder zu Vernehmungen, sodass wir drei genug Zeit hatten, alles zu besprechen. Wir liehen uns sogar ein DDR-Strafgesetzbuch von der U-Haft-Bücherei aus, um herauszufinden, welche Strafe uns blühen würde, falls das alles schiefginge. Wir ermittelten fünf bis zehn Jahre. Was Andreas betraf, so wollte ich ihm eine Teilnahme anbieten. Da ich als Mittäter keine Möglichkeit hatte, persönlich mit ihm in Kontakt zu treten, übernahm Jörg das für mich. Wir ließen ihm die Nachricht zukommen, dass er sich zum Arzt melden solle. Jörg tat dies ebenfalls und hatte so Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Wie nicht anders erwartet, ließ Andreas mir bestellen, dass er selbstverständlich mitmachen würde.
Unser Plan sah vor, zwei Wärter als Geiseln zu nehmen, mit einem geklauten Auto zum Grenzübergang Drewitz zu fahren und zu drohen, die Geiseln zu erschießen, falls man uns die Passage nach West-Berlin verweigern sollte. Im Westen würden sie uns dann als Helden feiern, als diejenigen, die dem kommunistischen Regime entkommen waren. Wir würden unsere Story für viel Geld verkaufen können und wären direkt gemachte Männer.
Ich spürte, wie ich dösig wurde. Definitiv. Was morgen passieren würde, gehörte noch mit zum dritten Fluchtversuch.
„Nachtruhe beenden!“
Die Stimme des Wärters weckte mich. Ich war todmüde, hatte höchstens eine Stunde geschlafen. Aber die Müdigkeit verflog, als ich mir die Wichtigkeit dieses Tages ins Gedächtnis rief. Es war mein letzter in der DDR. Morgen um diese Zeit würde ich schon im Westen sein. Ich stand auf und zog mich direkt an. Jörg und Burkhard taten dasselbe. Wir tauschten Blicke aus und die verrieten, dass keiner von uns seine Meinung geändert hatte. Als der Kinderschänder sah, dass wir uns die Schuhe anzogen, wurde er misstrauisch. Jetzt schien er zu realisieren, dass wir es ernst meinten. Aber es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Wir packten ihn, fesselten seine Hände auf dem Rücken, knebelten ihn und schoben ihn unter eins von den beiden Doppelstockbetten. Jetzt hatten wir den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab.
Kurz darauf bewegte sich der Deckel vom Guckloch. Ein Auge schaute hindurch und die Riegel wurden krachend zurückgeschoben. Schlüssel klapperten; die Tür ging auf. Ich eilte, ohne die übliche Meldung zu machen, an dem verdutzt dreinschauenden Wärter vorbei. Mein Ziel war es, seinen Genossen, der am Ende des Flurs stand, außer Gefecht zu setzen. Im Gehen hörte ich, wie der Mann verwundert fragte, ob in diesem Verwahrraum nicht vier Gefangene sein müssten. Dann hörte ich einen dumpfen Schlag, ein Klatschen und Poltern. Inzwischen war ich beim Sicherungsposten angekommen. Ich streckte ihn mit einem Faustschlag nieder und schleifte ihn den Flur entlang.
Jörg und Burkhard hatten nicht so leichtes Spiel mit ihrem Mann, denn der, mit Spitznamen „Fußballer“, war ein athletischer Typ, der sich nach Kräften wehrte. Zwar hatten sie ihn in die Zelle gedrängt, doch sie konnten die Tür nicht schließen, weil Fußballer sich von innen immer wieder dagegenwarf. Nachdem es ihm gelungen war, die Türe wieder aufzustoßen und die Zelle zu verlassen, versuchte er, einen der Alarmkästen zu erreichen. Das durfte auf keinen Fall passieren, denn dann wäre unser Plan schon hinfällig gewesen. Als ich sah, dass Jörg und Burkhard den Mann nicht unter Kontrolle bekamen, eilte ich ihnen zu Hilfe. Mit vereinten Kräften gelang es uns, ihn „auszuschalten“.
Plötzlich war das Schließen eines Trenngitters im Treppenhaus zu hören, dann schnell näherkommende Schritte. Ich schaltete sofort und rannte den Flur hinunter. Da dieser im rechten Winkel abbog, konnte mich der Wärter nicht sehen. Als er um die Ecke kam, rammte ich dem überraschten Mann die Faust ins Gesicht. Er taumelte zurück und sackte benommen zusammen. Ich packte ihn, wie zuvor seinen Genossen, schleifte ihn den Flur hinunter und sperrte ihn zu den anderen beiden in die Zelle.
Mit den Schlüsseln, die wir den Wärtern abgenommen hatten, befreiten wir Andreas aus seiner Zelle, eine Etage tiefer. Seine Reaktion verriet, dass er überrascht war und offensichtlich nicht damit gerechnet hatte, dass wir die Sache durchziehen würden. „Bist du wahnsinnig, André!“, stieß er hervor, als ich seine Zellentür öffnete. Er brauchte einen langen Moment, um den Schock zu verarbeiten, kam dann aber mit.
Wir schlossen uns hinunter bis ins Erdgeschoss. Nun trennte uns nur noch eine Tür vom Wirtschaftshof des U-Haftgebäudes. Wir schauten gebannt auf Burkhard, als er auf den Klingelknopf drückte. Nur eine Sekunde später war ein Summen zu hören und die Tür ließ sich öffnen. Wir tauschten erleichterte Blicke aus. Kaum zu glauben, wir hatten es tatsächlich aus dem Gebäude geschafft! Das war aber erst die halbe Miete.
Wir schlichen uns an die fensterlose Rückseite des Wachhäuschens für den Freihof heran. Mit verstellter Stimme forderte ich den Wärter auf, die Tür zu öffnen. Kurz darauf wurde ein Riegel zurückgeschoben und die Blechtür ging auf. Der Wärter war seine Maschinenpistole im Handumdrehen los. Wir versicherten unserer ersten Geisel, dass ihr nichts passieren würde, solange sie unseren Anweisungen folgte. Der etwas übergewichtige Obermeister, der auf uns immer einen äußerst Respekt einflößenden Eindruck gemacht hatte, wirkte extrem eingeschüchtert und ordnete sich sofort unter. Weiter ging es zur Personenschleuse. Wir sahen den Posten durch das Fenster an seinem Schreibtisch sitzen. Er sah uns ebenfalls und realisierte, dass etwas nicht stimmte. Jörg legte die gerade erbeutete Kalaschnikow an und zielte durch die Scheibe auf den Mann. Dabei rief er: „Tür öffnen oder es knallt.“
Der Posten griff ängstlich in unsere Richtung blickend nach dem Telefonhörer.
Jörg drückte ohne zu zögern ab. Dann forderte er uns alle auf, zurückzutreten, weil er das Türschloss zerschießen wollte. Gesagt, getan. Als die Tür aufsprang, betraten wir die Personenschleuse.
Der Posten lag schwer verletzt auf dem Boden. Jörg hatte ihn am Oberarm erwischt. Wir nahmen ihm seine Pistole ab. Außerdem erbeuteten wir eine weitere Maschinenpistole, die in einer Ecke des Raums stand. Bevor wir die Schleuse verließen, legte Andreas dem verletzten Posten einen Verband an, um die Blutung zu stoppen.
Auf dem Parkplatz vor der Anstalt stand nur ein Wagen, der uns alle hätte aufnehmen können. Jörg schlug mit dem Kolben der Maschinenpistole ein Seitenfenster ein und Burkhard, der nach eigenen Angaben jeden Wagen innerhalb von Sekunden kurzschließen konnte, machte sich an die Arbeit. Einige Augenblicke später sahen wir einen Streifenwagen um die Ecke biegen. Verdammt! Der Schleusenposten hatte es also doch geschafft, Alarm zu schlagen. Das warf unsere ganze Planung durcheinander.
Der Streifenwagen rollte langsam in unsere Richtung und stoppte in einiger Entfernung. Die Hintertüren gingen auf und zwei Polizisten sprangen heraus. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich die Maschinenpistole, die wir in der Schleuse gefunden hatten. Ich rief den beiden zu, dass wir Geiseln hätten und sie gefälligst verschwinden sollten. Um klarzumachen, wie ernst wir es meinten, gab ich mehrere Schüsse in ihre Richtung ab. Dabei verschwendete ich keinen Gedanken daran, dass ich sie eventuell treffen und auch töten könnte. Die beiden flüchteten sich in die Büsche, während der Streifenwagen zurücksetzte, wendete und mit quietschenden Reifen davonfuhr.
Da Burkhard den Wagen nicht zum Laufen brachte – der Motor drehte zwar durch, wollte aber nicht anspringen –, verließen wir den Parkplatz, um nach einem anderen geeigneten Fahrzeug Ausschau zu halten. Nachdem wir nur wenige Meter gegangen waren, sahen wir wieder einen Streifenwagen. Er stand in einer Parktasche, dahinter ein Polizist mit gezückter Pistole in Schussposition. Sonst war niemand weit und breit zu sehen. Plötzlich kam mir eine Idee: Warum schwierig, wenn’s auch einfach ging? Warum nicht den Streifenwagen als Fluchtfahrzeug benutzen?
Wir richteten unsere Waffen auf den Mann und forderten ihn auf, die Pistole fallen zu lassen. Komischerweise folgte er der Anweisung, ohne zu zögern. Er trat hinter dem Wagen hervor und kam langsam, mit erhobenen Händen, auf uns zu. Dabei baumelte die Dienstwaffe an einer Halteschnur, die an seinem Gürtel befestigt war. Burkhard ging auf den großen, bulligen Mann zu und zerrte an der Pistole. Beim dritten Versuch gelang es ihm, sie abzureißen. Als ich dem Polizisten sagte, er solle mir den Autoschlüssel geben, stürmte er plötzlich auf mich zu und versuchte, mir die Maschinenpistole zu entreißen. Nach kurzem Kampf gab es einen Knall. Ich weiß nicht, wer von uns beiden am Abzug war, das Ding ging jedenfalls los, verletzte aber niemanden. Durch den Schreck ließ der Polizist locker, was mir die Chance gab, wieder volle Kontrolle über die Waffe zu bekommen. „Dachtest wohl, du kannst mich nehmen, Arschloch“, sagte ich wütend und rammte ihm den Ellbogen ins Gesicht. Ich stand keuchend da und sah, wie er zurücktaumelte. Plötzlich knallte es zweimal kurz hintereinander. Der Polizist zuckte zusammen und sank zu Boden. Ich drehte mich um und sah, wie Burkhard die Pistole, die er dem Mann nur wenige Sekunden zuvor abgenommen hatte, immer noch im Anschlag hielt. Dabei blickte er verstört um sich, als könne er nicht fassen, was er gerade getan hatte.
Der Polizist lag seitlich auf dem Straßenpflaster. In seiner Bauchgegend bildete sich ein Blutfleck, der schnell größer wurde. Näherkommende Sirenen waren zu hören. Anwohner, durch die Knallerei aufmerksam geworden, blickten neugierig aus den Fenstern der umliegenden Häuser.
„Wir müssen weg hier“, sagte Andreas. „Erst mal in das Hochhaus da drüben.“ Die verletzte Geisel vor sich her treibend, lief er auf das Gebäude zu. Wir anderen folgten ihm. Im Hochhaus angekommen klingelten wir an der erstbesten Wohnungstür. Eine Frau öffnete. Angesichts unseres Aufzugs – Häftlingskleidung und bewaffnet – war sie äußerst verwirrt, sagte uns aber dennoch, wo sich die Wohnung des Hausmeisters befand. Wir brauchten ein Telefon, um mit der Polizei in Kontakt zu treten. In der DDR hatten nur wenige Haushalte einen Anschluss, Hausmeister jedoch fast immer. Andreas, die verletzte Geisel und ich fuhren zunächst allein mit dem Fahrstuhl hoch zu dessen Wohnung, um die Lage zu erkunden. Als der Mann öffnete und uns sah, wollte er die Tür direkt wieder zuschlagen, doch ich stellte meinen Fuß dazwischen. Dann schoben wir den Endfünfziger einfach zur Seite und marschierten ein. Im Wohnzimmer saß seine Frau im Bademantel. Als sie uns sah, sprang sie erschrocken auf.
Nachdem wir die Situation erklärt hatten, fand sich das Hausmeisterehepaar zähneknirschend mit der Tatsache ab, dass ihr Sonntagmorgen verdorben war. Da sie ein Telefon hatten, blieb ich mit der Geisel bei ihnen, während Andreas die anderen holte. Als sie kamen, bat uns die Frau des Hausmeisters, wenigstens die Freundlichkeit zu besitzen, unsere Schuhe auszuziehen. Wir taten ihr den Gefallen. Einige Minuten später ging die Tür zum Schlafzimmer auf und eine ältere, nur mit Nachthemd bekleidete Dame kam heraus. Als sie uns sah, schrie sie auf und machte kehrt. Die Frau des Hausmeisters folgte ihr, um sie aufzuklären. Währenddessen erfuhren wir von ihrem Mann, dass dies seine 78-jährige Tante war. Sie weilte zu Besuch aus West-Berlin und wollte am Nachmittag wieder heimfahren.
Der Zustand der Geisel mit der Schussverletzung verschlechterte sich zusehends. Unser neuer Plan sah vor, telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu treten und einen Arzt, einen Fluchtwagen sowie freies Geleit nach West-Berlin zu fordern. Eigentlich wollten wir ein Vorgehen kopieren, das wir in einem Gangsterfilm gesehen hatten. Ich ging ans Telefon und wählte die 110, um das Gespräch zu führen.
„Äh … hören Sie“, stammelte der Polizist. „Ich ... kann das nicht entscheiden. Machen Sie keinen Unsinn. Wir können –“
„Hör zu, Bulle“, unterbrach ich. „Wir stellen hier die Forderungen. Wir wollen raus aus eurem Bolschewisten-Staat, und dass wir nicht spaßen, müsstet ihr eigentlich schon mitgekriegt haben.“ Ich winkte die unverletzte Geisel heran. „Erkläre ihm, dass wir nicht spaßen.“
Der Mann erhob sich von seinem Platz auf dem Sofa und kam auf mich zu. Nachdem ich den Hörer an ihn weitergereicht hatte, begann er zögerlich zu sprechen. „Hier ... spricht Obermeister K. Die Jungs spaßen nicht ... ehrlich. Erfüllt ihre Forderungen, sonst legen die uns um. Wir brauchen dringend einen Arzt. Genosse L. macht sonst nicht mehr lange. Der blutet wie ein Schwein.“
Das Hausmeisterehepaar wurde zutraulicher und später sogar ausgesprochen freundlich. Die Frau machte Kaffee für alle. „Ich wünsche euch wirklich, dass ihr’s schafft“, sagte sie. „Wenn wir jünger wären, würden wir auch rübermachen.“
Die alte Dame hielt sich im Hintergrund. Sie wollte sich nicht zu uns setzen, da sie, wie sie es ausdrückte, „zu alt, für das alles“ war. Währenddessen saßen die Geiseln stumm und mit gesenkten Köpfen da. K. schwitzte stark. Er wischte sich ständig die Schweißperlen von der Stirn und bat immer wieder um ein Glas Wasser, das er dann in einem Zug leertrank. Der Verband der verletzten Geisel war inzwischen durchgeblutet. Andreas legte ihm einen neuen an.
Nach einer Stunde folgte das zweite Telefonat. Mir wurde versichert, dass man unsere Forderungen erfüllen würde. Wir müssten uns allerdings ein bisschen gedulden.
Das hörte sich vielversprechend an. War unsere Stimmung zu diesem Zeitpunkt eher gedrückt, so stieg sie nun an. Wir saßen alle am Wohnzimmertisch, tranken Kaffee und unterhielten uns. Als Jörg irgendwann zum Fenster ging und hinausschaute, sank das Stimmungsbarometer jedoch wieder, denn die Straßen waren wie leergefegt. Es gab keinerlei Verkehr mehr. In einiger Entfernung sahen wir einen großen Trupp Uniformierter. Im näheren Umkreis des Hochhauses standen einzelne Grüppchen von Männern, die kugelsichere Westen trugen. So einfach, wie es kurzzeitig den Anschein gehabt hatte, sollte die Sache also doch nicht über die Bühne gehen.
Ich wählte die 110. „Was ist mit dem Arzt, Bulle?“, fragte ich aggressiv. „Und wann kommt unser Wagen?“
Mein Gesprächspartner versuchte, mich zu beruhigen. „Ich sagte doch schon: Ihre Forderungen werden erfüllt. Aber wir brauchen mehr Zeit.“
„Eine halbe Stunde habt ihr noch“, sagte ich. „Ist der Wagen dann nicht hier, fällt ein Schuss und die erste Geisel ist tot.“
„Bitte tun Sie das nicht“, hörte ich noch, bevor ich auflegte.
Es war offensichtlich, dass die Zeit gewinnen wollten. Aber wofür? Was sollten wir tun, wenn der Wagen in einer halben Stunde nicht bereitstand? – Wir diskutierten die Sache durch und kamen zu dem Schluss, dass die uns den Wagen hundertprozentig bereitstellen würden. Die konnten doch nicht das Leben ihrer Genossen aufs Spiel setzen. Falls es doch anders käme, würden wir einen Schuss in die Luft abgeben. Für die Polizei wäre das der Beweis, dass wir unsere Drohung wahrgemacht hatten. Spätestens dann müssten sie einlenken, um wenigstens das Leben der verbliebenen Geisel zu retten. So zumindest unsere Logik.
Wir warteten. Nichts passierte. Es war nicht zu fassen. Entweder hatten die uns durchschaut und wussten, dass wir blufften, oder das Leben der Geiseln war ihnen egal. Nach Ablauf der Zeit öffnete Jörg das Fenster und gab einen Schuss ab. Kurz darauf klingelte das Telefon.
„Was war das eben für ein Schuss?“
„Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass wir die erste Geisel erschießen, wenn der Wagen nicht in einer halben Stunde hier ist. Das Leben eures Genossen geht auf eure Kappe.“
„Haben Sie das wirklich getan?“ Mein Gesprächspartner klang entsetzt. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Der Wagen müsste jeden Augenblick bei Ihnen ankommen.“
„Wenn ihr uns weiter verarscht, stirbt die zweite Geisel auch.“ Nachdem ich aufgelegt hatte, schaute ich zu den Geiseln hinüber. Die Angst stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Natürlich wäre uns nicht im Traum eingefallen, sie einfach so zu exekutieren. Aber das wussten sie natürlich nicht. Die Stimmung war gedrückt. Jörg lief unruhig hin und her und blickte immer wieder aus dem Fenster, in der Hoffnung, endlich unseren Fluchtwagen zu sehen. Schließlich schaltete jemand das Radio ein. Die Musik hatte eine beruhigende Wirkung. So warteten wir und jeder machte sich seine Gedanken darüber, wie die Sache wohl ausgehen würde.
Kurz nach halb elf klingelte es an der Wohnungstür. Burkhard ging, um nachzuschauen.
„Ich bin der Arzt“, klang eine Stimme laut und vernehmlich.
Jörg und ich nahmen Schussposition ein, während Burkhard vorsichtig die Tür öffnete. Der Arzt, begleitet von einer Krankenschwester, betrat die Wohnung. Wir untersuchten die beiden nach Waffen und führten sie ins Wohnzimmer zu der verletzten Geisel. Als der Arzt mit seiner Untersuchung fertig war, sagte er, dass der Mann unverzüglich stationär behandelt werden müsse. Nach kurzer Beratung beschlossen wir, ihn gehen zu lassen. Gestützt vom Arzt und der Krankenschwester, verließ er die Wohnung.
Für uns und die verbliebene Geisel hieß es weiter: warten. Die Zeit verging. Gegen 11:30 Uhr kamen die Frauen mit Handtaschen und einem Koffer aus dem Schlafzimmer. Sie wollten zum Bahnhof. Wir hatten keinen Grund, sie aufzuhalten.
Als sie weg waren, gingen wir nochmals unseren Plan durch: Wir zogen probehalber die Strumpfmasken über, die wir aus unseren Unterhosen gefertigt hatten, und stellten uns mit der Geisel in der Reihenfolge auf, in der wir zum Fluchtwagen gehen wollten, genau, wie wir es in dem Gangsterfilm gesehen hatten. – Danach setzten wir uns wieder und warteten.
---ENDE DER LESEPROBE---