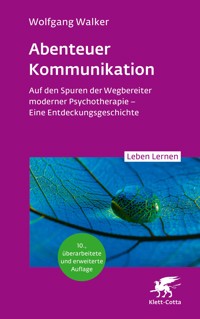
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
Das fünfte Paradigma: Psychotherapie und Kommunikation Wie die Kommunikationstheorie die therapeutische Praxis revolutionierte Die theoretischen Grundlagen moderner, interventionsorientierter Psychotherapie Medizinische, psychodynamische und verhaltenstherapeutische Vorstellungen prägen nach wie vor weite Bereiche der Psychotherapie. Psychische Probleme werden auf neurobiologische Störungen, innere Konflikte oder erlernte Denk- und Verhaltensmuster zurückgeführt. Doch der Blick auf das Individuum übersieht entscheidende Zusammenhänge. In den 1950er Jahren leiteten der Anthropologe Gregory Bateson und der Psychiater Jürgen Ruesch einen Paradigmenwechsel ein, dessen Tragweite bis heute massiv unterschätzt wird. Ihre kybernetisch fundierte Kommunikationstheorie stellt bestehende Annahmen radikal in Frage und eröffnet eine völlig neue Sichtweise auf die Ursachen und Behandlung psychischer Leiden. Sie zeigt schlüssig, dass diese als Folge fehlgeleiteter Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsprozesse verstanden werden können – im Individuum, in Beziehungen und in der Gesellschaft. Zeitgleich entwickelten einige visionäre Psychotherapeuten und -therapeutinnen innovative Methoden, die solche Prozesse gezielt verändern. Sie schufen die Grundlage für moderne, interventionsorientierte Psychotherapie. Die Erforschung ihrer Arbeit lieferte Antworten auf entscheidende Fragen: Wie lassen sich psychische Prozesse theoretisch angemessen beschreiben? Und wie kann therapeutische Kommunikation so gestaltet werden, dass sie direkt Veränderungen bewirkt? Dieses Buch ist weit mehr als ein historischer Rückblick. Der Autor zeichnet die Entstehung dieser bahnbrechenden Erkenntnisse anhand fesselnder Biografien der Schlüsselfiguren nach. Er beschreibt und untersucht die Rolle grundlegender theoretischer Vorannahmen der großen psychotherapeutischen Strömungen und lädt dazu ein, diese konstruktiv zu hinterfragen. Ein Must-Read für alle, die sich mit den Grundlagen der Psychotherapie auseinandersetzen wollen – fundiert, vielschichtig und hochaktuell. Dieses Buch richtet sich an: Angehende und praktizierende Psychotherapeut:innen, Psycholog:innen, Psychiater:innen, Forschende im Bereich der Klinischen Psychologie und Psychotherapie, Coaches, interessierte Laien
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolfgang Walker
Abenteuer Kommunikation
Auf den Spuren der Wegbereiter moderner Psychotherapie – Eine Entdeckungsgeschichte
Klett-Cotta
Leben Lernen
Die Reihe »Leben Lernen« stellt auf wissenschaftlicher Grundlage Ansätze und Erfahrungen moderner Psychotherapien und Beratungsformen vor; sie wendet sich an die Fachleute aus den helfenden Berufen, an psychologisch Interessierte und an alle nach Lösung ihrer Probleme Suchenden.
Alle Bücher aus der Reihe »Leben Lernen« finden Sie unter:
www.klett-cotta.de/lebenlernen
Zu diesem Buch
Traditionelle therapeutische Sichtweisen führen psychische Probleme auf neurobiologische Störungen, innere Konflikte oder erlernte Denk- und Verhaltensmuster zurück. Doch der Blick auf das Individuum übersieht entscheidende Zusammenhänge. In den 1950er Jahren leiteten der Anthropologe Gregory Bateson und der Psychiater Jürgen Ruesch einen Paradigmenwechsel ein, dessen Tragweite bis heute massiv unterschätzt wird. Ihre kybernetisch fundierte Kommunikationstheorie eröffnete eine völlig neue Sicht auf psychische Leiden und deutet sie schlüssig als Folge fehlgeleiteter Informationsverarbeitungs- und Kommunikationsprozesse – auf individueller, zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Ebene. Zeitgleich entwickelten visionäre Psychotherapeuten und -therapeutinnen bahnbrechende Methoden, die die therapeutische Praxis revolutionierten. Die kybernetische Perspektive erlaubt es, klinische Phänomene und moderne Therapieverfahren in einem neuen Licht zu verstehen.
Anhand fesselnder Biografien der Schlüsselfiguren zeichnet der Autor die Entstehung dieser richtungsweisenden Erkenntnisse nach und lädt dazu ein, die Grundannahmen psychotherapeutischer Schulen konstruktiv zu hinterfragen.
Ein Must-Read für alle, die sich mit den Grundlagen der Psychotherapie auseinandersetzen wollen – fundiert, vielschichtig und hochaktuell.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 1996/2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Jutta Herden
unter Verwendung einer Abbildung von Vera Kuttelvaserova/Adobe Stock
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-89322-9
E-Book ISBN 978-3-608-12330-2
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20676-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Danksagung
Vorwort
Vorbemerkungen und Überblick
Teil I
Die fünf Grundmodelle psychotherapeutischer Welt- und Menschenbilder
Kapitel 1
Paradigmatische Voraussetzungen therapeutischer Systeme
Die schamanistische Sichtweise
Die somatogenetische Sichtweise
Die psychodynamische Sichtweise
Die lerntheoretische Sichtweise
Der Neuansatz der Kommunikationstheorie
Kapitel 2
Die Erforschung veränderungswirksamer therapeutischer Kommunikation
Richard Bandlers Begegnung mit der Gestalttherapie
Bandlers Gestaltgruppen der Jahre 1971 und 1972
Die Kooperation mit Frank Pucelik
Die Zusammenarbeit mit John Grinder
Die Anfänge des »Meta«-Projekts
Die Begegnung mit Virginia Satir
Die erste »Meta-Gruppe«
Die Begegnung mit Gregory Bateson
Die Begegnung mit Milton H. Erickson
Die Gruppen der Jahre 1974 bis 1977
Grundlegende Charakteristika der frühen Forschungen
Teil II
Die Theorie der Kommunikation
Kapitel 3
Gregory Bateson – der Wegbereiter systemischer Therapiekonzepte
Leben und Werk – ein Überblick
Auf dem Weg zu einer Theorie der Kommunikation
Die frühen anthropologischen Studien auf Papua-Neuguinea
Die Studien auf Bali
Exkurs: Die frühen Lerntheorien
Batesons Beiträge zur Lerntheorie
Resümee
Kybernetik, Kommunikationstheorie und die »Double Bind«-Hypothese zur Schizophrenie
Die kybernetische Perspektive der 1940er Jahre
Die Theorie kybernetisch vernetzter Kommunikation
Die Forschungen zur Schizophrenie und die Entstehung der »Double Bind«-Hypothese
Die Entwicklung nach der Veröffentlichung der »Double Bind«-Hypothese
Teil III
Die Praxis veränderungswirksamer therapeutischer Kommunikation
Kapitel 4
Fritz Perls – Rebell und Erneuerer
Fritz Perls und die Entwicklung der Gestalttherapie
Die psychoanalytischen Lehrjahre
Exkurs: Zur Entwicklung der psychoanalytischen Behandlungstechnik
Der Übergang zur »Konzentrationstherapie
Die Frühform der klassischen Gestalttherapie
Die Entdeckung der »existentiellen Sackgasse«
Die Spätform der Gestalttherapie
Kapitel 5
Virginia Satir – die »Grande Dame« der Familientherapie
Der Werdegang Virginia Satirs
Grundlegende Konzepte Virginia Satirs
Psychotherapie und Spiritualität
Persönliches Wachstum und die Ganzheit des Selbst
Selbstwert und Kommunikation
Der Prozess der Kommunikation
Kongruenz und Inkongruenz
Ziele und Grundprinzipien der therapeutischen Arbeit Satirs
Kapitel 6
Milton H. Erickson – der Magier der Kommunikation
Zur Person Milton H. Ericksons
Der Lebensweg
Die Persönlichkeit Milton H. Ericksons
Milton H. Ericksons Auffassungen zur Psychotherapie
Ericksons atheoretischer Pragmatismus
Der Utilisationsansatz in der Psychotherapie
Ericksons Auffassung vom Unbewussten und die Ablehnung der Einsichtstherapie
Indirektheit als therapeutisches Prinzip
Ericksons Forderungen an Psychotherapeuten
Teil IV
Die Grundlegung kommunikationstheoretisch fundierter Psychotherapie
Kapitel 7
Die kommunikationstheoretischen Modelle John Grinders und Richard Bandlers
Die theoretische Perspektive
Die pragmatische Perspektive
Exkurs: Grundlegende Vorgehensweisen akademischer Psychotherapieforschung
Das kommunikationstheoretische Rahmenmodell
Das erkenntnistheoretische Rahmenmodell
Das »Meta-Modell« therapeutisch wirksamer Sprache
Sinnesspezifische Prädikate, Repräsentationssysteme und nonverbale Zugangshinweise
Hypnotische Sprachmuster, Trancezustände und das Konzept der »Transderivationalen Suche«
Die Erforschung veränderter Bewusstseinszustände
Nonverbale Markierungen und das Konzept des »Ankerns«
Die Struktur der subjektiven Erfahrung
Das Konzept der Submodalitäten
Kapitel 8
Weitere kommunikationstheoretisch begründbare Therapiemodelle
Epilog
Anhang
Literatur
Sachregister
Personenregister
Dies ist ein Buch über Menschen und ihre Suche nach Wegen zur Heilung und Linderung von Leid. Ihre bahnbrechenden Erkenntnisse eröffneten grundlegend neue Möglichkeiten therapeutischer Arbeit. Sie schufen die Grundlagen wahrhaft moderner Psychotherapie.
Meiner Frau Meike für ein Leben in Liebe gewidmet
(1)Danksagung
Viele der Gedanken, die hier ihren Ausdruck finden, entstanden im Laufe langjähriger Beziehungen, gemeinsam geteilter Erfahrungen(1) und leidenschaftlich geführter Diskussionen. Es ist mir daher ein großes Anliegen, einer Reihe von Menschen zu danken, denen ich mich zutiefst verbunden fühle. Sie alle haben – auf ihre je eigene Weise – das ihre zur Entstehung dieses Buches beigetragen.
Mein Dank gilt zunächst meinen Eltern, FRITZ und LORE WALKER. Ihre selbstlose Unterstützung und Liebe ist ohne Beispiel. Mit unendlicher Geduld und Großzügigkeit schufen sie mir die Möglichkeit, meine Fähigkeiten zu entfalten. Ich verdanke ihnen mehr, als Worte zu sagen vermögen.
MEIKE MUNDER und MO MUNDER sind zwei wundervolle Menschen. Sie machen mein Leben glücklich und erfüllt. Was soll man zu so viel Glück sagen? Schöner kann eine Familie nicht sein! Auch mein Bruder, KLAUS WALKER und MARTINA HAINER-WALKER sind ein sehr wichtiger Teil meines Lebens.
Mein Dank geht auch an ALENA SPERLING. Sie wies mir vor vielen Jahren den Weg. Ebenfalls prägend war die Begegnung mit DR. ELKE LEONHARD. Sie machte mir schon in sehr jungen Jahren Mut, meinem eigenen Weg zu folgen. Die Freundschaft mit ihr war intensiv und reich an Impulsen. Dies gilt auch für JOHANN W. KLUCZNY. Er lehrte mich, wie kreativ und humorvoll die therapeutische Arbeit mit Menschen sein kann. Mit Freude erfüllte mich auch die Begegnung mit JOHANN C. RAUDNER (†), der mit einzigartigem Humor ungewöhnliche Dimensionen im Bereich der Heilung erkundete.
Eine tiefe persönliche Freundschaft, gemeinsame fachliche Interessen und spannende – gelegentlich auch kontroverse – Diskussionen verbinden mich seit über 25 Jahren mit DR. LUCAS DERKS, dem Entdecker des »Sozialen Panoramas« und Begründer der »Mental Space Psychology« sowie dem Kulturwissenschaftler und Ökonomen PROF. DR. WALTER ÖTSCH. Unser fortlaufender Austausch und die gemeinsame Ausarbeitung zentraler Leitideen im Rahmen des »International Laboratory For Mental Space Research (ILMSR)« sind eine stete Quelle der Inspiration. Sie prägen meine therapeutische Arbeit zutiefst.
Die unermüdliche Neugier, der keine Grenzen kennende Forschergeist und die liebevolle Hilfsbereitschaft von BRUCE A. MOEN (†), meinem Bruder im Geiste, war ausschlaggebend für weitere entscheidende Durchbrüche. Gemeinsam gelang es uns, die Grenzen des therapeutisch Erreichbaren um eine grundlegend neue Dimension zu erweitern: die Auflösung von – als kognitiv nicht steuer- und veränderbar erlebten – Leid erzeugenden emotionalen Prozessen.
Dankbar bin ich auch meinen Klienten – insbesondere jenen aus dem Bereich der Psychiatrie. Mit ihnen durfte ich lernen, wie wirksame therapeutische Hilfe gelingt.
Mehr als Dank schulde ich schließlich DR. GERHARD HERGENRÖDER. In geradezu selbstloser Weise fand er sich immer wieder dazu bereit, mich bei der Verwirklichung meiner Ziele zu unterstützen. Er lehrte mich das Handwerk des Autors und stand mir während der gesamten Entstehungszeit dieses Buches – auch bei dessen vorliegender Erweiterung und grundlegender Revision – mit seinem unersetzlichen Rat zur Seite. Er machte mir Mut, wenn ich zu zweifeln begann und führte mich mit außergewöhnlichem psychologischem Feingefühl behutsam zur Verwirklichung meines Vorhabens. Ohne ihn wäre dieses Buch nie entstanden.
Mit GEORG ARMBRUST, ULRICH BURMEISTER, MARTIN SCHMID, CAROLA DECKER, SILVIA SCHILLINGER, MEIKO BRUDZIAK, DR. UTA ESER, ROLAND EISELE, DR. KAREN SCHNELLBACH, ULRIKE HOPE, THOMAS und MONIKA SCHÖNBURG, RECHA DREWS, BERND FASSAUER, ANJA ECK, JANA WÖLLERT, ROBERT WÖLLERT-WACHE, MARGARETHE RAUDNER, MARIE ROGGE, AXEL RYMARCEWICZ, STEFFEN KUBE, DR. KATRIN GOEDSCHE, CHRISTIAN ROSENBLATT, DR. FRANK GÖRMAR (†), JOCHEN SPRENGER sowie THIES und JORI WEIDE verbinden mich langjährige Freundschaften. Sie alle sind ein Teil meines Lebens, den ich niemals missen möchte.
Mein Dank gilt auch PROF. DR. JÜRGEN KRIZ, dessen engagierte Arbeit und wissenschaftliche Toleranz vorbildhaft sind. Anders als viele seiner Kollegen ermöglichte er es mir, mit der ursprünglichen Fassung dieser Arbeit meinen akademischen Grad zu erlangen.
Neben den genannten (und den vielen hier nicht genannten) Menschen möchte ich auch meiner ersten Lektorin, IRMELA KÖSTLIN, danken. Sie hatte das Potential dieses Buches unmittelbar erkannt. Mein besonderer Dank gilt auch – neben den anderen an diesem Projekt beteiligten MitarbeiterInnen des Verlags Klett-Cotta – DR. STEPHAN DIETRICH und UTE LACHENMAYER. Die Zusammenarbeit und der persönliche Kontakt mit ihnen war und ist ein Vergnügen!
Berlin, im Mai 2024
Wolfgang Walker
Vorwort
Dieses Buch schildert die Entdeckungsgeschichte und grundlegende Prinzipien moderner, interventionsorientierter Psychotherapie. In einer Ablösung von den tiefenpsychologischen und verhaltenstherapeutischen Hauptströmungen, die das Feld der Psychotherapie noch heute prägen, hatten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Sichtweisen entwickelt, die die psychotherapeutische Theorie und Praxis auf vollkommen neue Grundlagen stellten.
Die hier als »modern« bezeichneten Therapieverfahren besitzen ein Alleinstellungsmerkmal: Ihre Interventionen zielen direkt auf die Veränderung psychischer Prozesse ab, die – in Individuen, Partnerschaften, Familien, beruflichen Zusammenhängen und der Gesellschaft – Leid erzeugen.
Therapieprozesse können mit den heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten deutlich verkürzt werden. Angesichts des zunehmenden Bedarfs an psychotherapeutischer Hilfe – bei gleichzeitig begrenzten finanziellen Möglichkeiten öffentlicher Gesundheitssysteme – ist dies ein Gebot der Stunde.
Doch warum sind moderne Verfahren weniger verbreitet, als es ihnen zustehen würde? Hier lohnt sich zunächst ein nüchterner Blick auf die aktuelle Situation.
Sichtet man die Vielzahl wissenschaftlicher Studien zu gängigen Verfahren der Psychotherapie, so fällt auf, dass einer Reihe von Methoden tatsächlich Wirksamkeit attestiert wird. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die statistisch ermittelten Effekte weit unter dem liegen, was mit heutigen Mitteln erreichbar ist. Neurowissenschaftler ziehen aus ihren Untersuchungen gar den Schluss, dass die Wirkung im Gesundheitswesen etablierter Therapieverfahren unabhängig von den angewandten Methoden vorwiegend auf unspezifische Wirkfaktoren – wie etwa die von den Klienten erlebte Qualität der therapeutischen Beziehung – zurückzuführen sei.1
Bezieht man ernste psychiatrische Erkrankungen in die Betrachtung mit ein, so muss man sich eingestehen, dass die Erfolgsquote heute angewandter Behandlungsformen – gemessen am Kriterium der »Heilung« – fast gegen Null tendiert. Dies wird gelegentlich darauf zurückgeführt, dass diese Erkrankungen »unheilbar« seien. Man könne die Betroffenen daher nur dabei unterstützen, »mit der Erkrankung zu leben«. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht stellt sich jedoch die Frage, ob die ausbleibenden Behandlungserfolge(1) nicht auch darauf zurückführbar sein könnten, dass die angewandten Verfahren – und deren theoretische Grundlagen – konzeptionell nicht in der Lage sind, die zugrundeliegenden psychischen Prozesse angemessen zu erfassen.
Gelegentlich wird auch unterstellt, es gehe schulenspezifischen Interessensverbänden(1) von Psychotherapeuten vor allem darum, die zur Verfügung gestellten Gelder in die Kassen der eigenen Mitglieder zu lenken. Doch selbst wenn dies in Einzelfällen zuträfe, so wären die Funktionäre schlecht beraten. Zum einen ginge dies an den Bedürfnissen der Betroffenen und der Gesellschaft vorbei. Doch sie sind der Grund, weshalb es diesen wunderbaren Beruf gibt. Zum anderen machen wir therapeutisch tätigen Menschen diese Arbeit, weil wir Leidenden helfen möchten. Moderne, interventionsorientierte psychotherapeutische Verfahren erlauben dies um vieles wirksamer. Unser Leben als professionelle Menschenhelfer wird erfüllter.
Schwerer scheint das Argument zu wiegen, dass die institutionellen Strukturen, in denen sich die psychotherapeutische Landschaft organisiert, zum Teil selbst zu undurchlässig sind. Angesichts des teils beträchtlichen Wildwuchses im therapeutischen Bereich hat man in Deutschland zu Recht beschlossen, dass – analog zur Medizin – nur solche Verfahren durch Krankenversicherungen erstattet werden, deren Wirksamkeit wissenschaftlich validiert ist. Gleichzeitig hat man es jedoch versäumt, eine unabhängige, öffentlich finanzierte Prüfbehörde zu installieren. Sie würde es Innovatoren im Feld erlauben, die Wirksamkeit ihrer Methoden – neutral und unvoreingenommen – wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Stattdessen übertrug man diese Aufgabe entsprechenden Fakultäten an den Universitäten. Doch diese neigen – nicht zuletzt weil sie Forschungsprojekte beantragen müssen – dazu, vor allem jene Verfahren zu testen, die mit eigenen Denkweisen und Forschungsstrategien vereinbar sind. Der Zugang zu den personellen und materiellen Ressourcen(1)(1), die für Grundlagenforschung und aussagekräftige Studien unverzichtbar sind, wird nicht-akademischen Forschern in der Regel verwehrt. Sprengen deren Modellvorstellungen(1) etablierte Sichtweisen, so bleiben sie – unabhängig von der Wirksamkeit ihrer Methoden – im wissenschaftlichen Diskurs chancenlos. Dies ist in gewisser Weise paradox, da viele heute anerkannte Verfahren aus der therapeutischen Praxis heraus – und nicht an akademischen Lehrstühlen – entwickelt worden sind. Mit privaten Ressourcen sind umfangreiche, wissenschaftlich solide Studien jedoch selten zu leisten. Daher haben innovative Praktiker, die keine engagierten Verbündeten unter akademischen Forschern finden, faktisch kaum Möglichkeiten, ihre Neuentwicklungen auf den Prüfstand zu stellen. In der Folge ist es ein Leichtes, ihnen entgegenzuhalten, die Wirksamkeit ihrer Verfahren sei nicht wissenschaftlich belegt. Dies zu ändern ist eine Aufgabe der Politik.
Doch die eigentlichen Wurzeln für die Probleme, auf die innovative Ansätze stoßen, liegen – so meine feste Überzeugung – viel tiefer. Betrachtet man die faszinierende Geschichte der Psychotherapie(1) aus konzeptioneller Perspektive, so wird deutlich, dass entscheidende theoretische Entwicklungen nie in voller Breite rezipiert worden sind. Dies ist bedauerlich, denn nichts ist praktischer als eine gute Theorie! Gelingt es, psychische Prozesse auf dieser Ebene angemessen zu beschreiben, so können daraus praktische Methoden abgeleitet werden, die um ein Vielfaches schneller und wirksamer sind.
Fundamentale Voraussetzung für Innovationen ist jedoch – wie in allen Wissenschaften – die Bewusstmachung und kritische Reflexion eigener paradigmatischer Vorannahmen und Forschungsmethoden. Sie markieren die Grenzen dessen, was therapeutisch vorstellbar und machbar erscheint. Doch auf dieser fundamentalen Ebene wird heute – so mein Eindruck – kaum noch ergebnisoffen reflektiert. In der Folge findet man an den meisten psychologischen Fakultäten heute eine verhaltenstherapeutisch dominierte geistige Monokultur vor. Wertvolle Ressourcen außerhalb aktuell gängiger akademischer Diskurse bleiben so systematisch ungenutzt.
Ziel des vorliegenden Werkes ist es, diese Lücke zu schließen. Ich möchte Sie, die Leserinnen und Leser dieses Buches, in einer lebendigen und anschaulichen Art und Weise an das Eingangsportal zu einem – noch immer weitgehend unbekannten – Land therapeutischer Möglichkeiten führen.
Meine Hoffnung ist es, nicht nur heute und in Zukunft tätige Therapeutinnen und Therapeuten sowie interessierte Laien zu erreichen. Auch Forscherinnen und Forscher an den Universitäten – insbesondere aus dem Bereich der Klinischen Psychologie und der Kognitiven Therapie – werden dieses Buch mit Gewinn lesen. Und dies ist wichtig, denn sie sind einflussreiche Multiplikatoren und Gewährsleute für Seriosität, die das zukünftige Gesicht der psychotherapeutischen Landschaft maßgeblich mitprägen werden. Daher werden auch ihnen vielfältige Anregungen gegeben, Vorannahmen und Begrenzungen eigener Forschungsprojekte und -methoden konstruktiv zu reflektieren.
In diesem Sinne versteht sich das vorliegende Buch auch als Anstoß für einen – seit langem fälligen – Diskurs über den professionellen Auftrag von Psychotherapeuten sowie grundlegende Prinzipien, Werthaltungen und Zielsetzungen der Psychotherapie und der akademischen Forschung.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen!
Vorbemerkungen und Überblick
Diejenigen von Ihnen, denen eine geschlechtsspezifische Ausdrucksweise wichtig ist, bitte ich schon jetzt, mir zu verzeihen. Ich verstehe das dahinter stehende Anliegen und teile es zutiefst. Doch die in diesem Buch dargestellten Sachverhalte sind zum Teil komplex. Ich wollte es Ihnen einfach erleichtern, den Gedankengängen zu folgen. Daher habe ich mir erlaubt, darauf zu verzichten.
Auch ist es in diesem Rahmen nicht möglich, die Grundlagen aller therapeutischen Verfahren zu besprechen, die heute angewandt werden. Ein solches Unterfangen ist unmöglich, wenn man nicht oberflächlich bleiben möchte. Daher beschränke ich mich auf die Hauptlinien der Psychotherapiegeschichte. Diejenigen von Ihnen, die ihre Arbeit – etwa im Bereich energiemedizinisch begründeter Ansätze – in diesem Buch nicht wiederfinden, bitte ich um Nachsicht. Dennoch denke ich, dass auch Sie durch dieses Buch bereichert werden.
Um Ihnen eine erste Orientierung zu geben, was Sie bei der Lektüre erwartet, wird im Folgenden ein Überblick über den Aufbau und die Inhalte des Textes gegeben.
Das Buch ist in vier Teile untergliedert. Sie alle können separat gelesen werden, falls Sie sich nur für bestimmte Themen interessieren. Umfangreiche Fußnoten und Literaturverweise werden es Ihnen ermöglichen, jene Aspekte zu vertiefen, die für Sie von besonderem Interesse sind. Es ist jedoch auch möglich, nur den Haupttext zu lesen und – so Sie dies wünschen – die teils umfangreichen und in den Fußnoten ausgeführten Gedankengänge anschließend zur Kenntnis zu nehmen.
Die zentralen Aussagen des Buches erschließen sich dann, wenn Sie dem impliziten roten Faden vom Anfang bis zum Ende folgen. Er führt Sie anhand grundlegender theoretischer Überlegungen auf einen spannenden Streifzug durch – nach wie vor unzureichend erschlossene – Gebiete in der Geschichte der Psychotherapie.
Teil I: Die fünf Grundmodelle psychotherapeutischer Welt- und Menschenbilder
Alle Verfahren im Bereich der (1)(1)Heilkunde beruhen auf Vorannahmen. Von jeher werden Störungs- und Behandlungsmodelle aus umfassenderen geistigen Bezugssystemen abgeleitet.
Daher werden zunächst die grundlegenden Welt- und Menschenbilder vorgestellt, die therapeutischen Systemen zugrundeliegen. Dabei wird den traditionellen Auffassungen des Schamanismus, der Medizin, der Psychodynamik und der Psychologie der Neuansatz einer kybernetisch orientierten(1) Kommunikationstheorie gegenübergestellt. Kernthese dieser Ausführungen ist, dass mit der 1951 von dem englischen Anthropologen (1)GREGORY BATESON und dem aus der Schweiz stammenden Psychiater (1)JÜRGEN RUESCH veröffentlichten kybernetisch konzipierten Kommunikationstheorie(1) ein grundlegend neues Paradigma geschaffen wurde, das radikal mit allen vorangegangenen Denkweisen im klinischen Bereich brach.
(2)BATESON und (2)RUESCH warfen auch erstmals zwei brisante Fragen auf: Wie können psychische Prozesse im Kontext kommunikativer Netzwerke(1) verstanden und angemessen theoretisch beschrieben werden? Und wie genau funktioniert veränderungswirksame therapeutische Kommunikation? Wie sich zeigen wird, konnten sie diese – für therapeutische Praktiker in hohem Maße relevanten – Fragen letztlich nicht zufriedenstellend beantworten.
Dies gelang erst einer Gruppe junger Forscher, die sich – ohne den programmatischen Entwurf (3)BATESONS und (3)RUESCHS zu kennen – Anfang der 1970er Jahre auf vollkommen unkonventionelle Weise aufmachte, das Geheimnis veränderungswirksamer therapeutischer Kommunikation(1) zu entschlüsseln. Auf konzeptioneller Ebene führten die Forschungen von (2)JOHN GRINDER,(1)RICHARD BANDLER und (1)FRANK PUCELIK zu neuartigen, nie zuvor gesehenen Rahmenmodellen, die eine Revolution im Bereich des therapeutisch Möglichen bewirkten. Diese Modelle ermöglichen nicht nur ein Verständnis therapeutisch wirksamer Veränderungsprozesse(1). Aus ihnen lassen sich – weit über die von (3)GRINDER und (2)BANDLER selbst entwickelten Veränderungsmethoden hinaus – ganz neue Klassen therapeutischer Vorgehensweisen ableiten. Sie alle können detailliert beschrieben und an therapeutische Praktiker weitervermittelt werden.
Um zu veranschaulichen, welch abenteuerliche Umstände zur Entwicklung dieser Modelle geführt hatten, wird zunächst ein Überblick über die Vorgänge und maßgeblichen Personen gegeben, die – direkt oder indirekt – an deren Entstehen beteiligt waren. Der Schwerpunkt liegt auf dem interessanten Geflecht persönlicher Beziehungen, das sich Anfang der 1970er Jahre zwischen der Gestalttherapie(1)(1)FRITZ PERLS’,(2) dem Verleger (1)ROBERT SPITZER, den Studenten (3)RICHARD BANDLER und (2)FRANK PUCELIK, dem Assistenzprofessor für Linguistik (4)(4)JOHN GRINDER,(5) der Familientherapeutin (1)VIRGINIA SATIR, dem Anthropologen (4)GREGORY BATESON und dem Nestor der modernen Hypnosetherapie(1), (1)MILTON H. ERICKSON ergeben hatte.
Damit ist zugleich der Rahmen für die weiteren Ausführungen des vorliegenden Werkes gesetzt. Die Grundprinzipien der Modelle (6)GRINDERS und (5)BANDLERS werden im vierten Teil dieses Buches beschrieben.
Teil II: Die Theorie der Kommunikation
Ziel des zweiten Teils ist es, grundlegende Gedanken der Kommunikationstheorie(2)(6)GREGORY BATESONS nachzuvollziehen. Die von ihm entwickelte Sichtweise auf Probleme der Psychopathologie wurde zur konzeptionellen Grundlage sowohl systemischer als auch weiterer kommunikationstheoretisch fundierter Therapieverfahren.
Im Anschluss an einen Werküberblick wird vertiefend auf die anthropologischen Forschungen eingegangen, die (7)BATESON in den 1930er Jahren in Neuguinea und mit der Anthropologin (1)MARGARET MEAD auf Bali durchgeführt hatte. Hier liegen die Wurzeln seines Werkes.
Anschließend wird die Auseinandersetzung (8)BATESONS mit behavioristischen Lerntheorien(1)(1) und deren konzeptionelle Erweiterung vorgestellt. Nach einem kurzen Resümee über die Bedeutung seiner Erkenntnisse für den Bereich der Verhaltenspsychologie(1) wird auf die Entstehung der Kybernetik und den von (9)BATESON und (4)RUESCH vorgelegten Entwurf einer umfassenden »Theorie der Kommunikation« eingegangen. Hier wurden Menschen erstmals als informationsverarbeitende und kybernetisch vernetzte Systeme(1) konzipiert.
Schließlich werden (10)BATESONS psychiatrische Forschungen und die Entstehung der sog. »Double Bind«-Hypothese zur Schizophrenie(1)(1) vorgestellt. Leitidee dieser Arbeiten war es, klinische Phänomene, die bis dahin durch rein intrapsychisch konzipierte Störungsmodelle(1) erklärt worden waren, aus dem Blickwinkel intrapersonaler, interpersonaler und kulturell vermittelter Kommunikationsvorgänge zu betrachten. Grundlegende Implikationen dieser neuartigen Sichtweise für die klinische Psychologie und Psychotherapie werden diskutiert.
Der zweite Teil endet mit einer Darstellung der weiteren Entwicklung dieser Forschungen am Mental Research Institute (MRI)(1) in Palo Alto. Ausgehend von den Ideen (11)BATESONS und der praktischen Arbeit (3)MILTON H. ERICKSONS entwickelte man dort erstmals kurzzeittherapeutische(1) Konzepte und Vorgehensweisen, die zum Ausgangspunkt systemisch orientierter Therapieverfahren(1) wurden.
Damit ist zugleich der theoretische Rahmen gespannt, vor dessen Hintergrund im folgenden Teil des Buches die Arbeit dreier innovativer Galionsfiguren interventionsorientierter Psychotherapie beleuchtet wird.
Teil III: Die Praxis veränderungswirksamer therapeutischer Kommunikation
Hier werden der Werdegang und die Arbeit dreier bedeutender Wegbereiter moderner Psychotherapie vorgestellt.
(3)FRITZ PERLS, der Begründer der Gestalttherapie(2), steht wie kein anderer für die allmähliche Ablösung von den theoretischen Konzeptionen und Behandlungstechniken der Psychoanalyse. In einem lebenslangen Ringen gelang es ihm gegen Ende seines Lebens, eine Arbeitsweise zu entwickeln, die auf die direkte Veränderung der Klienten ausgerichtet war.
Neben biographischen Angaben zur Person werden Grundpositionen der Gestalttherapie(3) in ihrer historischen Entwicklung herausgearbeitet. Dabei wird auf grundlegende Fragen psychoanalytischer Behandlungstechniken(1)(1) und deren zunehmende Ersetzung durch die experimentellen und erfahrungsorientierten Ansätze der Gestalttherapie eingegangen. Darüber hinaus werden grundlegende Überlegungen (4)PERLS’ zu Theorie und Praxis moderner Psychotherapie(1) diskutiert. Von besonderer Bedeutung war seine Entdeckung, dass sich veränderungswirksame(1) Psychotherapie weniger an dem orientieren sollte, was Klienten inhaltlich äußern, sondern daran, wie sie ihre Probleme kommunizieren. Auf dieser Grundlage entwickelte er – ohne hinreichend beschreiben zu können, warum er was tat – Therapietechniken, die darauf abzielten, diese Probleme in der direkten Begegnung mit dem Therapeuten aufzulösen.
(3)VIRGINIA SATIR war die erste Psychotherapeutin, die mit vollständigen Familien arbeitete. Wie niemand sonst verstand sie es in ihrer Arbeit, intrapsychische Vorgänge in Menschen mit Konzepten interpersonaler Kommunikation zu verbinden.
Im Anschluss an eine kurze Einführung zur Geschichte der Familientherapie(1) wird der persönliche Werdegang (4)VIRGINIA SATIRS geschildert. Dann werden zentrale Grundpositionen ihrer Auffassungen zur therapeutischen Arbeit dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf (6)SATIRS humanistischer Grundhaltung und ihren Vorstellungen von der fundamentalen Bedeutung der Kommunikation(1) in zwischenmenschlichen Beziehungssystemen(1). Das Kapitel endet mit einem kurzen Überblick über die Ziele und einige Grundprinzipien der therapeutischen Arbeit (7)SATIRS.
(4)MILTON H. ERICKSON gilt als der innovativste und kreativste Psychotherapeut des 20. Jahrhunderts. Seine spektakuläre – bislang unhinterfragte Grenzen überschreitende – therapeutische Arbeit übte enormen Einfluss auf die Entstehung moderner (2)kurzzeittherapeutischer Konzepte aus. Als erster Psychotherapeut von Rang vollzog er eine Kehrtwende von abstrakten theoretischen Spekulationen über das Wesen seelischer Störungen(1) hin zur Erforschung pragmatisch(1)(1)orientierter Strategien der Veränderung. Er entwickelte eine Vielzahl sprachlicher und (1)non-verbaler(1)(1) Kommunikationsformen, die therapeutische Veränderung direkt induzieren.
Im Anschluss an die Darstellung seines außergewöhnlichen Lebenswegs und seiner Persönlichkeit werden zentrale Überlegungen (6)ERICKSONS vorgestellt. Sein atheoretischer Pragmatismus(1) ermöglichte es ihm, die individuellen Voraussetzungen seiner Klienten zu nutzen. Er begegnete ihnen in ihrer Welt und führte sie – nicht selten ohne dass sie bemerkten wie – zu einer Lösung ihrer Probleme. Dafür nutzte er alle Möglichkeiten, die sich ihm boten. Seine Auffassung vom »Unbewussten(1)« stand in krassem Gegensatz zu der von (1)SIGMUND FREUD begründeten Tradition der Psychoanalyse. Bewusste Einsicht in die Ursachen seelischer Probleme(2) hielt er für unnötig und hinderlich. Bot es sich an, so arbeitete er mit indirekten(1) Kommunikationsformen. Sorgfältig gestaltete Geschichten ohne offensichtlichen Bezug zum Anliegen der Klienten führten auf fast magische Weise zur Veränderung. All dies war möglich, weil (7)ERICKSON ein überdurchschnittliches Engagement an den Tag legte. Er war sein Leben lang bereit, seine Methoden weiterzuentwickeln, zu verfeinern und Wirkungsloses über Bord zu werfen. Daher endet das Kapitel mit einer Reihe von Forderungen (8)ERICKSONS an praktizierende Psychotherapeuten.
Teil IV: Die Grundlegung kommunikationstheoretisch fundierter Psychotherapie
Im vierten und letzten Teil des Buches werden zunächst die(1)(1) Erträge der therapiehistorischen Rekonstruktionen zusammengefasst und verdichtet. Dabei werden die Konturen und Merkmale therapeutischer Ansätze sichtbar, die von sich behaupten können, auf der Höhe der Zeit und des Möglichen zu sein.
Nach einer Darstellung und Kritik akademischer Psychotherapieforschung wird das kommunikationstheoretische Rahmenmodell(1)(7)GRINDERS und (6)BANDLERS sowie dessen erkenntnistheoretische Begründung beschrieben. Anschließend werden die zentralen Erträge ihrer Forschungen vorgestellt. Sie umfassen zunächst zwei linguistisch fundierte Modelle(1) zum Gebrauch therapeutisch veränderungswirksamer Sprache(1). Im Anschluss wird ein Modell menschlicher Informationsverarbeitung(1) beschrieben. Es schließt Möglichkeiten ein, die Verlaufsstruktur imaginativer Prozesse am nonverbalen Ausdrucksverhalten(1)(1) von Menschen ablesen zu können. Danach werden grundlegende Entdeckungen im Bereich nonverbaler therapeutischer Kommunikation erläutert und veranschaulicht. Die von (8)GRINDER und (7)BANDLER zur Kunstform erhobene Nutzung allgemeiner Prinzipien der Klassischen Konditionierung(1)(1) eröffnete Zugang zu einer neuen Kategorie von Veränderungsmethoden. Diese sind für die Traumatherapie von hoher Relevanz.
Anschließend wird eine Möglichkeit vorgestellt, psychopathologische Phänomene(1)prozessorientiert zu beschreiben. Hieraus lässt sich – in vielen, wenn auch nicht allen – Fällen ableiten, wie und wo genau veränderungswirksame therapeutische Interventionen ansetzen sollten. Dies führt schließlich zu einer erstaunlichen Entdeckung (8)RICHARD BANDLERS. Mit seinem Konzept der »Submodalitäten(1)« beschrieb er als erster, dass die emotionale Wirkung von Vorstellungsbildern(1)(1)nicht von deren Inhalt, sondern ihren formalen Eigenschaften – also Größe, Abstand und Position im mentalen Raum, dem Tonfall des inneren Dialogs und vielem mehr – beruht. Diese Erkenntnis besitzt enorme Implikationen für die klinische Grundlagenforschung und moderne therapeutische Verfahren im Bereich der Kognitiven Therapie(1), die imaginationsbasierte Techniken(1) anwenden.
In einer abschließenden Betrachtung wird beispielhaft auf Therapiemodelle verwiesen, die – wie etwa die von (1)FRANCINE SHAPIRO, einer ehemaligen Mitarbeiterin (9)JOHN GRINDERS, entwickelte Methode des »Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)« – entweder(1)(1) direkt oder indirekt aus den im vorliegenden Buch dargestellten Geistesströmungen hervorgegangen sind oder deren Wirkprinzip sich zu weiten Teilen aus ihnen begründen lässt. Alle diese Methoden streben im Kern die Veränderung von Imaginationen an, die seelische Leiden erzeugen.
Die zentrale Rolle imaginativer Prozesse(1) für die Ätiologie und Aufrechterhaltung klinisch relevanter Phänomene ist empirisch gesichert. Seit Beginn der 2000er Jahre wurde eine Vielzahl grundlagenwissenschaftlicher Studien durchgeführt, die dies belegen.
Schon 1970 hatte (1)AARON T. BECK, der Begründer der Kognitiven Therapie(2), darauf hingewiesen, dass Phantasiebilder(1) eine wichtige Rolle bei klinischen Symptomatiken spielen.2 Der renommierte US-amerikanische Psychologe und Neurowissenschaftler (1)STEPHEN M. KOSSLYN regte Mitte der 1990er Jahre an, die Beziehung zwischen Imaginationen(1)(1) und Emotionen zu untersuchen, da mentale Bilder(1) aus neurowissenschaftlicher Perspektive eng mit emotional hoch aufgeladenen Prozessen verbunden zu sein scheinen.3 Die 2017 verstorbene klinische Psychologin (1)ANN HACKMANN fokussierte ihre Arbeit an der University of Oxford auf die Nutzung mentaler Bilder (mental imagery) in der Kognitiven Therapie(1)(1).4 Arbeitsgruppen um die – heute an der Universität von Uppsala in Schweden forschende – klinische Psychologin (2)EMILY A. HOLMES führten in Cambridge, Oxford und London grundlegende empirische Studien zur Rolle von Imaginationen(1) in der Psychopathologie durch.5(1)ANKE EHLERS, Klinische Psychologin und Professorin für Experimentelle Psychopathologie an der Oxford University, entwickelte imaginationsbasierte Methoden im Umgang mit Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)(1)(1).6
Weitere bedeutsame wissenschaftliche Beiträge zur Rolle imaginativer Prozesse bei Posttraumatischen Belastungsstörungen wurden von (1)CHRIS R. BREWIN, Klinischer Psychologe und emeritierter Professor für Psychologie am University College London, erarbeitet.7(1)LUSIA STOPA, Professorin für Klinische Psychologie an der University of Southampton, untersuchte die Rolle verzerrter Selbstbilder(1)(1)(1) bei sozialen Phobien(1) und PTBS.8(1)JACKIE ANDRADE, Professorin für Psychologie an der University of Plymouth, erforschte die Rolle mentaler Bilder bei Suchtverhalten(1)(1) und (1)(1)Essstörungen.9(1)DAVID M. CLARK, emeritierter Professor für Experimentalpsychologie an der University of Oxford, forschte u. a. zu Panikstörungen(1), sozialen Phobien und posttraumatischen Belastungsstörungen(1). (1)TIM DALGEISH, Klinischer Psychologe und Leiter der MRC Cognition and Brain Sciences Unit an der University of Cambridge, arbeitet auf dem Gebiet von Angststörungen(1) sowie an der Übersetzung von Erkenntnissen aus der verhaltens- und neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung in neuartige klinische Interventionen.
Auch Forscherinnen und Forscher wie (1)MEREL KINDT, Professorin für Experimentelle Klinische Psychologie an der Universität von Amsterdam, (1)BESSEL VAN DER KOLK, Professor für Psychiatrie an der Boston University School of Medicine, (1)ARNOUD ARNTZ, Professor für Klinische Psychologie an der Universität Amsterdam, (1)JULIE KRANS, Assistenzprofessorin am interdisziplinär arbeitenden Behavioural Science Institute an der niederländischen Radboud Universiteit in Nijmegen und viele weitere akademische Forscher haben seit der Jahrtausendwende die enorme Bedeutung imaginativer Prozesse für das Feld der Psychotherapie erkannt.
Faszinierenderweise entwickelte sich dieser relativ neue Trend in der klinisch orientierten Forschung vollkommen unabhängig von den – psychotherapiehistorisch betrachtet deutlich früheren – Entwicklungslinien, die Gegenstand des vorliegenden Werkes sind. Offenbar ohne diese zu kennen, kam man in der akademischen Welt – auf vollkommen anderen Wegen – zu ganz ähnlichen Erkenntnissen. Deren Umsetzung in wirksame Therapieverfahren verläuft bislang jedoch – mit wenigen Ausnahmen wie etwa der Arbeit (2)MEREL KINDTS – eher schleppend. Auch theoretische Begründungszusammenhänge für empirische Befunde bleiben zum Teil hypothetisch und vage.10
Die aktuelle Ausgangslage für weitere bahnbrechende Innovationen im Bereich der Psychotherapie ist dennoch so günstig wie nie. Es gibt heute eine Fülle wissenschaftlicher Literatur zur Bedeutung imaginativer Prozesse in der Psychopathologie und Psychotherapie. Auf der anderen Seite existiert ein reichhaltiger Schatz ausgefeilter – seit mehr als fünfzig Jahren in der Praxis erprobter und weiterentwickelter – imaginationsbasierter Veränderungsmethoden, die aus der Arbeit (5)PERLS’, (8)SATIRS und (9)ERICKSONS sowie den kommunikationstheoretisch fundierten Modellen (10)GRINDERS und (9)BANDLERS hervorgegangen sind.
Die akademische Seite besitzt ein grundlagenwissenschaftlich fundiertes Verständnis für die Rolle imaginativer Prozesse bei klinischen Symptomatiken. Die kommunikationstheoretische Entwicklungslinie verfügt über ein umfangreiches pragmatisches Wissen, wie genau veränderungswirksam interveniert werden kann und wie genau diese Interventionen kommuniziert werden sollten, um ihre maximale Wirksamkeit zu entfalten.
Ein Austausch zwischen diesen Bereichen würde es therapeutischen Praktikerinnen und Praktikern erlauben, die Erkenntnisse der Forschung deutlich leichter und eleganter in ihrer therapeutischen Arbeit umzusetzen. Umgekehrt könnten systematisch demonstrierbare Befunde aus der therapeutischen Praxis akademische Forscher dazu anregen, eigene erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische und methodologische Vorannahmen und Setzungen ergebnisoffen zu hinterfragen und den eigenen Forschungshorizont zu erweitern.
Die gezielte Zusammenarbeit relevanter Akteure beider Seiten würde – so meine feste Überzeugung – ganz im Sinne der »Marburger Deklaration«(1) von 2022 ein enormes Potential für weitere Fortschritte in der Psychotherapie erschließen.11
Teil I
Die fünf Grundmodelle psychotherapeutischer Welt- und Menschenbilder
Kapitel 1
Paradigmatische Voraussetzungen therapeutischer Systeme
Was bewegt den Menschen zum (1)Handeln? (1)Wie erklären sich die – oft gravierenden – Widersprüche in seinem Verhalten(1)? Und welche Ursachen haben die vielfältigen Formen des Erlebens und Verhaltens, die heute gemeinhin als »psychische Erkrankungen« bezeichnet werden?
Schon seit grauer Vorzeit ist der Umgang mit Krankheit ein zentrales Thema jeglicher menschlichen Kultur. Das Bemühen, Wege zur Heilung und Linderung von Leid zu finden, reicht bis in prähistorische Zeiten zurück.
Die Suche nach Antworten – so lehrt ein Blick in die Geschichte – ist stets von paradigmatischen Vorannahmen über die Grundstruktur der Wirklichkeit selbst geleitet. Diese – so der berühmte Wissenschaftshistoriker (1)THOMAS S. KUHN in seinem Klassiker »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« – sind grundlegende Prämissen, die selbst nicht zweifelsfrei beweisbar oder widerlegbar sind. Sie sind – bis zu einem gewissen Grad willkürliche – Setzungen, die sich auf folgende Fragen beziehen:
»Welches sind die Grundbausteine des Universums? Wie wirken sie aufeinander und auf die Sinne ein? Welche Fragen können sinnvoll über diese Bausteine gestellt und welche Methoden bei der Suche nach Lösungen angewandt werden?«12
Und weiter:
»Die [eingenommenen] Positionen … spezifizieren nicht nur, welche Entitäten das Universum bevölkern, sondern auch, welche es nicht enthält.«13
Die Antworten auf diese Fragen fallen – je nach Weltregion und Zeitepoche – verschieden aus. Jede menschliche Kultur besitzt sozial akzeptierte Formen der Wahrnehmung und des Erkenntnisgewinns. Aus ihnen resultieren Vorstellungen über den Aufbau der Welt und die grundlegende Natur des Menschen. Krankheitstheorien – und daraus abgeleitete Heilbehandlungen – sind unauflöslich mit diesen Glaubenssystemen verwoben.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts lassen sich auf die Frage nach der Natur »psychischer Störungen« – grob vereinfacht – vier ernst zu nehmende Antworten ausmachen: die schamanistische, die somatogenetische, die psychodynamische und die lerntheoretische Sichtweise. Sie alle leisten wertvolle Beiträge zur Linderung von Leid.14
Jede dieser Auffassungen beruht auf einer unterschiedlichen Art, die Welt zu erleben; und jede dieser Varianten des Erlebens führt zu anderen Annahmen über die Beschaffenheit der Wirklichkeit und des Menschen. Es überrascht daher kaum, dass auch die daraus abgeleiteten Folgerungen für die praktische Heilkunst höchst verschieden sind.
Der britische Psychiater und Neurowissenschaftler (1)IAIN MCGILCHRIST, einer der Universalgelehrten unserer Zeit, formulierte in diesem Zusammenhang eine faszinierende These, die international großes Aufsehen erregte: Demnach nutzen die linke und die rechte Gehirnhälfte grundlegend verschiedene Arten der Informationsverarbeitung und Aufmerksamkeitssteuerung. Weltbilder und Kulturepochen – so (2)MCGILCHRIST – lassen sich danach unterscheiden, ob die Hemisphären ausbalanciert zusammenwirken oder eine Seite funktional dominiert. Dementsprechend verändere sich das subjektive Erleben(1) der Wirklichkeit(1).15
Die rechte Hemisphäre des Gehirns nimmt die Welt auf ganzheitliche und intuitive Weise wahr. Sie verarbeitet Informationen gleichzeitig und ordnet diese in deren Kontext ein. Anstatt sich auf Details zu konzentrieren, erfasst sie Muster und Zusammenhänge. Daher ist sie in der Lage, »Synchronizitäten(1)« zu erkennen.16 Die rechte Hirnhälfte(1) verarbeitet und differenziert emotionale Zustände und nonverbale soziale Signale wie Gestik, Mimik und Tonfall. Durch ihre Fähigkeit, die Welt mit emotionaler Tönung zu erleben, erlaubt sie ein ganzheitliches Verständnis der Umgebung. Sie ermöglicht Kreativität, Inspiration und überraschende intuitive Einsichten.
Die linke Hemisphäre(1) – auch Sitz des Sprachzentrums(1) – befähigt zu logisch-rationalem Denken. Sie begegnet der Welt analytisch. Im Unterschied zur rechten Hemisphäre zerlegt sie komplexe Aufgaben in einzelne Schritte. Sie isoliert Details und verarbeitet Informationen nacheinander. Darüber hinaus dient sie der Verarbeitung und Manipulation von symbolischen Repräsentationen und Zahlen.
Die rechte Hemisphäre erlebt die Welt direkt, während die linke Gehirnhälfte deren Erleben abstrahiert und lediglich »re-präsentiert«. (4)MCGILCHRIST schreibt:
»Die Welt der linken Hemisphäre, abhängig von begrifflicher Sprache und Abstraktion(1), erzeugt Klarheit und die Fähigkeit, Dinge zu manipulieren, die bekannt, unveränderlich, feststehend, isoliert, dekontextualisiert, eindeutig, entkörperlicht, ihrer Natur nach allgemein, jedoch letztlich entseelt und leblos sind.
Im Unterschied hierzu bringt die rechte Hemisphäre eine Welt individueller, sich verändernder, sich entwickelnder, miteinander verbundener, implizit personifizierter lebender Wesen innerhalb des Kontextes einer real gelebten Lebenswelt hervor, die ihrer Natur nach niemals vollständig erfassbar, stets nur unvollständig bekannt ist – und zu der sie in einer Beziehung der Fürsorge steht.
Das Wissen, das durch die linke Hemisphäre vermittelt wird, … hat den Vorteil der Perfektion, aber eine derartige Perfektion(1) wird letztlich um den Preis einer Leere, einer Selbstbezüglichkeit(1) erkauft. Sie kann Erkenntnisse nur in Form einer mechanischen Reorganisation anderer bereits bekannter Dinge hervorbringen. Sie kann niemals wirklich ›ausbrechen‹, um etwas Neues zu erkennen, da ihr Wissen lediglich aus ihren eigenen Re-Präsentationen(1) besteht. Während der Gegenstand selbst nur für die rechte Hemisphäre ›präsent‹ ist, wird er von der linken Hemisphäre lediglich ›re-präsentiert‹, indem er nun zur Idee eines Gegenstands geworden ist.«17
Je nachdem, ob ein Weltentwurf aus der ausgewogenen Zusammenarbeit beider Hirnhälften oder der Dominanz einer Hemisphäre hervorgeht, unterscheidet sich die Beschreibung der Wirklichkeit.18
Die schamanistische Sichtweise
Animistisch geprägte Kulturen erleben die Welt als von beseelten Kräften durchzogen. Diese Vorstellung ist so alt wie die Menschheit selbst. Sie findet sich zu allen Zeiten und in allen Regionen der Erde. Noch im 21. Jahrhundert beeinflusst sie – unbeeindruckt von den erstaunlichen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften der Moderne – das Leben und den Alltag weiter Teile der Weltbevölkerung. Schon von alters her begründete sie die Praxis der Magie(1) und des schamanistischen Heilens(1).19
Animistisch geprägte Zivilisationen betrachten die Welt als ein lebendes, bewusstes und multidimensionales Wesen. Unzugänglich für die Sinnesorgane des Körpers wirkt in dessen materieller Ausdrucksform eine Vielzahl immaterieller Kräfte. Alles, was existiert, ist ein individuierter Teil dieses Wesens und von einer lebensspendenden Essenz beseelt. Menschen, Tiere und Pflanzen – aber auch scheinbar unbelebte Gegenstände sowie Orte, Berge, Flüsse und Winde – besitzen immaterielle »Seelen«(1). Diese weisen eine energetische Signatur auf, die als »Ausstrahlung« oder »Atmosphäre« erspürt werden kann.20
Mitglieder solcher Kulturen sind von einem Leben nach dem Tod überzeugt. Viele vertreten das Konzept der Reinkarnation(1). Demnach verleihen sich »Seelen« (2)von Zeit zu Zeit Ausdruck in der materiellen Dimension. Doch ihre Inkarnationen(1) sind zeitlich begrenzt. Ziehen sie sich aus der Materie zurück, so existieren und wirken sie in nicht-physischen Wirklichkeiten weiter. Diese wiederum – so die animistische Überzeugung – sind von Myriaden weiterer, niemals inkarnierender Wesen bevölkert. Deren Bildnisse zieren – mit Ausnahme muslimischer Kultstätten – die Fassaden von Kirchen und Tempeln in aller Welt.
»Götter«, »Dämonen«, »Geister« und die »Seelen«(3) Verstorbener – sie alle besitzen ein gewisses Maß an »Macht«, mit der sie das Handeln und Erleben des Menschen beeinflussen können. Sie sind immaterielle Wirkkräfte, die je nachdem »gut«, »böse«, »hilfreich«, »boshaft« usw. sind. Der Mensch ist ihrer Willkür bis zu einem gewissen Grad ausgeliefert. Daher ist es unumgänglich, ein wohlwollendes Verhältnis zu ihnen zu pflegen.
Mit diesem Weltbild geht ein tiefer Respekt vor anderen Lebewesen, der Natur und nicht-physischen Dimensionen der Wirklichkeit einher. Was auf materieller Ebene getrennt erscheint, ist für animistisch geprägte Kulturen aufs Engste in einem dynamischen Netzwerk von Beziehungen und Wechselwirkungen miteinander verwoben. Folglich muss alles mit Rücksicht behandelt werden. Lebenspraktiken und Rituale animistischer Kulturen zielen darauf ab, das Gleichgewicht der Wirkmächte in der Welt zu bewahren. Dies sichert das harmonische Gleichgewicht der Kräfte – und damit das eigene Wohlergehen.
Die maßlose Ausbeutung von – als tote Materie verstandenen – natürlichen Ressourcen(1) ist seit der abendländischen Antike ein Alleinstellungsmerkmal technisierter, dominant linkshemisphärisch geprägter Zivilisationen. Aus animistischer Sicht ist ein solch rücksichtsloses Vorgehen unvernünftig, destruktiv und letztlich selbstzerstörerisch.
Animistische Vorstellungen und schamanistische Praktiken(1) beruhen auf Erfahrungen(1) in nicht-alltäglichen Bewusstseinszuständen, die aufgeklärten, modernen Kulturen eher fremd sind: Seelenreisen(1)21, Nahtoderlebnisse22, Erfahrungen unter dem Einfluss psychoaktiver Pilze und Pflanzen sowie ekstatischer Praktiken(1)23, introspektive Trancezustände(1), besondere Arten von Träumen(1) und Visionen(1) sowie das »Channeln(1)« geistiger Wesen(1)(2)24 gelten als legitime Werkzeuge der Informationsgewinnung.
Imaginative Wahrnehmungen(1) werden – anders als in wissenschaftlich-technisch geprägten Gesellschaften – nicht ausschließlich als selbst erzeugte »Einbildungen(1)« verstanden. Vielmehr gilt die menschliche Imagination(3) als Wahrnehmungsorgan für nicht-physische Wirklichkeiten(3), denen eine unabhängige Existenz jenseits der materiellen Ebene zugesprochen wird. Werden die Ursachen seelischer oder körperlicher Probleme dort vermutet, finden therapeutische Interventionen auch in imaginativ erlebten Wirklichkeiten statt. In verblüffender Übereinstimmung entwickelten sich auf dieser Grundlage weltumspannend strukturell ähnliche Krankheitstheorien und therapeutische Praktiken, die heute gemeinhin als »Schamanismus« bezeichnet werden. Diese Vorstellungen fanden auch Eingang in einige moderne, interventionsorientierte Therapieverfahren.25
Psychische Störungen sind aus schamanistischer Sicht eine Auswirkung von »Besessenheit«(1), die Folge des Verlusts eigener »Seelenanteile(1)«, ein Resultat der Beeinflussung durch »schwarze Magie«(1) oder »karmisch bedingt«(1).26
So können seelische und körperliche Erkrankungen(1)(1) die Folge eines Anhaftens nicht-physischer Wesen sein. Auf Abwege geratene Verstorbene, boshafte Geister und dämonische Kräfte besitzen demnach die Möglichkeit, sich mit den immateriellen, seelischen Anteilen des Menschen zu verbinden. Unter ihrem Einfluss kommt es zu Unstimmigkeiten und Störungen im Denken, der Vorstellungswelt, dem emotionalen Erleben, dem Verhalten und körperlichen Regulationsprozessen. Die Entfernung derartiger Fremdeinwirkungen gilt folglich als vorrangiges therapeutisches Ziel.27
In anders gelagerten Fällen werden Erkrankungen auf den traumatisch bedingten Verlust eigener Seelenanteile(2) zurückgeführt. Der therapeutische Leitgedanke ist hier, diese wiederzufinden, zu heilen, zu den Leidenden zurückzubringen und erneut mit diesen zu verschmelzen. Auf diese Weise wird die seelische Ganzheit und Lebensenergie der Person wiederhergestellt. Dieser Vorgang erfolgt – in der Regel unter Mitwirkung helfender nicht-physischer Wesen – im Rahmen von Seelenreisen(3) des Schamanen oder einer therapeutischen Trance.28
Schädliche Fernwirkungen durch schwarze Magie(2) und Zauberei sind ein weiteres Motiv schamanistischer Krankheitsätiologie(1)(1). Diese werden durch einen Gegenzauber neutralisiert. Auch krankheitserzeugende – den normalen Sinnen entzogene – immaterielle Objekte können in die Person eingedrungen sein. Diese werden von nicht-physischen Helfern oder vom Heiler selbst extrahiert.29
Seelische oder körperliche Leiden können dieser Sichtweise zufolge auch auf extrem traumatisierende Erfahrungen(2) in »früheren Leben« zurückzuführen sein. Auch besteht die Möglichkeit, dass sie ein – sich von der Seele(4) selbst auferlegter – Ausgleich für Verfehlungen in vorangegangenen Inkarnationen oder schlicht der eigenen Entwicklung dienende Erfahrungen sind.30
Die Klärung der Ursache des Leidens(1) und die daraus abgeleitete Behandlung obliegen in animistisch geprägten Kulturen zu weiten Teilen dem Schamanen. In modernen, schamanismusverwandten Psychotherapieverfahren wirken Therapeuten und Klienten arbeitsteilig zusammen.
Die somatogenetische Sichtweise
Einen vollkommen anderen(1) Standpunkt nahm der griechische Arzt (1)HIPPOKRATES (ca. 460–370 v. Chr.) ein. Er begründete eine Ärzteschule, deren grundlegender Ansatz die abendländische Medizin bis heute dominiert.31
(3)HIPPOKRATES stand im Austausch mit antiken Sophisten und dem fast gleichaltrigen griechischen Philosophen (1)DEMOKRIT. Dieser hatte mit seinem Lehrer (1)LEUKIPP das erste materialistische Weltbild des Abendlands entworfen und mehrere medizinische Bücher verfasst.
(2)LEUKIPP und (2)DEMOKRIT betrachteten das All als unentstandenen, grenzenlosen, unveränderlichen, unbewegten und absolut leeren Raum. In diesem befänden sich unendlich viele, aus sich selbst heraus bewegte und mit hoher Geschwindigkeit wahllos umherschwirrende materielle Teilchen. Diese seien extrem klein und könnten daher nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden. Da diese Teilchen selbst keinen leeren Raum enthielten, seien sie notwendigerweise massiv. Folglich seien sie auch nicht weiter teilbar. Daher bezeichneten (3)LEUKIPP und (3)DEMOKRIT sie als »Atome« (von altgr. atomos, nicht zu zerschneiden). Ihr Weltentwurf wurde unter der Bezeichnung »Atomismus(1)« bekannt.
Doch wie erklärte das atomistische Weltbild die Belebtheit und Eigenbewegung von Pflanzen, Tieren und Menschen? Diese hatten die Griechen bislang auf das Wirken eines belebenden Prinzips – der Seele(5) (altgr. psyche) – zurückgeführt. Wenn diese den Körper verlässt, kommt jede Bewegung im Organismus zum Stillstand. Der Tod tritt ein.
(4)DEMOKRIT behielt dieses Konzept bei. Anders als seine Vorgänger interpretierte er es jedoch rein stofflich. Die Seele(6) bestand für ihn aus den allerkleinsten, kugelförmigen Atomen. Diese befänden sich in großer Zahl in der Luft. Aufgrund ihrer Feinheit und Form vermochten die Seelenatome(1) die aus – zufällig ineinander verhakten – gröberen Teilchen gebildeten Organismen zu durchdringen. Die Eigenbewegungen der Seelenatome versetzten die Körper von Lebewesen dann mechanisch in Bewegung. Der Druck der Umgebung neige dazu, sie wieder aus dem Körper zu pressen. Beim Einatmen drängen mit der Luft jedoch weitere Seelenatome in den Körper ein. Diese verhinderten das Entweichen der vorhandenen.
Irgendwann werde die Atmung jedoch unmöglich. Dann presse der Umgebungsdruck die Seelenatome(2) aus dem Körper heraus. Diese zerstreuten sich in alle Richtungen. Der Organismus erstarre zu einem leblosen Ding. Denn in Wirklichkeit – so (5)DEMOKRITS Credo – existierten nur die Atome und das Nichts.32 Ein Fortbestehen der Seele(7) nach dem Tod schloss er kategorisch aus. Er schrieb:
»Manche Menschen, die nicht wissen, dass die menschliche Natur der Auflösung ausgeliefert ist, und die sich der schlechten Handlungen in ihrem Leben sehr bewusst sind, quälen sich zeitlebens in Unruhe und Ängsten, indem sie sich Lügengeschichten über die Zeit nach dem Tod ausdenken.«33
Vor dem Hintergrund dieser Weltanschauung revolutionierte (4)HIPPOKRATES die Heilkunst. Als unerlässliche Voraussetzungen ärztlicher Kompetenz(1) betrachtete er eine genaue Beobachtungsgabe und einen analytischen Verstand(1). Er vertrat die Auffassung, dass die ärztliche Tätigkeit einer exakten – auf sinnlicher Anschauung beruhenden – Informationssammlung bedarf. Nur so könnten beweisbare Schlussfolgerungen gezogen werden. Und in der Tat – nie zuvor waren Symptome und Krankheitsverläufe derart feingliedrig beobachtet und nüchtern beschrieben worden.34
(5)HIPPOKRATES erhob zunächst einen gründlichen körperlichen Befund(1). Aktuelle Klima- und Umweltbedingungen(1) bezog er in seine Analyse mit ein. Auch kollektive und individuelle Gewohnheiten waren für ihn bedeutsam. Diese außerordentlich differenzierte Untersuchung des Kranken und seiner Umwelt diente ihm dazu, die Aussicht des Leidenden auf Heilung prognostisch abzuschätzen.
Aus den über viele Patienten hinweg gewonnenen Informationen leitete (6)HIPPOKRATES allgemeine Verlaufsmuster von Symptomatiken(1) ab. Diese waren – anders als die imaginative Schau schamanistischer Heiler – an sinnlich wahrnehmbare Kriterien gekoppelt und durch andere überprüfbar. Die spezifische Situation eines Patienten konnte objektiv beurteilt werden.
Mit diesem methodischen Zugang setzte (7)HIPPOKRATES einen epochemachenden Kontrapunkt zur animistischen Sichtweise seiner Zeit. In einer atemberaubenden Zusammenschau seiner Erfahrungen schuf er die älteste überlieferte Differentialdiagnostik des Abendlandes.
In der Schrift über die »Epidemien(1)« wies (8)HIPPOKRATES auch darauf hin, wie wichtig die sorgfältige Dokumentation aller Beobachtungen ist. Er schrieb:
»Ich meine, dass ein wichtiger Bestandteil der ärztlichen Kunst auch die Fähigkeit ist, über die schriftlichen Aufzeichnungen richtig urteilen zu können. Denn wer sie richtig beurteilt und anwendet, kann, so scheint mir, keine großen Fehler in der Kunst begehen. Man muss jede einzelne Wetterlage und dazu die Krankheit genau studieren und erkennen, was in der Wetterlage und in der Krankheit zum Guten und was in ihnen zum Schlechten zusammenwirkt, welche Krankheit langwierig und tödlich, welche langwierig und heilbar, welche akut und tödlich, welche akut und heilbar ist. Man hat die Möglichkeit, mit Hilfe dieser Erwägungen die Ordnung der Krisentage zu erkennen und danach Voraussagen zu machen. Wer hierin Einsicht hat, kann wissen, welche Kranken er wann und wie behandeln muss.«35
Das Wissen um allgemeine Verlaufsmuster bildete den Entscheidungshorizont, vor dessen Hintergrund kalkulierbar wurde, ob und wann der Arzt welche Maßnahmen ergreifen sollte. Mit seiner bahnbrechenden Vorgehensweise erhob (9)HIPPOKRATES die heilerische Tätigkeit erstmals in den Stand eines empirisch begründeten Handwerks. Seinem Vorbild folgend dokumentierten nun auch andere Ärzte ihre Befunde. Beobachtete Symptome, Krankheitsverläufe und die Wirkung von Heilbehandlungen wurden aufgezeichnet, das akkumulierte Wissen miteinander geteilt.
(1)POLYBOS – der Schwiegersohn des (10)HIPPOKRATES – versuchte, die Vielgestaltigkeit der Phänomene auf ein vereinheitlichendes Prinzip zu reduzieren. In seinem Manuskript »Über die Natur des Menschen« begründete er die antike Säftelehre. (2)POLYBOS ging von den Körpersäften aus. Blutungen, gelbe und schwarze Galle sowie Schleim schienen bei vielen Erkrankungen eine wichtige Rolle zu spielen. Oft waren sie den normalen Ausscheidungen(1) beigemengt. Möglicherweise – so seine Vermutung – versuchte der kranke Körper also, ein Übermaß dieser Substanzen auszuscheiden. Es war daher keinesfalls abwegig, ungünstige Mischungsverhältnisse der Körpersäfte als Ursache – auch seelischer – Krankheiten zu betrachten. Als Therapie(1) für körperliche und seelische Leiden empfahlen hippokratisch geschulte Ärzte daher Kräuter, Erbrechen, Einläufe, Diäten, Fasten, Bäder, frische Luft, Massagen, Ruhephasen und Bewegung.
Die auf(3) POLYBOS zurückgehende Humoralpathologie(1) dominierte die abendländische Medizin bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann wurde sie durch das Aufkommen der Zellularpathologie(1) des deutschen Mediziners (1)RUDOLF VIRCHOW (1821–1902) und der Bakteriologie abgelöst.
Die grundsätzliche Überzeugung hippokratischer Medizin(2)(1), dass alle Leiden ihren Ursprung auf körperlicher Ebene haben, ist jedoch – sieht man von psychodynamisch und komplementärmedizinisch orientierten Strömungen ab – bis heute unumstritten. In unserer Zeit behandeln Ärzte seelische Leiden daher mit Psychopharmaka – der gezielten Beeinflussung von Stoffwechselvorgängen im Gehirn.
Die psychodynamische Sichtweise
Die Ursprünge psychodynamischer Erklärungsmodelle(1) reichen bis in die griechische Antike zurück.
(1)PLATON (424–347 v. Chr.) betrachtete die Fähigkeit zu Selbstreflexion(1) und rationaler Einsicht als konstituierendes – ihn von der Tierwelt unterscheidendes – Merkmal des Menschen. Doch er erkannte auch, dass dieser oft impulsiv und irrational handelt, innere Konflikte erlebt und unterschiedlich akzentuiert sein kann.
So sei ein Mensch etwa in der Lage, sich über eigene Zwänge zu ärgern. Auch könne er Lüste in sich verspüren, ihnen jedoch widerstehen, wenn ihn die Einsicht in unerwünschte Folgen zurückhalte. Habe er das Gefühl, Unrecht getan zu haben, so sei er bereit, seine Strafe geduldig zu erleiden. Fühle er sich ungerecht behandelt, könne er jedoch rasend werden. Dann sei er in der Lage, andere Bedürfnisse aufzuschieben. Hunger, Durst, Kälte und anderen Widrigkeiten zum Trotz würde er alles tun, um so rasch wie möglich wieder Gerechtigkeit herzustellen. Da ein und dasselbe nicht gleichzeitig entgegengesetzte Strebungen in sich tragen könne, müsse demnach von unterschiedlichen Seelenteilen(1) ausgegangen werden.36
Daher beschrieb (3)PLATON die – als unsterblich und sich reinkarnierend verstandene – menschliche Psyche(1) als dreigliedriges Aggregat. Dessen Teile erfüllen unterschiedliche Funktionen und können in Konflikt miteinander geraten. Der Vernunftteil(1) (altgr. to logistikón) habe seinen Sitz im Kopf. Er ermögliche rationales Denken(1), stelle moralische Überlegungen an und strebe nach Wahrheit und Erkenntnis. Der Selbstbehauptungswille(1) (altgr. to thymoeidés) habe seinen Sitz in der Brust und sei für emotionale Reaktionen(1) verantwortlich. Er treibe den Menschen an, Ziele zu verfolgen und Herausforderungen zu bewältigen. Die Begierde(1) (altgr. to epithymêtikon) habe ihren Sitz im Unterleib und sei die Basis der Fortpflanzung und Nahrungsaufnahme. Sie strebe nach Lust und unmittelbarer Befriedigung ihres unersättlichen Verlangens.37
Je nachdem, welchem Aspekt der Einzelne die Führung überlasse, gingen unterschiedliche Menschentypen hervor: Werde ein Mensch vom niedrigsten Seelenteil(1) beherrscht, so fröne er vor allem den Lüsten. Sein Leben drehe sich um gutes Essen, Trinken und Sex. Voraussetzung hierfür seien materielle Mittel. Daher strebe er nach Geld, Gewinn und der Anhäufung von Dingen. Überwiege der mittlere Seelenteil(1), so suche der Mensch nach Herausforderungen im Wettstreit und Kampf. Er sei weniger an sinnlichen Genüssen interessiert. Ihn motiviere der Vergleich mit anderen, denn aus dem Siegen ergäben sich Ehre und Ruhm. Dominiere der vernünftige Seelenteil(1), so bestimme die Lust am Lernen und den Wissenschaften das Leben. Das höchste Ziel sei das (1)Erlangen von Weisheit.38
Eine ausgeglichene Seele(9) stehe unter Führung der Vernunft. Nur sie sei in der Lage, auch das Wohl der anderen Seelenteile(2) zu berücksichtigen. Der mittlere Seelenteil müsse mit ihr verbündet sein. Dann bleibe er standhaft dem für richtig Erkannten treu. Im Rahmen vernünftiger Grenzen könne der begehrende Seelenteil sein Verlangen dann schadlos befriedigen. Nur eine solche Ordnung gewährleiste seelische Harmonie und Wohlbefinden. In ihr trügen alle Seelenteile(1) zum Wohl des Ganzen bei. (4)PLATONS – die Vernunft zum Leitstern erhebendes – Grundmodell wurde richtungsweisend für das abendländische Selbstverständnis und Menschenbild.
In modifizierter Form griff der Wiener Arzt (2)SIGMUND(3)FREUD (1856–1939) – der wirkmächtigste Vertreter des psychodynamischen Paradigmas – diese Vorstellungen im 20. Jahrhundert erneut auf.39
Seine – die Psychoanalyse(1) begründende – Theoriebildung durchlief eine Reihe von Phasen.40 Mitte der 1890er Jahre vertrat (5)FREUD zunächst eine Traumatheorie(1). Er war überzeugt, dass die rätselhaften Symptome der Hysterie auf die Verdrängung von Erfahrungen(2) sexuellen Missbrauchs im Kindesalter zurückzuführen seien. Doch nur wenig später verwarf er diese These. Entsprechende Schilderungen weiblicher wie männlicher Patienten deutete er fortan als inzestuöse Wunschphantasien kindlicher Sexualität. (1)JEFFREY M. MASSON, der diese Kehrtwende (6)FREUDS in einer aufsehenerregenden Studie zu rekonstruieren suchte, schrieb:
»Ich bin … der Überzeugung, dass Freud seine eigene Entdeckung aus dem Jahre 1896 – dass Kinder in vielen Fällen in ihren eigenen Familien sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind – als so belastend empfand, dass er sie buchstäblich aus seinem Bewusstsein tilgen musste. Die psychoanalytische Bewegung … besteht dagegen auch heute noch darauf, dass Freuds frühere Position bloß ein Irrweg war. Freud musste, so lautet die anerkannte Lehrmeinung, seinen Irrglauben an die Verführung aufgeben, um die Wahrheit von der Macht der inneren Phantasie(1)(1) und der spontanen kindlichen Sexualität entdecken zu können. … Die vorherrschende Meinung der Psychotherapeuten lautete, das Opfer habe sich seine Qualen ausgedacht. Damit ließen sich insbesondere Sexualverbrechen der Vorstellungskraft des Opfers anlasten … Für die Gesellschaft war dies eine tröstliche Ansicht, denn Freuds Interpretation – der zufolge die sexuelle Gewalt, die sich so schwerwiegend auf das Leben seiner Patientinnen ausgewirkt hatte, ein reines Phantasieprodukt ist – war keine Bedrohung für die bestehende Gesellschaftsordnung. Die Therapeuten konnten dadurch auf der Seite der Erfolgreichen und Mächtigen bleiben, statt sich auf die Seite der Opfer familiärer Gewalt zu stellen.«41
Im Jahr 1923 veröffentlichte (7)FREUD ein »Strukturmodell der Psyche(1)(1)«. Er unterschied drei »Instanzen«: Das »Es(1)« – die primäre Triebkraft der Persönlichkeit – bestehe aus angeborenen, instinktiven Trieben und Wünschen. Es wirke auf unbewusster Ebene, operiere auf der Grundlage des Lustprinzips und strebe – ohne Rücksicht auf die Konsequenzen – nach unmittelbarer Befriedigung seiner Bedürfnisse. Das »Über-Ich(1)« repräsentiere die verinnerlichten Normen und Werte der Gesellschaft. Es entwickle sich im Laufe der Kindheit durch die Internalisierung der elterlichen Autorität und kultureller Einflüsse. Das »Ich(1)« wiederum sei die bewusste und rational handelnde Instanz der Persönlichkeit. Es fungiere als Vermittler zwischen den impulsiven Bedürfnissen des »Es«, den Anforderungen der Realität und den strengen moralischen Normen des »Über-Ichs«.42
Psychische Störungen(3) – so die grundlegende Idee des späten (9)FREUD – seien eine Folge missglückter Versuche, gegensätzliche Strebungen dieser Instanzen angemessen zu integrieren. Im Kern führte er sie auf das Spannungsverhältnis zwischen der Befriedigung(1) instinkthafter Triebe(1) und deren sozial notwendiger Begrenzung zurück.
Es ist verblüffend, wie sehr (10)FREUDS späte Theoriebildung einer Variation des platonischen Grundthemas gleicht. (11)FREUD war ein Hippokratiker im platonischen Gewand. Seelisches Leiden(1) betrachtete er als im Grunde unvermeidliche Folge der grundlegenden Verfasstheit des Menschen selbst.
Im Zuge seiner Arbeit entwickelte er eine Reihe von Behandlungstechniken, die den Patienten helfen sollten, unbewusste Konflikte(1) aufzudecken, emotionale Blockaden zu lösen und Einsichten in die tiefere Natur der eigenen Psyche zu gewinnen.
Bei der Methode der »freien Assoziation(1)(1)« wurden Patienten ermutigt, frei über ihre Gedanken, Gefühle und Erinnerungen(1) zu sprechen. Dabei sollten sie alle Versuche unterlassen, bewusst Ordnung oder Sinn in ihre Äußerungen zu bringen. Aus den auftretenden Assoziationsketten destillierte (13)FREUD Hinweise auf unbewusste Konflikte heraus. Im Rahmen der »Traumdeutung(1)« forderte er sie auf, ihre Träume zu erzählen. Deren Deutung sollte geheime Wünsche aufdecken und der bewussten Verarbeitung zugänglich machen. Er entdeckte auch, dass Patienten dazu neigten, alte Gefühle und Beziehungsmuster aus der Vergangenheit auf ihn zu übertragen. Deutungen im Rahmen der »Übertragungsanalyse(1)« sollten sie dabei unterstützen, dysfunktionale Projektionen zu erkennen und zu verändern. Auch erkannte er die Tendenz der Analysanden, unangenehme oder bedrohliche Gedanken und Gefühle zu vermeiden. Aufgabe des Psychoanalytikers war es daher, dies im Rahmen einer »Widerstandsanalyse« zu erkennen und den Patienten dabei zu helfen, sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Heilung – so die zentrale therapeutische Idee – erfolge durch bewusste Einsicht und Verstehen.
Im Hinblick auf das zugrundeliegende Menschenbild nahm (14)FREUD eine eigentümliche Mittelstellung zwischen somatogenetischen Erklärungsansätzen(1) und psychogenetischen Vorstellungen(1) ein. (1)JÜRGEN(2)KRIZ schreibt dazu:
»Abgesehen von Einsichten im Bereich der Philosophie und Dichtung stand der Mediziner Freud(15) … ganz im Paradigma mechanistischer/somatischer Medizin und Naturwissenschaft. … So machte seine Theorie, die Psychoanalyse(2), zunächst deutliche Anleihen bei den wissenschaftlichen Modellen der Mechanik, Hydrodynamik und Neurophysiologie. … bis zu seinem Tode hoffte er, seine Theorie könnte letztlich auf physiologische und biochemische Erkenntnisse zurückgeführt werden. … Freud(16)s außerordentlich große Bedeutung besteht darin, dass er sich trotz (oder vielleicht: gerade wegen) der Hoffnung auf eine somatisch/physiologische Reduktion intensiv psychischen Prozessen und Korrelaten klinischer Phänomene zuwandte …«43
Sein Grundansatz war von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Psychotherapie(2) im 20. Jahrhundert. Zentrale Denkfiguren seiner psychodynamischen Erklärungsmuster sind in vielen späteren Therapiemodellen dialektisch aufgehoben.
Die lerntheoretische Sichtweise
Schon der legendäre(1) sizilianische Heiler, Seher und Philosoph (1)EMPEDOKLES (um 495–435 v. Chr.) – Begründer der wirkmächtigen Lehre von den vier Elementen(1) (Luft, Erde, Feuer, Wasser) – hatte sich zu Fragen der Wahrnehmung und der Physiologie der Sinne geäußert. Daher waren psychologische Fragestellungen bis weit in das 19. Jahrhundert hinein eine Domäne der Philosophie.
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Deutschland erste Versuche, diese Themen empirisch zu erforschen. Der Arzt, Physiologe und Physiker (1)HERMANN VON HELMHOLTZ (1821–1894) befasste sich experimentell mit Fragen der visuellen und auditiven Wahrnehmung(1)(1). Er maß erstmals die Geschwindigkeit der Erregungsleitung in Nerven. Auf Vorarbeiten des Anatomen und Physiologen (1)ERNST HEINRICH WEBER (1795–1878) aufbauend, schuf der Physiker und Naturphilosoph (1)GUSTAV THEODOR FECHNER (1801–1887) das Gebiet der Psychophysik(1). Er erforschte die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen quantitativ messbaren physikalischen Reizen und deren subjektiver Wahrnehmung.
Der Mediziner, Physiologe und Philosoph (1)WILHELM WUNDT (1832–1920) institutionalisierte die Psychologie erstmals als selbständige experimentelle Wissenschaft. 1879 gründete er an der Universität Leipzig das weltweit erste psychologische Laboratorium. Dort führte er Experimente zur Untersuchung von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Willen, Vorstellungen und Emotionen durch. Darüber hinaus publizierte er über Träume(2), Hypnotismus(1) und Suggestion(1). Seine Forschungsstätte zog Studenten aus aller Welt an. Viele von ihnen wurden selbst zu Pionieren neuer Forschungsfelder innerhalb des Fachs.
(2)WUNDT betrachtete es als Aufgabe der Psychologie, die nicht weiter reduzierbaren Grundelemente des »Bewusstseins(1)« und deren Beziehungen untereinander zu erfassen. Klinische Fragestellungen und unbewusste Vorgänge waren für ihn ausdrücklich kein Gegenstand des Fachs.
Die Forschungsmethoden (3)WUNDTS umfassten objektive Messungen, aber auch die bewusste Beobachtung psychischer Vorgänge durch – zuvor sorgfältig geschulte – Versuchspersonen: Die Probanden wurden unter streng kontrollierten, experimentellen Bedingungen aufgefordert, subjektiv erlebte Gedanken, Vorstellungsbilder und Empfindungen zu berichten. (4)WUNDT betrachtete die Selbstauskünfte ausgebildeter Testpersonen als wissenschaftliche Daten, aus denen allgemeine Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. (1)HOWARD GARDNER, Professor für Psychologie und Pädagogik an der Harvard University, beschrieb (5)WUNDTS Grundposition wie folgt:
»Nach Wundts Ansicht erforscht die Physik die Objekte der Außenwelt: diese Untersuchung ist zwar notgedrungen durch die Erfahrung vermittelt, dennoch ist die Physik nicht das Studium der Erfahrung. Die Psychologie hingegen ist das Studium bewusster Erfahrung als Erfahrung. Ihr muss man sich durch Selbstbeobachtung, durch Introspektion nähern. Selbst wenn alle Menschen solche Erfahrungen machen, sind nicht alle zwingend gleich qualifiziert, geübte Beobachter ihres Erlebens zu sein. Wundt befürwortete also die Methode der (1)Introspektion – einer Methode, bei der man die eigenen Empfindungen sorgfältig beobachtet und so objektiv wie möglich beschreibt Eine derartige Objektivität bedeutet hier, die Empfindungen, die man fühlt, zu beschreiben und nicht den Reiz, der sie hervorruft; und Gedanken (oder Bilder) ohne Verweis auf ihre Bedeutung oder ihren Kontext zu berichten. Wundts Lehre steht und fällt mit der Möglichkeit derartiger Introspektion.«44
Anfang des 20. Jahrhunderts erschütterten hitzige methodologische Debatten das noch junge Fachgebiet. Diese drehten sich um die Frage, welche Bewusstseinsphänomene(1) introspektiv erforscht werden konnten und unter welchen Voraussetzungen solche Daten wissenschaftliche Gültigkeit beanspruchen können. Zunehmend unversöhnliche Auffassungen führten schließlich zur Diskreditierung der Forschungsmethodik selbst.45
Als vehementester Kritiker introspektiver Forschung profilierte sich der amerikanische Psychologe (1)JOHN BROADUS WATSON (1878–1958). In einem – als »Behavioristisches Manifest(1)« berühmt gewordenen – Aufsatz unterzog (2)WATSON die psychologische Forschung einer vernichtenden Kritik. Er kritisierte, dass objektive Verhaltensdaten und Tierexperimente als wertlos erachtet würden. Stattdessen befasse man sich – auf einer höchst fragwürdigen Datenbasis – mit vermeintlichen psychischen »Tatsachen«. Dadurch verhindere man, die Psychologie in den Stand einer echten Naturwissenschaft zu erheben. Er schrieb:
»Die Psychologie(1), so wie sie allgemein verstanden wird, hat etwas Esoterisches in ihren Methoden. Wenn Sie meine Ergebnisse nicht reproduzieren können, liegt das nicht an einem Fehler in Ihrem Apparat oder in der Kontrolle Ihrer Reize, sondern daran, dass Ihre Introspektion nicht geschult ist. … Der Angriff richtet sich gegen den Beobachter und nicht gegen die Versuchsanordnung. In der Physik und in der Chemie wird der Angriff auf die Versuchsbedingungen gemacht. … In diesen Wissenschaften wird eine bessere Technik zu reproduzierbaren Ergebnissen führen. In der Psychologie ist das anders. Wenn Sie nicht 3–9 Zustände von Klarheit in der Aufmerksamkeit beobachten können, ist Ihre Introspektion schlecht. Wenn Ihnen andererseits ein Gefühl einigermaßen klar erscheint, ist Ihre Introspektion wiederum mangelhaft. Sie sehen zu viel. Gefühle sind nie klar.«46
Und weiter:
»Die Psychologie, die ich aufzubauen versuchen würde, würde erstens von der beobachtbaren Tatsache ausgehen, dass sich Organismen, Menschen und Tiere gleichermaßen, mit Hilfe von Erbanlagen und Gewohnheiten an ihre Umwelt anpassen. Diese Anpassungen können sehr adäquat oder so unzureichend sein, dass der Organismus seine Existenz kaum aufrechterhalten kann; zweitens, dass bestimmte Reize die Organismen dazu bringen, diese Reaktionen zu zeigen. In einem vollständig ausgearbeiteten System der Psychologie können bei gegebener Reaktion die Reize(1) vorhergesagt werden; bei gegebenen Reizen kann die Reaktion vorhergesagt werden.«47
In seinem als Vorlesungsreihe konzipierten Buch »Behaviorism(1)« führte (4)WATSON das – dezidiert materialistische – Welt- und Menschenbild seiner neuen Psychologie wie folgt ein: Die bisherige Psychologie und die Psychoanalyse fußten im Grunde auf dem religiösen Aberglauben an die Existenz einer »Seele(1)





























