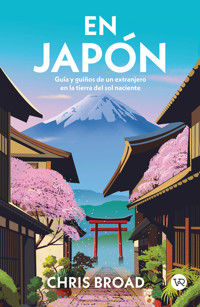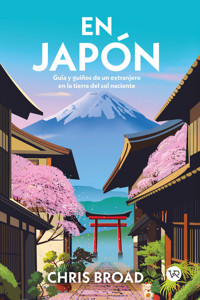9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Chris Broad völlig blauäugig einen Job als Hilfslehrer in der nordjapanischen Provinz annahm, fragte er sich, ob er nicht einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Weder sprach er ein Wort Japanisch, noch hatte er irgendwelche Erfahrungen im Unterrichten. Würde er als der am schnellsten gefeuerte Englischlehrer in die Geschichte Japans eingehen? In seinem Buch erzählt Chris Broad mit viel Witz darüber, wie er vor mehr als zehn Jahren direkt nach der Uni von Großbritannien nach Japan ausgewandert ist und was er seither im Alltag dort alles so erlebt hat – Culture Clash und viele skurrile Begebenheiten inklusive. Bald schon begann er Videos über sein Leben im Land der aufgehenden Sonne zu drehen und bereiste Japans 47 Präfekturen, von den üppigen Reisfeldern auf dem Land bis zu den neonbeleuchteten Straßen Tokios. Er erlebte einen erschreckenden nordkoreanischen Raketenzwischenfall, machte eine kränkende Erfahrung in einem Liebeshotel und verbrachte eine Woche mit Japans größtem Filmstar. Von all seinen großen und kleinen Erfahrungen in Japan berichtet er in seinem Buch, das in England sogleich auf den ersten Platz der Sunday-Times-Bestsellerliste stürmte. »Ein witziger Blick auf das Land des Karaoke, der Katzenfanatiker und der schokoladenüberzogenen Pommes.« The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Chris Broad
Abroad in Japan
Meine Abenteuer im Land der aufgehenden Sonne
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Chris Broad
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Chris Broad
Chris Broad ist ein britischer Filmemacher und Gründer des Youtube-Kanals »Abroad in Japan«, der mit über 3 Millionen Abonnenten und 500 Millionen Aufrufen einer der größten ausländischen Youtube-Kanäle in Japan ist. Im Laufe von zehn Jahren und verarbeitet in rund 300 Videos hat Chris alle 47 Präfekturen Japans besucht und über die japanische Alltagskultur und aktuelle Themen berichtet. Sein Buch stand in England auf Platz 1 der Sunday-Times-Bestsellerliste. Chris Broad lebt in Tokio.
Jörn Pinnow, geboren 1974, studierte Geschichte und Literaturwissenschaften in Tübingen, Brüssel und Berlin. Er übersetzt Sachbücher und Belletristik aus dem Englischen, Französischen und Niederländischen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Chris Broad völlig blauäugig einen Job als Hilfslehrer in der nordjapanischen Provinz annahm, fragte er sich, ob er nicht einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Weder sprach er ein Wort Japanisch, noch hatte er irgendwelche Erfahrungen im Unterrichten. Würde er als der am schnellsten gefeuerte Englischlehrer in die Geschichte Japans eingehen?
In seinem Buch erzählt Chris Broad mit viel Witz darüber, wie er vor mehr als zehn Jahren direkt nach der Uni von Großbritannien nach Japan ausgewandert ist und was er seither im Alltag dort alles so erlebt hat – Culture Clash und viele skurrile Begebenheiten inklusive.
Bald schon begann er Videos über sein Leben im Land der aufgehenden Sonne zu drehen und bereiste Japans 47 Präfekturen, von den üppigen Reisfeldern auf dem Land bis zu den neonbeleuchteten Straßen Tokios. Er erlebte einen erschreckenden nordkoreanischen Raketenzwischenfall, machte eine kränkende Erfahrung in einem Liebeshotel und verbrachte eine Woche mit Japans größtem Filmstar.
Von all seinen großen und kleinen Erfahrungen in Japan berichtet er in seinem Buch, das in England sogleich auf den ersten Platz der Sunday-Times-Bestsellerliste stürmte.
»Ein witziger Blick auf das Land des Karaoke, der Katzenfanatiker und der schokoladenüberzogenen Pommes.« The Times
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Abroad in Japan
Copyright © Chris Broad, 2023
First published as Abroad in Japan in 2023 by Bantam, an imprint of Transworld. Transworld is part of the Penguin Random House group of companies.
Aus dem Englischen von Jörn Pinnow
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach dem Originalumschlag von Penguin Random House
Covermotiv: © Matt Saunders
ISBN978-3-462-31315-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Prolog: Das Interview
1. Die Sushi-Offenbarung
2. Die Japan-Lotterie
3. Schweiß und Sand
4. Heiße Quellen und winzige Autos
5. Mr. Dick
6. Sake, onegaishimasu!
7. Wenn der Unterricht schiefgeht
8. Verdammt viel Schnee
9. Die unmögliche Sprache
10. Party Time
11. Land der anschwellenden Gürtellinie
12. Hostess-Clubs und die Kunst der teuren Begleitung
13. Raus hier. Sofort
14. Japans exzentrischster Mann
15. Die weisen Männer vom Fuji
16. Doctor Who
17. Der brathühnchenabhängige Bär
18. Der schlimmstmögliche Anfang
19. Ein Brief vom Colonel
20. Auf Wiedersehen
21. Neuanfang
22. Katzennation
23. Endlich zu Hause
24. In Deckung!
25. Ground Zero
26. Erlösung nach einem verlorenen Jahr
27. Verschwindendes Kyōto
28. »Das ist mein Traum«
29. Angst und Erdbeben
Nachwort
Danksagung
Ich widme dieses Buch der unglaublichen Abroad-in-Japan-Community, die mich in den letzten zehn Jahren auf diesem wilden Ritt begleitet hat.
Prolog: Das Interview
Januar 2012
Ich saß in der Ecke in einem der höhlenartigen Säle der japanischen Botschaft in Mayfair, London. Der Raum mit dem goldenen Kronleuchter an der Decke und dem üppigen roten Teppich war beeindruckend, aber bis auf diese beiden Dinge praktisch leer und bot somit nichts, womit ich mich hätte ablenken können, um mein angespanntes Nervenkostüm zu beruhigen. Das einzige Möbelstück war ein Tisch, auf dem ein Klemmbrett mit dem Ergebnis des Englisch-Grammatiktests lag, den ich eben geschrieben hatte. Ich musste all meine Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht aufzustehen und einen Blick darauf zu werfen.
Es gibt wenige Dinge im Leben, die ähnlich nervenaufreibend sind wie ein Bewerbungsgespräch für einen Job, den man unbedingt haben will. Nach einer fünfminütigen Ewigkeit öffnete sich die gewaltige Eichentür mir gegenüber, und ein Botschaftsmitarbeiter bat mich in einen weiteren, ebenfalls imposanten Raum und führte mich zu einem einzelnen Stuhl an einem langen Tisch mit zwei unbeeindruckt dreinblickenden Interviewern.
Drei Jahre hatte ich auf diesen Moment gewartet, und in den nächsten Minuten würden der höfliche, aber scheinbar emotionslose mittelalte Japaner und ein etwas strenger dreinblickender Brite – ein Alumnus des Programms, an dem ich teilnehmen wollte – über mein weiteres Schicksal entscheiden. Es hatte etwas von einem »Good cop, bad cop«-Szenario, was nichts dazu beitrug, meine Nervosität zu drosseln.
Im Jahr 1987 hatte die japanische Regierung ein Programm ins Leben gerufen, über das englische Muttersprachler an Schulen in ganz Japan gelockt werden sollten, um dort die Englisch-Sprachfähigkeiten zu verbessern und eine Basisinternationalisierung anzustoßen. In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten war das Japan Exchange and Teaching Programme mit seinen mehr als fünftausend Teilnehmern und Teilnehmerinnen pro Jahr aus 57 Ländern zum weltweit größten Austauschprogramm für Lehrer geworden.
Mir bot es eine bequeme Möglichkeit für ein spektakuläres Abenteuer auf der anderen Seite der Welt. Nachdem ich den eher langwierigen schriftlichen Teil der Bewerbung hinter mir hatte, musste ich nun nur noch diese letzte Hürde überwinden.
Ich hatte im Vorfeld obsessiv im Internet recherchiert und von anderen Bewerberinnen und Bewerbern erfahren, dass der Erfolg vor allem davon abhing, übertrieben freundlich zu sein. Der perfekte ausländische Lehrer sollte immer als genki (元気) erscheinen. Dieses häufig verwendete japanische Wort bedeutet so viel wie »munter« oder »lebhaft«, zwei Worte, mit denen mich niemand beschreiben würde, weshalb ich alle Energie aufbringen musste, um während des dreißigminütigen Interviews ein bemühtes Lächeln präsentieren zu können.
»Wie gut ist Ihr Japanisch?«, wollte der britische Alumnus wissen und flog mit dem Stift über mein Bewerbungsformular.
»Nein«, erwiderte ich und zuckte augenblicklich über meine seltsame Antwort zusammen. »Äh, Entschuldigung … ich meinte nicht Nein. Aber nicht gut. Ich bin fest entschlossen, es zu lernen, sollte ich das Glück haben, die Stelle zu bekommen.«
Der japanische Interviewer, der gerade seine Kopie meines Bewerbungsbogens durchsah, kicherte, als er an die Stelle kam, an der ich meinen bevorzugten Einsatzort genannt hatte.
»Also, in Ihrer Bewerbung geben Sie an, dass Sie am liebsten entweder auf dem Land oder in Kōbe eingesetzt werden würden. Können Sie uns erklären, warum?«
Es war allgemein bekannt, dass die sicherste Art, das JET-Interview nicht zu bestehen, darin bestand, um den Einsatz in Tokio zu bitten. Das Programm sah nur sehr wenige Stellen in der dicht besiedelten Hauptstadt vor, und sofern man keinen ausgezeichneten Grund hatte, dorthin gehen zu müssen, galt man mit dieser Bitte entweder als faul oder schlecht vorbereitet.
»Ich würde wirklich sehr gern auf dem Land leben, ganz egal, wo. Mir gefällt die Vorstellung, in einer kleineren Gemeinde eine größere Rolle zu spielen. Sie könnten mich auf Hokkaido in eine Höhle stecken und ich wäre glücklich.«
Schweigen breitete sich im Raum aus, und mir wurde klar, dass meine Bemerkung wortwörtlich verstanden worden war. Die Interviewer tauschten einen irritierten Blick aus, bevor sie fortfuhren.
»Und warum Kōbe?«
Insgeheim hatte ich mich vor dieser Frage gefürchtet. Die Entscheidung für Kōbe war nicht sonderlich gut begründet: Ich hatte mir ein paar Tage lang Japan auf Google Maps angeschaut und erkannt, dass Kōbe genau zwischen Kyōto und Ōsaka liegt, den beiden für mich faszinierendsten Städten, die zwar nah beieinanderliegen, zugleich aber den Kontrast zwischen Tradition und Moderne verkörpern. Außerdem war die Stadt weltberühmt für das Kōbe-Rind. Leichtsinnigerweise hatte ich angenommen, dieses legendäre Fleisch müsse für die Bewohner Kōbes billig und leicht verfügbar sein, weshalb es mir eine gute Idee erschien, dort leben zu wollen.
»Nun, ehrlich gesagt erscheint mir das Rindfleisch dort verdammt gut zu sein.«
Ich erwartete eine weitere Welle des Schweigens, wurde aber von einem Ausbruch der Heiterkeit überrascht.
»Eine gute Überlegung«, bestätigte der Japaner. »Das Kōbe-Rind ist wirklich ausgezeichnet.«
Ich hatte noch mal Glück gehabt, aber mir war klar, dass es noch nicht überstanden war. Es gab eine weitere Sache, vor der ich mich fürchtete, sollte sie auf den Tisch kommen. In meiner Bewerbung hatte ich erklärt, zahlreiche Bücher über Japan gelesen zu haben und betonte vor allem eines über wabi-sabi, eine buddhistische Philosophie und Ästhetik, die berühmt dafür ist, undefinierbar zu sein.
»Chris-san, Sie schreiben, Sie hätten sich mit wabi-sabi beschäftigt. Könnten Sie uns wohl erklären, was es damit auf sich hat?«
Am besten lässt sich das Konzept des wabi-sabi (侘び寂び) damit erklären, dass es das Unvollkommene mit offenen Armen begrüßt und die Schönheit im Unvollständigen oder Nichtperfekten erkennt. So sind die gefragtesten handgefertigten Keramiken in Japan häufig die, die asymmetrisch, einfach oder bescheiden aussehen. Diese Ideologie ist für das Leben vieler Japaner und Japanerinnen ganz grundlegend.
Das wäre eine fantastische Antwort gewesen.
Ich aber schaute zu Boden und nuschelte etwas wie »Äh … äh … das ist also wie … ich meine …«.
Der Japaner sah mich über den Rand seiner Brille intensiv an, und ich erkannte, dass dies die alles entscheidende Frage war. Das war meine Chance zu beweisen, dass ich über die kommunikativen Fähigkeiten verfügte, die man von einem Lehrer erwartet.
»Nun, also, die Sache mit wabi-sabi ist etwas, das sich nicht so leicht definieren lässt. Es ähnelt eher einem Gefühl oder einer Emotion als einem klaren, definierbaren Konzept.«
Was für ein Mist.
Mein Glück war, dass sich der Prüfer seinen Sinn für Humor bewahrt hatte.
»Haha, ja. Es ist wirklich schwer zu erklären – ich weiß, was Sie meinen!« Er gluckste kurz. »Gut, das wäre es dann für den Moment. Vielen Dank.«
Es war vorbei.
Ich taumelte aus dem beeindruckenden Gebäude und über die Straße zur U-Bahn-Station Green Park und wusste insgeheim, dass nichts und niemand auf dieser Welt mir nun noch diese Stelle verschaffen konnte.
Aber zwischen all meinen katastrophalen Antworten musste doch irgendetwas Brauchbares dabei gewesen sein. Vielleicht lag es an meiner anrührenden Beschreibung des wabi-sabi oder der schieren Verzweiflung meines Angebots, sogar in einer Höhle auf Hokkaido unterrichten zu wollen, jedenfalls erhielt ich zwölf Wochen später einen Brief mit der Nachricht, dass ich angenommen worden war. Mein Leben würde sich rund 10.000 Kilometer nach Osten verlagern, in ein Land, über das ich kaum etwas wusste, mit einem Job, für den ich mich beklagenswert unvorbereitet fühlte.
1. Die Sushi-Offenbarung
Juli 2012
Von London nach Tokio zu reisen ist ein unfassbar ungeschmeidiger Übergang, bei dem nicht weniger als acht Zeitzonen überquert werden und sich eine kulturelle Kluft auftut, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war.
Als ich mich von meinen Eltern verabschiedete und meinen mit Koffern beladenen Gepäckwagen in die Abflughalle von London Heathrow schob, hatte ich keine Vorstellung davon, wann ich meine Familie wiedersehen oder wie viele Jahre ich unterwegs sein würde. Jeder potenziell traurige Gedanke wurde von Adrenalin und einer Unruhe angesichts der Reise verdrängt, die mir nun bevorstand. Der Flug von Heathrow nach Tokio Narita dauert rund zwölf Stunden, was bei der Ankunft für den schlimmstmöglichen Jetlag sorgen sollte.
Ich blickte aus dem Kabinenfenster und sah zu, wie die Dächer Londons der Nordsee Platz machten und dann skandinavische Wälder auftauchten, bis alle Anzeichen von Zivilisation nach und nach verschwanden, da wir fast die gesamte Flugzeit in 11.500 Metern Höhe über der sibirischen Tundra verbrachten.
Ich wollte schlafen, doch die junge Frau neben mir – ebenfalls eine JET-Teilnehmerin – schnarchte derart laut, dass sie selbst die Motoren des Düsenjets übertönte. Und da somit auch keine Aussicht auf angeregten Small Talk während des Flugs bestand, blätterte ich durch ein billiges Japanisch-Wörterbuch. Beim Versuch, mir die passenden Worte für meine einleitenden Vorstellungsworte in der Schule einzuprägen, schlummerte ich ein.
Als Zweiundzwanzigjähriger und frisch von der Universität konnte ich es immer noch kaum glauben, dass ich meinen ersten festen Job auf der anderen Seite der Welt ergattert hatte, in einem Land, in dem ich niemanden kannte, und in dem eine Sprache gesprochen wurde, die ich nicht wirklich verstand.
Zwar hatte ich schon immer gehofft, eines Tages Japan besuchen zu können, doch die Vorstellung, dort tatsächlich zu leben, hatte sich erst mit achtzehn entwickelt, als ich auf einem Flug nach Frankreich zum ersten Mal vom JET-Programm hörte. Ich saß damals im Flugzeug neben einem Ehepaar, dessen Tochter zu diesem Zeitpunkt in Japan unterrichtete, und die beiden waren begeistert von meiner Aussage, nach der Uni durch die Welt reisen und Englisch unterrichten zu wollen. Am Ende des Flugs hatten die beiden mich überzeugt, eine Bewerbung für das JET-Programm einzureichen und in mir eine neue Leidenschaft entfacht.
Angesichts der Tatsache, dass diese Unternehmung bei einem Gespräch mit Fremden in einem Flugzeug begonnen hatte, war es traurig, dass der heutige, viel längere Flug keine derartig schicksalsträchtige Begegnung für mich bereithielt. Nur sägendes Schnarchen und Frustration.
Zwölf Stunden später weckte mich das Rumpeln, mit dem das Flugzeug auf der Landebahn des Flughafens Narita aufsetzte. Der Anblick des düsteren Terminal-Gebäudes war enttäuschend. Keine kawara-Dachziegeln oder Pagoden weit und breit. Ich sah mich rasch um, konnte aber auch nirgends die schneebedeckte Spitze des Bergs Fuji in der Ferne erkennen. Fast nichts wies darauf hin, dass wir in Tokio gelandet waren. In gewisser Weise waren wir das ja auch nicht.
Schnell stellte sich heraus, dass der Flughafen Narita nicht in Tokio, sondern inmitten einiger Reisfelder rund siebzig Kilometer östlich der Stadt liegt.
Ich verließ das Terminal-Gebäude und trat in den backofenheißen Nachmittag hinaus, um entsetzt festzustellen, wie furchtbar feucht Luft sein konnte; jeder Atemzug war wie das Inhalieren von heißem Wasserdampf. Glücklicherweise wurde ich, noch bevor mein Blut verdampfen konnte, zusammen mit anderen JETs in einen bereitstehenden Bus geschoben, wo ich ein Stoßgebet für das Wunder der Klimaanlage gen Himmel schickte, während wir uns über die Autobahn in Richtung Tokio aufmachten.
Wenn etwas für Narita spricht, dann die Tatsache, dass man bei der Weiterfahrt das gewaltige, atemberaubende Ausmaß der weltweit größten Metropole hautnah erfährt. Die Anreise nach Tokio beginnt in den endlosen Ebenen der Präfektur Chiba und ihrer Ansammlung traditioneller japanischer Häuser inmitten von kilometerlangen Reisfeldern. Nach und nach tauchen am Rand der Straßen dann Städte auf, und die Reisfelder machen zweckmäßigen Wohnblöcken und Werbetafeln Platz, auf denen lachende Männer und Frauen die neuesten Schönheitsprodukte anpreisen. Mir fiel ein schäbiges Love Hotel auf, das einer mittelalterlichen Burg nachempfunden war und auf dem Dach mit dem seltsamen Namen Hotel Smile Love Time warb.
Rund 37 Millionen Menschen leben im Großraum Tokio. Diese Zahl scheint fast unbegreiflich – mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung versammelt in nur einer Stadt –, doch wenn zum ersten Mal die Skyline sichtbar wird, erscheint dies plötzlich durchaus möglich.
Innerhalb nur einer Stunde Fahrzeit war alles Grün verschwunden. Als unser Bus die Rainbow Bridge in der Tokyo Bay überquert hatte, waren wir ringsum nur noch von Hochhäusern umgeben, und der kultige Tokyo Tower – Japans Antwort auf den Eiffelturm – ragte über die Skyline hinaus. Ich presste mein Gesicht an die Fensterscheibe und erstarrte vor Ehrfurcht, waren doch, egal wohin ich blickte, überall noch mehr Hochhäuser, noch mehr Betonblöcke, noch mehr Chaos und Wirrwarr zu sehen. Reden wir nur von der schieren Größe, wirkt London dagegen wie ein Witz.
Der Bus suchte sich seinen Weg entlang komplizierter Autobahnen und zwischen Häuserreihen gequetschter Hochstraßen und führte uns dabei an unendlich vielen Plakaten mit Prominenten vorbei, die für Asahi Bier oder Suntory Whisky warben; dann waren wir mitten im Zentrum Tokios angekommen. Die zweistündige Fahrt fühlte sich wie ein Ritt durch einen Freizeitpark an, war mein Magen von dem unablässigen Auf und Ab der Autobahnrampen doch gewaltig durchgeschüttelt worden. Endlich erreichten wir das renommierte Keio Plaza Hotel im Hochhausviertel Shinjuku. Mit seinen beiden Türmen und 1400 Zimmern war dies einer der wenigen Orte, der den jährlichen Ansturm von JETs beherbergen konnte.
Nachdem man uns aus dem Bus gescheucht hatte, atmete ich zum ersten Mal die Sommerluft Tokios ein: heiß, feucht und durchsetzt vom stechenden Geruch der Kanalisation. Die Abwasserrohre der Stadt zerbröselten unter den ansonsten makellosen Straßen.
Bis zu diesem Augenblick hatte mich mein Stolz darauf, für das JET-Programm ausgewählt worden zu sein, zu der Vorstellung verführt, ich wäre etwas Besonderes. Doch als ich nun in der Lobby des Keio Plaza Hotels stand als eines von tausend fremden Gesichtern, dämmerte mir, dass ich nur ein winziges Rädchen in einer wohlgeölten Maschinerie war.
An der Spitze der Warteschlange angekommen, ließ ich mir von einem Japaner die Schlüsselkarte zu einem Hotelzimmer im 25. Stock überreichen. Ich teilte mir ein Dreibettzimmer mit zwei sportbegeisterten Briten namens Colin und Michael. Als ich die Zimmertür aufstieß, diskutierten die beiden gerade lachend über Rugby. Meine Ankunft schien sie ein wenig davon abzulenken.
»Wohin hat es euch denn verschlagen?«, erkundigte ich mich und warf meinen Rucksack auf das verbliebene leere Bett, das am Fenster.
»Ich gehe nach Himeji, direkt neben Japans berühmtester Festung«, erklärte Michael mit einer Selbstgefälligkeit, die andeutete, ihm gehöre die Burg.
»Und ich gehe nach Nagasaki«, strahlte Colin.
Verdammt. Warum habe ich nicht Nagasaki oder Himeji bekommen?
»Und wohin zieht es dich?«, erkundigte sich Michael gespannt, ob ich seine Burg noch übertrumpfen konnte.
»Ich bin in Yamagata. Das liegt im Norden.«
»Ach so? Noch nie davon gehört.« Michael schenkte mir ein siegesgewisses Lächeln, im vollen Bewusstsein, den Hauptgewinn gezogen zu haben.
Die endlose Anreise hatte mich ausgelaugt, aber noch stärker als die Erschöpfung wirkte meine Rastlosigkeit. Ich überließ Colin und Michael den Gesprächen über Rugby und ihre Männlichkeit, verließ das Zimmer und trat in das letzte Tageslicht Tokios hinaus. Die goldene Stunde ließ die obersten Stockwerke der Hochhäuser aufleuchten, die den Stadtteil prägten. Die zwei Türme des Tokyo Metropolitan Government Building lockten mich, gab es laut meines Japan-Reiseführers dort doch »die beste Aussicht über Tokio – umsonst«.
Als ein von Aussichtsplattformen besessener Nerd hatte ich schon viele Hochhäuser erklommen, um den Anblick von oben zu genießen, angefangen bei Shanghai über Seattle und Barcelona bis Berlin. Doch als ich aus dem Lift des Tokyo Metropolitan Government Building stieg und die Stirn an die Glasscheibe legte, sah ich verwundert auf eine Stadt hinunter, die offenbar keine Grenzen kannte. Von meinem Standpunkt aus, im Zentrum der Metropole, konnte ich bis zum diesigen Umriss der Bergkette um die Stadt nur Beton erkennen. Die Aussicht war sowohl ebenso berauschend wie auch erschreckend.
Ich sah zu, wie es innerhalb von zwanzig Minuten dunkel wurde und überall in der Skyline Millionen winziger Lichter in den Fenstern angeschaltet wurden. Das Funkeln erleuchtete die riesige Fläche, was mindestens ebenso faszinierend war wie ein Feuerwerk. Zum ersten Mal Tokio in der Dämmerung zu erleben fühlte sich wie etwas ganz Besonderes an, und ich entschloss, dies müsse gefeiert werden.
Ich ließ mich auf einem Stuhl am Fenster des überteuerten Cafés der Aussichtsplattform nieder und versenkte mich in ein aberwitzig teures Stück Schokoladenkuchen, während ich den Sonnenuntergang über 37 Millionen Menschen beobachtete. Nach dem letzten Happen war ich derart erschöpft, dass ich über dem Tisch zusammensackte und einschlummerte. Ich muss wohl eine halbe Stunde geschlafen haben, als eine Kellnerin mir sanft auf die Schulter tippte, um mich zu wecken und aufzuscheuchen.
Es folgten zwei Tage intensiver Kurse und Orientierungsveranstaltungen, durchsetzt mit verzweifelten Versuchen, mich mit meinen beiden neuen Begleitern anzufreunden. Die JET-Seminare waren eine schwammige Mischung aus Jetlag und Informationsüberfluss. Anstatt am zweiten Tag eine wichtige Veranstaltung zu besuchen über all das, was man in Japan tunlichst vermeiden sollte, verbrachte ich den Morgen im Bett, zusammen mit einer Packung nicht sonderlich überzeugender Chips mit Sojasaucengeschmack aus dem 7-Eleven. Am Nachmittag schlich ich dann in einen Workshop zu den »Dos« und »Don’ts« der Zusammenarbeit mit japanischen Lehrern und Lehrerinnen, in der Hoffnung, niemand habe mein chipsbedingtes Fehlen am Morgen bemerkt. Eine begeisterte junge Frau namens Amy, eine Britin im zweiten JET-Jahr, leitete den Kurs und stellte dem bangen Publikum eine Reihe von Multiple-Choice-Fragen.
»Wenn eine japanische Englischlehrerin vor der Klasse einen Englisch-Fehler macht, wie solltet ihr euch dann verhalten? A: Unterbrecht den Unterricht und weist auf den Fehler hin. B: Lasst den Unterricht laufen und weist die Lehrerin so darauf hin, dass kein Schüler etwas davon mitbekommt. Oder C: Ignoriert den Fehler und lasst den Unterricht laufen.«
Kurz war es still, dann rief ein Typ mit starkem US-Südstaaten-Akzent: »B!«
»Genau, ihr solltet die Lehrerin nicht vor der Klasse bloßstellen und keine Konflikte mit eurer Kollegin provozieren. Wenn so etwas passiert, ist es immer besser, die Situation von Fall zu Fall zu entscheiden, je nach Lehrer oder Lehrerin.«
Wenn so etwas passiert. Mit einem Mal wurde mir klar, dass die japanischen Englischlehrer womöglich gar nicht so gut Englisch konnten. Bis hierher hatte ich mir die Sache in etwa so vorgestellt, dass ich hinten in der Klasse sitzen würde und einen kompetenten Vorgesetzten hatte. Mir war gar nicht in den Sinn gekommen, dass von allen Anwesenden eventuell ausgerechnet ich am besten Bescheid wissen könnte. Auf einmal trug ich deutlich schwerer an der Verantwortung dieser Aufgabe.
Angesichts unserer divergierenden Interessen hatte ich meine Zimmergenossen Colin und Michael so gut es ging auf Abstand gehalten. Jeder Small-Talk- und Annäherungsversuch war bislang kläglich gescheitert. Und dennoch entschieden wir uns am dritten und letzten Abend in Tokio, uns in Shinjukus raues Rotlichtviertel zu stürzen – wir kannten ja ohnehin niemand anderen in der Stadt. Die Organisatoren des JET-Programms hatten alle eindrücklich aufgefordert, Kabukichō fernzubleiben, vor allem wegen der Gefahren durch Schlepper auf den Straßen, die unerfahrene Touristen in schäbige Bars lockten, die von den örtlichen Verbrechersyndikaten betrieben wurden. Dass diese Warnungen genau den gegenteiligen Effekt auf uns hatten, dürfte nicht überraschen. Jetzt mussten wir dahin.
Der Eingang ins Rotlichtviertel Kabukichō wird von einem großen, rot beleuchteten Tor markiert, die Straße dahinter führt durch eine blendende Ansammlung von Leuchtreklamen und Neonlichtern, die Essen, Sake, Karaoke und Liebe versprechen. Eine für einen Hostess-Club werbende Plakatwand zeigte sechs lächelnde junge Frauen in Bikinis, die mit ausgestreckten Händen Nachtschwärmer anlockten. Daneben hing ein Zeichen mit der Silhouette einer Kuh und dem Wort »wagyū«, das auf ein Steakrestaurant in einem Gebäudekomplex verwies. Rechts von der Kuh ein Bild von Händen, die einen Rücken massierten, dazu das mit lateinischen Buchstaben geschriebene Wort »Flamingo« sowie eine Preisliste, beispielsweise neunzig Minuten für 2500 Yen (etwa 15 Euro). Dampf stieg aus einer Bude auf, die über ein Loch in der Wand Hefebrötchen verkaufte, und zu all dem ertönte der ohrenbetäubende Sound von Jingles und Werbesongs, die gleichzeitig von riesigen Screens über uns ausgeschüttet wurden. Überwältigt und unglaublich naiv, verstand ich überhaupt nicht, was hier geschah.
An britische Läden und Restaurants gewöhnt, die sich normalerweise im Erdgeschoss befinden, verblüffte mich in Tokio die auffallende Vertikalität der japanischen Gastronomie. Restaurants und Bars waren übereinandergestapelt, und Neonlichter wiesen darauf hin, was in welchem Stockwerk zu bekommen war. Das verlieh den Straßen nicht nur eine futuristische Cyperpunk-Ästhetik, sondern machte gleichzeitig die Wahl eines Restaurants zu einer einschüchternden Angelegenheit, da man keine Möglichkeit hatte, vor dem Betreten hineinzuschauen. Wir fuhren mit dem Fahrstuhl in den dritten Stock eines Gebäudes, da uns ein knalliges Schild Cocktails versprach, doch als sich die Türen zu einer schäbig eingerichteten Bar mit voll besetzter Theke öffnete, machte der Barkeeper hinter dem Tresen mit den Armen ein großes »X«. Entweder war die Bar voll oder er wollte uns nicht haben. Wir hasteten augenblicklich davon.
Wir entschieden uns schließlich für ein Sushi-Restaurant im Erdgeschoss, in das wir durch das Fenster zumindest schon einen Blick hatten werfen können. Es beruhigte uns zu sehen, dass hier geschäftiger Betrieb herrschte, inklusive einer Reihe von Köchen mit den typischen weißen Schürzen und Mützen, die mit Leidenschaft nigiri-Sushi zubereiteten.
Ich, der zum ersten Mal im Leben ein japanisches Restaurant betrat, staunte nicht schlecht, als alle, von den Köchen bis hin zu den Kellnern, in ein lautes »Irasshaimase! Willkommen!« ausbrachen. Ein Chor in den unterschiedlichsten Tonlagen, vom dröhnenden Bass des Küchenchefs bis zum schrillen Kreischen einer vorbeieilenden Kellnerin, die zwei Teller aus Hinoki-Holz balancierte.
Da gerade großer Andrang herrschte und die Pendler fürs Abendessen in die Restaurants stürzten, waren beinahe alle Tische besetzt, nur drei Stühle am Tresen waren noch frei. Eine zwischen den Gästen hin und her wuselnde junge Frau kam zu uns herüber und hielt fragend drei Finger hoch. Wir nickten.
»Hai, dōzo! Hier entlang, bitte.« Sie führte uns an den Tresen und stellte drei Becher kochend heißen grünen Tee vor uns ab, um dann an einen Nachbartisch zu eilen.
Bis dahin hatte ich in Großbritannien erst ein- oder zweimal Sushi gegessen, und zwar immer nur aus dem Supermarktregal. Das Erlebnis von geschmacklosem Fisch auf steinhartem Reis hatte mich nicht sonderlich überzeugt. Während ich Platz nahm, bereitete ich mich auf eine neue Erfahrung vor, da mich das halbe Dutzend Köche in den Bann zog, das synchron an Gerichten arbeitete, die eher wie Kunstwerke denn wie Nahrungsmittel aussahen.
Drei Köche schnitten prächtige Stücke frischen Thunfisch und Lachs auf, während andere den Reis in ihren Händen zu perfekten Bällen formten. Ich beobachtete, wie ein weiterer Koch mit einer kleinen Lötlampe planvoll Thunfischscheiben auf Reiskügelchen festbrannte, wobei der Fisch unter der heißen Flamme seine Farbe von Rosa zu Goldbraun wechselte. Der fertiggestellte Happen wurde sorgfältig auf einen Holzteller gelegt, außerdem eine Reihe nigiri mit einer Auswahl an Garnierungen, von Lachsrogen über ein fluffig aussehendes Omelette bis hin zu Stücken eines weißen Fischs, den ich nie zuvor gesehen hatte. Der verführerische, süße Duft des sautierten fetten Thunfischs vermischte sich mit dem ohnehin überwältigenden Geruch nach frischem Fisch, was dafür sorgte, dass man sich eher wie in einem Hafen fühlte als im Zentrum der größten Metropole der Welt.
Obwohl die Speisekarte ohne Englisch auskam, zeigte sie glücklicherweise herrlich verlockende Fotos von jeder Sorte Sushi. Ich tippte auf einen Teller mit Thunfisch. Das großzügige Gericht versprach drei verschiedene Arten Thunfisch: akami, ein dunkelrotes, fleischiges Stück; ōtoro, das fetteste von allen, hellrosa; und chutoro, ein mittelfettes Stück. Diese drei waren in Perfektion sautiert, zerkleinert, aufgeschnitten und gerollt worden und wurden nun als handgeformtes nigiri, als maki-Rollen und als einige Scheiben Sashimi serviert, und zwar auf einem Bett aus Daikon-Rettich und mit einem Klecks Wasabi. Das Gericht aus zwölf Stück Sushi kostete 2700 Yen (rund 17 Euro), was mir deutlich teurer vorkam als mein Supermarktessen.
Ich schob den ersten Bissen chutoro nigiri in den Mund.
Als Erstes schmeckte ich den shari – den Reis selbst. Der außerhalb Japans wohl am meisten unterschätzte Bestandteil von Sushi besteht aus mit Essig, Salz und Zucker vermengtem Reis mit einem deutlich auffallenden, süßlichen Geschmack. Er war klebrig, aber zugleich fest, was es leicht machte, den Bissen aufzunehmen, aber auch, ihn im Mund zu zerteilen. So etwas hatte ich noch nie geschmeckt. Das »Sushi«, das ich in England bekommen hatte, fühlte sich im Vergleich dazu an wie ein aus Hass begangenes Gewaltverbrechen.
Und dann war da noch der chutoro-Thunfisch selbst. Seine buttrige, im Mund zergehende Konsistenz erinnerte mich an ein gutes Steak und besaß überraschenderweise fast überhaupt keinen Fischgeschmack. Die Balance zwischen Fett und Fleisch machte ihn zu einem unglaublich befriedigenden Happen, vor allem dank des raffinierten Wasabi-Kicks.
»Wahnsinn. So soll Sushi also schmecken«, bemerkte ich.
»Da muss sich jedes britische Sushi in Grund und Boden schämen«, stammelte Colin und holte kurz Luft, bevor er sich noch mehr Fisch in den Mund schob.
Als man mir den Thunfisch gebracht hatte, stieg in mir die Sorge auf, nicht satt zu werden. Es sah alles so zart aus. Doch nach dem zwölften Stück war ich kurz vor dem Platzen. Ich hatte unterschätzt, wie sättigend essiggetränkter Reis sein konnte.
Allerdings nahm das Essen noch eine Wendung ins Üble, als Michael darauf bestand, zum Abschluss noch ein Gericht zu bestellen.
»Mein japanischer Freund meinte, ich müsse das probieren, wenn ich Sushi esse. Es heißt shiokara.«
Wir hatten noch nie davon gehört, aber ich begann mir Sorgen zu machen, als ich den verblüfften Ausdruck auf dem Gesicht eines Sushi-Kochs entdeckte, der mitbekommen hatte, was wir bestellten.
Wenige Augenblicke später stand fest, dass Michael sich mit den falschen Freunden umgab.
Eine Kellnerin brachte uns drei kleine Gerichte, für jeden von uns eines. Es sah aus, als hätte jemand einen Fisch ausgeweidet und all das blutige Innere in eine Schüssel geleert.
Und genau das war es auch.
Nun stellte sich heraus, dass ika no shiokara so viel wie »fermentierte Tintenfischinnereien« bedeutete.
»Eine echte Spezialität also?« Ich bohrte meine Stäbchen in die braune, unansehnliche Masse.
»Ja. Wobei ich fürchte, es wird Zeit, dass ich zur Burg Himeji aufbreche…« Ein plötzlich deutlich weniger selbstgefälliger Michael machte sich zum Aufbruch bereit.
Der hinter dem Tresen mit dem Vorbereiten eines Thunfischfilets beschäftigte Koch lachte über unsere Reaktion.
»Ganbatte ne! Viel Glück!«, spornte er uns an und ballte komisch die Faust, als wolle er uns auf einen Kampf vorbereiten.
Um den Meister nicht zu enttäuschen, probierte ich einen Happen. Bei dem salzigen, bitteren Geschmack schrumpfte meine Zunge augenblicklich zusammen. Rasch griff ich nach dem grünen Tee.
Mehrere Köche und Gäste an der Theke kreischten vor Vergnügen.
Ich überlebte meinen ersten Besuch eines japanischen Sushi-Restaurants, der, von fermentierten Tintenfischinnereien einmal abgesehen, nichts weniger als eine Offenbarung für mich war.
2. Die Japan-Lotterie
August 2012
Als sich die intensive dreitägige Tokio-Einführung ihrem Ende zuneigte, wurde jeder, den ich hier getroffen und jede, mit der ich mich angefreundet hatte, abrupt auf ein Nimmerwiedersehen davongetragen.
Manche wurden mit dem Shinkansen an exotische Orte wie Ōsaka, Himeji oder Kōbe gebracht – wahrscheinlich um dort das wagyū-Rind zu essen, das ich mir gewünscht hatte. Die weniger Glücklichen trieb man zu Bussen, die in Tokios nicht sonderlich aufregende Nachbarpräfekturen Chiba und Saitama fuhren. Mit jedem halbwegs vertrauten Gesicht, das ich aus den Augen verlor, verlor ich auch ein Stück Sicherheit.
Was mich betraf, so wurde ich per Minibus zum Flughafen Haneda gebracht, von wo aus ich eine Stunde gen Norden in die Präfektur Yamagata flog. Nur ein weiterer JET-Kollege reiste ebenfalls in dieser Richtung, ein schüchterner, aber freundlicher Typ aus Colorado, Mark. Außerdem begleitete uns ein Japaner, der uns persönlich unseren japanischen Kolleginnen und Kollegen vor Ort übergeben würde. Es fühlte sich fast wie ein glamouröser Gefangenenaustausch an.
Mit dem Start des Flugzeugs stieg meine Nervosität. Es sollte nicht mehr lange dauern, dann würde ich in einer Schule stehen und mich als Lehrer vorstellen müssen. Zu meiner eigenen Beruhigung zog ich den inzwischen zerfledderten und zerknitterten Zusagebrief aus meiner Tasche hervor. In ihm stand eine Zeile meines in Yamagata stationierten JET-Koordinators, zu der ich immer wieder zurückkehrte.
»Herzlichen Glückwunsch, Chris. Sie haben die Japan-Ortsvergabelotterie gewonnen.«
Mit einem Gefühl wachsender Unruhe blickte ich auf diese Worte.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Weg zu einem aufregenden Ort war, erschien mir äußerst gering. In den von Beklemmung geprägten Tagen vor meiner Abreise nach Japan hatte ich versucht, so viel wie möglich über Yamagata herauszufinden, über jene ländlich geprägte Präfektur, die ich in Kürze für einige Jahre mein Zuhause nennen würde.
Eine Wikipedia-Suche über die Region und ihre Bevölkerung von einer Million Menschen hatte unter anderem ergeben: »In der Präfektur werden siebzig Prozent der Kirschen Japans geerntet.«
Wahnsinn.
Es fanden sich kaum Sehenswürdigkeiten, Festivals oder andere Besonderheiten von kulturellem oder historischem Wert. Aber zum Glück gab es ja die Kirschen. Die würden mich schon retten.
Ich begann, irgendetwas in den übertrieben positiven Ton des Briefs hineinzuinterpretieren. Vielleicht war das nur ein Trick, um die unangenehme Wahrheit zu übertünchen, dass ich auf dem Weg in Japans übelste Region war. Um mich von meiner zunehmenden Nervosität abzulenken, schaute ich aus dem Fenster. Wir flogen über das Ōu-Gebirge, das sich wie eine Wirbelsäule auf der japanischen Hauptinsel entlangzieht. Die mit 500 Kilometern längste Gebirgskette des Landes sollte schon bald die physische Grenze bilden zwischen mir und allem, was mir vertraut war. Die Berge waren fraglos wunderschön, mit ihren scharfen, felsigen Gipfeln und den endlosen, üppigen Wäldern an ihren Hängen. Während man beim Gedanken an Japan meist das urbane Tokio oder Kyōtos rot lackierte Schreine im Kopf hat, besteht das Land in Wirklichkeit zu siebzig Prozent aus Bergen und Wäldern. Die hügelige Landschaft ist der Grund, weshalb sich ein so großer Teil der Bevölkerung in den dazwischenliegenden Ebenen und den Betonmegastädten wie Tokio, Nagoya oder Ōsaka drängt.
Unser japanischer Betreuer, bis hierhin eher schweigsam, lehnte sich mit einem Mal in seinem Sitz vor und deutete aus dem Fenster.
»Im Winter auf diesen Berg viel Schnee«, grinste er unheilverkündend.
Ich nickte zustimmend, nicht ahnend, dass die mickrigen Zentimeter Schnee, die ich aus Großbritannien kannte, nichts waren im Vergleich zu dem, was ich hier gegen Ende des Jahres erleben sollte. Ich wusste nicht, dass im Ōu-Gebirge zwischen Dezember und März so viel Schnee fällt wie sonst fast nirgendwo auf der Erde, was in den Wintermonaten eine Flucht aus Yamagata nahezu unmöglich macht.
Beim Landeanflug sah ich hinab auf eine Ebene, in der sich auf dreißig Kilometern sattgrüne Reisfelder aneinanderreihten und durch die sich schnurgerade Straßen in Richtung Chōkai zogen, dem am Horizont düster drohenden Vulkan. Die 2200 Meter hohe Spitze konnte ich im feuchten Sommerschleier gerade so ausmachen, und ich überlegte, ob dieser aufragende Gipfel meinen Untergang besiegeln würde, sollte er einmal ausbrechen. Schließlich waren bei uns in England Vulkanausbrüche und Erdbeben Ereignisse, die man ausschließlich in den Nachrichten aufschnappte oder bei Wikipedia fand. Zu meiner Erleichterung sollte ich schnell erfahren, dass der Chōkai mehr oder weniger erloschen war und zuletzt 1974 eine mittelgroße Menge an Rauch ausgestoßen hatte. Anstatt zu einer dauerhaften Bedrohung wurde der schlafende Vulkan schnell zu einer täglichen Erinnerung daran, wie glücklich ich mich schätzen konnte, in solch einer wunderbar exotischen Landschaft leben zu dürfen.
Die Shōnai-Ebene liegt eingeklemmt zwischen dem Japanischen Meer im Westen und dem Ōu-Gebirge im Osten, was sie zu einer ziemlich dramatischen Landschaft macht. Nichts hätte sich mehr von den ungeordnet aus der Umgebung herausgestemmten Feldern und den sanften Hügeln der britischen Provinz unterscheiden können.
Denn hier herrschte eine Art Ordnung, als habe man jedes Reisfeld ganz ordentlich in Rechtecke geschnitten und als sei die Ebene perfekt glatt, bis sie an ihrem Rand unvermittelt in steile Berge übergeht. Der Kontrast zwischen der türkisfarbenen See, den leuchtend grünen Reisfeldern und den diesig-blauen Berggipfeln war bei dieser ersten Begegnung eine unglaublich beeindruckende Erfahrung. Obgleich ich niemandem empfehlen würde, Japan im August zu bereisen, der nicht am eigenen Leib erfahren möchte, wie sich ein Brathühnchen fühlt, so ist dieser Anblick doch zweifellos im Hochsommer am eindrucksvollsten.
»Meine Damen und Herren, wir landen in Kürze auf dem Shōnai Airport. Bitte stellen Sie Ihre Sitze aufrecht und schnallen Sie sich an.«
Ich verstaute den Brief wieder in der Tasche und schloss schnell den obersten Hemdknopf. Ich trug elegante Arbeitskleidung, da man mich gewarnt hatte, ich würde direkt vom Flughafen zu einem ersten Treffen mit dem Schulleiter gebracht werden. Im Grunde war dies bereits mein erster Arbeitstag.
Mittlerweile fühlte ich mich allerdings wie ein zerzaustes Nervenbündel. In meinem Magen brannte es vor Anspannung, was zusammen mit dem Jetlag mein Hirn dermaßen vernebelte, dass ich nicht in der Lage war, zusammenhängende Sätze zu äußern. Allein der Gedanke daran, mit einer wichtigen Person reden zu müssen, im Zweifel sogar auf Japanisch, war der blanke Horror. Vermutlich wäre ich in Kürze der am schnellsten gefeuerte Englischlehrer der japanischen Geschichte.
Als wir uns der Ankunftshalle näherten, kniete Mark sich nieder, um seine Schnürsenkel zu binden. Kraftlos hoffte ich, darin ein Zeichen seiner eigenen Unruhe erkennen zu können.
»Bist du auch ein bisschen nervös?«, erkundigte ich mich und hoffte, ein wenig JET-Kameradschaft teilen zu können.
»Nein. Nicht besonders«, antwortete er und band seine Schuhe ohne äußere Gefühlsregung zu. Blödmann.
Nach dem Lärm und Wirrwarr von Haneda wirkte der Flughafen Shōnai recht klein. Schon im Flugzeug waren kaum andere Passagiere gewesen. Offenbar versagte die Anziehungskraft der Kirschen ihre Wirkung auf japanische Touristen.
Langsam fragte ich mich, auf was ich mich eingelassen hatte, wurde aber rasch aus meiner Abwärtsspirale herausgerissen. Der Moment der Wahrheit war gekommen. Wir zogen unser Gepäck durch das Ankunftsgate, um unsere neuen Arbeitskollegen kennenzulernen. Der erste Test.
Als sich die Tür öffnete, fielen unsere Blicke auf zwei Gruppen wartender japanischer Lehrerinnen und Lehrer, die sich an Schildern mit unseren Namen festhielten. Ein großer, mittelalter Mann mit Drahtgestellbrille hob eines mit »Chris-sensei« (»Lehrer Chris«) freundlich lächelnd in die Höhe.
Er stand zwischen einem Mann mit fast identischer Brille und einer Frau, die lächelte und winkte.
Ein ermutigender Start.
»Nun Mark, ich vermute, hier trennen sich –« Ich drehte mich um, um mich zu verabschieden, doch Mark war bereits mit seiner Gruppe verschwunden. So viel zum Thema lebenslange Freundschaft.
Mein Betreuer verbeugte sich rasch vor meinen wartenden Kollegen, sagte: »Schön, Sie kennenzulernen« und verschwand dann so schnell, dass man ihn für einen Geist hätte halten können. Damit war ich meiner Stützräder beraubt und mit meinen drei Kolleginnen und Kollegen allein.
Ich ging einen weiteren Schritt auf sie zu und winkte überenthusiastisch mit beiden Händen. »Konnichiwa! Hallo!« Alle drei verbeugten sich. »Konnichiwa. Schön, Sie kennenzulernen, Chris-san.«
»Bitte, darf ich Ihnen das abnehmen?«, erkundigte sich der größere der beiden Männer, nahm mir den Gepäckwagen aus der Hand und packte das Namensschild darauf. »Vielleicht möchten Sie einen Kaffee?«
»Ja, bitte. Ich bin todmüde von dem Jetlag«, scherzte ich linkisch. Die drei nickten lächelnd und führten mich zu einem kleinen Café im Flughafengebäude.
Nachdem wir eisgekühlten Kaffee bestellt und uns an einem Tisch in der Ecke niedergelassen hatten, versammelten sich alle Blicke auf mir. Die drei lächelten weiterhin, als wären ihre Mienen so eingefroren worden.
Der ältere Mann brach das unangenehme Schweigen. »Nun, Chris-san, hatten Sie einen guten Flug?«
»Der Flug war schon okay, kann man nicht anders sagen, aber der Jetlag macht mich echt fertig. Tokio war ziemlich intensiv, bei all dem Training und was sonst noch so auf mich eingestürzt ist. Und es war so irrsinnig heiß, dass ich die ganze Zeit dort kaum ein Auge zugemacht habe«, platzte es aus mir heraus.
Schweigen. Ich sah meine drei Kollegen an. Ihre Züge blieben unverändert, und sie hatten mir auch höflich zugenickt.
Aber es kam keine Antwort. Hatte ich etwas Beleidigendes oder Unpassendes gesagt? Ich nahm einen großen Schluck des kalten Kaffees, um die Stille zu überbrücken, und betete, jemand möge etwas sagen. Der ältere Mann sah seine Kollegen an, bevor er sanft reagierte.
»Chris-san. Vielleicht können Sie noch einmal reden, etwas mehr langsam, bitte?«
Oh Mist. Sie hatten kein Wort von dem verstanden, was ich gesagt habe.
Später sollte mir klar werden, dass von den elf japanischen Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich arbeitete, nur einer länger als drei Monate im Ausland gelebt hatte und mindestens drei Englisch weder sprachen noch verstanden. So angenehm die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen auch waren, offenbar gehörte es nicht zur Einstellungsvoraussetzung eines Englischlehrers in Japan, auch Englisch zu sprechen. Das könnte zum Teil erklären, warum Japan in Rankings über Englisch-Sprachkenntnisse so schlecht abschnitt, Platz 53 von einhundert Ländern, weit hinter China und Südkorea.
Die Geschwindigkeit, mit der ich sprach, zusammen mit meinem britischen Akzent – normalerweise wird amerikanisches Englisch in Japan unterrichtet – machte alles, was ich sagte, völlig unverständlich.
»Der Flug war gut. Aber ich bin durch den Jetlag erschöpft. Tokio ist sehr heiß!« Meine Worte kamen langsam und bedacht, und es wirkte. Mir wurde klar, dass meine übliche spöttische, sarkastische Sprachpersönlichkeit, angefüllt mit Metaphern und britischem Nonsens-Slang, hier unangebracht war. Um kommunizieren zu können, musste ich mein Vokabular drastisch vereinfachen – was dazu führte, dass ich noch langweiliger wirkte, als ich ohnehin schon bin. Mit der Zeit sollten zudem Gesten in meinen Interaktionen eine immer prominentere Rolle spielen.
»Ah, ja. Tokio ist im Sommer sehr heiß«, bestätigte der ältere Mann, und die beiden anderen nickten zustimmend.
Dann stellten sie sich förmlich vor. Der jüngere Mann war Nishiyama-sensei. Für einen japanischen Mann ungewöhnlich groß, hatte er, Ende dreißig, drei Monate seines Englischstudiums in Kanada verbracht. Er sprach Englisch langsam und methodisch, wobei er sich deutlich Mühe gab, dass ihm keine Grammatikfehler unterliefen. Das machte sein Sprechen irgendwie unheimlich und etwas roboterhaft, was jedoch von seinem warmen, fast unnatürlichen Lachen aufgehoben wurde.
Neben ihm saß Kengo-sensei, der schon Ende fünfzig war, obwohl er wie Anfang vierzig aussah. Von den dreien sprach er am souveränsten Englisch und pflegte einen sanften amerikanischen Akzent. Er war viel gereist, liebte es, Gitarre zu spielen und hatte Englisch über seine Liebe zur Musik gelernt. Nach dem Krieg war er Teil der japanischen Friedensbewegung gewesen und hatte immer wieder gegen das Militär und Atomwaffen protestiert. Im Vergleich zu den beiden anderen war er regelrecht enthusiastisch und schien von London wie besessen zu sein, was mir in die Karten spielen könnte, so hoffte ich.
Und schließlich war da noch Saitō-sensei, die nicht viel Vertrauen in ihre Sprachfähigkeiten zu haben schien. »Mein Englisch, nicht so gut!«, bemerkte sie scherzend und beendete ihre Vorstellung damit weitgehend, um sich wieder ihrem Kaffee zuzuwenden.
Sie waren alle sehr unterschiedlich, aber doch sympathisch und gastfreundlich, auf ihre eigene, leicht schräge Art.
»Chris-san, der Schulleiter wartet auf Sie. Sollen wir gehen?«, fragte Kengo-sensei und bezahlte die Rechnung.
Ich trank den letzten Schluck des eiskalten Kaffees, dann standen wir auf und steuerten auf den nahe gelegenen Ausgang zu. Draußen überwältigte mich die sengende Hitze, und ich erlebte zum ersten Mal den ohrenbetäubenden Lärm der Zikaden, die den Soundtrack für den japanischen Sommer bilden: Stellen Sie sich vor, eine Million Grillen feuern sich gegenseitig zu noch mehr Lärm an und werden über Festival-Lautsprecher verstärkt. Das Äußere von Kengo-senseis Auto war so heiß, dass ich kaum die Tür öffnen konnte, ohne mir meine Finger zu verbrennen.
Ich musste mich schnell abkühlen. Auszusehen, als wäre ich gerade erst aus einem Swimmingpool geklettert, war sicherlich nicht der erste Eindruck, den ich beim Schulleiter gern hinterlassen wollte.
Während der zwanzigminütigen Fahrt zur Schule rutschte ich nahe ans Fenster und versuchte, den Lufthauch abzubekommen. Wir fuhren durch endlose Reisfelder, in denen hin und wieder kleine Dörfer auftauchten, jedes mit einem leuchtend roten torii-Tor sowie traditionellen japanischen Häusern mit den kawara-Dachziegeln. Der Chōkai thronte über allem, was fast zu perfekt aussah, als hätte man die Landschaft so umgestaltet, dass sie die Quintessenz einer japanischen Gegend in einem Videospiel abgab. Die Aussicht und der Lärm der Zikaden machten mir wieder klar, dass ich sehr weit weg von zu Hause war. Nichts an diesem Setting fühlte sich auch nur im Entferntesten normal an.
Merkwürdigerweise verblüffte mich am meisten, dass ich nirgends auch nur ein Fleckchen Rasen sah. Nachdem ich nun schon ein paar Jahre hier gelebt habe, weiß ich, dass den meisten Menschen nicht einmal auffällt, dass es kein Gras gibt; in Japan ist jedes Stückchen Land entweder ein Reisfeld, mit Beton zugepflastert oder ein baumbestandener Berghang. Keines der Häuser, an denen wir vorbeikamen, hatte einen Rasen im Vorgarten, stattdessen verzierte eine Mischung aus Kies und sorgfältig geschnittenen Bäumen die winzigen Gärten der Häuser. Sogar die Parks bestanden hier vor allem aus Schotter und Sand.
Später sollte ich lernen, dass weniger als ein Prozent der Schulen in Japan Spielplätze mit Grasflächen haben, und zu Zeiten des Feudalsystems besaß nur der Adel Rasen, der als verzierendes Element, als visuelles Festmahl fürs Auge galt.
Leider war die Zeit fürs Grübeln über die Feinheiten von Grasflächen fast vorüber, denn wir erreichten die Stadt, die in den kommenden drei Jahren mein Zuhause sein sollte.
Sakata (酒田), wörtlich »Sake, Reisfeld«, war eine unauffällig aussehende Stadt. Hätte sie sich in England befunden, hätte man sie wahrscheinlich als heruntergekommen bezeichnet. Das an der Mündung des Flusses Mogami gelegene Sakata hatte als Hafenstadt in der Vergangenheit eine wichtige Rolle im Getreidehandel gespielt, doch diese glorreichen Zeiten waren schon lange vorbei. Über Jahrhunderte hatten Händler die lukrative Färberdistel, die man unter anderem als Färberpflanze für Kleidung und luxuriöse Lippenstifte verwendete, von Yamagata den Fluss hinab nach Sakata und von dort aus die japanische Westküste entlang nach Kyōto und Ōsaka verschifft. Der Handel hatte Sakata und die Shōnai-Ebene reich gemacht. In dieser abgelegenen, ruhigen Gegend wurde so viel Geld verdient, dass der hiesige Homma-Clan zum größten Landeigentümer in ganz Japan wurde und eine Menge Anwesen hinterlassen hat. Schaut man sich allerdings die nicht so wohlhabend wirkende Erscheinung des zeitgenössischen Sakata an, findet man nur wenige Hinweise auf diesen legendären Reichtum.
Das 20. Jahrhundert meinte es nicht gut mit der Region – so zerstörte ein im örtlichen Kino ausgebrochenes Feuer 1976 den Großteil der allseits bestaunten historischen Architektur und legte rund 22 Hektar Fläche im Stadtzentrum in Schutt und Asche.
Die alten Gebäude wurden durch gewöhnliche, praktische Apartmentblocks und ununterscheidbare Bauten ersetzt. Gerettet wird Sakata nur durch die mit Bäumen bestandene Uferpromenade mit ihren gewaltigen, rustikalen Holzlagerhäusern für Reis, direkt neben einem Kanal mit auf und ab wippenden Fischerbooten. Diese Lagerhäuser mit ihren makellos gekachelten Dächern sind der große Stolz der Bewohner der Stadt und tauchen überall im Internet auf, sobald man nach Sakata sucht.
Während unser Auto durch die labyrinthischen Straßen fuhr, fielen mir beunruhigend viele leer stehende oder verlassene Geschäfte und Häuser auf. Und wenngleich sie auch ganz ordentlich zugenagelt waren, so fragte ich mich doch, ob ich nicht in Japans schäbigster Stadt untergekommen war. Doch jedes Mal, wenn sich diese Enttäuschung in mir breitmachen wollte, wurde sie augenblicklich vom Anblick eines perfekt gestutzten Bonsai-Bäumchens, eines hellroten torii vor einem Schrein oder einem trendig aussehenden izakaya-Restaurant, das mit bemerkenswerten Kanji-Schriftzeichen gekennzeichnet war, weggewischt.
Ich fühlte mich ruhelos, wollte aus dem Auto springen und die Gegend erkunden, genau wie in Tokio während der endlosen Kurse. Als wäre ich in einem Open-World-Videospiel, wollte ich mich befreien und meine neue Umgebung entdecken. Das Problem war nur, dass in dem Augenblick, in dem ich hier gelandet war, mein Arbeitstag begonnen hatte.
Wir bahnten uns weiter den Weg durch das Stadtzentrum von Sakata, und mir fielen immer mehr leer stehende Geschäfte ins Auge, deren Rollläden heruntergelassen und deren Fenster vernagelt waren. Das Gefühl, in einer Geisterstadt unterwegs zu sein, wies auf eines der größten Probleme des ländlichen Japan hin: den raschen Bevölkerungsrückgang.
Im Jahr 2010 hatte Japans Bevölkerung mit 128 Millionen ihren Höchststand erreicht. Als ich 2012 ankam, waren es schon eine Million Menschen weniger, und bis 2050 soll die Zahl unter 100 Millionen fallen. Und die ländlichen Regionen tragen die Hauptlast, denn die jüngere Generation flieht in die nahe gelegenen Städte wie Sendai oder Tokio, um Partner oder Partnerin und eine Arbeit zu finden, die nichts mit Landwirtschaft zu tun hat.
In ländlichen Regionen wie Sakata werden daher häufig Schulen geschlossen oder zusammengelegt. Die für mich vorgesehene Lehranstalt war das Ergebnis einer Vereinigung von drei Schulen, die zusammen eine der größten nordjapanischen Schulen bildeten, eine brandneue, gewaltige Sekundarschule. Wir bogen um eine Ecke, und die Sakata Senior High tauchte vor uns auf: Das weiße Gebäude leuchtete in der Nachmittagssonne und die benachbarte Sporthalle ragte direkt daneben empor, groß genug, um ein Raumschiff aufzunehmen. Es war vermutlich das beeindruckendste moderne Haus, das ich bei unserer Fahrt durch die Stadt entdeckt hatte.
»Willkommen, Chris-sensei, an der Sakata Senior High School«, strahlte Nishiyama-sensei, als er uns durchs Tor und auf den Parkplatz steuerte. Wir verließen eilig das Auto und standen im Schatten der riesigen Turnhalle. Der Asphalt strahlte so viel Hitze ab, dass ich sicher war, innerhalb weniger Sekunden ein Spiegelei darauf hätte braten zu können.
Die Sakata Senior High einfach nur eine Schule zu nennen, wäre eine gewaltige Untertreibung. Sie besteht aus einem großen Komplex aus drei neu errichteten Schulgebäuden mit Klassenräumen, einer Sporthalle, einer großen Aula, in der man leicht eine ganze Flugzeugflotte hätte unterbringen können – oder zumindest 1200 Schülerinnen und Schüler sowie 120 Lehrerinnen und Lehrer – sowie einem (natürlich) nicht mit Rasen bedeckten, großen Spielplatz.
Der Anblick schüchterte mich ein, doch zu meiner damaligen Erleichterung fühlte es sich hier ebenso wie in einer Geisterstadt an wie im Stadtzentrum. Es war August und die Schülerschaft in den Sommerferien, abgesehen von einigen Schülern und Schülerinnen, die für Sommerkurse und -aktivitäten hiergeblieben waren. Als ich auf den Eingang zuging, hasteten drei Mädchen in Sportkleidung an mir vorbei, verbeugten sich und grüßten aufgekratzt.
Wir nickten alle zurück, und ich antwortete mit einem euphorischen »konnichiwa!«. Die Mädchen eilten davon, nicht ohne verstohlen einen Blick zurück auf ihren neuen, ungepflegten Englischlehrer zu werfen. Ich konnte ihre Enttäuschung gut nachvollziehen.
Auf dem Weg nach drinnen wurde ein deutlicher Unterschied zwischen japanischen und britischen Schulen offensichtlich: Reihen über Reihen von Schuhregalen. Jeder, der einen Fuß in das Gebäude setzt, muss seine Straßenschuhe ausziehen, sie ins Regal stellen und seine nur für Innenräume gedachten Schuhe anziehen. Hier erlebte ich zum ersten Mal Japans Straßenschuh-Verbotskultur: Bevor man eine japanische Wohnung oder sogar einige öffentliche Orte betritt, zieht man seine Schuhe aus. Ich will gar nicht wissen, was passiert, würde man mit seinen Turnschuhen eine Tatami-Strohmatte berühren. Eines der wenigen Male, dass ich eine Japanerin habe ausrasten sehen, war, als ein Freund mit Schuhen ein öffentliches Badehaus betreten hat – die ältere Dame am Empfangsschalter sprang aus ihrem Stuhl auf, um ihn mit Gewalt durch die Tür zurück nach draußen zu schieben.
Da dies mein erstes Mal war, fühlte es sich seltsam an, als Erwachsener in Socken am Eingang meiner neuen Arbeitsstelle zu stehen. Doch schon bald sollte ich mich an diese Art des Denkens gewöhnt haben. Heute, Jahre später, kommt es mir wie ein Verbrechen vor, in Innenräumen Straßenschuhe zu tragen.
Doch an meinem ersten Arbeitstag besaß ich noch keine Schuhe für drinnen, weshalb mir Kengo-sensei ein paar Hausschuhe reichte und erklärte: »Keine Sorge, Chris-san, wir kaufen morgen ein Paar Schuhe.«
Nishiyama-sensei führte mich in das riesige Gebäude. Wir kamen an zwei kichernden Schülerinnern vorbei, die auf einer Bank saßen und »Hallo!« hervorstießen.
Ich lächelte und nickte ihnen kurz zu. »Guten Tag!«
»Kakkoī!«, erwiderte eine von ihnen, und beide begannen zu lachen. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, also zeigte ich ihnen einfach einen Daumen hoch und hoffte, sie hatten mich nicht gerade als Arschloch bezeichnet.
Nachdem wir ein paar Schritte gegangen waren, wandte sich Nishiyama-sensei mit einem fröhlichen Glucksen zu mir um: »Sie sagen, Sie sind cool.«
Puh.
Kengo und Saitō folgten uns und grinsten ebenfalls, als hätte ich ein privates freudestrahlendes Gefolge.
Im Innern der Schule war es unsäglich heiß, und die Hitze verstärkte den Geruch nach frisch polierten Böden. Anstatt in den Sommermonaten die Klimaanlage zu nutzen, öffnete die Schule lieber die Fenster, was aber fast nichts dazu beitrug, die saunaartigen Temperaturen zu drosseln.
Meine Hausschuhe quietschten auf den tadellosen Böden, und wir kamen an Gemälden von Schülerinnen und Schülern vorbei, die die Landschaft in der Umgebung zeigten. Außerdem hing an der Wand ein großes blaues Poster mit einer Manga-Polizistin mit erhobener Hand, darunter die englischen Worte »No! Drug!«. Ich vermutete, damit sollten die Kinder vom Drogenkonsum abgehalten werden, aber die schlampige Grammatik ließ es wirken, als wollte die Polizistin erreichen, dass die Schülerinnen mit dem aufhörten, was sie gerade taten und augenblicklich Drogen zu sich nahmen.
Kaum fühlte ich mich bei diesem Spaziergang durch die leere Schule etwas sicherer, da erreichten wir die Tür zum Lehrerzimmer, und Nishiyama sprach mich mit seinem typischen Lächeln an.
»Okay, Chris-sensei, bevor wir den Schulleiter treffen, können Sie sich dem Kollegium vorstellen.« Er präsentierte mir diese Neuigkeit, als würde er mir einen kostenlosen All-inclusive-Trip nach Disneyland anbieten.
Oh Gott.
»Äh, also, jetzt gleich?«
»Wir sollten es jetzt tun.«
»Mmh, ich bin aber noch müde vom Jetlag!«, scherzte ich halbherzig in der Hoffnung, dem elenden Schrecken einer Ansprache an Dutzende von Kolleginnen und Kollegen entgehen zu können.
»Es ist okay. Nur eine kurze Vorstellung.«
Nishiyama schob die Tür auf und gab den Blick frei in ein weitläufiges rechteckiges Büro mit Dutzenden von Schreibtischen, auf denen sich Bücher, Papiere und Laptops stapelten. An einem gewöhnlichen Schultag würden hier 120 Lehrerinnen und Lehrer Noten verteilen, am Computer arbeiten, ein Schläfchen halten oder die Schüler disziplinieren, die sich falsch verhalten hatten.
Zu meinem Glück waren Sommerferien und daher nur etwa dreißig Kolleginnen und Kollegen anwesend. Wäre der Raum voll gewesen, wäre ich vermutlich in Tränen ausgebrochen. Einige im Raum sahen zu uns herüber, um den Frischling zu betrachten.
Mir war klar, dass ich einen guten ersten Eindruck hinterlassen musste, und damit das klappte, müsste ich zumindest versuchen, mich auf Japanisch vorzustellen. Ich hatte bei den Einführungskursen fünf Kernsätze gelernt, vermutete aber, dass ich sofort scheitern würde, sollte ich sie nun vor den hier Versammelten abliefern müssen.