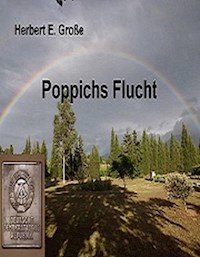Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Unternehmer N kann noch kurz vor der Insolvenz seinen Betrieb verkaufen. Jetzt hat er endlich Zeit, seinen Jugendtraum, eine Extremwanderung durch die Pyrenäen, zu verwirklichen. Schon am zweiten Tag seiner Tour kommt alles ganz anders als geplant. Er gerät in akute Lebensgefahr. Nach einem furchtbaren Bergsturz muss er sich zusammen mit der ihm unbekannten Urlauberin Maria auf ein Plateau durchkämpfen. Dort sind beide jedoch von der Außenwelt völlig abgeschnitten. N kann nach einem waghalsigen Abstieg Rettung für Maria organisieren und setzt seine Extremwanderung allein fort. Wieder zu Hause erhält er die Möglichkeit, seine Werkhalle von dem Konzern, der seinen Betrieb gekauft hat, für einen symbolischen Euro zurückzuerhalten. Bedingung dafür ist aber, dass er mit vier problematischen leitenden Angestellten des Konzerns eine erneute Extremwandertour absolvieren muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Kapitel
Hätten die Bahnbediensteten nicht gestreikt, wäre N rechtzeitig vor Abfahrt des Omnibusses angekommen, um gleich weiter in die Pyrenäen zu fahren und seine große Abenteuertour zu beginnen. Auf dem Rücken liegend, würde er den wilden Thymian riechen, die blauen Veilchen und weißen Margeriten anschauen und in die untergehende Sonne blinzeln.
Doch jetzt stand er auf dem abgasgeschwängertren Bahnhofsvorplatz. Die Passanten stanken nach Deodorant oder Einheitsparfüm und er war gezwungen, sich ein Hotelzimmer zu suchen und erst morgen weiterzufahren. Nach alter Gewohnheit ärgerte er sich zunächst, stellte aber fest, dass er alle Zeit der Welt hat. Für sein Vorhaben spielten ein oder zwei Tage wirklich keine Rolle.
Gleich neben dem Bahnhof befand sich ein Hotel der Kette, in deren Häusern er stets auf seinen Geschäftsreisen abgestiegen war. Fast automatisch, ohne groß nachzudenken, führte sein Weg dorthin. Heute erfuhr er nicht die übliche Aufmerksamkeit seitens des Hotelpersonals. Später ankommende Gäste wurden vor ihm abgefertigt. Als er fragte, was das solle, erfuhr er, dass in diesem Hause selten Rucksacktouristen absteigen würden.
„Nennen sie mir bitte eine Absteige in der Nähe, wo solche Penner wie ich für eine Nacht unterkommen können“, sagte er verärgert. Er war es nicht gewohnt, so behandelt zu werden und wollte gerade wieder gehen, als die Empfangsdame meinte, dass sie sich etwas unpassend ausgedrückt habe.
„Für eine Nacht können sie selbstverständlich ein Zimmer bekommen. Haben sie aber bitte Verständnis dafür, dass sie mit einer Kreditkarte einchecken und das Meldeformular ausfüllen müssen, mein Herr.“
Plötzlich machte N dieses Theater Spaß und er suchte umständlich seine Kreditkarte zunächst in seinem Rucksack. Als er sie angeblich nicht fand, sagte er: „Ach richtig, ich habe sie in meiner Hosentasche.“
Die Hotelangestellte nahm die Karte, zog sie kurz durch den Scanner und gab sie nach dem Ton, der die Deckung des Kontos anzeigte, N zurück.
„Hier ist ihr Schlüssel. Das Zimmer befindet sich im fünften Stock. Sie können den Fahrstuhl benutzen. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause.“
N nahm den Schlüssel. Es reizte ihn, die Sache auf die Spitze zu treiben und er fragte: „Wo finde ich den Busbahnhof; ich will morgen mit dem 1€ - Bus weiterreisen.“
„Von hier aus gesehen, befinden sich die Haltestellen direkt hinter dem Bahnhof“, antwortete die Angestellte hinter dem Rezeptionstresen und wandte sich dem nächsten Gast mit besonderer Höflichkeit und Aufmerksamkeit zu.
N fuhr mit dem Fahrstuhl in den fünften Stock und betrat sein Zimmer. Das Fenster gewährte einen Blick auf den Hinterhof.
Nachdem er ausgiebig geduscht hatte, entschloss er sich, in einem Restaurant außerhalb des Hotels zu essen und noch einen kleinen Spaziergang durch die, für ihn, fremde Stadt zu machen.
Als er den Fahrstuhl verlies, bemerkte er eine eigenartige Unruhe in der Hotelhalle. Die Empfangsdame hatte einen hochroten Kopf und schien gerade ihre persönlichen Sachen zusammenzupacken. Ein Mann im dunklen Anzug rang um Fassung. Als er N vor dem Fahrstuhl entdeckte, ging er eilends auf ihn zu.
„Monsieur N, ich bin untröstlich, wie sie in unserem Hause behandelt worden sind. Bitte erlauben sie mir, die Hausdame zu beauftragen, ihre Sachen in ein anderes Zimmer zu räumen und auf Kosten des Hauses zu dinieren“, flüsterte der Hoteldirektor.
„Ich glaube, nicht richtig zu verstehen“, antwortete N.
„Es ist mir unerklärlich, warum man sie nicht erkannt hat.“
„Ich bin das erste Mal in dieser Stadt und deshalb auch noch nie in ihrem Hause abgestiegen“, erwiderte N amüsiert.
„Unsere Hotelkette kennt all seine Premiumgäste. Die Empfangsdame hätte anhand ihrer Kreditkarte sofort erkennen können und müssen, dass sie zu den besonderen und bevorzugten Gästen unserer Häuser zählen.“
„Zur Entschuldigung ihrer Angestellten muss man aber feststellen, dass ich als Rucksacktourist ihr Haus betreten habe“, versuchte N die Hotelangestellte in Schutz zu nehmen.
„Bitte verzeihen sie uns dieses Missgeschick. Wenn sie einverstanden sind, lasse ich sie umquartieren. Den neuen Schlüssel erhalten sie an der Rezeption.“
N war einverstanden, machte aber vor dem Diner noch den beabsichtigten Spaziergang, um die Abfahrtzeiten der Busse zu studieren. Wie erwartet, fand er eine Busverbindung in die ungefähr 50 Kilometer entfernte letzte größere Stadt am Fuße des Bergmassives.
Während des Essens auf Kosten des Hauses dachte N darüber nach, dass dies die letzte Vorzugsbehandlung während der nächsten zwei oder drei Monate gewesen sein wird.
„Ich werde und will es nicht vermissen. Endlich geht mein großer Traum, den ich mein ganzes bisheriges Leben geträumt habe, in Erfüllung“, dachte er.
So richtig konnte er das Abendessen nicht genießen; in Gedanken war er schon auf der großen Tour.
2. Kapitel
Der Bus fuhr, für südfranzösische Verhältnisse, relativ pünktlich ab. N hatte seinen Rucksack im Laderaum verstaut und einen Platz in der Nähe der hinteren Tür gefunden. Gedankenverloren schaute er aus dem Fenster. So richtig konnte er seinen Schritt noch immer nicht realisieren.
„So, jetzt gibt es für mich kein zurück. Zivilisation lebe wohl! Keine Sorgen mehr um den Betrieb. Vielleicht hätte ich ihn teurer verkaufen sollen. Aber dann wäre alles nicht so schnell gegangen“, überlegte er und hätte es sich fast selbst laut erzählt.
Er hatte kaum einen Blick für die wunderschöne Landschaft. Es wurde bergiger. Nach drei Stunden hatte der Busfahrer, immer noch recht pünktlich, das Ziel erreicht und verkündete, dass für diese Buslinie hier Endstation sei.
„Nach ihrem Rucksack zu urteilen, wollen sie bestimmt weiter bis zur alten Bergwerksstadt, oder?“ N bejahte diese Frage des Busfahrers.
„Ein Kollege fährt in einer Stunde mit einem Minibus dorthin. Die Haltestelle ist auf der anderen Seite des Platzes.“
N bedankte sich für die Auskunft und schulterte seinen Rucksack, um über den großen Platz, auf dem nicht nur Pkw, sondern auch Busse, abgestellt waren, zu laufen. Alles sah verlassen und trostlos aus. Die verfallene Fabrikruine ließ vermuten, dass dieser Ort einmal bessere Zeiten gesehen haben muss. Vergebens suchte N ein Café oder wenigstens eine Imbissbude. Schließlich setzte er sich auf einen großen Stein und wartete.
Zehn Minuten vor der planmäßigen Abfahrt des Busses schlug ihm ein unbekannter Mann auf die Schulter und sagte: „Sie wollen bestimmt mit mir zur alten Bergwerksstadt fahren.“
„Wenn sie der Busfahrer sind, wird es so sein“, antwortete N.
„Sie können schon einsteigen, wenn sie wollen.“
„Wo ist denn ihr Bus?“
„Sie sitzen fast davor. Es ist der Iveco Daily hinter ihnen.“
Fünf Minuten nach der offiziellen Abfahrtszeit sagte der Busfahrer, dass er losfahren würde, da offenbar niemand mehr mitfahren wolle.
N wunderte sich, dass er der einzige Fahrgast war und fragte, ob der Bus immer so überbelegt wäre.
„Wissen sie, in der Schulzeit transportiere ich zwei oder drei Kinder und ab und zu mal alte Weiber, die kein Auto haben.“
„Rentiert sich diese Linie denn?“, fragte N und erhielt zur Antwort, dass der Staat mit diesen Buslinien seine soziale Verantwortung wahrnehmen würde.
„Wie weit wollen sie“, fragte der Busfahrer nach einigen Minuten.
„Bis zur Endstation“, antwortete N.
„So meine ich es nicht. Mich interessiert, wie weit sie touren wollen.“
„Ich verstehe ihre Frage nicht.“
„Solche Männer wie sie gehen allein in Richtung Westen; wenn es klappt, sogar die 400 Kilometer bis zum Atlantik. Ich bewundere euch Typen. Ihr seid die letzten richtigen Männer mit Mut. Ihr werdet bestimmt nie aussterben.“
N schwieg eine kurze Zeit und sagte, dass er sich vorgenommen habe, so weit wie möglich zu gehen.
„Sie schaffen es mit Sicherheit“, erwiderte der Busfahrer.
„Woher wollen sie denn das wissen“, fragte N schon etwas leicht genervt.
„Ich fahre diese Linie bereits seit fünf Jahren und habe schon einige solcher Typen, wie sie einer sind, transportiert. Von zehn ihrer Sorte kommen acht nach zwei oder drei Tagen zurück und geben auf. Auf der Fahrt zur Bergwerksstadt erzählen sie mir, was für harte Kerle sie seien und was sie schon alles unternommen hätten. Außerdem haben diese Warmduscher übergroße Rucksäcke dabei und tragen edle Wanderkleidung. Sie sind mit Sicherheit einer der beiden, die nicht wieder mit mir zurückfahren.“
„Wie kommen sie zu dieser Erkenntnis?“
„Sie haben einen älteren und kleineren Militärrucksack und sind nicht modisch gekleidet. Außerdem sind sie ein Schweiger, einer von der harten Sorte.“
„Jetzt machen sie es aber einmal halblang, sie Menschenkenner.“
Bis zur Endstation schwiegen beide und man sah dem Busfahrer an, dass er in Gedanken N beneidete.
Als N ausstieg, erhielt er noch den Rat, erst morgen aufzusteigen, weil das Wetter nicht besonders sei.
„Das hätte ich auch ohne ihren Rat getan; ich bin zwar bestimmt etwas „spezial“ in ihren Augen, aber nicht lebensmüde“, sagte N und fragte, wo man in diesem gottverlassenen Nest schlafen könnte.
„Siehste, du Greenhorn!“ Der Busfahrer lachte etwas spöttisch und sagte: „Daran haste nicht gedacht, was? Geh zum Lebensmittelhändler; er ist der Einzige, der dir helfen kann. In dieser Großstadt gibt es keine Hotels und nur ein einziges Fremdenzimmer. Wenn du Glück hast, ist das frei. Wenn nicht, hast du dein erstes Problem. So, jetzt muss ich zurück. Viel Erfolg und grüß den Russen von mir“, sagte der Busfahrer, schloss die Türen seines Fahrzeugs und fuhr ab.
N winkte noch kurz und stand jetzt mutterseelenallein auf einer Art Dorfplatz.
Er entdeckte eine armselige Kirche und zählte gerade einmal neun Häuser. Kein Mensch war weit und breit zu sehen; nicht einmal ein Straßenköter.
Ein Haus sah anders als die anderen aus und N ging dorthin. Es war das einzige Geschäft des Dorfes. Das übliche Schild mit den Öffnungszeiten konnte er nicht entdecken. Vorsichtig öffnete er die Ladentür; ein leises Läuten war zu hören. Geduldig wartete N, dass jemand erschien. Es dauerte bestimmt fünf Minuten, bis aus einem hinteren Raum ein Mann mittleren Alters kam.
„Guten Tag. Sind sie gerade mit dem Bus angekommen?“
„Ja, man hat mir berichtet, dass ich bei ihnen ein Zimmer für eine Nacht mieten könnte. Ich will erst morgen zu meiner großen Tour aufbrechen, weil das Wetter nicht besonders aussieht.“
„Ich muss sie leider enttäuschen. Das einzige Fremdenzimmer ist bereits seit einer Woche an ein Ehepaar vermietet“, sagte der Ladenbesitzer achselzuckend.
„Da habe ich offenbar richtiges Pech. Was raten sie mir, wie ich mein Problem lösen könnte?“
„Für verspätete Wanderer haben wir in dem Schuppen hinter dem Haus Schlafplätze. Sie haben bestimmt eine Matte mit Schlafsack. Der Platz ist kostenlos. Wer möchte, kann eine Spende in die alte Konservendose legen.“
„Und wo kann ich etwas zu Abend essen“, fragte N schon leicht resignierend.
„Hier im Laden können sie einkaufen. In der Unterkunft steht ein kleiner Ofen. Damit können sie sich etwas kochen, oder besser gesagt, aufwärmen.“
„Gibt es auch eine Toilette“, wollte N wissen und erhielt zur Antwort, dass man dafür hinter den Schuppen in eine Art Stall gehen müsse.
N tat, wie ihm geraten und nahm sich vor, am nächsten Morgen so früh wie möglich aufzubrechen. Wenigstens werde ich heute nicht nass, dachte er sich und versuchte, bald zu schlafen.
Kaum war er eingeschlafen, als der Ladenbesitzer in den Schuppen trat.
„Sie wollen bestimmt die Riesentour entlang der Grenze gehen“, fragte er und N bestätigte ihm seine Vermutung.
„Sicherlich werden sie auch bei Boris vorbeischauen, oder?“
„Ich habe schon von diesem Einsiedler gehört. Ist das der, den man den Russen nennt?“, fragte N.
„Ja. Alle, die von hier aus aufbrechen und nicht den leichten ausgeschilderten Wanderweg GR 10 nehmen, kommen notwendigerweise nach ungefähr drei Tagen bei ihm vorbei. Ob er ein Russe ist, weiß niemand genau. Aber alle behaupten es. Boris legt Wert darauf, dass jeder Besucher ihm ein Kilo Zucker und eine Flasche Wodka mitbringt. Beides können sie bei mir im Laden erwerben.“
„Sie vermuten richtig, dass ich nicht den Wanderweg benutzen werde. Ich will mir einen Jugendtraum erfüllen und die Pyrenäen richtig kennenlernen. Ich werde den Wunsch des Einsiedlers beachten und aus ihrem Geschäft Zucker und Wodka mitnehmen“, erklärte N und erhob sich von seiner Schlafmatte.
„Vielleicht interessiert sie mein folgender Vorschlag: Ich muss morgen mit dem Quatre-Quatre zur Quelle, die unser Dorf mit Trinkwasser versorgt. Da stimmt etwas nicht. Seit einigen Tagen hört man aus den Bergen ungewöhnliche Geräusche. Irgendetwas ist anders als sonst. Hier in den Bergen und auch an den Küsten muss man mit der Natur leben und lernen, sie zu verstehen“, erklärte der Ladenbesitzer.
„Weil ich es auch so sehe, reizt es mich, das letzte Stück relativ unberührter Natur Europas intensiv kennenzulernen“, erwiderte N.
„Diese Quelle befindet sich auf einem Plateau, das nicht auf ihrer voraussichtlichen Route liegt. Wenn sie wollen, können sie trotzdem mitfahren. Sie können von dieser Quelle über den westlichen großen Sattel wieder auf ihre Route gelangen und sind alsbald bei Boris. Der Vorteil für sie wäre, dass sie einen ganzen Tag früher beim Russen sind und ich zumindest nicht allein die ganze Fahrt machen muss.“
„Das hört sich interessant an, was sie mir da vorschlagen. Ich werde es mir überlegen. Wann würden sie losfahren?“
„Ich muss spätestens gegen 9 Uhr aufbrechen, weil eine Fahrt gute drei Stunden dauert, und ich nicht weiß, wie lange ich für die Besichtigung und eventuelle Reinigung der Quelle brauche“, antwortete der Lebensmittelhändler.
„Gut, ich werde mitfahren und ihnen gegebenenfalls bei der Instandsetzung der Quelle helfen“, sagte N.
3. Kapitel
Am nächsten Morgen war N bereits gegen 8 Uhr abreisebereit. Während er auf den Lebensmittelhändler und den Jeep wartete, ärgerte er sich, dass er zugesagt hatte, mit zur Quelle zu fahren. Wenn er allein losgegangen sein würde, wäre er jetzt bereits ein ordentliches Stück des großen Weges getourt und mit sich und der Natur allein.
Kurz vor neun Uhr hörte er den typischen Klang eines kalten Geländewagenmotors und staunte nicht schlecht, dass neben dem Ladenbesitzer eine Frau mittleren Alters in einem modischen Anorak und Turnschuhen saß.
„Guten Morgen Monsieur? Entschuldigung, ich kenne noch nicht einmal ihren Namen“, grüßte der Kaufmann und N stellte sich vor.
„Mein Name ist Joseph. Frau Maria hat den unbändigen Wunsch, mit zur Quelle zu fahren. Ich hoffe, sie sind einverstanden, dass wir zu dritt fahren.“
Man sah N deutlich an, dass er nicht besonders glücklich war, seine Tour mit einer Frau zu beginnen.
„Was bleibt mir anderes übrig“, sagte N, seinen Missmut deutlich zeigend, warf seinen Rucksack auf die Ladefläche und setzte sich auf einen der Rücksitze. Die Beifahrerin tat so, als hätte sie diesen Ausspruch überhört.
Anfangs verlief die Fahrt problemlos. Maria schwieg und schaute sich interessiert die Gegend an.
Am ersten Bassin, in dem das Quellwasser kurz vor dem Ort aufgefangen und in die Wasserleitungen geleitet wird, machte der Lebensmittelhändler den ersten Stopp.
„Schauen sie sich das an“, sagte er, „das ist fast leer.“
N schaute interessiert und fragte, an was das liegen könnte.
„Weiter oben muss der Zulauf unterbrochen sein. Das sieht nicht gut aus. Hoffentlich finden wir die Ursache“, sagte Joseph und drängte auf ein sofortiges Weiterfahren.
Nach der übernächsten Wegbiegung schoss ein starker Wasserlauf quer über den Weg und Joseph musste mit Vollgas den Gué passieren und hielt erst danach an. Beide Männer stiegen aus und betrachteten voller Sorge die unmittelbar links vom Weg liegende Waldwiese, die unter Wasser stand. Maria beschwerte sich kaum hörbar über die Fahrweise des Jeepfahrers.
„Ich befürchte Schlimmes“, sagte Joseph und bemerkte, dass er froh sei, dass er N an seiner Seite hätte.
„Ich bin zwar Ingenieur, habe aber von Melioration keine Ahnung, lieber Freund.“
„Ein Ingenieur ist mir in dieser Situation tausendmal lieber als ein Schneidermeister. Auf jeden Fall reden sie als Ingenieur in dieser Situation keinen Unsinn. Wir müssen von der Quelle aus den Wasserlauf verfolgen, um Genaueres sagen zu können.“
„Das ist logisch; auf zur Quelle“, erwiderte N.
Da Maria im Auto sitzen geblieben war, konnte es sofort weitergehen. Der Weg wurde immer steiler und Joseph hatte Mühe den Geländewagen zügig nach oben zu chauffieren. Maria schrie von Zeit zu Zeit auf, aber keiner der beiden Männer reagierte darauf. Für N stand fest, dass der Jeep auf diesem Weg nicht zum Stillstand kommen durfte.
An zwei weiteren Stellen floss ebenfalls Wasser über den Weg und Joseph wurde immer unruhiger. Endlich war das kleine Plateau im Quellbereich erreicht.
„Oh mein Gott“, schrie Joseph, „die Quelle ist weg. Ein Erdrutsch hat hier alles verändert.“
N bemerkte als erster, dass der Erdboden völlig durchnässt war. Er hatte den Eindruck, dass sich das Quellplateau auch leicht bewegte.
„Joseph, ich befürchte Schlimmes. Wenden sie den Jeep und danach nichts wie weg hier“, schrie er. Der Kaufmann gab ihm recht und sagte, dass Maria aussteigen und N das Wendemanöver außerhalb des Wagens dirigieren und vor Gefahren warnen solle.
Kaum hatten beide Passagiere den Geländewagen verlassen und waren auf einen kleinen Felsvorsprung gestiegen, als Joseph versuchte, den Jeep auf dem engen Platz mit den steilen Abhängen zu wenden. Bevor N einen Warnschrei ausstoßen konnte, rutschte Joseph mit seinem Auto rückwärts den steilen Hang hinunter. Im gleichen Moment entstand ein gewaltiger Erdrutsch, der nicht nur das Quellplateau, sondern den gesamten Hang mit einem ohrenbetäubenden Lärm ins Tal gleiten ließ. Wasser und auch Staub stiegen auf. Maria und N hielten sich mit aller Kraft an dem Felsvorsprung, auf dem sie standen, fest.
Das war nicht nur ein Erdrutsch, sondern ein riesiger Bergsturz verbunden mit einer Schlammlawine.
Maria krallte sich nicht nur an dem Felsvorsprung, sondern auch an N fest; ihr wurde übel und N legte sie in sicherer Lage hin. Jetzt konnte er fasziniert und mit offenem Mund das Naturschauspiel beobachteten.
Nach ungefähr einer halben Stunde war es vorbei. Jetzt sah alles anders aus. Den Weg, auf dem sie hochgekommen waren, gab es nicht mehr. Kein Baum oder Strauch war mehr zu sehen. Nur noch Felswände und riesige Geröllhalden und Schlammflächen. Voller Entsetzen stellte N fest, dass die Bergwerksstadt verschwunden war; nur noch Geröll war zu sehen.
Vorsichtig stand N auf und sondierte das Gelände. Ein Abstieg war nicht mehr möglich, zumal er nicht allein war und Maria sicherlich keine Bergerfahrung hatte.
Wohin sollten sie auch absteigen? Den Ort, von dem sie am Morgen aufgebrochen waren, gab es nicht mehr. Bestimmt war auch die einzige Zufahrtsstraße, auf der N mit dem Linienbus das kleine, hochgelegene und verfallene Örtchen erreicht hatte, unpassierbar.N drehte sich um und sah nach oben. Auch hier war nur noch Felsgestein. Aber ungefähr 100 Meter höher schien der große Sattel zwischen dem Hausberg der alten Bergwerksstadt und dem Pic, auf dem Boris einsiedeln sollte, noch erhalten geblieben zu sein.
„Es wird uns nichts anderes übrigbleiben, als aufzusteigen, um den Sattel zu erreichen“, sagte er recht laut zu sich selbst, weil er vermutete, dass Maria noch immer geistesabwesend war. Dem war aber nicht so. Maria starrte ihn an und weinte.
N versuchte, sie zu beruhigen. „Das ist im Prinzip gar kein Problem. Es gibt so gut wie kein Geröll und die Felsenkanten erlauben einen festen Griff und Tritt.“
Maria setzte sich, schaute nach oben und weinte noch heftiger. Plötzlich suchte sie in ihren Taschen etwas und war noch enttäuschter. „Mein Handy ist nicht mehr da“, sagte sie und N versuchte sie erneut zu trösten, indem er ihr sagte, dass man hier oben ohnehin keinen Empfang hätte.
„Aber wie wollen wir jetzt Hilfe rufen?“
„Wir müssen uns selbst helfen!“
„Und wie soll das aussehen“, fragte sie und N erklärte noch einmal, dass man hoch auf den Sattel müsse, um mit einem längeren Marsch auf das westliche Gipfelplateau zu gelangen.
„Wenn wir erst einmal bei Boris sind, lösen sich alle Probleme. Ich weiß, dass man auch von Westen kommend den Einsiedler erreichen kann. Also muss es auch in dieser Richtung einen Abstieg geben.“
„Wir wollen sogleich losgehen“, bat Maria.
„Langsam, langsam! Zunächst müssen wir prüfen, ob einer von uns Verletzungen hat.“
„Ich bin fit, nur mein Hintern schmerzt etwas von den Steinen, auf denen ich gesessen habe“, sagte Maria und N wollte wissen, ob sie sich sicher sei.
Maria stand auf, um ihre Feststellung zu dokumentieren. Jetzt sah auch sie den riesigen Bergsturz, konnte aber nicht erkennen, dass die kleine alte Bergwerksstadt, aus der sie heute Morgen aufgebrochen waren, nicht mehr zu sehen war. N machte sie auch nicht darauf aufmerksam und dachte sich, dass sie dieses Unglück noch rechtzeitig erfahren würde.
Er hatte bereits festgestellt, dass auch er keine nennenswerten Verletzungen hatte.
„So, da wir körperlich fit sind, müssen wir feststellen, über welche Hilfsmittel wir verfügen.“
„Wie muss ich das verstehen“, fragte Maria.
„Checken wir zunächst ihre Kleidung. Eine lange Hose und einen recht modischen Anorak kann ich erkennen. Auch sehe ich, dass sie Turnschuhe tragen. Ich muss aber auch wissen, welche Unterwäsche sie heute Morgen angezogen haben; insbesondere die Unterhose und das Unterhemd.“
„Was erlauben sie sich, sie Satyre.“
„Maria, in unserer Situation ist es unangebracht, mich einen Lüstling zu nennen. Die Lust an der Lust ist mir vergangen. Ich habe eine mindestens zweimonatige Überlebenstour geplant und bin entsprechend gekleidet.“
„Das glaube ich ihnen. Aber was hat ihre Tour mit meiner Unterwäsche zu tun?“
„Madame, wenn wir den Sattel erreichen sollten, wird es Abend sein und wir müssen ein Nachtlager bereiten. Der Weg zu Boris wird mit ihnen auch kein Spaziergang. Klartext! Haben sie richtige Unterhosen oder solche modernen Furchenknipper an? Ich muss auch wissen, ob ihr Unterhemd wärmt, weil sie ohne Daunendecke und auf hartem Untergrund schlafen müssen.“
„Oh mein Gott, das klingt furchtbar, was sie da sagen. Aber ich kann sie beruhigen. In meinem Alter trägt man keinen String-Tanga; auch habe ich keine Periode mehr. Zufrieden Überlebenskünstler?“
„Bitte schauen sie in ihren Taschen nach, was sie eventuell für Hilfsmittel bei sich tragen. Aber bitte keine blöden Antworten, unsere Lage ist mehr als ernst.“
„Ich sagte schon, dass ich mein Telefon verloren habe. Außer einem Taschentuch und einer defekten Armbanduhr habe ich nichts mehr.“
Jetzt durchsuchte N seine Taschen und stellte fest, dass er außer seinem Bowiemesser, einem Sacktuch und dem Brustbeutel mit seinem Pass, Kreditkarten und Bargeld nichts bei sich hatte.
Entsetzt war er, weil er keine Hilfsmittel fand, um ein Feuer zu machen. Genauso schrecklich war es, dass die Trinkflasche fehlte. Er sagte nur, dass es schade wäre, dass sein Rucksack im Jeep geblieben sei und versuchte, eine unbekümmerte Miene zu machen.
Maria spürte nichts von seiner Unruhe und nahm alles gelassen.
Ein Unbeteiligter hätte vermuten können, dass sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden hatte. Nur der Blick nach oben verschlug ihr den Atem. Noch niemals hatte sie eine richtige Wanderung in den Bergen unternommen; und jetzt diese Felswand.
4. Kapitel
Wenn Maria und N eine Verbindung zur „Zivilisation“ gehabt hätten, würden sie gesehen haben, dass die Stadt mit den verfallenen Fabrikgebäuden in heller Aufregung war.
Der Gouverneur war eigens angereist, um sich ein Bild von den Verwüstungen, die der Bergsturz angerichtet hatte, zu machen. Die kleine Stadt war voller Gendarmerie und Militär. Schweres Räumgerät wurde herbeigeschafft, obwohl diese Stadt selbst von der Naturkatastrophe nicht betroffen war. Aber hier war es möglich, die Einsatzleitung des Katastrophendienstes zu etablieren.
Als die ersten Meldungen aus den Helikoptern eintrafen, stand fest, dass es für die kleine Bergwerksstadt, in der N übernachtet hatte, keine Rettung mehr geben konnte.
Auch die Helfer, die über die Straße versucht hatten, den Ort zu erreichen, kamen zurück und meldeten, dass der kleine Ort unter einer mindesten 20 Meter hohen Schlamm- und Gerölllawine begraben sei.
Die Einsatzleiter waren sich schnell einig, dass selbst mit schwerem Räumgerät und Bergepanzern eine Suche nach Überlebenden aussichtslos sei.
Auch der herbeigerufene Chefgeologe warnte vor einer überhasteten Freilegung des Ortes. Wegen der vielen Bergwerksstollen und des Ausmaßes des Bergsturzes mit den großen Schlammmassen bestünde die Gefahr, dass sofort neues Gestein und neuer Schlamm nachrutschen würde. Außerdem sei die Chance, noch lebende Einwohner zu bergen, gleich null, weil die großen Schlammmassen jegliches Überleben unmöglich machen würden.
Die anderen Verantwortlichen der Bergungsmannschaften bestätigten den Geologen und wiesen auf die Gefahren für die Rettungsteams hin.
Nur der Gouverneur teilte die Meinung der Fachleute nicht und bestand auf einer sofortigen Bergung. Dabei wusste jeder der Anwesenden, dass der Gouverneur aus politischen Gründen so reagieren musste. Schließlich änderte auch er seine Einschätzung der Lage und wies die Gendarmerie an, festzustellen, mit wie vielen Opfern zu rechnen sei und möglichst die Namen der Verschütteten zu registrieren.
Als die ersten Pressevertreter und Fernsehteams eintrafen, waren die Fachleute den Gouverneur los; er kümmerte sich um die Medienleute.
Umweltschützer machten den Klimawandel für die Katastrophe verantwortlich und der eingetroffene Meteorologe schaffte es nicht, die Umweltschützer und Teile der Presse davon zu überzeugen, dass dieser Bergsturz rein gar nichts mit dem viel gescholtenen Klimawandel zu tun hätte.
Lediglich der Vertreter der örtlichen Presse fragte unvoreingenommen, ob es eine Verbindung mit dem Starkregen der letzten Tage und dem globalen Klimawandel gebe würde.
„Der weltweite Klimawandel führt unstreitig zu einer allgemeinen Erwärmung, auch hier in dieser Bergregion“, begann der Meteorologe seine Antwort zu formulieren und fuhr fort: „Die starken Regenfälle mit mehr als 250 Millilitern sind aber eher auf eine typische lokale Gegebenheit zurückzuführen. Wenn die Wassertemperaturen des Mittelmeeres hoch sind und wir eine starke Luftströmung vom Meer her haben, regnen sich die Wolken an den Bergen ab. Das ist normal und wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen. So kam es zum Beispiel im Oktober 1940 dazu, dass in weniger als 24 Stunden 1000 Milliliter Regen fielen.“
Nach diesen Bemerkungen fragte der Zeitungsreporter, ob es eine Statistik über die Häufigkeit dieser Wetterphänomene gäbe und erhielt zur Antwort, dass zwar keine Statistiken, aber Wetteraufzeichnungen vorhanden seien.
„Und was besagen diese Aufzeichnungen?“
„In den Jahren 1999, 2002, 2003 kam es häufig zu solchen starken Regenfällen. In den letzten beiden Jahren blieb der starke Regen aus; dieses Jahr häufen sich jedoch die starken Niederschläge wieder“, antwortete der Meteorologe.
„Eine abschließende Frage habe ich noch“, sagte der Reporter, „sind die Regenfälle die Ursache für den riesigen Bergsturz?“
„Ich glaube schon. Aber warum es zu dem Abgang der Erd- und Schlammmassen gekommen ist, müssen sie den anwesenden Geologen fragen“, war die Antwort und der Reporter suchte den Geologen, um auch diesen zu interviewen.
Dieser erklärte: „Die Pyrenäen sind, so wie auch die Alpen, im Tertiär entstanden. Die Besonderheit ist aber, dass im Westen, oben am Atlantik, der Kalkstein vorherrscht. Hier bei uns haben wir ein Granitgestein, das härter und glatter als der Kalkstein ist. Durch das Auftauen des Permafrostbodens und ständiger Erosionen haben sich über dem festen und glatten Granit lose Geröllmassen und Humusschichten abgelagert. Wenn sich zwischen dem festen Untergrund und der relativ losen Oberschicht genügend Wasser sammelt, kommt alles ins Rutschen.“
„Konnte man den heutigen Bergsturz nicht voraussagen“, wollte der Zeitungsmann noch wissen und erhielt zur Antwort, dass dies theoretisch schon möglich wäre; praktisch aber unmöglich sei.
Der Lokalreporter war mit den Ausführungen der beiden Fachleute zufrieden und tippte alles fleißig in seinen Computer.
Zur Befragung des Gouverneurs kam er nicht mehr, weil diesem seitens der Gendarmerie berichtet wurde, dass man mit mindestens fünf vermissten Personen rechnen müsste. Diese Bewohner der verschütteten Ortschaft wären heute Morgen im Dorf geblieben; alle anderen seien zur Arbeit oder zum Markt in die Stadt gefahren.
Der Busfahrer sei noch nicht befragt worden, sodass die genaue Zahl der möglichen Opfer noch nicht feststünde. Außerdem habe der Lebensmittelhändler Feriengäste beherbergt. Das könnten aber maximal zwei Personen gewesen sein, weil es in seinem Haus nur zwei Gästebetten gebe.
Bevor der Reporter seinen Bericht an die Redaktion senden konnte, erschien der Busfahrer und erzählte, wie viele Personen er heute Morgen aus dem Ort chauffiert habe.
Danach stand für die Gendarmerie fest, dass die vermuteten fünf Einwohner verschüttet sein müssten. Da von den Marktbesuchern berichtet wurde, dass beim Lebensmittelhändler zwei Feriengäste wohnten, stand die Zahl der Opfer mit sieben jetzt ziemlich sicher fest.
„Es muss ein achtes Opfer geben“, sagte der Busfahrer und berichtete von N, der mit Sicherheit ebenfalls im Bergwerksdorf übernachtet habe. Selbst wenn er sehr früh zu seiner Tour aufgebrochen sein sollte, wäre auch er verschüttet worden.
5. Kapitel
„Maria lassen sie uns bald aufbrechen. Es ist schon früher Nachmittag. Wenn wir den Sattel vor Einbruch der Dunkelheit erreichen wollen, müssen wir bald aufsteigen“, sagte N und schaute erneut nach oben. Sie bemerkte den sorgenvollen Blick ihres Begleiters und erklärte wenig überzeugend, dass man das schon schaffen würde.
N gingen die Grundregeln des Kletterns und des Extremwanderns durch den Kopf.
„Es hat keinen Zweck, der Stadtfrau vor dem Einstieg die Regeln zu erklären“, überlegte er und entschloss sich, nur zwei oder drei wichtige Punkte zu erwähnen. Er dachte sofort daran, dass er keine Wasserflasche mehr hatte.
„Maria, wichtig ist, dass wir vor Beginn unserer Kletterei so viel wie möglich trinken, weil meine metallene Wasserflasche im verlorenen Rucksack war. Ich werde deshalb vorsichtig von unserem Felsvorsprung hinunter zur ehemaligen Quelle gehen. Sie bleiben hier und rühren sich nur, wenn ich es ihnen sage. Haben sie das verstanden?“
„Ja, großer Meister; ich warte geduldig.“
N hielt sich mit einer Hand an der Felskante fest und rutschte mehr, als dass er stieg, zum Quellplateau hinunter. Die Quelle war nicht mehr zu sehen und er wollte resigniert die Suche beenden, als er entdeckte, dass aus einer Schlammschicht ein kleines Rinnsal entsprang.
„Ich habe sie gefunden“, rief er laut und fügte leise hinzu: „Oh mein Gott, wie soll Madame daraus trinken?“
Mit der Hand fing er etwas Wasser auf und kostete; es war reines Quellwasser. Das Rinnsal wurde größer und dadurch das Trinken leichter. Gerade wollte er wieder zu seiner Begleiterin aufsteigen, als er eine alte Plastikflasche sah. Sie war zwar stark verschmutzt, aber intakt.
„Maria es wird eine kleine Weile dauern. Ich habe eine Plastikflasche entdeckt und muss sie mühsam füllen. Bleiben sie bitte ruhig dort sitzen, wo sie sind.“
Nach ungefähr zehn Minuten war die Flasche innen erträglich sauber. Mit der Säuberung der Außenfläche hielt N sich nicht auf, füllte die Flasche mit Quellwasser und kehrte zu Maria zurück.
„Die ist nur äußerlich so schmutzig; innen war sie sauber. Bitte trinken sie, soviel sie können. Danach fülle ich die Flasche erneut und wir können losgehen.“