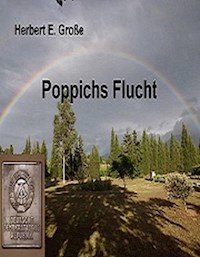Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paul, ein pensionierter Richter, flieht vor seiner Ehefrau nach Südfrankreich. Dort trifft er Henri, einen dispensierten katholischen Priester. Dieser lebt zurückgezogen in den Bergen. Beide alten Männer werden gute Freunde, die über Gott und die Welt philosophieren und sich über die Touristen lustig machen. Ab und zu vertreiben sie sich die Zeit mit infantilen Scherzen. Als eine junge Frau in ihr Leben tritt, wird alles anders. Aischa ist eine junge Muslima, die sich ihrer Zwangsverheiratung widersetzte und geschändet wurde. Auch sie kann nach Südfrankreich flüchten und lässt die beiden alten Männer über sich hinauswachsen. Der Erzähler schildert Südfrankreich mit und ohne rosarote Brille.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Kapitel
Vor acht Wochen sagte er ihr, dass er jetzt für immer gehen würde. Sie möge sich einen anderen suchen, den sie ständig bevormunden und beleidigen könne. Er habe es lange genug ertragen, jetzt sei Schluss!
Zuvor hatte er mit einem Bekannten in einem türkischen Restaurant gegessen und dort eine junge Frau in einem blauen Kleid gesehen, die ihn an eine frühere Zeit erinnerte. In diesem Moment stand für ihn fest, dass er jetzt gehen müsse.
Nach dem Restaurantbesuch ging er zur Bank und regelte seine Finanzen. Zu Hause suchte er seine wichtigsten Papiere zusammen und erklärte seiner Ehefrau, dass er jetzt ginge.
Sie lachte nur höhnisch, beschimpfte ihn als Idioten und sagte, dass er den Haustürschlüssel nicht vergessen solle, damit sie nicht aufstehen müsse, wenn er wieder nüchtern sei und nach Hause käme. Paul setzte sich in sein Auto und fuhr weg, hierher ins Roussillon, wo er ohne ihr Wissen bereits im vorigen Jahr das Mas Ferrol gekauft hatte.
Das Mas war eine Ruine. Die Türen schlossen nicht richtig, das Glas in den Fenstern hielt nicht mehr, sodass es beim Öffnen der Fenster herausfiel. Die Badewanne allerdings war recht neu und befand sich im ersten Stockwerk. Wenn Paul in der Wanne lag, konnte er den Himmel sehen.
In den ersten zwei Wochen hatte er das Dach repariert und in der dritten Woche neue Fenster eingebaut, die der ortsansässigen Schreiner maßgenau hergestellt und geliefert hatte.
Diese ersten drei Wochen war eine Zeit harter Arbeit, jetzt brauchte er neues Baumaterial, aber es war Sonntag.
Gegen 17 Uhr ließ der Wind nach und er entschloss sich, eine größere Pause einzulegen. Der Südwind hatte hohe Temperaturen gebracht und die Sonne sorgte für noch mehr Wärme auf der alten Terrasse.
Er schenkte sich ein Glas Rotwein ein und setzte sich in den einzigen vorhandenen Liegestuhl, der sogleich unter seinem Körpergewicht zusammenbrach.
Paul blieb in den Trümmern des Stuhles liegen. Er musste lediglich einen Holzstab, der in seinen Rücken stach, entfernen. Statt zu fluchen, lächelte er nur, trank seinen Rotwein und blickte mit sich zufrieden in den Himmel.
Jetzt lag er einigermaßen bequem auf seinem zerbrochenen Liegestuhl. In Gedanken hörte er sie sagen, dass er nicht einmal in der Lage sei, sich wie ein normaler Mensch in einen Liegestuhl zu legen oder dass er zu geizig sei, neue Gartenmöbel zu kaufen. Wenn jetzt noch Besuch gekommen wäre, hätte sie sich produziert und ihn schlechtgemacht.
„Das ist vorbei, ein und für alle Male!“, sagte er sich und war zufrieden.
Das Zirpen der Grillen war so laut, dass man schon fast Lärm dazu sagen konnte; es roch nach Süden, nach Südfrankreich. Den Geruch des alten Mauerwerkes konnte man hier nicht wahrnehmen. Wenn er bequemer gelegen hätte, wäre er eingeschlafen.
Paul stand nach einiger Zeit auf, ging in die Küche, holte den vorgestern auf Anraten des boucher, des örtlichen Metzgers, gekauften ganzen Serrano-Schinken, einen Hartkäse aus Ziegenmilch, eine Salami, Tomaten, Oliven, Olivenöl und ein Baguette auf die Terrasse und aß zu Abend. Er setzte sich so an den Tisch, dass er die Berge und die untergehende Sonne sehen konnte.
Die Grillen waren wie auf Kommando verstummt, um gleich danach mit ihrem Konzert fortzufahren. Sie saßen zu dieser Jahreszeit zu Hunderten in der Bambushecke, die am Ufer eines Regenwasserkanals Pauls Grundstück in nördlicher Richtung begrenzte. Jeder noch so kleine Luftzug erzeugte ein sanftes Rauschen in den Bambusstangen. Die älteren Nachbarn sagten, dass der Bambus Geschichten erzählen könne.
2. Kapitel
Dringende Bankgeschäfte zwangen Paul, in den nahegelegenen Ort St. Génis zu fahren. Nach seinem Bankbesuch war es bereits nach zwölf Uhr, sodass es keinen Sinn mehr machte, noch den Lebensmittelhändler im oberen Teil der Kleinstadt aufzusuchen.
Er wusste, dass im Süden Frankreichs alle Geschäfte von zwölf bis vierzehn Uhr geschlossen haben. Ausgenommen die großen Supermärkte, die es aber hier nicht gab.
Deshalb entschloss er sich, im Restaurant „Le Carrefour“ zu Mittag zu essen. Auf dem Weg dorthin fiel ihm wieder ein, wie er dieses Restaurant kennengelernt hatte.
Nachdem er ins Roussillon gezogen war, glaubte er, wie jeder Tourist oder Neuankömmling, dass man in einem Restaurant am besten auf der Straßenterrasse sitzt, um seine Mahlzeit einzunehmen.
Also ging er in das „Le Carrefour“ und setzte sich vor dem Restaurant auf einen der unbequemen und wackeligen Plastikstühle, bestellte nach der Karte das Essen sowie eine Flasche Côtes du Roussillon und eine Karaffe Wasser.
Die Pastete gab es in Form von zwei Scheibchen auf einem kleinen Teller. Das Fleisch des Hauptganges war hart und nicht mehr richtig heiß. Dafür musste er einen ordentlichen Preis zahlen und rechnete sich aus, dass er nicht oft so essen gehen könne.
Trotzdem wiederholte er diese Besuche in unregelmäßigen Abständen. Nach ungefähr zwei Wochen fragte der Wirt, ein kleiner dicker Mann mit viel zu kurzen Hosen, Hosenträgern und einem karierten Hemd, ob er denn seine Mahlzeit nicht im Restaurant einnehmen und die „plat de jour“ bestellen wolle.
Hocherfreut willigte er ein und wurde neben dem Billardtisch in der Nähe der Toilette platziert.
Als „plat de jour“ gab es drei Hauptgerichte zur Auswahl. Die Pastete wurde ihm in einer großen Tonschüssel gereicht. Allerdings war kaum noch etwas an Pastete, die er sich aus der Schüssel kratzen konnte, vorhanden. Der Rotwein, ebenfalls ein Côtes du Roussillon, wurde ohne besondere Bestellung als offener Wein in einem Tonkrug gereicht. Nur das Dessert war portioniert. Zu seiner größten Überraschung war das Menü auch noch finanziell erschwinglich.
Auf der Terrasse vor dem Restaurant hatte er zwischen Touristen gesessen, jetzt waren seine Tischnachbarn Franzosen. So ging das wiederum zwei Wochen lang. Danach fragte ihn der Wirt nach seinem Namen und ob er hier länger bleiben würde.
„Ich habe das Mas Ferrol gekauft und bleibe hier“, sagte Paul.
„Nein Monsieur, das ist eine Ruine! Was haben sie damit vor?“
„Nichts Besonderes. Ich will das Mas renovieren und darin wohnen“, antwortete er.
„Sie haben Mut, das muss man ihnen lassen. Der letzte Eigentümer war überall bekannt und konnte viel trinken.“
„Das habe ich auch schon gehört und bemerkt. Es gibt viele leere Flaschen.“
„Ich wünsche ihnen jedenfalls viel Glück und Erfolg“, sagte der Wirt schrie in die Küche: „Bernadette, hör mal, unser neuer Gast, Monsieur Paul, hat das Mas Ferrol gekauft und will es wieder bewohnbar machen.“
Aus der Küche kamen nur unverständliche Laute und damit war die Angelegenheit zunächst erledigt.
Als er das nächste Mal ins „Le Carrefour“ kam, begrüßte ihn der Wirt mit „monsieur Paul“ und „ça va“, und wies ihm einen Platz am hinteren langen Tisch zu. Der Wirt zählte die Varianten der „plat de jour“ auf und fragte, was er essen wolle. Der Wein war nicht mehr portioniert, die Pastete kam in einer frischen und vollen Schüssel und das Fleisch wurde erst gebraten, nachdem der Wirt es in der Küche abrief. Der Preis allerdings hatte sich nicht mehr geändert. Nur die Mengen waren größer geworden und er konnte so viel Wein trinken, wie er wollte.
An diesem langen Tisch im hinteren Teil des Restaurants saßen die Einwohner von St. Génis. Sie kamen, setzten sich, ohne zu fragen auf die freien Plätze und fingen an zu schwatzen.
Erst jetzt gehörte er dazu und war einer von ihnen. Jedermann grüßte ihn und fragte das übliche „ça va“. Der Wirt erfragte den Fortschritt seiner Renovierungsarbeiten und die anderen Einwohner waren danach ebenso informiert.
An einem Samstag kam ein älterer, ergrauter Herr an den langen Tisch im „Le Carrefour“ und setzt sich neben Paul.
„Pardon, ich heiße Henri. Ich habe gehört, sie sind Deutscher und haben das Mas Ferrol gekauft. Bitte betrachten sie mich nicht als aufdringlich. In der Schule habe ich die deutsche Sprache gelernt. Ich würde mich erfreuen, wenn ich bei sie überprüfen könnte, ob ich diese Sprache noch beherrsche.“
Aus dieser ersten Begegnung war eine besondere Freundschaft geworden.
3. Kapitel
Wenn es nicht den berühmten Türsturz über dem Westportal der Kirche gäbe, würde St. Génis in keinem Reiseführer erwähnt werden. Es ist eine typische südfranzösische Kleinstadt mit einer Durchgangsstraße und dem alten Ortskern leicht bergauf. Dahinter kommt ein Neubaugebiet.
Von der Durchgangsstraße biegt man am Brunnen vor der „Crédit Agricole“ ab und ist sofort an der Kirche. Heute ist es die Gemeindekirche „Saint-Michel“. Früher war es ein Benediktinerkloster, das 1507 dem Kloster Montserrats angegliedert wurde.
Der berühmte Türsturz datiert von 1019 und stellt Christus mit einer perlengeschmückten Mandorla dar. Getragen wird er von zwei Erzengeln. Neben den Erzengeln befinden sich je drei Apostel.
Der Kreuzgang ist ein solcher wie jeder andere. Auch dem Kircheninneren kann man keine Besonderheit bescheinigen, obwohl viele Bildungstouristen fast in Ekstase geraten, wenn sie alles besichtigen.
Henri und Paul hatten gemeinsam im „Le Carrefour“ zu Mittag gegessen. Auf dem Weg zu ihren Autos, die auf dem oberen Parkplatz hinter dem „Syndicat d`Initiative“ abgestellt waren, kamen sie an der Kirche „Saint-Michel“ vorbei. Auf der Portalseite stehen riesige Platanen, die in der Nachmittagshitze angenehmen Schatten spendeten. Neben dem Eingangsportal lehnte an der Wand eine Metallbank, die unbesetzt war. Weil sie sich noch etwas unterhalten wollten, setzten sie sich.
„Warum ist Jesus auf diesem Türsturz nur mit sechs Aposteln dargestellt?“, fragte Paul.
„Beantworten kann ich ihnen diese Frage nicht mit Sicherheit. Ein Apostel ist im Verständnis der christlichen Tradition jemand, der direkt von Jesus als „Gesandter“ beauftragt worden ist.
Später, ich glaube nach dem 8. Jahrhundert, wurden in der katholischen und in der orthodoxen Kirche auch die Bischöfe als Apostel bezeichnet. Jesus wurde allerdings bis zum 11. Jahrhundert meist mit nur sechs Aposteln dargestellt. Wenn man bedenkt, dass dieser Türsturz aus dem Jahre 1019 datiert, könnte dies eine Erklärung sein“, sagte Henri.
Bevor sie sich weiter über den Türsturz, die Apostel und katholische Bischöfe unterhalten konnten, legte sich ein Straßenköter zwischen ihre Beine. Obwohl der Hund ungepflegt aussah, stank er nicht.
Paul sagte etwas gedankenverloren: „Überall in den südlichen Ländern laufen immer irgendwo Hunde herum, meist in Rudeln. Ein Bellen hört man nur selten und die Köter sind friedlich. Wenn ich jedoch an Deutschland denke, erinnere ich mich, dass die Hunde fast immer angeleint sind und bei einer Begegnung mit anderen Artgenossen regelmäßig aggressiv werden. Die Hundehalter haben ihre Mühe, ihre braven Lieblinge zu bändigen. Hier im Süden stört sich niemand an diesen Tieren. Ich glaube, sie werden als Mitgeschöpfe so toleriert, wie sie sind.“
„Das sehen sie richtig“, antwortete Henri und kraulte dem Hund den Kopf.
Plötzlich kam ein Tourist, offenbar ein Engländer, auf den Platz. Typische Sandalen mit Socken, kurze Safarihosen und das entsprechende Hemd. Auch der Hut passte zu diesem Mann. Etwas unbeholfen stellte er eine große Reisetasche ab. Ganz professionell suchte er den richtigen Standort für sein Stativ, das er sorgfältig entfaltete und darauf einen Fotoapparat befestigte. Mit einem Gerät maß er offenbar die Lichtverhältnisse.
Jetzt holte er einen Reiseführer aus der Tasche, blätterte darin und las etwas. Er richtete den Fotoapparat auf den Türsturz und drückte mehrmals ab.
Henri erinnerte ihn noch an die Grabplatten an den Seiten der Türen. Offenbar stand aber darüber nichts in seinem Reiseführer und er ließ sie unbeachtet.
Daraufhin sagte Paul zu dem Engländer: „Wissen sie, dass der Türsturz am Eingang der Kirche in Saint André, das ist der nächste Ort in Richtung Strand, noch viel wertvoller ist, als dieser hier. Das wissen aber nur Eingeweihte und nicht alle Touristen.“
„Was erzählen sie denn da für einen Unfug?“, fragte ihn Henri.
„Das ist doch nur ein englischer Tourist, der ohnehin keine Ahnung hat. Der erzählt bestimmt zu Hause von diesem Tipp.“
„Das glaube ich nicht, denn die Grabplatten haben ihn auch nicht interessiert, weil sie nicht in seinem Reiseführer erwähnt waren. Es ist zwar richtig, dass diese kleine vorromanische Kirche in St. André zu den bedeutenden Monumenten Frankreichs aus dem 10. /11. Jahrhundert gerechnet wird. Aber der Türsturz ist kulturhistorisch nichts Besonderes“, erwiderte Henri.
Weil sie deutsch sprachen, verstand der Engländer sie offenbar nicht. Denn er fragte, ob sie sich auf der Bank so hinsetzen könnten, dass sie mit auf dem Bild seien.
Henri wollte diese Bitte gerade abschlagen, als der Straßenköter in die Reisetasche des Engländers einen dicken Haufen setzte.
„Können sie denn nicht auf Ihren Hund besser aufpassen!“, schrie der Engländer und jagte den Straßenköter weg.
„Ist nichts Schlimmes passiert“, erwiderte Henri.
„Doch! Dieses widerliche Vieh hat in meine Reistasche geschissen.“
„So?“, sagte Henri und ging zur Reisetasche.
„Tatsächlich, das Zeug ist noch warm und stinkt entsetzlich.“
„Wer entfernt jetzt das Zeug aus meiner Tasche?“
„Kein Problem!“, erwiderte Henri und griff in die Tasche. Als er seine Hand herausnahm, hielt er darin den Hundehaufen. Er wandte sich dem englischen Touristen zu, gab ihm die Hand, in der er den Hundehaufen hielt, und sagte: „Nichts für Ungut, Mister. Das kann schon mal passieren und ist nur hündisch.“
Der Fotograf nahm tatsächlich die ihm entgegen gestreckte Hand und griff zu, als wollte er die Entschuldigung annehmen. Nachdem er das Unheil bemerkt hatte, musste er sich übergeben und wischte auch noch die kotverschmutzte Hand an seiner Hose ab.
„Paul wissen sie, wessen Hund das ist?“
„Nein, aber der englische Gentleman soll seinen Fotoapparat und die Tasche nicht vergessen.“
4. Kapitel
Die Renovation des Mas Ferrol war so gut wie abgeschlossen. Paul hatte nicht nur neue Gartenmöbel gekauft, sondern auch vom örtlichen Schreiner catalanische Möbel anfertigen lassen. Es gab zwar keinen wirklichen rechten Winkel in seinem Mas, er war aber zufrieden und Henri war voll des echten Lobes und freute sich besonders über das Lavendelblau der Fenster und Türen.
„Offenbar muss mein neuer Freund Paul ein besonderes Verhältnis zur Farbe Blau haben“, dachte er sich, ohne ihn auf seine Vermutung anzusprechen.
Paul erinnerte sich wieder daran, dass ihm am Anfang seiner Renovierungsarbeiten sogar einmal der Verkauf von Baumaterial mit der Bemerkung verweigert worden war, dass man an Deutsche nichts verkaufen würde.
Er führte diese Verweigerung auf sein nicht perfektes Französisch zurück und kaufte das Material in einem anderen Geschäft.
Danach kaufte er - wie jeder Franzose - hier im Süden ein. Paul lernte schnell, dass es bei Geschäften im Süden von Frankreich nicht üblich ist, sofort über den Preis zu sprechen. Dieses Thema wird erst zum Schluss angesprochen.
Er stellte aber auch fest, dass dies für einen Fremden, zumal einen Deutschen, etwas gewöhnungsbedürftig ist; wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es nur schön und angenehm. Irgendwann erhält man eine Rechnung, die ohne intensive Kontrolle bezahlt wird.
„Die eigenen Leute betrügt man nicht!“, sagen hier die Leute.
Nur hier im Süden kann man verstehen, dass Eile nicht das Gleiche wie Ungeduld ist, stellte er ebenfalls bald fest.
Paul hatte auch schnell begriffen, dass „demain“, oder „maniana“, wie die Catalanen in Spanien sagen, genau übersetzt „morgen“ bedeutet, man aber sagen will: „Ich kann es nicht sofort erledigen, es geht erst später.“
Im nahe gelegenen spanischen Empuriabrava hatte Paul einmal zufällig mitbekommen, wie ein deutscher Ferienhausbesitzer einen spanischen Handwerker mit den Worten verabschiedete: „Aber nicht spanisch maniana, sondern deutsches maniana, klar!“
Nach Wochen hat er ihn wieder getroffen und gefragt, ob der Handwerker tätig geworden sei.
„Ach, was meinst du denn! Das war eine richtige faule spanische Sau. Als ich nachgefragt habe, wusste der gar nicht mehr, dass er von mir einen Auftrag erhalten hatte.“
Ergänzend fügte dieser Bekannte hinzu: „Wenn du hier nicht immer hinterher bist, wird gar nichts. Am besten man beauftragt die wenigen deutschen Handwerker, die sich hier niedergelassen haben. Aber die beschäftigen meist Portugiesen und die sind noch fauler.“
Henri und Paul sahen sich jetzt öfter, gingen zusammen essen, machten sich über die Touristen lustig, alberten mit den Dorfkindern herum und unterhielten sich intensiv über Religion und Politik.
Henri besaß oben in den Albères, so nennt man die Ausläufer der Pyrenäen zum Mittelmeer hin, ein Mas. Es war in den Felsen hineingebaut und lag so am Hang, dass man nur auf der Terrasse sitzen konnte, weil es sonst keine begehbare Grundstücksfläche gab.
Er war damit zufrieden und sagte stets, dass man nicht mehr brauche, um glücklich zu sein.
Die Wohnfläche war nicht besonders groß. Das hintere Zimmer befand sich im Berg, hatte keine Fenster und wies fast das ganze Jahr die gleiche Temperatur auf. Vor diesem Felsenzimmer lagen das Bad, die Küche und ein Schlaf- und Essraum. Die Wände dieses Raumes waren vollgestopft mit Büchern, sodass man kein freies Stück Wand sah.
Im Sommer lebte Henri auf der Terrasse. Allerdings war das Dach nicht dicht und er sagte: „Mein Dach ist inkontinent, aber die Sonne bescheint lange diese Fläche. Schade, dass es keinen belle vue gibt. Man blickt unmittelbar auf einen bewaldeten Berghang. Dafür ist es absolut ruhig. Man hört keine, von Menschen herrührenden Geräusche; nur die der Natur.“
Man kann dieses Haus über einen steilen Feldweg erreichen. Es verfügte über einen Stromanschluss, jedoch keine öffentliche Wasserleitung. Aber auch das störte Henri nicht, weil er sein Trinkwasser aus einer Bergquelle bezog. Eine Telefonleitung führte einmal neben der Stromleitung zum Haus. Irgendwann war sie gerissen und er hat sie nie reparieren lassen. Er benutzte ein Handy, ein portable, wie man in Frankreich sagt. Auf einen Internetanschluss legte er keinen Wert. Nur auf den Fernseher wollte er nicht verzichten.
„Ich habe meine Bücher, das reicht mir. Ich will - außer für meine engsten Freunde - auch für niemand mehr erreichbar sein. Nur im Winter wird es manchmal kritisch. Aber so schnell verhungert man nicht.“
Für heute hatte Henri zum Barbecue eingeladen. Es gab wie immer gegrillte Hühnerbeine und als Vorspeise Tomaten auf geröstetem Brot und Olivenöl. Danach servierte er Ziegenkäse aus den Bergen und viel Rotwein.
„Warum sind sie Priester geworden?“, frage Paul während des Essens.
„Man kann eine solche Frage nicht einfach so beantworten. Jedoch in meinem Falle ist eine kurze Antwort möglich; zumal ich sie ihnen, lieber Freund, gebe.“
Paul war nach dieser Ankündigung gespannt, weil er wusste, dass Henri vom Amt des Priesters dispensiert worden war.
„Ein Jahr vor dem Abitur war ich unsterblich in eine Mitschülerin verliebt. Wochenlang gab sie mir das Gefühl, dass auch sie etwas für mich empfindet. So richtig wusste ich nicht, was ich ihr sagen oder was ich mit ihr anstellen sollte. Eines Tages sah ich sie mit einem anderen Jungen im Park beim Austausch von Zärtlichkeiten. Wie sie sicherlich verstehen werden, brach für mich die Welt zusammen. Meine schulischen Leistungen ließen nach und niemand konnte mit mir etwas anfangen. Eines Tages lief ich unserem uralten Priester über den Weg. Seit der Ministrantenzeit hatte ich mich bei ihm nicht mehr sehen lassen. Er erkannte mich sofort und fragte nach dem Grund meines schulischen Abgleitens. Weil ich auf seine Frage nicht recht antworten konnte, flüchtete ich mich in eine Ausrede. Ich wolle in ein Kloster gehen, weil ich die Welt - so wie sie ist - nicht mehr verstehen würde. Von meinem Liebeskummer habe ich ihm nichts erzählt. Ich hielt das für überflüssig, weil ich annahm, dass er in seinem Alter und als Priester ohnehin nicht wüsste, was das ist.
Zwei Tage später traf ich ihn erneut und er erklärte mir, dass mein Seelenzustand ein Zeichen Gottes sei. Gott habe mich auserkoren, Priester zu werden. Irgendwann hatte ich in der Schule erzählt, dass ich Philosophie studieren wollte. Dies muss unser alter Priester ebenfalls erfahren haben. Denn er erklärte mir sofort, dass er bereits mit dem Bischof gesprochen habe und ein Platz im Priesterseminar für mich freigehalten würde. Ein Studienplatz in Philosophie und Theologie sei ebenfalls kein Problem. Nach dem ersten Schreck über diese Neuigkeiten sagte ich ihm, dass ich darüber nachdenken wolle.
Nach dem Abitur, das ich mehr recht als schlecht bestanden hatte, wusste ich nicht, was, wo und wie ich studieren sollte. Da fiel mir unser alter Priester wieder ein und ich dachte mir, dass ich auf diese Art zum Philosophiestudium zuglassen werden könnte.
Mit Priesters und Bischofs Hilfe studierte ich Philosophie und Theologie. Außerdem trat ich in das nächste Priesterseminar ein und wurde dort fit für das Priesteramt gemacht. Heute würde man vielleicht von Gehirnwäsche sprechen. So war es aber auch wieder nicht. Zumindest habe ich damals nichts davon bemerkt. Bereits während der Praktika bekam ich manchmal Zweifel, ob ich alles richtiggemacht hätte. Doch mich reizte die feierliche Priesterweihe. Zeit für eine Freundin gab es ohnehin nicht, sodass ich auch mit dem Zölibat keine Probleme hatte. So wurde ich Priester.“
Er fügte aber sofort hinzu, dass diese Kurzfassung etwas sehr kurz geraten sei.
„Und warum sind sie Richter geworden?“
„Sie werden es kaum glauben, aber auch meine Geschichte ist ähnlich. Vorsorglich muss ich vorausschicken, dass Deutschland bis 1989 aus zwei Teilen bestand. Ein Teil, die Bundesrepublik, war der westliche demokratische Teil. Im Osten gab es den kommunistischen Staat DDR. Ich wurde in Dresden, also im kommunistischen Teil Deutschlands, geboren und habe dort auch Abitur gemacht.
Wegen meiner politischen Einstellung durfte ich aber nicht studieren, sodass ich Kellner wurde. Wie viele meiner Kollegen habe ich die Gäste betrogen und mich mit krummen Geschäften über Wasser gehalten. Im Jahre 1966 gelang mir die Flucht in den Westen. Weil mein ostdeutsches Abitur nicht anerkannt wurde, musste ich erneut in die Schule und das westdeutsche Abitur nachholen. Danach wusste auch ich nicht, was ich studieren sollte. Ein Freund sagte mir, dass er Jura studieren werde. Obwohl ich gar nicht wusste, was das war, habe ich auch Jura studiert. Meine Examensnoten reichten für das Richteramt aus und so wurde ich Richter. Mein Freund, der mich zu diesem Studium verleitet hatte, wurde Advokat.“
„Über ihre Flucht müssen sie mir unbedingt ein andermal erzählen“, sagte Henri.
Der Abend war lang geworden und Paul hatte Mühe nach Hause zu kommen.
5. Kapitel
Obwohl es Juli war, regnete es schon den dritten Tag, was hier im Roussillon ungewöhnlich ist. Dies war auch der Grund, warum es im „Le Carrefour“ so voll war.
Die Touristen mussten notgedrungen im Restaurant sitzen und auf ihre geliebte Terrasse verzichten. Der Wirt hatte richtig Mühe, alle Gäste unterzubringen. Nur der lange hintere Tisch war für Fremde tabu, darauf achtete er. An solchen Tagen fühlten sich auch die Einheimischen in den Restaurants nicht richtig wohl und blieben nur kurze Zeit.
Paul hatte sich mit Henri zum Essen im „Le Carrefour“ verabredet und Henri erzählte gerade, dass er in einer Zeitung einen hochinteressanten Artikel über die Zukunft des Finanzkapitalismus gelesen habe, und dass man darüber einmal ausführlich diskutieren müsse, als sich ein junges Pärchen direkt neben die beiden an den hinteren Tisch setzte.
Der Wirt hatte sie nicht eingewiesen. Sie setzten sich auf zwei freie Stühle. Die Antwort auf die Frage, ob hier noch frei wäre, beantwortete Henri zwar mit einem „Nein“. Offenbar hatten sie diese Antwort aber nicht verstanden. Beide sprachen englisch miteinander. Auch die Aufforderung des Wirtes den Platz zu räumen, schienen sie nicht zu verstehen, sodass sich alle in ihr Schicksal fügten.
Der junge Mann war typisch gekleidet; geschlossene Halbschuhe, weiße Strümpfe, Jeans und ein langärmeliges Hemd. Die junge Frau trug ein blaues Sommerkleid.
Paul schaute wie versteinert die junge Frau an und wurde blass. Er schien mit seinen Gedanken in einer anderen Welt zu sein.
Nach kurzer Zeit sagte er: „Nein, sie war nicht blond.“
Henri fragte, ob es ihm nicht gut gehen würde.
Paul antwortete nur leise und so, als würde er mit sich selbst reden, dass alles in Ordnung sei, und fügte hinzu: „Sie hatte schwarzes Haar.“
Da sich der Wirt nicht um die jungen Leute kümmerte, schauten sie sich Hilfe suchend um. Plötzlich stand der junge Mann auf und holte sich vom Buffet eine Speisekarte und gab sie seiner Begleiterin.
Die junge Frau versuchte lange, die Karte zu lesen und gab es schließlich auf. Sie erklärte ihm, dass man die Bedienung fragen müsse.
Als der Wirt sich schließlich erbarmte, die beiden nach ihren Wünschen zu fragen, war das Chaos perfekt.
Der Wirt wollte die beiden nicht verstehen und die jungen Leute hatten Mühe mit der französischen Sprache.
Plötzlich wandte sich die junge Frau an Paul und sagte: „Ich habe gerade gehört, dass sie deutsch sprechen.“
Offenbar hatten Paul und Henri bei ihrer Unterhaltung die Sprache gewechselt, was öfter vorkam.
Henri sah die junge Frau an und behauptete, kein Deutsch zu sprechen. Es könne sich nur um ein Missverständnis handeln.
Paul hingegen tat die junge Frau leid. Er starrte immer noch auf ihr blaues Kleid und bestätigte ihr noch leicht verwirrt, deutsch zu sprechen.
„Gott sei Dank. Wissen sie, ich habe geglaubt, mit meinem Schulfranzösisch durchzukommen. Niemand versteht mich. Ich bin schon ganz verzweifelt. Mein Freund ist Engländer und spricht nur englisch, weil er der Auffassung ist, dass überall englisch gesprochen und verstanden würde. Ihn versteht erst recht niemand. Unser Urlaub ist eine einzige Katastrophe“, sagte die junge Frau.
„Am Strand und auf der Touristenmeile braucht man kein Französisch“, warf Henri auf Englisch ein.
„Aber dort gibt es nur Pizza und Fast Food“, erwiderte sie und er antwortete auf Französisch: „Das reicht für Ausländer aus. Außerdem gibt’s auch noch Bier.“
„Und heute wollen sie einmal richtig französisch essen?“, fragte Paul die junge Frau.
„Ja, und wenn sie uns helfen könnten, wären wir ihnen dankbar“, antwortete sie.
„Was soll man da helfen. Der Engländer isst ohnehin Beefsteak mit Fritten, weil es in Frankreich keine Fish and Chips gibt“, lästerte Henri auf Französisch.
„Aber dem Mädchen können wir helfen“, ergänzte er noch.
„Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, gehe ich einmal davon aus, dass ihre Urlaubskasse nicht zu üppig ist“, begann Paul seine Hilfe.
„Das trifft zu, wir machen die ersten Ferien nach dem Abitur.“
„Nehmen sie die „plat de jour“. Heute gibt es einen vorzüglichen Lammspieß mit weißen Bohnen und als Vorspeise empfehle ich ihnen Schnecken auf katalanische Art oder einen Schinkentoast nach Art des Hauses“, schlug Paul vor.
Die junge Frau übersetzte seinen Vorschlag ihrem Freund, der sofort den Gesichtsausdruck wechselte.
„Und noch einen guten Rat! Beginnen sie jedes Gespräch mit dem Zaubersatz, dass sie sich dafür entschuldigen, dass sie als Ausländerin nur wenig französisch sprechen. Wenn langsam gesprochen würde, hätten sie weniger Probleme. Sie werden sehen, dieser Satz bewirkt Wunder“, ergänzte er noch.
Die junge Frau errötete leicht und wartete auf den Wirt, der offenbar gesehen hatte, dass Paul sich mit den jungen Ausländern unterhielt.
Die junge Frau fing das Gespräch mit dem Wirt unter Benutzung des „Zaubersatzes“ an.
„Sie sprechen recht gut französisch“, entgegnete der Wirt und empfahl ihr den Lammspieß. Sie entschied sich für den Spieß und die Schnecken.
Danach fragte der Wirt den jungen Mann. Wie Henri vorhergesehen hatte, bestellt er auf Englisch Beefsteak mit Fritten ohne Vorspeise.
Man merkte, dass der Wirt ihn verstanden hatte. Trotzdem musste die junge Frau übersetzen.
Es kam die Sprache auf die Getränke. Fragend schaute die junge Frau Paul an und er flüsterte ihr zu: „Muskat und Rotwein des Hauses.“ Der junge Mann bestellt selbstverständlich Bier.
Bevor Paul noch erklären konnte, dass man Flaschenbier als Hauptgetränk bestellen müsse, weil man sonst ein pression bekäme, das man hier als Aperitif trinke, war der Wirt schon weg und brachte pression.
Die junge Frau war von dem Essen begeistert. Der Engländer hingegen konnte offenbar nicht hinsehen, wie sie die Schnecken aß. Sein Beefsteak sah irgendwie traurig aus, aber er fand es offenbar recht schmackhaft.
Nach dem Essen wandte sich Paul nochmals an die junge Frau und fragte, wie es ihr geschmeckt habe.
„Ausgezeichnet, das war ein toller Rat!“
„Ich habe noch einen Tipp für sie. Sagen sie auch dem Wirt, dass es ihnen geschmeckt hat. Und wenn sie wieder einmal außerhalb von Deutschland ein Restaurant betreten, warten sie, bis man ihnen einen Platz zuweist.“
Die junge Frau errötete erneut und übersetzte ins Englische.
„Soweit kommt es noch. Ich mache hier Urlaub. Da muss ich mich nicht auch noch verbiegen“, antwortete der Engländer.
Die junge Frau merkte, dass beide ihren Freund verstanden hatten und war erneut peinlich berührt.
Jetzt sagte Henri auf Deutsch: „Ich habe auch noch einen Tipp für sie. Wenn man in ein anderes Land kommt, kann man es am besten kennenlernen, wenn man sich nach Landessitte durchisst und durchtrinkt. Dies zu ignorieren ist ein arrogantes Desinteresse.“ Und auf Französisch fügte er noch hinzu: „Und wenn es geht, meiden sie die Engländer.“
Den letzten Satz hatte die junge Frau offenbar verstanden.
„Er ist ein Schulfreund. Und ich glaube, nach dem Urlaub mein Exfreund.“
Jetzt kam Henri auf den Artikel über den Finanzkapitalismus, den er in der Zeitung gelesen hatte, zurück.
„Heute habe ich zwar keine Lust mehr, tiefgründige gesellschaftspolitische Unterhaltungen zu führen. Nur einen Passus muss ich ihnen mitteilen. Sinngemäß stand zu lesen, dass es der Kapitalismus gewesen sei, der die Menschen aus der Sklavenhalterwelt Oliver Twists befreit habe. Der Finanzkapitalismus hätte es den Menschen ermöglicht, sich aus langweiliger, ermüdender oder beschwerlicher Arbeit zu befreien und sich fortan geistig anspruchsvollen Tätigkeiten zuzuwenden. Wenn ich mir den jungen Engländer ansehe, stimmt das Fazit des Kolumnisten aber nicht.“