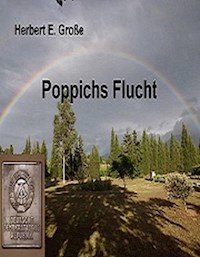
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Poppich - eigentlich Paul Thiele - arbeitet 1965/66 als Kellner in einem Interhotel in der DDR. Anfangs erfährt man auf recht amüsante Art und Weise etwas über die Sonderstellung dieser "DDR-Nobelhotels", die Beschäftigten und die "besonderen Gäste" dieser Häuser. Zusammen mit zwei weiteren Kellnern und drei Köchen aus anderen Interhotels wird Poppich1966 als "Repräsentant des Arbeiter- und Bauerstaates" zur "Weiterbildung" nach Bulgarien abgeordnet. Von den sechs "Repräsentanten" fliehen nach und nach fünf in den Westen. Poppich flieht als letzter. Was er bei der Flucht erlebt und erleidet, ist voller Spannung und Dramatik. Der Autor hat dieses bereits im November 2012 erstmals erschienen E-Book überarbeitet und marginale Änderungen vorgenommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kleine Vorbemerkung des Autors
Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen von fünf Fluchten aus der DDR erzählen.
Aber es sind keine Heldengeschichten. Denn Helden sind nur diejenigen, die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen.
DDR-Flüchtlinge hingegen waren nur mutige Egoisten. Sie haben ihr Leben aus Eigennutz riskiert.
Erzählt haben sie von ihrer Flucht selten, denn dann hätten sie Nachahmer gefährdet.
Außerdem waren sie Straftäter.
Für die DDR-Justiz waren sie als Republikflüchtlinge Verbrecher und gehörten für mehrere Jahre ins Zuchthaus Bautzen II oder ins Frauenzuchthaus Hohenschönhausen.
Im Westen waren sie, wenn sie nicht direkt die innerdeutsche Grenze, die Mauer, überwunden haben, auch Grenzverletzer. Sie hatten jedoch einen Rechtfertigungsgrund für ihre Tat.
Auf jeden Fall hatten sie Zivilcourage - und das nicht zu wenig.
Ich kann dem Leser aber versichern, dass sich die Fluchten tatsächlich so ereignet haben, wie ich sie Ihnen schildern werde. Nur die Namen habe ich geändert.
Und noch eines sei Ihnen, dem geneigten Lesern, versichert: Jede Flucht hatte ihre eigene Tragik und wäre es wert, ausführlich geschildert zu werden.
Doch ich will Ihnen nur von einem Flüchtling und seiner Flucht ausführlich erzählen. Nennen wir ihn Paul Thiele oder - wie seine Kollegen ihn nannten - Paul Poppich.
Nach dem ersten Erscheinen dieses E-Books am 27. November 2012 habe ich einige marginale Änderungen vorgenommen. Paul Thiele (Poppich) war damit einverstanden.
Herbert E. Große
1. Kapitel
„Na, Poppich, Interesse an Bulgarien?“
Paul drehte sich um und sah den Restaurantchef Weser, den er schon an der Stimme erkannte. Bevor er etwas sagen konnte, sprach der Restaurantchef weiter: „Ich habe sie beobachtet. Wenn sie wollen, empfehle ich sie.“
„Ich habe noch nie einen Witz aus ihrem Munde gehört, Herr Weser.“
„Überlegen sie es sich.“
Paul, den alle nur Poppich nannten, blieb noch einen Augenblick vor dem Schwarzen Brett mit dem Hinweis, dass Kellner und Köche für einen Einsatz in Bulgarien gesucht werden, stehen und begann seine Arbeit im Restaurant. Er hatte Bulgarien bald vergessen und dachte erst wieder an den Aushang, als er kurz vor dem Einschlafen war.
Warum mag dieser alte Mann mich?
Er hat schon in allen großen Häusern in Europa gearbeitet. Alle Kollegen haben nur Hochachtung vor ihm und trauen sich nicht, ihn anzusprechen. Immer schicken sie mich vor, und ich muss mit ihm sprechen oder ihn etwas fragen, überlegte Paul.
Paul Thiele schlief bald ein. Morgen war sein freier Tag, und danach ging es in die Frühschicht.
Er genoss seinen freien Tag, seinen Ruhetag. Erst am späten Vormittag stand er auf. Zunächst flanierte er durch die Stadt. Es war schön zu sehen, dass alle Leute arbeiten mussten und in ihrem grauen Alltag versanken. Paul dagegen fühlte sich gut. Es war heute etwas Besonderes, weil er sich in der Bäckerei ein Brötchen kaufen und dieses auf der Straße essen konnte.
Danach trank er in einer Art Caféhaus ein Kännchen Kaffee; in Magdeburg sagt man: „eine Portion“.
Hier fühlte er sich wohl. Es roch anders als in anderen Gaststätten. Das Linoleum wölbte sich an einigen Stellen. Paul staunte immer wieder, wie die Kellnerinnen es schafften, über diese Holperpiste elegant zu schweben. Die Tische hatten den typischen braunen Sprelacartbelag, der an einigen Stellen abgeblättert war. Tischdecken gab es nicht. Nur unter den Aschenbechern befand sich eine Serviette. Und auf jedem Tisch stand eine kleine Vase mit einer Blume.
Paul aber setzte sich hinter eine Art spanische Wand. Hier gab es zwei Tische mit weißen Tischdecken, und die Stühle hatten Kissen. Die Bedienungen nannten es den „Personalraum“. Damit war für jedermann klar, dass normale Gäste hier keinen Zutritt hatten.Es dauerte einige Zeit, bis er seinen Kaffee bekam.
Für ihn wurde der Kaffee noch nach Oma-Art im Hinterzimmer richtig gefiltert. Paul liebte diesen Geruch des Filterkaffees. Er erinnerte ihn an zu Hause.
Meist servierte man ihm auch selbstgemachten Kuchen, den das Bedienungspersonal zu Hause buk und mit in das Café brachte. Der Kuchen und die Torten aus der Zentralbäckerei schmeckten nur, wenn man Hunger hatte.
Hier wurde er verwöhnt. Als Gegenleistung brachte er aus dem Intershop immer eine kleine Schokoladenleckerei oder auf Bestellung Perlonstrümpfe mit.
Als der Kaffee serviert wurde, sagte die Bedienung: „Ach, der Herr Poppich (auch hier kannte man Paul nur, als den Herrn Poppich) hat heute frei. Sie haben es gut. Wir müssen arbeiten.“
„Und was muss ich, wenn sie Ruhetag haben?", fragte er zurück.
„Das ist doch etwas anderes. Sie arbeiten in diesem großen Nobelhotel, und wir plagen uns in dieser Klitsche. Nie wissen wir, ob wir auch genug Kaffeepulver geliefert bekommen. Und die Gäste meckern über alles und warten darauf, dass es einmal besser wird, so wie es die Partei immer verspricht. Das macht doch keinen Spaß! Und wenn ein Fremder kommt, spricht kaum jemand, außer über das Wetter“, sagte die Serviererin und fügte hinzu, dass die Gerda heute zusätzlich freihabe und wir sie grüßen sollen, wenn sie gerade heute kämen.
„Ich komme gern zu ihnen. Es ist gemütlich hier. Und dass Gerda heute nicht da ist, finde ich schade. Grüßen sie sie von mir“, sagte Paul.
Als Bezahlung für den Kaffee legte er ein Tütchen Kokosflocken mit Schokoladenüberzug aus dem Intershop auf den Tisch und ging.
In der Straßenbahn, mit der er zur Wäscherei fuhr, beobachtete er die Leute. Besonders heute fiel ihm auf, dass alle irgendwie gleich und blass aussahen. Auch die DDR-Gäste im Hotelrestaurant sahen immer irgendwie uniformiert, hilflos und gehemmt aus. Nur die Leute aus dem Westen verhielten sich anders. Sie sahen auch anders aus.
Paul fand es plötzlich komisch, dass es ihm gerade an diesem Tag auffiel. Doch bevor er weiter seinen Gedanken nachhängen konnte, musste er aussteigen. Das letzte Stück hätte er auch den Bus nehmen können. Aber er hasste es, in so einem stinkenden Bus zu fahren, und ging lieber zu Fuß.
In der Wäscherei gab er seine benutzten Sachen ab, geordnet nach Wolle, Unterzeug und Hemden. Als ihm seine gestärkten, sauberen Frackhemden übergeben wurden, lobte er die Waschfrauen und holte, wie jedes Mal, eine Schachtel Westpralinen aus seiner Tasche.
Die Waschfrauen stürzten sich sofort auf die Pralinen, die gerecht aufgeteilt wurden.
Paul war zufrieden mit sich und der Welt. Wer trug in der DDR schon einen Frack? Nur die Kellner im Interhotel. Herr Weser trug sogar Cut und Stresemannhosen. Die DDR-Bürger dagegen waren stolz auf ihren neuen Dederonanzug, der meistens noch nicht einmal richtig passte.
Das Interhotel war wie ein Kokon. Außen und in der ersten Hälfte des Restaurants war es die typische DDR. Ab der zweiten Hälfte des Restaurants, in der Hotelhalle und in den Konferenzzimmern galten andere Regeln. Paul stellte sich so den Westen vor.
„Hier werden Illusionen verkauft“, sagte Herr Weser stets und fügte hinzu, dass hier der Marxismus keinen Zutritt hätte.
Als er zum Elbufer schlenderte, um auf einer Bank zu entspannen, fiel ihm wieder der Aushang am Schwarzen Brett ein. Bulgarien klingt nach Süden und Urlaub und vor allen Dingen nach Fremde, dachte er sich. Er schloss die Augen und stellte sich vor, wie er mit einem kalten Bier am Strand liegen würde. Doch gerade jetzt fing es leicht zu regnen an und er war wieder im grauen Magdeburg. Es regnete noch den gesamten Tag, und er legte sich für den Rest seines Ruhetags ins Bett.
Schichtwechsel war für Paul immer am Mittwoch. An diesem Mittwoch regnete es richtig kräftig. Das Restaurantgeschäft lief schleppend, und er entschloss sich, wieder einmal im Intershop einzukaufen. Westgeld hatte er mehr als genug. Viele westdeutsche Gäste bezahlten mit DM statt Ostmark, weil ihnen die Umtauscherei zu nervig war. Außerdem waren die Preise selbst im Interhotel so, dass die Westgäste beim Bezahlen mit Westgeld es als billig empfanden.
Alle Kellner waren angehalten, nach dem Kassieren von Westgeld dieses eins zu eins mit entsprechender Quittung bei Frau Markgraf umzutauschen. Die wenigsten Kellner hielten sich daran und tauschten nur zur Wahrung des Scheins geringe Beträge um.
Hilde Markgraf war die Ehefrau vom „großen Chef“ des Hotels.
Das Interhotel Magdeburg war das Banketthaus der DDR-Regierung. Es wurde von einem besonderen Genossen geleitet. Herr Markgraf war nicht unsympathisch. Aber er war kein Hotelkaufmann, sodass Herr Weser das Hotel managte.
Jeder wusste, dass Herr Markgraf ein hoher SED-Bonze und Stasimann war. Man hatte zwar große Angst, aber keinen Respekt, was auch für seine Ehefrau galt.
Nur mit dem Ausgeben des Westgeldes im hoteleigenen Intershop gab es für die Kellner Probleme. Frau Markgraf, die auch den Intershop verwaltete, akzeptierte beim Einkauf pro Kellner und Monat nur 10 DM.
Allein der Poppich machte wieder einmal eine Ausnahme. Als der Geburtstag seiner Mutter nahte, wollte er eine große Flasche 4711 kaufen. Die kostete aber über 15,- DM. Paul hatte zu allem Unglück nur einen 50-DM-Schein, den keiner der Kollegen wechseln konnte oder wollte. Da die Zeit drängte, ging er respektlos in den Intershop.
„Oh, haben sie eine neue Freundin?", fragte Frau Markgraf.
„Nein, nein! Meine Mutter hat Geburtstag und wünscht sich eine Flasche 4711“, antwortete er.
„So einen Sohn möchte ich auch haben.“
In diesem Moment ritt Paul der Teufel, und er setzte alles auf eine Karte. „Liebe Frau Markgraf, darf ich ihnen ebenfalls eine Flasche 4711 schenken?“
Es wurde so still, dass man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können. Frau Markgraf war blass geworden, und Paul wollte gerade etwas zur Entschuldigung stammeln, als Frau Markgraf sagte: „Lieber Poppich! Das finde ich wirklich nett von ihnen. Ich muss das alles verkaufen und darf beziehungsweise kann selbst nichts von all den schönen Dingen erwerben. Wenn sie mir ihr Ehrenwort geben, dass niemand etwas davon erfährt, insbesondere mein Mann nicht, nehme ich ihr Geschenk an. Mir ist bekannt, dass alle Kellner nicht korrekt das Westgeld deklarieren. Auch weiß ich, dass gerade sie viel Westgeld kassieren, weil sie immer zur Bedienung besonderer Gäste eingesetzt werden. Ich habe kein schlechtes Gewissen, diese Kleinigkeit von ihnen anzunehmen.“
Paul war für einen kurzen Moment sprachlos, fing sich aber schnell wieder und sagte:
„Liebe Frau Markgraf, sie haben mein Ehrenwort. Mein Vater war Soldat und hat mir mit auf den Weg gegeben, dass man sich lieber erschießen lässt, als sein Ehrenwort zu brechen.“
Er ließ allerdings unerwähnt, dass sein Vater als überzeugter Nazi das EK I hatte und bis zu seinem Tode im Jahre 1958 bei seiner politischen Überzeugung geblieben war.
Ab diesem denkwürdigen Tag konnte Paul in unbegrenzter Höhe im Intershop einkaufen. Er vergaß aber nie ein kleines Geschenk für Frau Markgraf. So wie er nie die Westpralinen für die Waschfrauen und eine Kleinigkeit für die Bedienung im Café vergaß.
Am folgenden Dienstag verspätete sich Paul um zehn Minuten. Als er ins Hotel kam, schien die Hölle los zu sein.
„Weser sucht sie, und keiner weiß, wo sie sind“, begrüßte ihn ein Kollege.
Mein Gott, wegen zehn Minuten Verspätung kann sich der alte Herr doch nicht so aufregen, dachte er und ging sofort ins Büro des Restaurantchefs.
„Wo stecken sie denn? Hier müssen sie unterschreiben“, sagte Herr Weser zu Paul.
„Was bitte muss ich unterschreiben?“
„Ihren Antrag für Bulgarien.“
„Ich habe doch noch gar keinen gestellt.“
„Eben deshalb. Heute läuft die Antragsfrist für das Jahr 1966 ab, und ihre Unterlagen müssen sofort nach Berlin. Frau Markgraf hat schon den ganzen schriftlichen Kram mit meiner und Herrn Markgraf`s Stellungnahme fertiggemacht. Er hat ihnen die politische Zuverlässigkeit und ich habe ihnen die fachliche Kompetenz bescheinigt."
Paul unterschrieb das Schriftstück, obwohl er in Gedanken gar nicht bei der Sache war.
„Das klappt schon, davon bin ich überzeugt. Aber hängen sie es nicht an die große Glocke. Das gibt unter ihren Kollegen nur böses Blut“, sagte der Restaurantchef und schickte ihn weg.
Die nächsten Tage verliefen wie gewöhnlich. Sobald Paul das Interhotel betrat, verließ er die graue Alltagswelt der DDR und tauchte in eine andere Welt ein.
Es gab unterschiedliche Gäste. Herr Weser platzierte sie entsprechend im Restaurant. Oft bekamen die „Dederongäste" keinen Platz und wurden in den Bierkeller geschickt.
Höhere Parteifunktionäre besetzten die Tische gleich hinter dem Eingang. Besondere Gäste und westliche Ausländer durften am anderen Ende des Restaurants Platz nehmen und wurden sogar noch gefragt, ob der Platz angenehm wäre.
Der Restaurantchef und Paul Thiele betätigten sich für die besonderen DDR-Gäste als „Fluchthelfer". Es war eine stille Absprache zwischen ihnen; beide verstanden sich ohne Worte. Sie verhalfen diesen besonderen Gästen für einen Abend zur Flucht aus dem grauen Alltag der DDR.
Wer als „Flüchtling“ in Betracht kam, entschied Herr Weser am Restauranteingang. Paul Thiele sorgte dafür, dass sich diese Gäste wie in einer anderen Welt fühlten.
Die Regeln der hohen Servierkunst waren nicht gefragt. In einem lockeren Gespräch empfahlen Herr Weser oder Paul einen Hauptgang, der nicht auf der Speisekarte stand, oder einen Wein, den keiner kannte. Allein den Namen des Weines und dessen Herkunft schilderten beide in einer Art, die die Gäste in höchste Verzückung versetzte. Über Preise wurde nicht gesprochen.
Ein in Weißwein und Kräutern der Provence gedünstetes Schweinelendchen und dazu ein weißer Burgunder klang ein bisschen wie Südfrankreich und versetzte die Gäste in stille Träumerei. Wenn Paul noch als Vorspeise einen Langustencocktail empfahl, hörte er von den Gästen nur noch ein genüssliches Luftholen, und sie bestellten, was empfohlen wurde.
Anders als üblich verstummten die Gespräche der Gäste nicht, wenn sich Herr Weser oder Poppich dem Tisch näherten.
Eine Ausnahme machte Herr Weser, wenn „Madame Polska“ erschien. Warum diese Frau eine Ausnahmestellung einnahm, wusste keiner der Kellner. Es hieß nur, dass sie die Frau eines polnischen Diplomaten sei und der Restaurantchef nicht anders könne.
„Madame Polska“ war Ende fünfzig, kleidete sich aber wie eine Fünfundzwanzigjährige. Allerdings war ihr Haar immer gepflegt und einwandfrei blond gefärbt.
Sie erschien stets in anderer männlicher Begleitung und sprach laut mit einem gespielten Lachen. Keiner der Kellner wollte sie freiwillig bedienen, weil sie stets an allem etwas auszusetzen hatte.
„Herr Ober, schauen sie einmal hier! Das geziemt sich aber nicht für ein Interhotel!“, war immer der erste Satz. Kein Teller war eben oder sauber genug.
Herr Weser musste stets einen Kellner mit den Worten, dass der Gast König sei, zwangsverpflichten, „Madame Polska“ zu bedienen.
Der Restaurantchef begrüßte sie mit den immer gleichen Worten und Gesten.
„Madame, schön, dass sie uns wieder einmal die Ehre geben. Ich hoffe, ihnen geht es genauso gut, wie sie aussehen." Dabei gab er ihr formvollendet einen Handkuss und begleitete sie zu einem Tisch am Fenster.
Normalerweise schaute er im Lokal nach einem Kellner, den er herbeiwinkte, und dem er sagte, dass dieser heute die Ehre habe, die gnädige Frau zu bedienen.
Heute war es anders. Er sagte zu ihr, dass sie sofort bedient würde.
Als Herr Weser im Kellnergang erschien, waren alle Kellner verschwunden. Nur Paul ging gelassen seiner Arbeit nach, weil er nicht damit rechnete, dass der Restaurantchef ihn zur Bedienung der „Madame Polska“ einteilen würde.
„Poppich, heute gehört die gnädige Frau ihnen“, befahl er und entfernte sich.
Plötzlich herrschte wieder die übliche Hektik im Kellnergang.
Für einen Moment war Paul sprachlos. Irgendetwas muss der Weser bezwecken, dachte er sich und ging ins Restaurant an deren Tisch.
„Guten Tag, gnädige Frau!“ Weiter kam Paul nicht, weil sie sich sofort darüber beschwerte, dass sie so lange habe warten müssen. Das sei sie in einem Haus wie dem Interhotel nicht gewöhnt.
„Gnädige Frau, bitte entschuldigen sie meine Verspätung. Ich bin ab sofort nur noch für sie da“, antwortete Paul, indem er eine leichte Unsicherheit vorspielte.
Warte nur ab, du alte Schlampe, dir werde ich es schon zeigen, dachte er sich.
„Werden sie heute bei uns essen?", fragte er unterwürfig.
Nachdem seine Frage bejaht worden war, legte er formvollendet die Speisekarte und die Weinkarte vor. „Madame Polska“ studierte zunächst die Weinkarte und schlug ihrem Begleiter schließlich vor, den einzigen auf der Karte ausgezeichneten Roséwein zu nehmen. Ihr Begleiter nickte zustimmend.
„Gnädige Frau, wünschen sie vorher einen Aperitif?", fragte Paul fast flüsternd.
„Ich könnte ihnen einen polnischen Drink mixen lassen“, fügte er hinzu und erhielt zur Antwort, dass dies eine gute Idee sei und er den Drink servieren solle.
Als sich Paul umdrehte, um zum Kellnergang zu gehen, stellte er fest, dass alle Kollegen ihn beobachteten. Im Türfenster zum Kellnergang erblickte er auch den Kopf des Herrn Weser.
Euch werde ich einmal zeigen, wie man mit solchen Gästen umgeht. Er bongte den Roséwein und zwei Nordhäuser Doppelkorn. Als er zum Büfett kam, stand der Roséwein in einem Sektkübel schon bereit, und der Büfettier sagte so nebenbei, dass die immer das Gleiche saufen würde. Allerdings staunte er über die beiden Schnäpse.
„Mach‘ sie bitte in Sektgläser“, bat Paul den Büfettier.
Danach ging er mit den beiden Sektgläsern zur Kuchenküche und bat um etwas Kirschsaft und zwei Kirschen. Mit einem Löffel gab er in jedes Glas ein wenig Saft und je eine Kirsche. Danach rührte er alles um und ging. Der Kuchenbäcker schüttelte nur mit dem Kopf und sagte halblaut, das sei wieder einmal typisch Poppich.
Am Büffet steckte Paul Trinkhalme in die Gläser, nahm den Kübel mit dem Roséwein und begab sich zum Tisch der „Madame Polska."
„Voilà Madame, hier der versprochene polnische Aperitif“, sagte er.
„Was ist das, Herr Ober?“
„Madame, ich bin überzeugt, sie werden es beim ersten Schluck erkennen“, antwortete Paul und beschäftigte sich mit dem Roséwein.
„Das schmeckt vorzüglich, Herr Ober. Natürlich kenne ich den Drink."
„Haben sie schon gewählt, was sie essen werden?", fragte er jetzt, um weiter von seinem Aperitif abzulenken.
„Wir nehmen eine Tomatensuppe und das Steak vom Beef, aber wirklich medium.“
„Eine ausgezeichnete Wahl, gnädige Frau! Und darf es auch ein Dessert sein? Ich habe gesehen, dass unser Küchenchef heute eine vorzügliche Schokocreme gezaubert hat“, sagte er und wartete auf die Reaktion, wobei er an den Schokoladenpudding dachte, den es zum Personalessen gab.
„Sie sind perfekt, junger Mann. Wir machen es so, wie sie gesagt haben.“
Im Kellnergang wurde Paul vom Küchenpersonal gefragt, ob es wieder Tomatensuppe und Steak sei, was er bejahte, und hinzufügte, dass er auch noch zwei Schokopudding brauche. Auf die erstaunte Rückfrage des Chefkochs sagte er, man solle vom Personalessen zwei Pudding nehmen und zunächst in den Gefrierschrank stellen. Der Koch wollte wissen, was er mit dem kalten Zeug machen solle. Er möge auf einen Glasteller etwas Vanillesoße geben und den Pudding auflegen, sagte Paul.
„Ich dachte immer, dass ich der Koch bin“, erhielt er zur Antwort.
Er solle auch nicht kochen, sondern eine Illusion erfüllen, antwortete Paul und ging.
„He, Poppich, die Tomatensuppe ist fertig“, rief der Suppenkoch.
„Nur Geduld stell sie warm. So schnell kann man doch keine Suppe für die gnädige Frau bereiten“, antwortete er und ging zum Kuchenschalter, um einen Kaffee zu trinken. Dabei bemerkte er, dass der Restaurantchef ihn ständig beobachtete.
Bevor er die Suppe servieren konnte, setzte „Madame Polska“ an den Suppentellern aus, dass der untere Rand beschädigt sei. Paul entschuldigte sich, nahm die Suppenteller wieder vom Tisch und ging zum Kellnerschrank. Dort tat er so, als wenn er unbeschädigte Teller suchte, nahm die reklamierten Teller erneut mit einer frischen Serviette und polierte sie bis zum Tisch.
„So, gnädige Frau. Sehen sie, wir benutzen nur Unikate und keine Fließbandware. Aber jetzt dürfte alles in Ordnung sein“, sagte er, gab auf jeden Teller eine kleine Kelle Suppe und wünschte guten Appetit.
Nach dem ersten Löffel kam die erwartete Beschwerde, dass die Suppe heute nicht so sei wie sonst. Er nahm die leicht gefüllten Teller und die Suppenterrine und versprach, sich selbst darum zu kümmern.
Der Suppenkoch kannte schon das Problem. „Mach‘ die Scheiße richtig heiß, sodass sie sich das Maul verbrennt, und mach‘ die Terrine wieder voll“, sagte Paul.
Der Suppenkoch tat, wie ihm befohlen, und Poppich servierte die Suppe erneut mit den Worten, dass er selbst für den richtigen Geschmack gesorgt hätte. „Madame Polska“ und ihr Begleiter lobten die gut schmeckende Suppe.
Bevor er die Steaks servierte, vereinbarte er mit dem Koch, dass dieser die Steaks normal grillen und in eine Servierpfanne legen solle. Am Tisch stellte er auf einem Servierwagen einen Rechaud mit offener Flamme auf. Er brachte die Pfanne mit den Steaks und stellte sie auf den Kocher. Nach kurzer Zeit drückte er mit einem großen Messer auf das Fleisch.
„Ich glaube, so wird es richtig sein, gnädige Frau“, sagte Paul. „Madame Polska“ war perplex und nickte.
„Endlich ist das Steak so, wie ich es wünsche“, sagte sie und aß mit großem Lob.
Den Pudding servierte Poppich mit der Bemerkung, er habe zusammen mit dem Küchenchef die Qualität geprüft.
Beim Servieren des polnischen Wodkas sagte sie, dass Herr Weser die Rechnung zur Gegenzeichnung fertigmachen solle. Sie suchte in ihrer Tasche nach Kleingeld, fand aber erwartungsgemäß keines und entschuldigte sich bei Paul, dass sie leider kein Trinkgeld geben könne.
Herr Weser hatte die Rechnung bereits fertig und sagte zu den anwesenden Kellnern: „Meine Herren, vom Poppich kann selbst ich noch etwas lernen."
Als Herr Weser und Paul allein waren, erfuhr er, dass es eine allerhöchste Anordnung gebe, die Frau zu hofieren; warum, wisse niemand. Die Rechnung würde immer an die polnische Botschaft gehen.
„Madame Polska“ wollte von da an nur noch von Herrn Poppich bedient werden, was die anderen Kellner ungemein freute.
Nach einigen Wochen erschien sie in eleganter, altersgerechter Kleidung, war leise und meckerte nicht mehr. Sie suchte bei einem guten Aperitif den Hauptgang aus und bestellte erst danach den dazu passenden Wein, die Vorspeise und das Dessert. Nur auf den polnischen Wodka verzichtete sie nicht. Paul erfuhr sogar, was ihr Ehemann machte, behielt diese Information aber wegen seines Ehrenworts auch gegenüber Herrn Weser für sich.
Paul hatte schnell begriffen, wie wichtig und richtig die Unterscheidungen waren. Bald hatte es sich eingespielt, dass einige der besonderen Gäste nur von Herrn Poppich bedient werden wollten.
Herr Leinen, der für das Thälmannkombinat mit den westdeutschen Kunden verhandelte, aß nur in der Hotelhalle und ließ sich ausschließlich von Poppich bedienen. Manchmal musste Paul extra zum Dienst geholt werden. Herr Leinen, der für das Kombinat die Devisen hereinholte, hatte eine Art Narrenfreiheit. Gegenüber dem Bedienungspersonal war er jedoch normal und nie arrogant. Er wollte immer nur relativ einfache Kost, bevor er mit seinen westdeutschen Gästen in die Tanzbar ging, zu der kein normaler DDR-Bürger Zutritt hatte.
Ein anderer Sonderfall war der Gast Winter. Paul hatte nie in Erfahrung bringen können, was dieser Mann machte. Herr Weser sagte einmal, dass er im Ministerium arbeite; genauere Angaben gab es nicht.
Herr Winter erschien mehrmals in der Woche mit der ganzen Familie in der Hotelhalle zum Abendessen. Die Enkelkinder liebten den Herrn Poppich über alles, weil er ihnen immer „geheime Winkel“ des Hotels zeigte und ihnen das Versprechen abnahm, mit niemandem darüber zu sprechen. Kaum waren sie wieder beim Opa angekommen, sprudelte es aus ihnen heraus, und sie erzählten stolz, dass sie in Geheimzimmern gewesen seien.
Paul verdiente bei der ganzen Sache nicht schlecht. Auch verfügte er stets über genügend Westgeld, das ihm so manche Tür öffnete.
An einem Donnerstag erschien ein fremder Gast in der Halle. Keiner konnte ihn richtig einordnen, sodass Poppich gerufen wurde. Der Gast gab an, ein Angestellter der holländischen Botschaft in Berlin zu sein. Bald erfuhr Paul, dass jener einen Kurzurlaub in Magdeburg mache und ein Diplomatenfahrzeug dabeihabe.
Er lud Paul nach Feierabend zu einer „Spritztour“ ein. Er nahm die Einladung an und staunte nicht schlecht, als der Holländer sämtliche Verkehrsregeln missachtete und dies mit den Worten „Diplomaten haben Narrenfreiheit“ kommentierte.
Im Laufe des Abends kam die Sprache darauf, dass man mit einem Diplomatenfahrzeug auch Leute aus der DDR schmuggeln könne. Wenn Paul es wolle, könne man einmal über alles reden. Poppich verlangte eine Bedenkzeit bis zum nächsten Abend.
Bevor Paul nach Hause ging, kehrte er noch bei Gerda im Café ein. Gerda war eine der wenigen Bekannten, die ihn mit Vornamen ansprach.
„Oh, da ist aber jemand etwas über die Leber gelaufen."
Paul, der zu Gerda großes Vertrauen hatte, sagte: „Mensch, da hat mir einer ein komisches Angebot gemacht.“
„Ich will nicht wissen, was passiert ist. Aber lassen sie die Finger davon. Das sagt mir mein Bauch."
Paul ging nach Hause, trank noch einen Kaffee und legte sich aufs Bett. Seine Gedanken drehten sich ständig im Kreis: Wenn es sich um ein ehrliches Angebot handelt, kann ich dieses verhasste Land verlassen, ohne selbst viel zu tun. Doch wenn es schiefgeht, lande ich in Bautzen II. Das war’s dann, sagte er sich und schlief endlich ein.
Am nächsten Morgen war er wie gerädert, weil er so schlecht geschlafen hatte. Alles und jeder ging ihm auf die Nerven. Als er an der Hotelrezeption vorbeikam, zupfte jemand von hinten an seinem Frack und sagte leise: „Der Holländer ist eine Falle."
Er drehte sich langsam um, konnte aber niemand hinter sich erkennen. Nur hinter dem Schalter stand Bärbel, die Frau vom „magischen Auge“. Sie tat überzeugend teilnahmslos und abwesend.
Bei Paul gingen alle Alarmzeichen an; er sprach Bärbel nicht an. Nur eines wusste er: Jetzt war äußerste Vorsicht geboten! Diese Warnzeichen lernte man in der DDR schon als Kleinkind. Wenn sich Erwachsene unterhielten und plötzlich das Thema wechselten oder überraschend schwiegen, hatte man als Kind nicht zu fragen oder sich zu äußern. Es war höchste Gefahr im Anmarsch.
Nur in Ruhe überlegen und das Richtige tun, dachte Paul. Noch war Zeit. Der Holländer war noch nicht da. Wie eine göttliche Eingebung kam ihm der Gedanke: Flucht nach vorn ohne Rücksicht auf Verluste! Der Holländer hat doch gesagt, dass ihm als Diplomat nichts passieren könne.
Ohne weiter nachzudenken, begab sich er in das Büro des Herrn Markgraf, und wurde auch gleich vorgelassen. Mit knappen Worten schilderte Paul, dass ihm ein holländischer Diplomat ein Fluchtangebot gemacht habe.
„Weil ich so überrascht war, habe ich mir Bedenkzeit ausgebeten, um mit ihnen darüber zu sprechen“, sagte er.
„Da haben sie richtig gehandelt, Poppich. Ich habe immer gesagt, dass auf sie Verlass ist“, antwortete Herr Markgraf.
Paul verließ das Büro des Chefs. Als er in der Hotelhalle ankam, war der Holländer eingetroffen. Das „magische Auge“ sprach kurz mit ihm, und der Holländer verließ schnell die Halle.
Noch den ganzen Tag lang dachte Paul über den Holländer nach. Er tröstete sich selbst, indem er sich immer wieder sagte, dass dem Diplomaten nichts oder nicht viel passieren würde, wenn es keine Falle war.
Es verging eine gute Woche. Niemand, auch nicht Herr Markgraf, erwähnte mehr die Geschichte mit dem Holländer. Nur Herr Weser sagte einmal im Vorübergehen: „Gut gemacht, Poppich."
Paul dachte wieder an die Warnung an der Rezeption und fragte einmal nebenbei Bärbel, warum ihr Mann das „magische Auge“ genannt würde.
„Mein Mann ist bei der Polizei und überprüft im Hinterzimmer die Anmeldungen der Gäste“, antwortete Bärbel nur kurz.
Jetzt wusste Paul, wer im Hotel der zweite einflussreiche Stasimann war. Er hatte schon gehört, dass alle Hotelgäste von der Stasi überprüft würden; nur wusste er bisher noch nicht, wer das machte.
Das „magische Auge“ war ein kleiner, dicker, unansehnlicher Mann. Er glich irgendwie dem Erich Mielke, und Paul wunderte sich, warum gerade die hübsche Bärbel mit ihm verheiratet war.
Geht mich nichts an! Nur: Wenn Bärbel mich gewarnt hat, muss noch etwas anderes dahinterstecken, überlegte er so für sich, beschloss aber, alles auf sich beruhen zu lassen.
Irgendwann wird sich schon herausstellen, wer mich warum gewarnt hat. In diesem Staate tut niemand etwas nur aus Nächstenliebe.
2. Kapitel
Als Frau Markgraf Paul in der Hotelhalle erblickte, holte sie ihn schnell ein, hielt ihn am Arm fest und sagte: „Herr Poppich, die Sache mit Bulgarien geht klar. Das habe ich gerade zufällig aufgeschnappt, als sich mein Mann mit dem Restaurantchef unterhielt. Aber bitte, das bleibt noch unter uns. Ich weiß nicht, wie alles offiziell weitergeht."
„Versprochen, Frau Markgraf.“
Paul hatte die Bulgariensache schon fast vergessen gehabt. Aber jetzt schossen ihm die Gedanken nur so durch den Kopf. Wie soll denn das alles gehen? Ich nach Bulgarien!? Einmal raus aus diesem Land!? Etwas anderes sehen und kennenlernen!? Wer hat schon so ein Glück in diesem Gefängnisstaat!? Ach, wenn das noch mein Vater erfahren hätte! Und wie erkläre ich es der Mutter? Die wird verzweifelt sein und nicht aufhören, gute Ratschläge zu geben.
Wie hatte der Vater immer gesagt: „Nur mit der Ruhe! Kommt Zeit, kommt Rat."
Paul kaufte sich erst einmal einen größeren Atlas.
Man sah es ihm an, dass er in Gedanken überall war, nur nicht bei der Arbeit.
Bärbel, die Frau vom „magischen Auge“, sprach ihn an. „Lieber Poppich würden sie mir einen großen Gefallen erweisen?“-
„Jeden!“ Denn zwischenzeitlich wusste er, dass nur Bärbel ihn gewarnt haben konnte.
„Paul“ - Bärbel nannte ihn zum ersten Mal beim Vornamen - „wenn sie mir den Gefallen nicht erweisen können, weiß ich, dass ich mich trotzdem auf sie verlassen kann und dieses Gespräch niemals stattgefunden hat“, begann Bärbel.
„Sie haben mein Ehrenwort, egal, was jetzt kommt.“
„Kurz heraus, ich würde gern jemanden in ihrem Appartement heimlich treffen“, sagte Bärbel plötzlich gefasst.
„Oh Gott, nicht so kurz vor meiner Bulgarienreise ein konspiratives politisches Treffen, das meinen Bulgarientraum vernichtet“, antwortete Paul spontan.
„Nein, nein, keine Angst. Es ist ein heimliches privates Treffen, von dem mein Mann nichts wissen darf. Auch ich gebe ihnen mein Ehrenwort. Erst nachdem ich von Frau Markgraf im Vertrauen erfahren habe, dass es mit Bulgarien klappt, habe ich den Mut gefunden, sie zu fragen. Ihr Bulgarienaufenthalt ist nicht gefährdet.“
„Wann brauchen sie den Schlüssel?“
„Wenn es ihnen recht ist, schon heute Nachmittag nach meiner Schicht“, antwortete Bärbel.
„Nein, das geht nicht. Es ist eine Junggesellenbude, und ich bin nicht vorbereitet.“
„Keine Sorge, wir sehen über die Junggesellenordnung hinweg. Vielleicht räumen wir auch auf. Wenn das Licht gelöscht ist, sind wir wieder weg.“
Paul war alles egal; Bulgarien wartete.
Vielleicht hat Gerda Zeit, mit mir essen zu gehen, bis ich wieder in meine Wohnung kann, dachte er und begab sich zu dem Café, in dem seine Bekannte arbeitete. Doch Gerda war nicht da, sodass er sich entschloss, ins Kino zu gehen.
Nach dem Kinobesuch schlenderte Paul langsam in Richtung seines Appartements. Es wurde gerade das Licht gelöscht.
„Das passt ja wie die Faust aufs Auge“, sagte er halblaut vor sich hin.





























