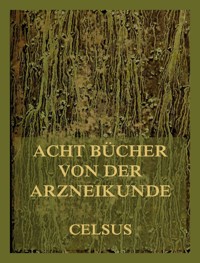
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
" Acht Bücher von der Arzneikunde" ist eine medizinische Abhandlung aus dem 1. Jahrhundert, verfasst von Aulus Cornelius Celsus, einem römischen Enzyklopädisten und möglicherweise (aber nicht wahrscheinlich) praktizierenden Arzt. Das Buch stützt sich auf das Wissen aus antiken griechischen Werken und gilt als die beste erhaltene Abhandlung über die alexandrinische Medizin. Es ist auch das erste vollständige Lehrbuch über Medizin, das jemals gedruckt wurde. Es besteht aus acht Büchern und ist wie folgt aufgeteilt: Buch I – Ernährung, Hygiene und die Vorteile von Bewegung, Buch II – Die Ursache von Krankheiten, ihre Symptome und Prognose, Buch III – Behandlung von Krankheiten, einschließlich Erkältung und Lungenentzündung, Buch IV – Anatomische Beschreibungen ausgewählter Krankheiten, Buch V – Arzneimittel, darunter Opiate, Diuretika, Abführmittel und Laxantien, Buch VI – Geschwüre, Hautverletzungen und -krankheiten, Buch VII – Klassische Operationen, wie Lithotomie und Kataraktentfernung, Buch VIII – Behandlung von Verrenkungen und Brüchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Acht Bücher von der Arzneikunde
CELSUS
Acht Bücher von der Arzneikunde, Celsus
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681867
Übersetzt von Bernhard Ritter
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
ZUEIGNUNG... 1
VORREDE.3
BIOGRAPHIE.4
ERSTES BUCH.6
ZWEITES BUCH.34
DRITTES BUCH.82
VIERTES BUCH.129
FÜNFTES BUCH.167
SECHSTES BUCH.234
SIEBTES BUCH.275
ACHTES BUCH.341
NAMENSVERZEICHNIS. 383
ZUEIGNUNG
Hochverehrungswürdigster Mann!
Wenn wir das schaffende Wirken und Walten des menschlichen Geistes, im Gebiete der Künste und Wissenschaften, von der ersten allmählichen Entwicklung, bis auf den Zustand ihrer gegenwärtigen Höhe verfolgen, so finden wir, bei diesem ganzen Verlaufe, überall eine Reproduktion einer stetigen Reihe von Tätigkeiten und Kräften ausgesprochen, welche in mannigfaltigem Wechsel in und auf einander folgen, in keinem Momente sich zwar ganz gleich sind, aber durch gegenseitiges Ineinandergreifen teils auf einen gemeinsamen Zweck abzielen, teils einen bestimmten Gang ihrer Richtung verfolgen. Unter diesen Verhältnissen entstehen daher, im Gange der Begebenheiten, gewisse Abschnitte oder Perioden, welche, wie die Jahresphasen nach dem Stande der Erde zur Sonne, nach der Wirkungssphäre eines Geistes erster Größe, der gleich den Kometen oft Jahrhunderte zu seinem Wiedererscheinen bedarf, bestimmt und je nach dem durch dessen wärmende Strahlen die frühere Aussaat zur Blüte oder Reife gebracht wurde, genauer bezeichnet werden.
Dies sind die Motive, hochverehrungswürdigster Mann! die mich, abgesehen von meiner seitherigen innigen Verehrung, zunächst bewogen haben, Ihnen diese Blätter hochachtungsvollst zuzueignen, da ich in Ihrer Person einen Mann zu verehren die Ehre habe, welcher dasjenige für unser Jahrhundert ist, was Celsus für sein Zeitalter war, und durch beide der Anfang einer neuen Epoche zu Stande gebracht wurde.
Wenn Celsus durch seine Schriften manches Gute von seinen Vorgängern und Zeitgenossen sowohl des römischen Gebietes, als des Auslandes entlehnt, der Vergessenheit entzogen und geprüft wieder gab; wenn er gangbaren Aberglauben und ruchlose Unfugen bestritten, durch Abstraktion manche Neuerungen in Vorschlag gebracht, und so auf Vervollkommnung der Arzneikunde allseitig hingewirkt hat, so haben wir Ihnen, um nur einige Momente Ihrer vielfältigen Verdienste aufzuführen, die Überpflanzung einer zwar alten, schon seit Jahrhunderten in Indien üblichen, in Europa aber bereits vergessenen Operation der s. g. Rhinoplastik, auf deutschen Boden zu verdanken, wovon nun Schösslinge über alle Länder und Völker der gebildeten Welt übergepflanzt wurden; die Gaumennaht ist als Ihre geistvolle Erfindung in den Blättern der neuern Geschichte aufgeführt; eine rätselhafte Krankheit die ägyptische Augenentzündung, hat durch Ihre Forschungen ihre richtige pathologische Bestimmung und Zurückführung der Behandlung auf wissenschaftliche Grundsätze erfahren, und ebenso die meisten bedeutenderen chirurgischen Operationen, teils durch Erfindung neuer Instrumente und Maschinen, teils durch neues Verfahren, wichtige Änderungen und Verbesserungen erlitten, und somit hat durch Ihre Leistungen in unserm Zeitalter die Arzneikunde auf analoge Weise förderliche Zusätze und Modifikationen, wie durch Celsus im ersten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, erhalten, angemessen dem jeweiligen Drange der Umstände und dem entsprechenden Bildungszustande des menschlichen Geistes.
Indem ich nun zum Schlusse die gehorsamste Bitte ausspreche, diese Blätter gefälligst eines geneigten Blickes würdigen zu wollen, habe ich hochachtungsvollst und dankbarst zu sein die Ehre
Euer Hochwohlgeboren
gehorsamster Diener
Dr. Ritter.
VORREDE.
Ich übergebe hiermit dem ärztlichen Publikum eine Schrift über Arzneikunde, aus dem ersten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, in unsere Muttersprache übergetragen, und glaube durch dieses Unternehmen demselben keinen geringen Dienst zu erweisen, und zwar nicht so fast durch die Übersetzung als solche, sondern vielmehr durch den Inhalt der beigegebenen Anmerkungen. Schon seit Jahren mich mit dem Lesen der griechischen und römischen Klassiker unseres Faches, mit besonderer Vorliebe beschäftigend, fühlte ich nur zu deutlich, wie gerne hierbei kursorisches Lesen die Stelle gründlichen Verstehens vertritt, da dem letzteren oft bedeutende Hindernisse in dem Wege stehen, deren Wegräumung nicht in den Kräften jedes Arztes steht. Ein Schriftsteller des Altertums dient nämlich oft zum Kommentar des anderen, und so kommt es denn, dass man sich bald bei Hippokrates, bald Dioskorides, bald Aretäus, bald Galen, bald bei anderen Rats erholen muss, um eine dunkle Stelle zu verständigen, oder die naturgemäße Deutung eines Wortes ausfindig zu machen Quellen, welche nicht überall und nicht immer zu Gebote stehen. Diesem Übelstande zu begegnen, und den Schriften des Celsus mehr verbreiteten Eingang zu verschaffen, ist der Zweck dieser deutschen Bearbeitung, wobei ich übrigens zu bemerken habe, dass die Furcht, derselben einen zu großen Umfang zu verleihen, mich öfters von umständlicheren Erläuterungen abgehalten hat. Inwieweit ich nun diese Aufgabe gelöst habe, überlasse ich dem billigen Urteil sachkundiger Kunstrichter, mit dem Anfügen, dass ich jede Belehrung dankbar aufnehmen, und bei einer weiteren Auflage benützen werde.
Rottenburg im Januar 1840.
Der Verfasser.
BIOGRAPHIE.
Über Celsus's persönliche Verhältnisse schwebt, in mancher Beziehung, ein dichter, schwer zu lüftender Schleier, welcher dem tieferen Eindringen des Forscherblickes entgegensteht, und deshalb bloß dem Felde der Vermutungen Spielraum gestattet. Nicht einmal in Hinsicht des Namens besteht unter den Gelehrten bindende Einigkeit, insofern er von Einigen als Aurelius Cornelius Celsus, von Anderen wieder als Aulus Cornelius Celsus aufgeführt wird, und es ist wirklich keine leichte Sache, hierbei ein streng entscheidendes Urteil zu füllen, da bedeutende Autoritäten einander widerstreitend gegenüberstehen. Auch ist es durchaus noch nicht zur Gewissheit entschieden, ob er in oder außer Rom, als Sklave oder Freier geboren, nur soviel ist gewiss, dass er während der Regierung des Kaisers Augustus und Tiberius, also im ersten Jahrhundert n. Chr. in Rom gelebt und in einem hohen Aller daselbst gestorben ist, wo ihm Maximus ein ehrenvolles Leichenbegängnis veranstaltet, der Verbrennung seines Körpers beigewohnt, und die übrig gebliebenen Knochen gesammelt haben soll, um sie in die nahegelegene Begräbnisstätte zu bringen. Ebenso wird endlich auch noch darüber gestritten, und ist bis heutigen Tages noch nicht entschieden, ob Celsus die Arzneikunde wirklich jemals ausübte, oder ob er sie als einen Gegenstand der Gelehrsamkeit betrieb. Kolumella nennt ihn "totius naturae prudens", auch Plinius führt ihn nie unter der Reihe der Ärzte auf, und auch bei Galen finde ich des Celsus nicht erwähnt. Horaz nennt Celsus, obgleich er ein Freund und großer Vertrauter desselben war, einen Plünderer der Handschriften der kaiserlichen Burg, und eine Krähe, welche sich mit fremden Federn schmückt, und gibt also dadurch nur zu deutlich zu erkennen, dass er bloß Kompilator war. Biankoni spricht sich in dieser Angelegenheit dahin aus: wenn wir unter dem Wort "Arzt", so wie Celsus selbst sagt, jemanden verstehen, welcher seine Kunst öffentlich ausübt, so halte ich für gewiss, dass er ein solcher niemals gewesen sei, obgleich Cavaubon, Morgagni u. m. a. einer anderen Meinung sind, er wurde bloß von seinen Freunden und Verwandten um Rat gefragt, hatte Gelegenheit, von anderen verrichtete Kuren von Krankheiten mit anzusehen, konnte daher sagen: "ich habe gesehen. Auch wissen wir, wie verhasst die Arzneikunde, und namentlich die Chirurgie, deren Ausübung anfangs sämtlich in den Händen der Griechen war, sich den Römern bewährte, und dass deshalb Kato, nach Plinius's Angabe, ein Buch von medizinischen Regeln zum Gebrauche für seine Familie schrieb, damit sie niemals Ursache hätten, ihre Zuflucht zu den griechischen Ärzten zu nehmen, welche er für schlechte Leute und gemietete Totschläger der Römer hielt. Auch sind die Äußerungen Celsus's, in welcher er in der ersten Person sprechend, ein Urteil abgibt, mehr auf Räsonnement, als auf Erfahrung gegründet, lauter Verhältnisse, welche nur zu deutlich darauf hindeuten, dass Celsus die Arzneikunde niemals praktisch in Ausübung brachte. Dagegen dürfte es mehr als wahrscheinlich erscheinen, dass Celsus des Tiberius Hofmeister und Sekretär gewesen sei, und bei diesem Geschäft sich auf die Wissenschaften verlegt habe. Quintilian) sagt, dass Celsus nicht nur über die Redekunst, Dichtkunst, sondern auch über die Kriegskunst, den Landbau und die Arzneikunde geschrieben habe. Die Bearbeitung dieser Wissenschaften legte er in einem enzyklopädischen Werk nieder, unter dem Titel: "Artes", welches zwanzig Bücher umfasste, von denen seine Abhandlung über die Arzneikunde das sechste Buch ausmachte, daher findet sich noch in alten Handschriften die Aufschrift: "Artium A. Cornelii Celsi liber sextus, medicinae vero liber primus." Sämtliche Bücher bis auf das letztere sind verloren gegangen.
ERSTES BUCH.
Einleitung.
Gleichwie der Ackerbau dem Körper, im gesunden Zustande seines Lebens, Nahrungsmittel verschafft, so gewährt die Arzneikunde demselben erkrankt Gesundheit. Dieser Wissenszweig hat von jeher bestanden. Wenn aber auch die rohesten Völker Kräuter und andere Mittel als wirksam bei Heilung der Wunden und Krankheiten erkannten, so wurde doch die Arzneikunde erst bei den Griechen um ein ziemliches mehr ausgebildet als bei den übrigen Völkerschaften; allein auch bei diesen nicht von ihrem ersten Ursprunge an, sondern bloß wenige Jahre vor uns, insofern nämlich Äskulap als ihr erster Urheber gerühmt wird. Weil nun dieser die noch unausgebildete und gering geschätzte diesfallsige Kenntnis weit scharfsinniger entwickelt hat, so wurde er unter die Zahl der Götter versetzt. Hernach leisteten seine beiden Söhne Podalirius und Machaon, welche dem Heerführer Agamemnon in den trojanischen Krieg folgten, ihren Mitkämpfern keine geringen Dienste. Doch setzt Homer hinzu, dass sie weder gegen die Pest, noch gegen verschiedene Gattungen anderer Krankheiten jemals Hilfe geleistet hätten, sondern bloß mit Heilung der Wunden, mittelst Arzneimitteln und Instrumenten, sich zu befassen pflegten. Hieraus erhellet also, dass dieser letztere Zweig der Arzneikunde ́ lediglich allein von ihnen ausgeübt wurde, und derselbe demnach der älteste sei. Aus demselben Schriftsteller können wir auch vernehmen, dass die Krankheiten zur damaligen Zeit für eine Strafe der unsterblichen Götter gehalten wurden, und man deshalb bei denselben Hilfe zu suchen gewohnt war. Es ist wahrscheinlich, dass beim Bestand nur weniger Heilmittel (auxilia adversae valetudinis) sich ihre Gesundheit doch meistens gut erhalten habe, wegen der guten Sitten, unter welche weder Trägheit noch Schwelgerei verderbend sich eingeschlichen hatten. Diese beiden letzteren Verhältnisse haben nämlich zuerst in Griechenland, hernach aber auch bei uns ihren schädlichen Einfluss auf den Körperzustand geäußert. Deswegen bringt die Arzneikunde, die in ihrem großen Umfange weder in den früheren Zeiten, noch bei anderen Völkern als Bedürfnis erachtet wurde, kaum einige von den Bessern an die ersten Stufen des beginnenden Alters. Nach den seither erörterten Umständen haben sich also nur wenige ausgezeichnete Männer mit der Arzneikunde befasst, bis man sich mit mehr angeregtem Eifer auf Erlernung der Wissenschaften zu verlegen begann, deren Betreibung, wenn auch dem Geiste unentbehrliches Bedürfnis, auf den Körper doch nachteilige Wirkung äußert. Im Anfange wurde die Arzneikunde als ein Teil der Philosophie erachtet, sowie auch die Heilung der Krankheiten und die Betrachtung der äußern Natur unter derselben Anführung ins Entstehen gerufen wurde, insofern gerade diesen Männern die Arzneikunde am meisten Bedürfnis wurde, da sie ihre körperlichen Kräfte durch anhaltendes Nachdenken und nächtliches Wachen geschwächt haben. Wir finden deshalb viele von den Lehrern der Philosophie, welche der Arzneikunde kundig gewesen waren. Die berühmtesten unter diesen aber sind: Pythagoras, Empedokles und Demokrit. Hernach aber auch Hippokrates, ein Schüler des letzteren (wie einige meinen), von Kos, der, als ein Mann gleich ausgezeichnet in seiner Kunst, wie in der Beredsamkeit, von allen der berühmteste zuerst die Heilkunde von dem Studium der Philosophie trennte. Nach diesem betrieben Diokles Carystius, hernach Praxagoras und Chrysippus, endlich Herophilus und Erasistratus ihre Kunst dergestalt, dass sie hierbei auf verschiedene Heilmethoden verfielen. Zur damaligen Zeit teilte man die Arzneikunde in drei Teile, wovon der erste mittelst den Nahrungsmitteln, der zweite mittelst Arzneimitteln, und der dritte mittelst besonderen Handgriffen die Heilung einleitet. Den ersten nannten die Griechen Diätetik, den anderen Pharmazie, und den dritten Chirurgie. Die bei weitem berühmtesten Stifter desjenigen Teils der Arzneikunde, welcher mittelst der Diätetik die Krankheiten heilt, haben sich auch, um etwas weiter vorzuschreiten, naturwissenschaftliche Kenntnisse zugeeignet, da sie ohne dieselben die Arzneikunde gleichsam verstümmelt und mangelhaft erachteten. Nach diesen war Serapion der erste, welcher öffentlich behauptete, dass diese vernünftelnde Methode durchaus keinen fördernden Einfluss auf die Arzneikunde übe, und beschränkte dieselbe deshalb auf Erfahrung und Versuche. Diesem folgte Apollonius und Glaucias, und bald nachher Heraklides von Tarent, und einige andere nicht unbedeutende Männer, und nannten sich, ihren Grundsätzen gemäß, Empiriker. Unter diesen Verhältnissen zerfiel auch die diätetische Schule selbst wieder in zwei Teile, insofern einige bei der Ausübung sich auf die Aussprüche der Vernunft, andere sich bloß auf die Erfahrung stützten; nach den seither erwähnten Männern beschäftigte sich aber keiner mit etwas anderem, als mit dem, was ihnen überliefert worden war, bis endlich Asklepiades die Heilmethode großen Teils umändert. Von seinen Nachfolgern wich Themison unlängst selbst noch in seinem Alter hiervon in etwas ab. Durch diese Männer wurde die Arzneikunde vorzugsweise in Aufnahme gebracht. Weil aber unter den drei Teilen der Arzneikunde derjenige der schwerste und vorzüglichste ist, der sich mit der Heilung der Krankheiten befasst, so muss vor allen anderen von ihm die Rede sein. Weil aber gerade hierin die Verschiedenheit der Meinungen am größten ist, insofern einige die Kenntnis bloß entnommen aus der Erfahrung für notwendig erachten, andere dagegen dieselbe für unzulänglich erklären, wenn sie nicht aus genauer Untersuchung der betreffenden Gegenstände hervorgegangen ist. Es muss daher erörtert werden, welche Gründe von beiden Parteien vorgebracht werden, wobei sodann umso leichter auch unsere eigene Ansicht mitbeigebracht werden kann. Diejenigen, welche sich zur rationellen Heilkunde bekennen, erachten folgendes für notwendig: Einmal die Kenntnis der verborgenen Ursachen, welche den Grund der Krankheiten enthalten; hernach die Kenntnis der offenbaren Ursachen, nach diesen aber auch den Inbegriff der Kenntnisse von den natürlichen Verrichtungen, vorzugsweise aber der inneren Teile.
Verborgene Ursachen nennen sie diejenigen, durch welche erforscht wird, aus welchen Grundbestandteilen unser Körper zusammengesetzt ist, und was sowohl Gesundheit als Krankheit bewirkt. Denn sie glauben, dass derjenige nicht wissen könne, wie man Krankheiten sicher zur Heilung bringe, welchem entgeht die Kenntnis von dem Ursprunge derselben. Es unterliege ferner keinem Zweifel, dass eine andere Behandlungsweise notwendig sei, wenn, nach der Meinung einiger Philosophen, aus den vier Elementen, entweder durch Übermaß oder Mangel, Krankheit erwächst; es sei ferner eine andere Heilmethode erforderlich, wenn der Fehler lediglich in den flüssigen Teilen liegt (wie Herophilus glaubte); wieder eine andere, wenn er, nach Hippokrates, in dem geistigen Prinzip beruht, noch eine andere, wenn das Blut in diejenigen Gefäße übergeführt wird, welche bloß für die Luft berechnet sind und Entzündung hervorruft einen Zustand, den die Griechen Phlegmone nennen, und diese Entzündung, nach Erasistratus's Ansicht, eine solche Bewegung bewirkt, wie sie beim Fieber stattfindet; endlich wieder eine andere, wenn, nach Asklepiades's Meinung, die schwimmenden Körperchen, durch ihren Stillstand, den Weg durch unsichtbare Öffnungen verschließen. Derjenige besitze aber die rechte Heilmethode, welcher sich in dem ersten Ursprunge der Krankheitsursache nicht geirrt habe, Sie stellen aber nicht in Abrede, dass auch Versuche notwendig seien; allein zu diesen könnte man nicht anders gelangen, außer mittelst Hilfe der Aussprüche der Vernunft; denn die älteren Ärzte hätten den Kranken nie etwas unbedingt geraten, sondern sie hätten vorher reiflich überlegt, was im gegebenen Falle am dienlichsten sein könnte, und hätten das anzuwenden versucht, worauf sie vorher durch bloße Mutmaßung geleitet worden wären. Es liegt auch nichts daran, ob nun schon vorher mehreres versucht worden sei, wenn man nur durch Überlegung hierzu gelangt sei. Und so verhalte es sich auch bei vielen. Oft kämen aber auch neue Gattungen von Krankheiten vor, bei welchen die Erfahrung noch nichts gelehrt habe, und eben deshalb sei es notwendig, über ihren Ursprung nachzudenken, ohne was keiner von den Sterblichen ausfindig zu machen vermöge, warum dieses Mittel mehr, als jenes in Anwendung zu ziehen sei. Eben weil sie in dieser Beziehung in Ungewissheit schweben, forschen sie den zu Grunde liegenden Ursachen nach –– Offenbare Ursachen nennen sie dagegen solche durch welche sie zu entdecken suchen, ob Wärme oder Kälte, Hunger oder Übersättigung, und diesen Ähnliches den Anfang der Krankheit herbeigeführt haben; denn sie behaupten, dass derjenige einen großen Vorsprung erhalte, welcher sich mit dem Anfang der Krankheit bekannt gemacht habe. Natürliche Verrichtungen des Körpers nennen sie diejenigen, durch deren Hilfe wir ein- und ausatmen, Speise und Trank zu uns nehmen, und verdauen, und durch welche dieselben wieder in allen Teilen der Glieder abgesetzt werden. Hernach untersuchen sie auch, warum unsere Blutgefäße sich bald sinken, bald wieder erheben, was die Ursache des Schlafes und des Wachens sei. Sie glauben, dass Niemand, ohne dieses zu wissen, den hieraus entstehenden Krankheitsfällen weder vorzubeugen noch sie zu heilen vermöge. Von allem diesem scheint aber die Verdauung vorzugsweise hierher zu gehören. Bei dieser blieben sie auch hauptsächlich stehen, und einige behaupten, nach dem Vorgange Erasistratus's, dass die Speisen in dem Magen zermalmt werden; andere nach Plistonikus, einem Schüler des Praxagoras, dass sie daselbst in Fäulnis übergehen, und wieder andere glauben nach Hippokrates, dass die Speisen durch die Wärme verdaut werden. Hierzu kommen auch noch die Anhänger des Asklepiades, welche alles dieses für nutzlos und überflüssig erklärten; denn diese behaupten, werde gar nichts verdaut, sondern die Speise werde unverändert, wie man sie gerade genossen hat, in den ganzen Körper verteilt. Hierüber haben sie sich zwar noch nicht gehörig miteinander ausgeglichen, allein nur eine Stimme herrscht in der Beziehung, dass man dem Kranken, wenn diese Ansicht wahr ist, andere Speisen reichen müsse, und wieder andere, wenn jene Grund hat. Denn wenn eine Speise im Magen zermalmt wird, so müsse man eine Speise reichen, welche am leichtesten der Zermalmung unterliegt; verfaule sie aber daselbst, so müsse man eine Speise wählen, welche am schnellsten in Fäulnis übergehe; bewirkt aber Wärme die Verdauung, so erlese man solche, welche die Wärme am meisten unterhält. Keine von allen diesen darf aber genommen werden, wenn gar keine Verdauung besteht; sondern in diesem Falle muss man solche zu sich nehmen, die am längsten in jenem Zustande verbleiben, in welchem sie genossen wurden. Auf dieselbe Weise glauben sie auch, könne, bei schwerem Atem, abweichendem Schlafen und Wachen, derjenige Heilung erzielen, welcher zum Voraus weiß, wie jene Übel zum Vorschein gekommen sind. Außerdem glauben sie auch, dass, wenn innere Teile von Schmerzen oder irgendeiner krankhaften Veränderung befallen werden, Niemand die geeigneten Mittel anzuwenden vermöge, wenn er keine Kenntnis von jenen Teilen besitzt. Es sei daher notwendig, die Körper der Verstorbenen zu zergliedern, ihre Eingeweide und Gedärme zu untersuchen, ja bei weitem am besten hätten Herophilus und Erasistratus daran getan, die sie die, von den Königen aus den Gefängnissen erhaltenen, Missetäter lebendig zergliederten, und wenn der Atem nachher auch aufhörte, doch Erscheinungen aufgedeckt hatten, welche die Natur seither verschlossen hielt, nämlich in Beziehung auf die Lage, Farbe, Gestalt, Größe, Ordnung, Härte, Weiche, Glätte, Verbindung, Vor- und Rückwärtsbeugung der einzelnen Teile, sowie auch dabei bemerkt, wie ein Teil in den anderen übergeht, und wo ein Teil etwas von dem anderen aufnimmt. Wenn Schmerz einen inneren Teil befällt, so könne derjenige, der unbekannt mit der gegenseitigen Lage jedes Eingeweides oder Darmes, weder wissen, was eigentlich schmerzt, noch derjenige eine Krankheit heben, der nicht wisse, was eigentlich erkrankt ist. Wenn durch eine Wunde irgendeines Teils Eingeweide zu Tage treten, so werde der, welcher nicht weiß, wie die Teile im gesunden Zustande aussehen, nicht zu beurteilen wissen, was unversehrt und was verletzt ist. Auf diese Weise könne man nicht einmal den Beschädigten gehörig zu Hilfe kommen; denn auch selbst die äußern Mitteln können geschickter in Anwendung gezogen werden, wenn man sich mit der Lage, Gestalt und Größe der inneren Teile vertraut gemacht hätte, und ebenso verhalte es sich auch mit allen übrigen seither erwähnten Punkten. Auch sei es nicht grausam, wie die meisten vorschützen, durch die martervolle Aufopferung einer geringen Anzahl von Missetätern, Heilmittel für schuldlose Nationen aller Jahrhunderte ausfindig zu machen.
Diejenigen dagegen, welche sich, von ihrer Erfahrung, Empiriker nennen, lassen zwar die Kenntnis der offenbaren Ursachen als notwendig gelten, aber die Untersuchung der verborgenen Ursachen und der natürlichen. Verrichtungen erachten sie deswegen für überflüssig, weil die Natur unbegreiflich sei. Dass man sie aber nicht erfassen könne, erhelle aus der Uneinigkeit derjenigen, welche hierüber abgehandelt haben; da in dieser Angelegenheit weder unter den Lehrern der Philosophie noch unter den Ärzten selbst Einigkeit herrsche. Denn warum sollte man dem Hippokrates mehr Glauben schenken, als dem Herophilus? und warum diesem wieder mehr beipflichten als dem Asklepiades? Wenn man Grundsätze befolgen wolle, so können die Grundsätze von allen sich nicht als unwahrscheinlich darstellen; denn sehe man auf die Behandlungsarten, so seien, von allen diesen, Kranke geheilt worden. Unter diesen Verhältnissen dürfe man also weder den schriftlichen noch mündlichen diesfallsigen Abhandlungen geradezu den Glauben absprechen. Auch die Philosophen würden die größten Ärzte sein, wenn bloßes Vernünfteln hierzu führen würde, nun aber seien sie reich an Worten, allein arm an Kenntnissen in der Arzneikunde. Auch richte sich die Heilmethode nach der natürlichen Beschaffenheit der Länder; etwas anderes sei in Rom, noch etwas anderes in Ägypten, und wieder etwas anderes in Gallien notwendig. Wenn nun die Krankheiten überall aus einerlei Ursachen entständen, so müssten auch die Arzneimittel überall die nämlichen sein. Oft seien die Ursachen auch ganz offenbar, wie z. B. beim Triefauge (lippitudo), einer Wunde, und doch könne man hieraus noch nicht erkennen, wie man dagegen verfahren müsse. Wenn nun die Kenntnis einer offenbaren Ursache unsere diesfallsige Einsicht nicht erhöht, um wie viel weniger kann sie nun derselben Vorschub leisten, in Fällen, wo die Ursache selbst zweifelhaft ist, da nun jene ungewiss und unbegreiflich sei, so müsse man, wie in allen übrigen Künsten, umso eher von gewissen und zuverlässigen Verhältnissen Aufschluss erwarten, d. h. von solchen, 'welche die Erfahrung bei der Heilung gelehrt hat. Auch werde weder der Ackersmann noch Steuermann durch gelehrte Spitzfindigkeiten, sondern bloß durch Erfahrung gebildet. Hieraus könne man also entnehmen, dass derlei Förscheleien eigentlich nicht zur Arzneikunde gehören, weil diejenigen, welche in ihren Ansichten hierüber auch abweichen, den Menschen doch in denselben gesunden Zustand zurückgeführt haben. Dieses hätten sie bewirkt, nicht weil sie von den verborgenen Ursachen, oder von den natürlichen Verrichtungen, sondern allein von der Erfahrung, wie sie sich jedem dargeboten hat, ihre Heilmethode abgeleitet. hätten. Selbst von Anfang an habe die Arzneikunde nicht von solchen Grübeleien, sondern von der Erfahrung ihren Ursprung genommen. Denn einige Kranken hätten, ohne ärztlichen Rat, wegen Fressbegierde, gleich in den ersten Tagen fortdauernd Speisen zu sich genommen; andere dagegen hätten, wegen Ekel, sich des Genusses der Speisen enthalten und die Krankheit derjenigen hätte sich gemildert, welche gefastet hatten; noch andere hätten selbst während eines Fieberanfalles etwas zu sich genommen, andere kurz vorher, noch andere nach eingetretenem Nachlasse des Fiebers, und am besten wäre das Fieber bei denen geheilt worden, welche erst nach Beendigung des Fieberanfalls dieses getan hätten. Auf dieselbe Weise hätten einige gleich im Anfange sich mit Speisen mehr oder weniger angefüllt, und diejenigen, die sich überfüllt hätten, wären kränker geworden. Da nun diesen ähnliche Vorfälle sich bereits täglich ereigneten, so hätten fleißige Männer angefangen, dasjenige aufzuzeichnen, was am meisten entsprochen und dasselbe hernach den Kranken selbst angeraten. So sei die Arzneikunde entstanden, indem man sofort von der Genesung des Einen und dem Tode des Anderen das Schädliche von dem Heilsamen zu unterscheiden gelernt habe. Erst nachdem man hierauf die ärztlichen Heilmittel entdeckt, hätten Männer angefangen, von ihrer inneren Beschaffenheit zu handeln. Die Arzneikunde sei also nicht aus Grundsätzen hervorgegangen, sondern umgekehrt, erst nachdem die Arzneikunde bereits bestanden habe, hätte man Grundsätze aus ihr abgeleitet. Auch frage es sich noch, ob die Vernunft dasselbe lehre, was die Erfahrung, oder etwas anderes. Lehrt sie dasselbe, so sei sie überflüssig, lehrt sie etwas anderes, so sei es ein Widerspruch. Zuerst hätte man die Arzneimittel mit der größten Sorgfalt untersuchen müssen, jetzt aber seien sie nun auf die angeführte Weise untersucht und es würden weder neue Krankheitsgattungen entdeckt, noch bedürfe man neuer Heilmittel. Wenn aber auch je ein bisher noch unbekanntes Krankheitsbild zum Vorschein käme, so brauche der Arzt doch nicht über verborgene Dinge nachzugrübeln, sondern wenn er zuvor gesehen, mit welcher Krankheit diese neue am meisten übereinkommt, so müsse er ähnliche, für letztere berechnete Arzneimittel versuchen, welche der ihr ähnlichen Krankheit oft schon abgeholfen haben und durch diese Ähnlichkeit würde er die geeignete Hilfe ausfündig machen. Auch sei ihre Ansicht nicht, als ob der Arzt keiner Überlegung bedürfe und selbst ein unvernünftiges Tier diese Kunst auszuüben vermöge, sondern dass die, auf verborgene Dinge sich beziehenden, Vermutungen nicht zur Sache gehören, weil nicht so fast daran gelegen sei, was die Krankheit errege, sondern was sie zu heben vermöge. Auch gehöre es nicht zur Sache, zu wissen wie, sondern was am besten verdaut werde. Hänge die Verdauung von dieser oder jener Ursache ab, sei sie eine wirkliche Verdauung, oder bloß eine Zerteilung des Genossenen. Man habe auch nicht zu untersuchen, auf welche Weise wir atmen, sondern was einen schweren und langsamen Atem bewirke, noch was die Blutgefäße bewege, sondern nur was jede Gattung der Bewegung anzeigt. Dieses lerne man aber aus Versuchen, und bei allen Grübeleien der erwähnten Art könne man gegen beide Teile streiten. Daher siege auch Scharfsinn und Beredsamkeit, allein die Krankheiten werden keineswegs durch Beredsamkeit, sondern durch Heilmittel gehoben. Ein Mann, der von der Erfahrung vorteilhaft unterstützt, würde selbst sprachlos einstens ein größerer Arzt werden, als ein solcher, der ohne Erfahrung in seiner Sprache sich ausgebildet hat Selbst auch dasjenige, worüber abgehandelt wurde, sei nur überflüssig. Was aber die Eröffnung des Bauches und der Brust lebender Menschen betrifft, so sei es sogar grausam, und die Kunst, dem menschlichen Wohle zum Schutze bestimmt, verschaffe jemanden nicht nur bloß den Untergang, sondern diesen selbst auch noch auf die grausamste Art, zumal da unter denen Dingen, welche mit solcher Heftigkeit gesucht werden, einige durchaus nicht erkannt, und andere auf eine weit mildere Art untersucht werden können. Denn die Farbe, die Glätte, die Weichheit, Härte und dergleichen seien bei einem geöffneten Körper nicht mehr von der Beschaffenheit, wie sie bei geschlossenen Körperhöhlen gewesen sind, weil alle diese Verhältnisse bei unverletztem Körper doch durch Furcht, Schmerz, Fasten, Unverdaulichkeit, Ermattung und tausend andere minder bedeutende Zufälle, oft verändert werden; daher es auch umso wahrscheinlicher sei, dass die inneren Teile, welche weicher und des Lichtes ungewohnt sind, unter den grässlichsten Verwundungen und bei der Ermordung selbst sich verändern. Nichts sei also törichter, als zu glauben, dass irgendetwas bei einem Lebenden dieselbe Beschaffenheit zeige, wie bei einem Sterbenden, oder gar bei einem Toten. Denn der Unterleib, welcher hier weniger in Betracht kommt, könne zwar bei einem noch atmenden Menschen stückweise betrachtet werden, sobald aber das Messer an die Brust angesetzt und das Zwerchfell, welches als eine Art Haut die oberen von den unteren Teilen absondert, durchschnitten werde, so sterbe der Mensch plötzlich, und so biete die Brust eines Verstorbenen die Eingeweide dem mörderischen Arzte zur Betrachtung dar, welche somit notwendig die Beschaffenheit eines Toten und nicht eines Lebenden zeigen. Hieraus gehe also hervor, dass der Arzt den Menschen, unter den angegebenen Verhältnissen, auf eine grausame Weise töte, ohne zu erfahren, wie seine Eingeweide im lebenden Zustande sich verhalten. Allein gesetzt auch, es gäbe etwas, welches sich bei einem atmenden Menschen der Beobachtung darböte, so gebe oft der Zufall dem Arzte hierzu Gelegenheit. Denn bisweilen werden Fechter auf dem Kampfplatze, Soldaten im Treffen, Reisende von Räubern angefallen und so verwundet, dass einige innere Teile ihres Körpers zu Tage stehen und bei anderen wieder andere, so dass der kluge Arzt, der sich nicht aufs Morden, sondern aufs Heilungsgeschäft verlegt, den Sitz, die Lage, die Ordnung und dergleichen genau kennen lerne, und er also durch Mitleid zu dem gelangt sei, was andere durch unmenschliche Grausamkeit kennen gelernt hätten. Deswegen sei nicht einmal die Zergliederung der Leichen notwendig, welche zwar nicht grausam, doch ekelhaft sei; zumal da sich bei Leichen alles anders verhalte, als bei Lebenden, wie die Heilung selbst zeige, da alles dieses in vielen Schriften und in weitläufigen gelehrten Abhandlungen von den Ärzten schon oft erörtert worden ist und noch erörtert werden wird, so muss noch hinzugefügt werden, was der Wahrheit am nächsten zu stehen scheint, ohne weder der einen oder der anderen Ansicht zu huldigen, noch von einer der beiden sich zu weit zu entfernen, sondern bei dieser Meinungsverschiedenheit gewissermaßen die Mittelstraße zu halten. Das, was uns, wenn wir anspruchslos nach Wahrheit forschen, bei den meisten gelehrten, Streitigkeiten auffällt, lauft immer auf eines hinaus. Denn die Verhältnisse, welche die Gesundheit fördern, oder Krankheiten erregen, welchen Anteil die Luft oder die Speise, insofern sie dem Körper entzogen, oder ihm beigebracht werden, daran haben, bringen die Lehrer der Philosophie nicht einmal zur klaren Einsicht, sondern sie folgern dieses nur aus bloßen Vermutungen. Wer aber von einer Sache keine sichere Kenntnis besitzt, der vermöge auch kein zuverlässiges Mittel dagegen zu finden. Es ist walır, zur Arzneikunde gehört nichts mehr als Erfahrung. Obgleich es viele Dinge gibt, die zu den Künsten selbst eigentlich nicht gehören, so wirken sie doch fördernd auf jene ein, insofern sie den Geist des Künstlers anregen. Daher bewirkt auch die Betrachtung der äußern Natur, obgleich sie den Arzt nicht geschickter macht, doch Fortschritte in der Arzneikunde. Es ist wahrscheinlich, dass Hippokrates und Erasistratus und alle andere, welche sich nicht begnügten, Fieber und Geschwüre zu heilen, sondern auch teilweise sich auf Naturwissenschaften verlegten, deswegen zwar keine Ärzte gewesen, aber deswegen doch zu größeren Ärzten herangewachsen sind. Die Arzneikunde bedarf der Theorie, wenn auch nicht gerade bei den verborgenen Ursachen und den natürlichen Verrichtungen, so doch in manchen Fällen. Denn diese Kunst beruht auf Hypothesen, und nicht nur die Hypothese, sondern auch die Erfahrung stimmt nicht immer mit ihr überein. Bisweilen tritt weder Fieber, noch Appetit, noch Schlaf ein, wie es gewöhnlich geschehen sollte. Seltener, jedoch bisweilen, ist auch die auftretende Krankheit eine neue Erscheinung, und es ist offenbar falsch zu behaupten, dass dieser Fall nie eintrete, da zu unserer Zeit eine gewisse Person in Folge eines fleischigen und trockenen Vorfalles aus den Geschlechtsteilen (Muttervorfall?) innerhalb wenigen Stunden starb, so dass die ausgezeichnetsten Ärzte: weder die Art der Krankheit noch ein Mittel dagegen ausfindig machen konnten). Ich glaube also, dass sie nichts getan haben, weil Niemand bei einer Person von Stande ein ungewisses Mittel versuchen wollte, damit es, im Falle eines ungünstigen Erfolges, nicht scheinen möge, als sei sie in Folge hiervon umgekommen. Doch ist es wahrscheinlich, dass, wenn die Person ihre Schamhaftigkeit hätte etwas beiseitesetzen können, man vielleicht auch etwas ausfindig gemacht hätte, welches hier entsprochen hätte. In solchen Fällen hilft auch nicht immer die Ähnlichkeit aus der Verlegenheit und wenn sie je auch etwas hilft, so ist es doch an und für sich vernünftig, bei dem Bestand vieler ähnlichen Gattungen von Krankheiten und Arzneimitteln, hierüber nachzudenken, welches Mittel im gegebenen Falle vorzugsweise in Anwendung zu ziehen sei. Wenn sich nun ein solcher Fall ereignet, so muss der Arzt auf etwas sinnen, welches vielleicht nicht immer, aber doch öfters anschlägt. Er wird aber auch neue Maßregeln ergreifen, allein nicht nach Maßgabe verborgener Ursachen, denn diese sind zweifelhaft und ungewiss, sondern solcher, die genau untersucht werden können, d. h. nach offenbaren Ursachen, denn es ist ein großer Unterschied, ob eine Krankheit von Erschöpfung oder von Durst, oder von Kälte, oder von Wärme, oder von Wachen, oder von Hunger, oder von Übermaß im Genuss von Speise und Wein, oder von Ausschweifung im Genuss der Liebe hervorgebracht worden ist. Der Arzt muss auch wissen, wie die Natur des Kranken beschaffen sei, ob das Flüssige, oder das Trockene in seinem Körper vorherrsche, ob seine Nerven erstarkt oder schwach sind, ob er öfters oder nur selten krank ist, und wenn er es ist, ob seine Krankheit heftig oder unbedeutend zu sein pflegt, ob sie kurz oder langdauernd ist, was derselbe für eine Lebensart führt, ob diese beschwerlich oder gemächlich, ausschweifend oder nüchtern sei; denn aus diesen und diesen ähnlichen Verhältnissen kann man oft eine neue Heilmethode ableiten. Obgleich man diese Punkte nicht so ansehen darf, als ob sie gar nichts Strittiges enthielten. Denn Erasistratus sagt, dass hieraus keine Krankheiten entstehen, weil einige hierauf kein Fieber bekamen und einige Ärzte unseres Jahrhunderts behaupten, gestützt auf Themison (dessen Nachfolger sie scheinen wollen), dass die Kenntnis der Ursache nichts zur Behandlung beitrage, es sei hinreichend, einige allgemeine Erscheinungen der Krankheiten zu beobachten. Derlei habe man drei Arten: 1) das Feste, 2) das Flüssige, 3) das Gemischte. Denn bald leerten die Kranken zu viel, bald zu wenig, bald in einem Teil zu wenig, in dem anderen zu viel aus. Diese Krankheitsgattungen seien bald schnell verlaufend, bald langwierig, bald nehmen sie zu, bald stehen sie stille, bald nehmen sie ab. Nachdem man nun erkannt habe, welche Gattung von den erwähnten es sei, so müsse man, wenn der Körper verstopft ist, ihn zu eröffnen suchen, dagegen stopfen, wenn er an Durchfall leidet; und wenn die Krankheit gemischter Art, so müsse man sogleich dem größeren Übel abzuhelfen suchen; anders müsse man die kurzdauernden Krankheiten heilen, anders die langwierigen, anders bei den zunehmenden, anders bei den stillstehenden, und anders bei den schon zur Genesung hinneigenden verfahren. In der Beobachtung dieser Dinge bestehe die Arzneikunde, welche sie so bestimmen, dass sie gleichsam ein gewisser Weg sei, welchen die Griechen Methode nennen, und eine Betrachtung der allgemeinen Erscheinungen bei Krankheiten, und wollen sich weder den rationellen Ärzten, noch denjenigen, welche sich bloß auf Erfahrung stützen, beigezählt wissen, da sie sich von jenen durch den Namen unterscheiden, weil sie das Wesen der Arzneikunde in eine bloße Mutmaßung der verborgenen Dinge gesetzt wissen wollen, von diesen aber dadurch, dass sie zu wenig Vertrauen auf die Aussprüche der Erfahrung setzen. Was den Erasistratus betrifft, so widerstreitet vorneweg der Augenschein seine Meinung, weil selten, wenn nicht eines von diesen erfolgt, eine Krankheit entsteht.
Hernach folgt auch nicht, dass das, was einem nicht schadet, einem anderen, oder demselben Menschen unter anderen Umständen nicht schadet, auch einem dritten, oder demselben Menschen, unter anderen Zeitverhältnissen nicht schaden sollte. Denn es kann etwas im Körper sein, was von einer Schwäche oder einer anderen Krankheit desselben herrührt, was sich bei einem anderen nicht vorfindet, oder was bei diesem sonst nicht vorhanden war, und obschon dieses an sich nicht so gewichtig sein mag, um eine Krankheit hervorzubringen, so kann es doch im Verein mehrerer anderen Verhältnisse auf den Körper nachteiligen Einfluss äußern. Wenn nun einer in der Betrachtung der äußern Natur (welche sich die Ärzte nicht umsonst zu eigen machen) hinlängliche Fortschritte gemacht hat, so weiß er auch wohl, dass nichts durch eine einzige Ursache vor sich gehe, sondern er muss das, was am meisten dazu beizutragen scheint, für die Hauptursache erachten. Ein Umstand kann allein keinen nachteiligen Einfluss auf uns äußern, den er aber, in Verbindung mit anderen, im höchsten Grad hervorbringt. Hierzu kommt noch, dass nicht einmal Erasistratus selbst, der das Fieber von einem Übergang des Blutes in die Pulsadern ableitet, wenn dieses bei einem mit Blut überfüllten Körper vor sich gehe, ausfündig gemacht hat, warum von zwei gleich vollblütigen Körpern der eine in Krankheit verfiel, der andere aber nicht die geringste Veränderung merken ließ - ein Zufall, der bereits täglich vor sich zu gehen pflegt. Hieraus kann man ersehen, dass jener Übergang des Blutes, wenn je etwas Wahres an der Sache ist, bei gesundem Körper nicht durch sich selbst stattfinden könne, sondern nur insofern, als einer der angeführten Umstände sich hinzugesellt hat.
Die Anhänger des Themison dagegen sind, wenn sie feste Prinzipien haben, wie sie vorgeben, mehr rationell als jene; denn wenn einer auch nicht allem dem huldigt, was ein anderer rationeller Arzt billigt, so bedarf man nicht sogleich eines anderen Namens der Kunst; wenn er nur, was die Hauptsache ist, sich nicht allein auf das Gedächtnis, sondern auch auf die Vernunft stützt. Wenn aber die Arzneikunde, wie es augenfällig ist, kaum je fester Grundsätze sich zu erfreuen hat, so sind die Anhänger des Themison denjenigen gleichzustellen, welche sich lediglich allein auf Erfahrung stützen, und dieses umso mehr, weil auch der Unwissendste schon einsieht, ob der Leib eröffnet ist, wenn Jemand von einer Krankheit befallen wird. Ein rationeller Arzt aber ist der, welcher das alles von der Vernunft ableitet, was den verstopften Leib eröffnet und den Durchfall stopft; ein empirischer dagegen, welcher sich bloß auf die Erfahrung beruft, und kein rationeller Arzt sein will. Bei ihm liegt daher die Kenntnis der Krankheiten außer dem Bereich der Kunst, und die Arzneikunde bleibt ganz innerhalb den Schranken der Erfahrung. Die Wissenschaft wird also durch die empirischen Ärzte nicht erweitert, sondern eingeschränkt, weil jene auf Vieles, diese dagegen nur auf das Leichteste und Gewöhnlichste ihr Augenmerk richten. Denn auch die Viehärzte befassen sich bloß mit dem Allgemeinen, da sie das Eigentümliche eines jeden von den vielen Tieren nicht zu erfassen vermögen. Auch auswärtige Völkerschaften sehen bloß auf das Allgemeine, da sie die subtilen Grundsätze der Arzneikunde nicht kennen. Auch diejenigen, welche die Kranken reichlich nähren, nehmen zu jenem Allgemeinen ihre Zuflucht, weil sie sich beim Einzelnen nicht mit der erforderlichen Umsicht zu raten wissen. Für wahr auch die alten Ärzte wussten jenes nicht weniger, aber sie blieben nicht dabeistehen. Daher sagt auch der älteste Schriftsteller Hippokrates, man müsse bei dem Heilgeschäfte sowohl auf die allgemeinen, als besondere Zufälle Rücksicht nehmen, Aber selbst diese können sich auf keinen Fall bei ihrer Lehrmethode beruhigen. Denn es sind sowohl die Gattungen der mit Verstopfung als der mit Durchfall verbundenen Krankheiten verschieden, und man kann dies am leichtesten bei den mit Durchfall verbundenen bemerken. Denn es ist ganz etwas anderes, Blut, etwas anderes, Galle, etwas anderes, Speisen wegzubrechen; etwas anderes, wenn sie durch den Stuhl weggehen, etwas anderes, wenn man an Bauchschmerzen leidet, etwas anderes, wenn man heftig schwitzt, etwas anderes, wenn man an Auszehrung leidet. Auch ergießt sich oft eine Flüssigkeit in gewisse Teile, wie z. B. in die Augen und Ohren, von welcher Gefahr kein menschliches Glied frei ist. Keines von diesen aber wird übereinstimmend geheilt. So geht die Arzneikunde, bei Betrachtung der mit Ausleerung verbundenen Krankheiten von dem Allgemeinen zu dem Besonderen über. Und auch hier muss man wieder oft den besonderen Zufall kennen, weil nicht das Nämliche bei allem, selbst nicht einmal ähnlichen Fällen Hilfe schafft. Es gibt nämlich gewisse Dinge, welche bei allen den Leib entweder verstopfen oder eröffnen. Doch findet man aber auch welche, wo dieses anders als bei den übrigen zu erfolgen pflegt.
Hier ist also die Untersuchung der allgemeinen Zufälle nachteilig, und nur die Untersuchung der eigentümlichen nutzenbringend. Oft wird die Krankheit gehoben, wenn man ihre Ursache in genaue Erwägung zieht. Deswegen hat auch der talentvollste Arzt unseres Zeitalters, den wir aufzuweisen haben, Cassius, einem Fieberkranken, der sich über heftigen Durst beschwerte, da er bemerkte, dass er in Folge von Trunkenheit erkrankt sei, kaltes Wasser zu trinken gegeben. Nachdem nun dieser hiervon getrunken, und durch seinen Zufluss die Kraft des Weines gebrochen hatte, so entschied sich das Fieber sogleich durch Schlaf und Schweiß. Dieses Hilfsmittel sah der Arzt glücklicherweise voraus, nicht dadurch, dass der Körper zu trocken oder zu feucht war, sondern aus der Ursache, welche vorausgegangen war. Auch diese Ärzte richten sich nach den Eigentümlichkeiten des Ortes und der Zeit, da diejenigen, welche sich hierüber streiten, was gesunde Menschen zu tun haben, wollen, dass man an ungesunden Orten oder bei übler Witterung, Kälte, Hitze, Überladung des Magens, schwere Arbeit und übermäßigen Beischlaf vermeide, dass man vielmehr an solchen Orten und zu solchen Zeiten sich der Ruhe bediene, wenn man eine gewisse Schwere im Körper fühlt, und dass man den Magen nicht durch Brechen und den Unterleib nicht durch Laxieren reize. So wahr diese Dinge sind, so gehen sie doch von dem Allgemeinen zu einigen Eigentümlichkeiten über, wofern wir nicht glauben, dass nur die Gesunden, nicht aber auch die Kranken Rücksicht zu nehmen hätten auf die Beschaffenheit des Himmels und der Jahreszeit, welchen jede Beobachtung umso notwendiger ist, als jede Schwächung dem Kranken weit nachteiliger ist. Ja selbst bei einem und demselben Menschen hat die Krankheit bald diese, bald jene Eigentümlichkeit, so dass der, welchen ganz geeignete Mittel nicht heilten, oft durch ganz entgegengesetzte. wieder hergestellt wurde. In Verordnung der Speisen wird der mannigfaltigste Unterschied gefunden, wovon ich hier nur ein einziges Beispiel anführen will. Den Hunger erträgt der Jüngling leichter als der Knabe, leichter bei einer dichten Luft, als bei einer dünnen, leichter im Winter, als im Sommer, leichter der, welcher sich nur an eine Mahlzeit, als der, der sich auch ans Frühstück gewohnt hat, leichter einer, der keine Bewegung macht, als einer, welcher sich bewegt. Oft muss man bei einem solchen, der den Hunger weniger ertragen kann, mit Reichung von Speisen. eilen. Deswegen ist es schicklich, dass derjenige, welcher das Eigentümliche nicht kennt, nur das Allgemeine berücksichtigen müsse, dass aber derjenige, welchem das Eigentümliche bekannt ist, das Allgemeine zwar nicht beiseitesetzen, sondern beides nebeneinander zu Rate ziehen müsse. Daher ist, bei gleich viel Kenntnissen, derjenige Arzt nützlicher, der den Kranken als Freund kennt, als wenn er ihm fremd ist. Damit ich aber wieder auf das mir vorgesteckte Ziel zurückkomme, so glaube ich, dass die Arzneikunde auf Gründen der Vernunft beruhen rationell sein müsse, glaube aber auch, dass sie aus Bemerkung der offenbaren Ursachen entstehe, so dass der Kunstverständige zwar allen verborgenen Ursachen nachdenken, aber nie auf die Kunst selbst anwenden soll. Es ist teils grausam, teils überflüssig, lebende Körper zu zergliedern, dagegen ist aber die Untersuchung der Leichen notwendig; denn man muss die Lage und die Ordnung der Teile kennen, welche beide Stücke bei Leichen besser, als bei lebenden und verwundeten Menschen sich bemerken lassen. Aber auch das Übrige, was sich nur bei Lebenden beobachten lässt, kann man bei Behandlung Verwundeter, zwar langsamer, aber auf eine weit mildere Art wahrnehmen und erlernen durch die Erfahrung. Nach diesen vorausgeschickten Sätzen werde ich zuerst erwähnen, wie die Gesunden sich zu verhalten haben, hernach aber auch zu dem übergehen, was sich auf die Krankheiten und deren Behandlung bezieht.
ErstesKapitel. Wie sich Gesunde zu verhalten haben.
Ein gesunder Mensch, der sich wohl befindet, und sich selbst überlassen ist, darf sich an keine bestimmten Vorschriften binden, und bedarf weder des eigentlichen Arztes noch der Hilfe derjenigen, welche sich mit dem Einsalben des Körpers abgeben (alipta). Er muss nicht notwendig eine einfache Lebensweise führen, muss sich bald auf dem Land, bald in der Stadt aufhalten, öfters Land- und Seereisen unternehmen, jagen, bisweilen ruhen, überhaupt aber sich häufige Bewegungen machen. Die Untätigkeit stumpft nämlich den Körper ab, Arbeit erstarkt ihn, jene bewirkt ein frühes Greisenalter, diese eine langdauernde Jugend. Es ist auch nützlich, bisweilen warm, bisweilen kalt zu baden, bisweilen sich salben zu lassen, bisweilen dieses zu unterlassen, keine Speise zu vermeiden, welche der gemeine Mann zu genießen pflegt, zuweilen an Gastmahlen Teil zu nehmen, zuweilen sich wieder davon zurückzuziehen, bald mehr als gewöhnlich, bald wieder weniger zu essen, lieber zweimal des Tags, als nur einmal Speisen zu sich zu nehmen, und immer soviel, als man verdauen kann. Wie aber derartige Übungen und Speisen nötig sind, so sind die sogenannten athletischen überflüssig. Denn auch die wegen einigen obrigkeitlichen Obliegenheiten gestörte Ordnung, in Betreff der Körperbewegung, schadet dem Körper, und Personen, welche nach Art der letzteren (der Athleten) sich anfüllen, werden sehr frühe alt und erkranken. Auch den Beischlaf muss man nicht zu häufig ausüben, aber sich auch nicht zu sehr von ihm enthalten. Seine seltene Ausübung ermuntert den Körper, seine häufigere Ausübung dagegen schwächt ihn. Da aber in Beziehung auf die Häufigkeit es nicht gerade auf die Zahl ankommt, sondern auf die Natur, in Rücksicht des Alters und des Körpers, so dient zu wissen, dass er nicht nachteilig einwirkt, wenn auf ihn weder eine Schwäche des Körpers noch Schmerz erfolgt. Er ist schädlicher bei Tage als bei Nacht, doch so, dass man auf seine Ausübung unmittelbar weder eine Mahlzeit, noch Wachen, noch Arbeit folgen lässt. Dieses haben Gesunde zu beobachten und zu verhüten, damit sie sich nicht, in gesunden Tagen, die Mittel entziehen, welche gegen Krankheiten schützen.
Zweites Kapitel.Was Magenschwache zu beobachten haben.
Magenschwache (wozu ein großer Teil der Städter, und fast alle, welche sich auf Wissenschaften verlegen, gehören) müssen sich mehr in Acht nehmen, damit ihnen dasjenige durch Sorgfalt ersetzt wird, was ihnen durch die Beschaffenheit ihres Körpers, die Lage ihres Wohnortes und die Art ihrer Studien entzogen ist. Hieraus geht also hervor, dass derjenige, welcher gut verdaut, ohne Bedenken früh aufstehen kann, wer aber schwache Verdauungskraft besitzt, muss ruhen, und wenn er früh aufstehen musste, sich wieder schlafen legen. Wer nicht verdaut, muss sich immer ruhig verhalten, und darf weder arbeiten noch sich bewegen, noch sich sonst beschäftigen. Wer ohne Magenschmerz Aufstoßen hat, der muss bisweilen kaltes Wasser trinken, und zu Hause bleiben. Er muss aber in einem hellen Zimmer wohnen, welches im Sommer luftig ist, im Winter aber die Sonne hat, und muss sich vor der Mittagssonne, der Morgen- und Abendkälte, auch der Ausdünstung der Flüsse und Sümpfe, in Acht nehmen, und sich namentlich nicht bei nebliger Luft der Sonne aussetzen, damit nicht bald Kälte, bald Wärme einwirke; welche Verhältnisse am meisten Schnupfen und Katarrh erzeugen. Mehr aber hat man dieses an jenen ungesunden Orten zu vermeiden, wo sie bisweilen die Pest verursachen. Aber man muss wissen, dass der Körper gesund sei, wenn täglich der Urin früh morgens weiß, nachher rötlich ist. Jenes zeigt an, dass man verdaue, dieses, dass man bereits verdaut hat. Wo man aufgestanden ist, da muss man einige Zeit verweilen, hernach aber, wenn es nicht gerade Winterszeit ist, den Mund mit vielem kaltem Wasser ausspülen, in den langen Tagen lieber vor, wenn dieses nicht angeht, nach dem Essen schlafen, den Winter hindurch aber hauptsächlich während der ganzen Nacht schlafen. Muss man aber in der Nacht arbeiten, so soll dieses nicht sogleich nach dem Essen, sondern nach vollbrachter Verdauung geschehen. Halten aber einen häusliche oder bürgerliche Geschäfte untertags ab, so muss er auch einige Zeit auf die Pflege seines Körpers verwenden. Die erste Pflege desselben ist aber Bewegung, die allezeit dem Essen vorangehen soll; sie kann bei dem, der wenig gearbeitet und gut verdaut hat, gelinder, bei demjenigen aber, der daran gewöhnt ist, und weniger gut verdaut hat, stärker sein. Schickliche Bewegungen sind aber: lautes Lesen, Fechten, Ballspiel, Laufen, Spazierengehen; allein dieses soll nicht bloß auf ebenem Wege geschehen. Das Bergan- und Bergabsteigen ist nämlich besser, insofern es den Körper auf eine verschiedene Weise bewegt, vorausgesetzt, dass derselbe nicht zu sehr geschwächt ist. Auch ist die Bewegung besser in der freien Luft, als in den bedeckten Hallen, besser, wenn es der Kopf verträgt, in der Sonne, als im Schatten, besser im Schatten von Gesträuchen und Hainen, als im Schatten eines Daches, besser gerade vor sich hin, als in Beugungen. Aber man muss am Ende jeder Bewegung, meistens in Schweiß geraten, oder es soll wenigstens Mattigkeit eintreten, welche sich übrigens nie zur wirklichen Ermüdung steigere, dieses muss man bald mehr, bald weniger tun. Allein man muss sich auch nicht nach dem Beispiel der Athleten hierbei richten, oder pünktlich nach gewissen Vorschriften, oder übermäßig arbeiten. Auf die Bewegung folgt gewöhnlich bald die Salbung, entweder an der Sonne oder dem Feuer, bald das Baden, aber in einem soviel als möglich hohen, hellen und geräumigen Zimmer. Von diesen darf aber nicht immer beides zugleich geschehen, sondern das eine öfter, als das andere, wie es gerade dem betreffenden Körperzustande angemessen ist. Nach diesem soll einige Ruhe eintreten. Kommt man nun zu Tische, so ist Übersättigung als schädlich zu umgehen. Oft ist eine zu große Enthaltsamkeit schädlich; oft ist, wenn je Unmäßigkeit stattfindet, diese in Beziehung aufs Trinken schädlicher als in Beziehung aufs Essen. Es ist besser, die Mahlzeit mit Eingesalzenem, Zugemüsen u. dgl. anzufangen; dann soll Fleisch kommen, welches gebraten am besten ist, oder auch gesotten. Alles Eingemachte ist aus zweierlei Ursachen schädlich, einmal weil man wegen des süßen Geschmackes mehr hiervon verzehrt, und hernach, was hiermit übereinstimmend ist, weil es doch schwer verdaut wird. Der Nachtisch schadet einem guten Magen nichts, bei einem schwachen aber erzeugt er Säure. Befindet sich einer daher hierbei weniger wohl, so muss er den übrigen Speisen den Genuss von Datteln, Äpfeln u. dgl. voranschicken. Hat man über Bedürfnis getrunken, so soll man nichts essen, und hat man zur Genüge gegessen, so soll man nichts arbeiten. Hat man aber zu viel gegessen, so verdaut man leichter, wenn man kaltes Wasser trinkt, dann einige Zeit wachend zubringt, und nachher gut schläft. Wenn einer den Tag über sich überladen hat, so soll er sich, nach der Mahlzeit, weder der Kälte noch der Wärme aussetzen noch sich einer Arbeit unterziehen; denn dieses schadet einem nüchternen Körper nicht so leicht, wie einem mit Speisen vollgestopften. Wenn je einer aus gewissen Ursachen fasten will, so muss er jede Arbeit vermeiden.
Drittes Kapitel. Einige Beobachtungen über außergewöhnliche Verhältnisse, über die Verschiedenheit des Körpers und des Geschlechts, des Alters und der Jahreszeiten.
Dieses hier Erwähnte sind zwar fast lauter unabänderliche Verhältnisse, dessen ungeachtet aber machen ungewöhnliche Umstände, die Verschiedenheit des Körpers und des Geschlechtes, das Alter und die Jahreszeiten einige Bemerkungen erforderlich. Denn es ist ebenso wenig ratsam, von einem gesunden Ort in einen ungesunden, als umgekehrt von einem ungesunden in einen gesunden plötzlich überzugehen. Es ist besser, sich gleich zu Anfange des Winters aus einer gesunden Stätte in eine ungesunde zu begeben, und zu Anfange des Sommers von einem ungesunden Orte in einen gesunden überzugehen. Aber es ist nicht ratsam auf lange angehaltenem Hungern zu große Übersättigung folgen zu lassen, noch auf zu große Übersättigung Hungern. Auch schadet sich derjenige, welcher nur einmal des Tages, wie derjenige, welcher zweimal täglich sich übermäßig mit Speisen überfüllt, wenn es gegen seine Gewohnheit ist. Ebenso ist auch der plötzliche Übergang von anhaltender Arbeit zur behaglichen Ruhe, als umgekehrt von behaglicher Ruhe zur schweren Arbeit sehr schädlich. Also wird einer, der je etwas abändern will, sich erst nach und nach daran gewöhnen müssen. Sowohl der Knabe als der Greis verträgt jede Art von Arbeit leichter als ein Mensch, der nie daran gewohnt ist. Deswegen ist auch ein allzu ruhiges Leben nicht dienlich, weil im Verlaufe des Lebens Arbeit zur Notwendigkeit werden kann. Wenn aber doch Jemand, der nicht daran gewohnt ist, gearbeitet hat, oder wenn er an Arbeit gewohnt war, mehr arbeitete als er sonst zu tun pflegte, so muss er sich nüchtern schlafen legen, und dieses umso mehr, wenn sein Geschmack bitter ist, wenn es ihm schwarz vor den Augen wird, oder sein Unterleib in Unordnung ist. Denn er muss alsdann nicht nur nüchtern zur Ruhe gehen, sondern auch den folgenden Tag so fortfahren, wenn die Ruhe diese Zufälle nicht schnell hebt. Wenn dieses geschehen' ist, so muss man aufstehen, und sich gelinde Bewegung machen. Wenn aber der Schlaf sich nicht als Bedürfnis darstellen sollte, weil man nur mäßig gearbeitet hat, so muss man doch, auf die angegebene Weise, einige Zeit spazieren gehen. Denjenigen aber, welche nach einer Ermüdung Speise zu sich nehmen wollen, dient zur allgemeinen Regel, dass, nachdem sie einen kleinen Spaziergang gemacht haben, bei Umgehung des Bades, sie sich an einem warmen Orte, im Sonnenschein, oder am Feuer sich salben lassen und schwitzen; baden sie aber, so müssen sie vor allen Dingen ins Schwitzbad sitzen, und nachdem sie hierauf einige Zeit der Ruhe gepflegt hatten, ins Bad gehen, und in die Badewanne steigen; dann mit vielem Öl salben und gelinde einreiben lassen, dann wieder in die Badewanne steigen); nach diesem sodann den Mund zuerst mit warmem, hernach mit kaltem Wasser ausspülen. Für diese ist ein heißes Bad nicht passend. Wenn sich daher einer bis beinahe zum beginnenden Fieber ermüdet hat, so genügt es für ihn, wenn er sich an einen warmen Ort begibt, sich bis an die Hüften in warmes Wasser, dem etwas Öl zugesetzt ist, setzt, nachher zwar den ganzen Körper, besonders aber diejenigen Teile, die im Wasser gewesen sind, mit Öl, dem Wein und etwas zerstoßenes Salz zugemischt ist, gelinde einreiben lässt. Nach diesem ist sodann allen Ermüdeten der Genuss der Speisen zu empfehlen, jedoch mehr der flüssigen, und zum Getränke Wasser oder ein anderer verdünnter Trunk, namentlich aber ein solcher, welcher auf den Urin wirkt. Auch muss man wissen, dass Jedem, welcher über der Arbeit schwitzt, ein kalter Trunk höchst gefährlich ist, auch ist er, wenn der Schweiß bereits auch schon nachgelassen hat, Jedem von der Reise Ermüdeten schädlich. Auch hält Asklepiades denselben schädlich für solche, die so eben aus dem Bade kommen. Dieses ist für diejenigen wahr, deren Unterleib leicht und, nicht zum Vorteil, zum Durchfall sich hinneigt, oder welche leicht von Schauer befallen werden; doch ist dieses nicht immer bei allen der Fall, da es vielmehr natürlich ist, dass ein erhitzter Magen durch das Getränk erfrischt, und ein erkälteter erwärmt wird. Dieses ist zwar meine Meinung, doch will ich nicht, dass man deswegen bei noch schwitzendem Körper kalt trinken soll. Auch pflegt nach dem Genuss verschiedener Speisen und vieler verdünnender Getränke Brechen, und am anderen Tage anhaltende Ruhe und nachher mäßige Bewegung von Nutzen zu sein. Wenn anhaltende Mattigkeit vorhanden ist, so muss man abwechslungsweise bald Wasser, bald Wein trinken, übrigens selten des Bades sich bedienen. Auch erleichtert Abwechslung der Arbeit die Ermüdung, und den, welchen eine ungewohnte Arbeit ermüdet, stärkt die, woran er gewohnt ist. Einem Ermüdeten ist tägliche Ruhe sehr zuträglich, bei dem hingegen, der nicht daran gewöhnt ist, vermehrt es die Schwäche. Denn alles Ungewohnte schadet, es mag angenehm oder beschwerlich sein. Etwas ganz Eigenes findet sich bei demjenigen vor, welcher sich durch einen Spaziergang ermüdet. Diesen stärkt selbst ein während dem Gehen fortgesetztes Reiben; nach vollendeter Bewegung soll er zuerst sitzend ausruhen, dann sich salben lassen, dann sich in eine Badewanne setzen und mehr die oberen Teile, als die unteren mit warmem Wasser bähen. Wenn einem aber die Sonnenhitze sehr zugesetzt hat, so muss er zuerst ins Bad gehen, und den Leib und Kopf mit Öl begießen lassen, dann sich in eine gut erwärmte Badewanne setzen und den Kopf mit vielem Wasser übergießen lassen, und zwar zuerst mit warmem, dann mit kaltem. Wen es aber sehr gefroren hat, der muss zuerst in ein bedecktes Bad sitzen, bis er zu schwitzen beginnt, dann sich salben lassen, nachher waschen und mäßig Speisen und unvermischte Getränke genießen. Derjenige aber, welcher eine Seereise gemacht hat und von Ekel befallen worden ist, muss, wenn er viele Galle ausgebrochen hat, sich entweder des Genusses der Speisen gänzlich enthalten, oder nur etwas Weniges essen. Wenn er aber sauren Schleim weggebrochen hat, so muss man schlechterdings Speisen zu sich nehmen, nur müssen sie leichter als gewöhnlich sein; bestand aber bloß Ekel, ohne wirkliches Erbrechen, so muss man entweder fasten, oder nach dem Essen sich erbrechen. Wer aber den ganzen Tag im Wagen oder im Schauspiel sitzt, diesem taugt das Laufen nichts, sondern er muss nur gelinde Bewegung machen. Ein längerer Aufenthalt im Bade, und eine sparsame Mahlzeit pflegt diesen gut zu tun. Wer im Bade Wallungen bekommt, den erfrischt in den Mund genommener und darin gehaltener Essig, in Ermanglung desselben leistet kaltes Wasser, auf dieselbe Weise genommen, dieselben Dienste. Vor allen Dingen muss er aber die Natur seines Körpers kennen, weil einige schlank, andere beleibt, einige feurig, andere kaltblütig, einige feucht, andere trocken, einige zur Verstopfung, andere zum Durchfall geneigt sind. Selten gibt es Jemand, welcher nicht irgendeinen schwächeren Teil an seinem Körper hätte. Ein hagerer Mensch muss sich aber mästen, ein wohlbeleibter sich schlank zu machen suchen, ein Hitzkopf sich abkühlen, ein kaltblütiger sich mehr anfeuern, ein feuchter sich trocknen, ein trockener dagegen anfeuchten; ferner der, dessen Leib zum Durchfall hinneigt, muss denselben stärken, und wenn Neigung zur Verstopfung besteht, den Leib eröffnen. Man muss immer am meisten demjenigen Teil zu Hilfe kommen, welcher gerade der leidende ist.
Die Ernährung des Körpers fördert: mäßige Bewegung, häufiger Genuss der Ruhe, Salben, Baden nach dem Frühstück, Mangel an Durchfall, mäßige Winterkälte, ruhiger, nicht allzu langer Schlaf, weichliches Bett, Ruhe des Geistes, süße, fette Speisen und Getränke, wiederholt reichliche Mahlzeit und gute Verdauung.
Zur Abmagerung des Körpers trägt bei: warmes Wasser, wenn man sich darin badet, besonders wenn es gesalzen ist, nüchtern genommenes Bad, brennende Sonnenhitze und jede Wärme, Sorgen, Nachtwachen, allzu langer oder zu kurzer Schlaf, Schlafen auf der Erde im Sommer, unnachgiebiges Bett im Winter, Laufen, häufige Bewegung und jede anstrengende Leibesübung, Erbrechen, Abführung, saure und herbe Speisen, täglich nur eine Mahlzeit halten, und die Gewohnheit, nüchtern lauwarmen Wein zu genießen. Da ich aber unter den Ursachen der Abmagerung Brechen und Abführen erwähnt habe, so muss von diesen noch einiges Besonderes erörtert werden. Ich sehe, dass von Asklepiades in dem Werk, welches er über die Erhaltung der Gesundheit schrieb, das Brechen verworfen worden ist, und ich tadle ihn deshalb nicht, wenn er über die Gewohnheit derjenigen sich ärgert, welche sich durch tägliches Erbrechen die Fähigkeit viel zu essen sich anzueignen suchen. Man hat es auch hierin zu weit getrieben. Derselbe Schriftsteller verwirft aber auch, in dem angeführten Werk, die Abführungen. Diese sind allerdings schädlich, wenn sie durch zu heftig wirkende Mittel bewirkt werden. Allein diese sind doch nicht unter allen Umständen zu verwerfen, weil die Beschaffenheit des Körpers und der Jahreszeiten sie notwendig machen können, wenn sie nur mit Maß und nicht ohne Not gereicht werden. Daher hat er auch selbst behauptet, dass man verdorbene Substanzen aus dem Körper schaffen müsse. Daher muss man diese Angelegenheit nicht ganz verwerfen. Allein es können auch mehrere Ursachen hierzu da sein, und man muss daher eine genauere Untersuchung hierüber anstellen.
Das Brechen ist nützlicher im Winter als im Sommer; denn zu dieser Zeit häuft sich der Schleim mehr an, und die Eingenommenheit des Kopfes ist größer. Hagern Personen und Leuten mit einem schwachen Magen ist es nicht dienlich; dagegen vertragen es gut fette, vollgallige Personen, wenn sie sich entweder zu sehr mit Speisen angefüllt oder nicht gehörig verdaut haben. Denn hat man mehr gegessen, als man verdauen kann, so muss man nicht auf Gefahr hin lange zuwarten, damit das Genossene nicht verderbe; wenn es schon in einen verdorbenen Zustand übergegangen, so ist nichts geeigneter dagegen, als das Brechen, weil man dadurch dasselbe auf dem nämlichen Wege wieder ausleeren kann, auf welchem es dahin gelangt ist. Man muss daher, sobald bitteres Aufstoßen mit einem Gefühl von Schwere in der Magengegend besteht, sogleich zu diesem Mittel seine Zuflucht nehmen. Ferner ist es demjenigen zuträglich, der ein beängstigendes Gefühl auf der Brust hat, dem sich viel Speichel in der Mundhöhle sammelt, der Ekel, Brausen vor den Ohren, in Wasser schwimmende Augen und bitteren Geschmack hat. Auf ähnliche Weise sagt es auch denen welche das Klima oder den Ort verändern, und endlich auch solchen, die, wenn sie mehrere Tage nicht gebrochen haben, Schmerz in der Magengegend empfinden. Ich weiß recht wohl, dass man unter diesen Verhältnissen Ruhe empfohlen hat, welche sich bei der arbeitenden Volksklasse nicht immer in Anwendung bringen lässt, und auch nicht bei allen die nämliche Wirkung hervorbringt. Ich glaube daher, dass jenes nicht aus Wollust geschehen müsse; indessen glaube ich auch, meinen Erfahrungen zufolge, dass es bisweilen mit Recht der Gesundheit zuliebe geschehe. Doch erinnere ich, dass nicht jeder, der gesund sein und alt werden will, dieses täglich so halten soll. Wer nach dem Essen brechen will, der muss, wenn man sich leicht erbricht, nur vorher laues Wasser nehmen, geht dieses aber schwer vor sich, so mische er dem Wasser etwas Salz oder Honig bei. Wer aber morgens brechen will, der muss vorher eine Vermischung von Wasser und Honig (Met) oder Ysoptee trinken, oder Rettiche essen, nach dem aber, wie oben schon erwähnt ist, laues Wasser trinken. Alles, was die übrigen Ärzte empfohlen haben, greift den Magen an. Wenn das Brechen vorbei ist, so muss man, wenn der Magen schwach ist, etwas Weniges, aber dem Zustande des Magens Entsprechendes essen, und drei Becher) kaltes Wasser trinken. Wenn aber das Brechen Rauigkeit des Halses bewirkt hat, so muss derjenige, welcher früh morgens gebrochen hat, spazieren gehen, dann sich salben lassen, hernach zu Tische gehen. Nach Tisch muss er sodann am folgenden Tage sich waschen und im Bade schwitzen, hierauf als schicklichste Speise eine mäßig nährende genießen, bestehend aus altbackenem Brot, einem herben unvermischten Weine, gebratenem Fleisch, und überhaupt lauter Speisen, die soviel als möglich trocken sind. Wer sich zweimal des Monats erbrechen will, wird besser tun, wenn er zwei Tage hintereinander fortfährt, als wenn er nach dem fünfzehnten Tage wieder brechen wollte, es sei denn, dass diese Zögerung ein Gefühl von Schwere auf der Brust bewirkt.
Die Ausleerung durch den Stuhl muss auch durch Arzneimittel eingeleitet werden, in Fällen, wo bei bestehender Verstopfung nur wenig entleert wird und in Folge hiervon Aufblähung des Leibes, Dunkelheit vor den Augen, Kopfschmerz und andere Zufälle der oberen Körperteile sich einstellen. Denn was kann unter diesen Umständen Ruhe und Fasten helfen, durch welche jene Zufälle meistens entstehen? Wer sich ausleeren will, bediene sich zuerst solcher Speisen und solcher Weine, welche unterstützend darauf hinwirken. Wenn nachher jene wenig helfen, so nehme er Aloe. Allein auch Abführungen bringen, wenn sie gleich bisweilen notwendig sind, Gefahr, wenn sie zu häufig erfolgen; denn die Ernährung des Körpers leidet dadurch Not und wird eben dadurch geschwächt, da bei allen Krankheiten Schwäche am meisten gefährlich ist.
Die Erwärmung des Körpers befördern: das Salben, gesalzenes Wasser, namentlich wenn es warm ist, alles Gesalzene, Bittere, Fleischige, Baden nach dem Essen, herber Wein. Dagegen kühlen, wenn man im nüchternen Zustande badet und schläft, jedoch nicht zu lang, alles Saure, möglichst kaltes Wasser, und dem Wasser zugemischtes Öl.
Den Körper feuchten an: weniger arbeiten, als man sonst gewohnt ist, häufiges Baden, reichliche Mahlzeit, vieles Trinken und nachher Spazierengehen und Wachen. An und für sich tragen hierzu auch bei vieles und längeres Spazierengehen, früh morgens Bewegung machen und nicht sogleich Speisen zu sich zu nehmen; ferner Genuss solcher Speisen, die aus kalten, den Regen ausgesetzten und feuchten Orten kommen. Dagegen trocknen: übermäßige Bewegung, Hunger, Salben ohne Wasser, Wärme, zu heftige Einwirkung der Sonnenhitze, kaltes Wasser, Genuss von Speisen, unmittelbar nach der Bewegung, namentlich solcher Speisen, die man aus trockenen und heißen Orten erhält.
Den Leib verstopft: Arbeit, sitzende Lebensart, Bestreichen des Körpers mit Töpferthon, schmale Diät, nur einmal eine Mahlzeit halten, wenn man zwei gewohnt ist, weniger trinken und nur dann, wenn man viele Speisen zu sich genommen hat, Ruhe nach Tisch. Im Gegenteil wirken aber eröffnend: vermehrte Bewegung und häufigeres Essen und hierauf folgende Bewegung und gleichzeitige Verbindung des Trinkens mit dem Essen. Auch muss man wissen, dass das Brechen den Durchfall hemmt, und die Verstopfung hebt. Auch wirkt stopfend Erbrechen, welches gleich auf das Essen erfolgt, dagegen eröffnet es, wenn es erst später eintritt.
Was nun das Alter betrifft, so erträgt das Mittelalter das Fasten am leichtesten, schon weniger die Jünglinge, und am wenigsten die Knaben, und die im hohen Alter stehen. Je weniger man dieses erträgt, desto öfter muss man Speise zu sich nehmen, und am meisten bedarf man dieses im noch wachsenden Alter. Warme Waschungen sind sowohl dem Knaben als dem Greisen zuträglich. Dem Knaben bekommt verdünnter, dem Greisen lauterer Wein gut, keinem von beiden aber sagt zu, was Blähungen erregt. Bei Jünglingen kommt weniger darauf an, was sie zu sich nehmen und wie sie behandelt werden. Wer in den Jugendjahren mehr flüssigen Stuhlgang hat, leidet meistens im höheren Alter an Verstopfung; wer aber in der Jugend verstopft ist, hat im Alter oft flüssigen Stuhl. Besser ist es aber in der Jugend offenen Leib zu haben, und im Alter verstopft zu sein.
Auch auf die Jahreszeiten muss man Rücksicht nehmen. Im Winter muss man mehr essen, und weniger, aber desto unvermischtere Getränke trinken, viel Brot essen, mehr gesottenes Fleisch, mäßig Zugemüse; nur einmal des Tags essen, ausgenommen, wenn der Leib zu verstopft ist. Wenn man zu Mittag speist, so ist es besser, nur etwas Weniges und zwar trockene Speisen, ohne Fleisch und ohne Getränke zu genießen. Zu derselben Jahreszeit muss man auch mehr lauter warmer Speisen sich bedienen, oder wenigstens solcher, welche Wärme erzeugen; der Genuss der Liebe ist sodann nicht so gefährlich. Im Frühling muss man aber nur wenig essen und mehr trinken, doch mehr verdünnte Getränke; mehr Fleisch und mehr Gemüse genießen, doch muss man allmählig den Übergang vom Gesottenen zum Gebratenen einleiten. In dieser Jahreszeit kann man ohne Anstand den Trieben der Liebe pflegen. Im Sommer bedarf der Körper öfters des Genusses des Trankes und der Speise, daher ist es passend, auch zu Mittag zu essen. In dieser Jahreszeit sind am dienlichsten: Fleisch und Gemüse, möglichst verdünntes Getränke, welches sowohl den Durst, stillt, als auch den Körper nicht erhitzt, kaltes Wasser, gebratenes Fleisch, kalte Speisen, oder solche, welche kühlen. Je öfter man essen muss, desto weniger muss man auf einmal essen. Den Herbst hindurch ist wegen der veränderlichen Witterung die Gefahr am größten. Daher darf man weder ohne Kleider noch ohne Schuhe gehen, besonders an den kälteren Tagen; zur Nachtzeit nicht unter freiem Himmel schlafen, oder sich wenigstens gut bedecken. Man muss sich weniger, aber desto nahrhafterer Speisen bedienen, aber stärkere Getränke zu sich nehmen '). Einige glauben, dass Obst schädlich sei, wenn man es unmäßig und den ganzen Tag über meistens so genießt, dass nicht auch etwas von anderen nahrhaften Speisen zu sich genommen wird. Nicht dieses ist also an sich schädlich, sondern bloß die Art des Genusses. Bei nichts ist zwar das Übermaß weniger schädlich als bei diesen, allein dessen ungeachtet soll man doch nicht häufiger Obst, als andere Speisen genießen. Wenigstens ist es nötig, wenn sich dieses ereignet, mitunter eine derbere Speise zu genießen. Weder im Sommer noch im Herbst bekommt Genuss der Liebe gut. Doch ist er noch zulässiger im Herbst als im Sommer, wo man ihn, wenn es möglich ist, durch seine ganze Dauer hindurch zu vermeiden hat.
Viertes Kapitel.Von denen, welche an irgendeinem Teil des Körpers, und zwar zuerst von denen, die an Schwäche des Kopfes leiden.
Zunächst muss ich nun von denen handeln, welche an Schwäche irgendeines Teiles des Körpers leiden. Wer einen schwachen Kopf hat, der muss ihn, wenn er gut verdaut hat, früh morgens mit seinen Händen gelinde reiben, ihn, wo immer möglich, niemals bedecken, oder ihn bis auf die Haut abscheren lassen, auch ist es gut, dem Mondscheine auszuweichen, namentlich aber vor der Zusammenkunft des Mon





























