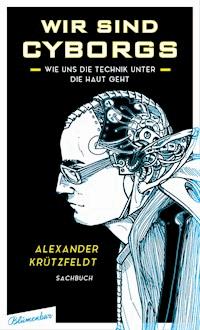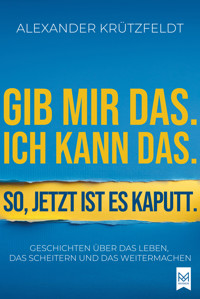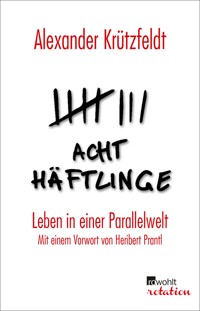
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Gefängnis ist ein Mikrokosmos, abgeriegelt von der Außenwelt, vom Alltag der anderen. Acht Häftlinge erzählen in diesem E-Book von ihrem Leben und dem Leben hinter Gittern: Einblicke in die Maschinerie eines unbekanntes Systems, in Hierarchien und Gewalt, Sex und Drogen, Kontrolle und Angst – und in das Innere von acht Menschen, die die Gefangenschaft verändert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Alexander Krützfeldt
Acht Häftlinge
Leben in einer Parallelwelt
Über dieses Buch
Das Gefängnis ist ein Mikrokosmos, abgeriegelt von der Außenwelt, vom Alltag der anderen. Acht Häftlinge erzählen in diesem E-Book von ihrem Leben und dem Leben hinter Gittern: Einblicke in die Maschinerie eines unbekanntes Systems, in Hierarchien und Gewalt, Sex und Drogen, Kontrolle und Angst – und in das Innere von acht Menschen, die die Gefangenschaft verändert hat.
Vita
Alexander Krützfeldt arbeitet u.a. für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, Krautreporter, Vice und die taz und kuratiert für piqd.de besonders gute Reportagen.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: Jessy Asmus/Süddeutsche Zeitung
ISBN 978-3-644-40529-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Namen aller Gesprächspartner mussten geändert werden. Einige Gesprächsparter werden namentlich auf eigenen Wunsch nicht erwähnt. Wir bedanken uns für ihr Vertrauen.
Recherche und Urheberin der Radiobeiträge: Eva Achinger
Die im Dunkeln sieht man nichtVorwort von Heribert Prantl
Strafvollzug war und ist der Versuch, an Menschen, die man kaum kennt, unter Verhältnissen, die man wenig beherrscht, Strafen zu vollstrecken, um deren Wirkung man nicht viel weiß. Wie ein guter Strafvollzug aussehen könnte, das war einmal ein großes Thema in Deutschland.
An den Universitäten gab es vor Jahrzehnten «Knastfeste», die auf Missstände in den Gefängnissen aufmerksam machen wollten. Der Geist der 68er-Jahre rüttelte an den Gittern, oft und gern wurde von den «Unterprivilegierten» gesprochen und über die fehlende Kommunikation «von draußen nach drinnen». Der Bundespräsident Gustav Heinemann sprach vom «Staatsbürger hinter Gittern». Und in dem Reformgesetz, das vor 40 Jahren in Kraft trat, stehen höchst anspruchsvolle Sätze, zum Beispiel: «Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen.» Lachhaft? Nein, aber es ist schwer, wenn im Gefängnis «aus demotivierenden Umständen sozialkonstruktives Verhalten entstehen soll», wie es der Kriminologe Heinz Müller-Dietz formuliert hat.
Die Debatte darüber, wie die Zustände in der Haft motivierender werden könnten, ist fast verstummt. Das liegt nicht an der Höhe der Gefängnismauern. Gewiss: Mauern verhindern nicht nur den Ausbruch der Gefangenen, sondern auch den Einblick der Öffentlichkeit. Aber das war immer so. Geändert hat sich vor elf Jahren, dass für den Strafvollzug nicht mehr der Bund, sondern die Länder zuständig sind. Das hat die Föderalismusreform, gegen den Protest der gesamten Fachwelt, im Jahr 2006 verfügt. Die Bundesländer haben sodann ihre jeweils eigenen Strafvollzugsgesetze geschrieben, und die sind gar nicht so schlecht geworden, wie das damals befürchtet worden war. Der Wettlauf der Schäbigkeit, von vielen Wissenschaftlern vorhergesagt, hat nicht stattgefunden.
Aber: Es gibt seit der Föderalismusreform einen Quantitäts- und einen Qualitätsverlust in der öffentlichen Diskussion über den Reformbedarf im Strafvollzug. Es fehlen Diskussionsanstöße, weil das nationale Forum fehlt, wenn Bundestag und Bundesrat für dieses Thema nicht mehr zuständig sind. Es fehlen Diskussionsanstöße, wenn der Bundesjustizminister sich zum Strafvollzug nicht mehr zu Wort meldet – und der Bundespräsident auch nicht.
Die Debatte über den Strafvollzug ist leider zerstückelt und damit minimalisiert, sie findet und fand zwar noch in den einzelnen Ländern statt, aber sie findet nicht mehr zusammen. Die Föderalismusreform hat damit etwas Schlimmes angerichtet: Sie hat die Wissenschaft vom Strafvollzug marginalisiert – und sie hat die gesellschaftliche Debatte über den Strafvollzug gekillt. Der Titel einer Schrift über den Strafvollzug und seine Probleme aus dem Jahr 2005 heißt, nach dem Motto von Bert Brecht aus der «Dreigroschenoper»: «Die im Dunkeln sieht man nicht». Man sieht sie heute noch weniger als damals.
«Acht Häftlinge» soll dazu beitragen, das Dunkel zumindest ein wenig aufzuhellen.
Gefangen in der Ohnmacht
Dinge, auf die Karl jetzt verzichten muss: Rinderrouladen.
Rouladen gehen direkt auf die Hüfte, sagt Karl, der, kurz nachdem er mit dem Alkohol vor etwa 15 Jahren aufgehört hat, mit dem Essen anfing. Dann war er zur Kur, Bluthochdruck und Asthma. Und so gesehen, sagt Karl, wird das alles gut im Gefängnis, auf keinen Fall will er da zunehmen.
Sport hat Karl bisher einmal die Woche im Fitnesscenter gemacht – Karl sagt: «Fitnesszentrum» –, von der AOK finanziert. War beides immer recht anstrengend, das mit dem Sport, aber auch das mit der AOK.
Schwieriger: Zitronensaft. Seit Karl zur Kur war, trinkt er ausschließlich Mineralwasser mit Zitronensaft. Nicht den aus Zitronen, sondern das Konzentrat aus den Plastikflaschen, die wie Zitronen aussehen. Die im Knast? Sicher nicht. Übrig bleibt also nur Wasser.
Aber am schwersten wird: Handy und Internet.
Es sind typische Gedanken vor dem Haftantritt, die Karl hat. Mit ihnen betritt Karl um Punkt 13 Uhr, wie es auf der Ladung steht, die Justizvollzugsanstalt, die einst ein Schloss war und dieser Zeit noch hinterhertrauert. Was wird aus mir, was wird aus den anderen? Karl denkt an seine Freunde, sie sind seine Familie. Seine Eltern sind beide tot, eine Frau hat er nicht, Kinder auch nicht, er hat seine Gründe.
Wird, denkt Karl. Wird schon werden.
Aber was wird? Was bedeutet das überhaupt: Strafvollzug? Wie ist es, die Freiheit zu verlieren? Was macht das mit den Menschen, die in den Zellen sitzen – und jenen, die draußen warten?
Gefängnisse sind tote Winkel unserer Gesellschaft, Menschen verschwinden hinter Mauern – und damit aus unserer Wahrnehmung. Sie haben keine Stimme, weil die Gesellschaft sich draußen vor ihnen fürchtet. Aber sie haben viel zu erzählen, über ihr Schicksal, ihre Sorgen und Ängste und über das System, das sich Strafvollzug nennt. Ein Mikrokosmos, der sich Blicken von außen fast vollständig entzieht.
In Deutschland gibt es 166 Haftanstalten für Erwachsene. Etwa 63000 Menschen sitzen ein, darunter 3600 Frauen. Das sind die offiziellen Zahlen der Behörden. Dem Statistischen Bundesamt zufolge leben aber pro Jahr insgesamt 200000 Menschen in Haftanstalten, weil durch kürzere Strafen die Gefängnisbetten mit dem Faktor 3,6 in einem Jahr belegt würden.
Das Gefängnisnetz ist ein neuronales: Kleine Haftanstalten in der Provinz haben etwa 200 Plätze. Große, die in Ballungszentren der Bundesrepublik als Knotenpunkte dienen, haben mehr als 1000 Insassen. Sie sind spezialisierte Städte in den Städten, in sich geschlossene Gesellschaften, die eine eigene Mülltrennung haben, Bäckereien und Zeitungsredaktionen. Manche stehen im Nichts, auf Wiesen, andere in Innenstädten. Und wenn man den Haftanstalten näher kommt, sieht man die Polizeiautos und die großen Busse mit ihren Gitterfenstern, die an den Wochentagen über das Land fahren und Häftlinge bringen wie der Schulbus die Kinder.
Das größte Gefängnis Deutschlands ist die JVA München. Dann kommt Köln. Dann Berlin-Tegel. Die Zahlen variieren je nach Quelle.
Karl ist auf dem Land, im Süden der Republik.
Wegen der Sache mit dem Handy wäre er fast zu spät gekommen, dann hätten sie Karl zur Fahndung ausgeschrieben. Karl ist Selbststeller, das bedeutet: Er reist selbst an, weil keine Gefahr besteht, dass er fliehen könnte, Zeugen einschüchtert oder Beweise vernichtet. Er wird nicht von der Polizei abgeholt oder aus dem Gerichtssaal geführt, sondern bekommt einen Stichtag und eine Uhrzeit auf einem streng aussehenden Stück Papier und muss sich dann melden. Ausgenommen von dieser Regelung sind nur Häftlinge, die vorsätzliche Tötungsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Sexualstraftaten begangen haben.
Karl ist lange vor der JVA auf- und abgelaufen. Er ist 60, klein und ein bisschen rund – Karl würde sagen: Idealgewicht! – mit lichtem Haar auf dem Kopf und einer Hand am Ohr. Er hat all seine Freunde noch einmal abtelefoniert, weil er gleich für sechs Monate kein Handy mehr hat. Sechs Monate. Jesusmaria.
Karl hat sich geschworen, wie es auch kommt, zuversichtlich zu bleiben. In seiner Abwesenheit würde sich alles regeln. Zehn Freunde haben versprochen zu kommen, der Rest will schreiben. Und diese Versprechen, das hat Karl allen noch mal gesagt, zählten jetzt doppelt. Sonst würde er da nämlich ganz allein sein. Das haben seine Freunde verstanden. Hofft er. Und irgendwann käme die Entlassung, und sein Leben, es würde da warten, verständnislos vielleicht, aber geduldig. Nicht alle hat er noch erreicht.
«Willkommen in der JVA», sagt der junge Beamte in hellblauer Uniform ohne Spott, er sitzt hinter Glas und nimmt Karls Ladung und den Personalausweis durch eine Schublade entgegen. Karl hat sich mitsamt Rollkoffer, Reisetasche und Rucksack durch die Tür drücken müssen; erst ging der Summer, dann nahm Karl den Griff, aber nichts tat sich, er rüttelte – und schlussendlich musste er sein ganzes Gewicht dagegendrücken, bevor dieses Mistding von Tür endlich nachgab. Ein Vorgeschmack? Auf was eigentlich?
Im Prinzip, denkt Karl, ist es wie eine Reise in ein diktatorisches Land. Und mit der Freiheit gehen verloren: der Status, der Beruf, die Rolle, die man bisher im Leben gespielt hat; das Ansehen bei den Mitmenschen natürlich und jene vertraute Umgebung, die etwas zur Heimat macht. Karl denkt: Zum Glück ist mein Boden unter den Füßen halbwegs stabil.
«Spielen Sie Fußball?», fragt der Beamte und blickt auf.
Karl stellt seine Sachen auf dem Linoleumfußboden ab. Ist es besser, Fußball zu spielen – oder könnten ihm daraus Nachteile erwachsen? Immerhin will er nicht am ersten Tag gleich auffallen. Warum nicht Fußball?
«Ja», sagt Karl entschlossen, und fügt hinzu: «Natürlich.» Er würde rauskommen und – locker – zehn Kilo weniger wiegen.
«Das ist gut», sagt der Beamte, während er Karls Sachen durchsucht. «Wir haben einen ausgezeichneten Sportplatz. Ich spiele auch.»
2006 ging die Hoheit im Strafvollzug vom Bund an die Länder über. Experten befürchteten, es würde einen Wettlauf der «Schäbigkeit» geben: um die günstigste JVA im Land. Das ist nicht eingetreten. Viele Länder haben investiert, andere allerdings hinken diesen Ansprüchen weit hinterher.
Welche Haftbedingungen man vorfindet, liegt – letztendlich ist das «justice by geography» im Wortsinn – am Wohnort.
Der Begriff «justice by geography» – der aus der Kriminalistik, Soziologie und Sozialgeographie stammt und von verschiedenen Wissenschaftlern geprägt wurde – beschreibt den Einfluss, den der Geburtsort und der Ort des Aufwachsens und Lebens auf das Individuum hat. Er differenziert soziale Einflüsse zwischen Stadt und Land – und die Unterschiede, die somit auf den Menschen hinsichtlich einer sozialen Gerechtigkeit wirken.
In Deutschland ist dieser Begriff verrechtlicht: Nach § 24 Abs. 2 der Strafvollstreckungsordnung wird die Strafe, wo immer sie auch ausgesprochen wird, grundsätzlich am Wohnsitz vollstreckt. Darunter verstehen die Gerichte den Ort, an dem eine Person den «Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse hat».
In manchen Fällen mieten sich Straftäter vorher einen Wohnsitz in Berlin, um die Strafe dort und nicht etwa in Bayern antreten zu müssen, das für eine rigidere Strafpraxis steht.
Im Internet hat Karl sogenannte «Hotel-Führer» gelesen – Online-Plattformen, auf denen sich Exhäftlinge und deren Angehörige über ihre Gefängnisse austauschen. Dabei erfuhr er, dass die meisten Anstalten in den großen Flächenländern stehen: in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Hessen; darüber hinaus hat Karl gehört, dass es neue und alte Anstalten gibt – und dass es einen großen Unterschied macht, in was für eine man kommt.
Die neuen – aus den 2000er Jahren – sind hell, freundlich und leblos-schön. Die alten, Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert oder noch älter, sind dunkel und eng wie der Bauch eines Tieres. Diese hier kam im Internet ganz passabel weg. In «seiner» JVA gibt es sogar einen Bauernhof, einen Ort außerhalb der Gefängnismauern, auf dem Häftlinge arbeiten dürfen. Karl mag Arbeiten an der frischen Luft, er sagt sogar, er habe «eine Schwäche für Ackerbau und Viehzucht».
In Gefängnissen gibt es den geschlossenen Vollzug, mit Hofgang und Einschluss, und den offenen. Dort wohnen Häftlinge in Wohngruppen und können in der Stadt arbeiten. Zudem gibt es ein Lockerungsprogramm, um Inhaftierte wieder an das Draußen zu gewöhnen: Dazu gehörten – zunächst meist begleitete – Freigänge in die Stadt. Im offenen Vollzug kommt man nur zum Schlafen zurück.
Noch bevor sich der Smalltalk fortsetzen kann, zieht der Beamte, der in Karls Sachen kramt, ein Buch aus der Tasche hervor: das Strafvollzugsgesetz. Karl will vorbereitet sein. Das Strafvollzugsgesetz regelt unter anderem, was einem Häftling in Haft zusteht und was nicht. Mit der Freundlichkeit ist es vorbei: «Sie wissen vermutlich, dass Sie laut EU