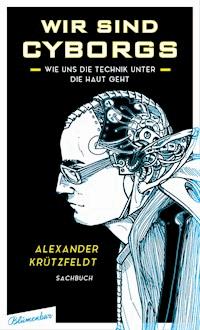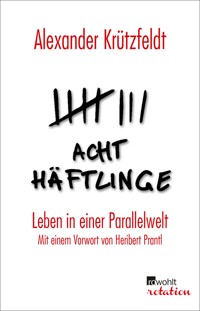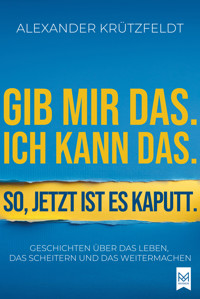
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie man jedes Hinfallen als Erfolg sieht Wer renoviert schon als handwerklicher Volllaie ein Haus – nur mit YouTube-Tutorials? Wer macht den Fehler, wenn man schon dreimal durch den Führerschein gefallen ist und meldet sich zum Motorradführerschein an? Und zwar bei exakt jenem Fahrlehrer, der einen vor 20 Jahren so oft hat durchfallen lassen? Unser Autor! Schlimmer geht immer, könnte man sagen – und Alexander Krützfeldt ist schon so oft auf die Nase gefallen, dass es beim Zuschauen wehtut. Dafür hat er es aber weit gebracht: zum ZeitMagazin, zur Süddeutschen Zeitung und zur Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die er als Kolumnist schreibt. Über das persönliche Scheitern. Berührend, bedrückend, ehrlich – und wahnsinnig lustig. Zum Beispiel über sein Haus und seine sechsstelligen Bauschulden. Da, hat ihm sein Therapeut geraten, solle man auch dankbar sein. Immerhin lerne man im Zweifel was für sein Leben! Denn die Frage ist ja nicht, warum man letztlich scheitert. Die Frage ist doch: Wie scheitert man – und was lernt man daraus? Kann man durch ständiges Scheitern nicht eine Art Superheld werden – weil einem das Scheitern neue Fähigkeiten lehrt? Weil es eine Herausforderung ist, an der man immer, oft, manchmal, wenigstens aber ab und zu mal ein bisschen persönlich wächst? Nach seinen sehr erfolgreichen Büchern »Letzte Wünsche« und »Acht Häftlinge«, für die er renommierte Preise gewonnen hat, jetzt also sein inoffizielles und vorgezogenes Lebenswerk (O-Ton Autor): »Gib mir das. Ich kann das. So, jetzt ist es kaputt.« Was nimmt man aus dem Scheitern mit? Alles übers Hinfallen, Wiederaufstehen, und Weitermachen. Ein Best-Of aus 10 Jahren hinter der Paywall. Knallgrelle, absurd-lustige und emotionale Reportagen, Essays und Magazingeschichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Krützfeldt
Gib mir das. Ich kann das. So, jetzt ist es kaputt.
Geschichten über das Leben, das Scheitern und das Weitermachen
Über dieses Buch
Wie man jedes Hinfallen als Erfolg sieht
Wer renoviert schon als handwerklicher Volllaie ein Haus – nur mit YouTube-Tutorials?
Schlimmer geht immer, könnte man sagen – und Alexander Krützfeldt ist schon so oft auf die Nase gefallen, dass es beim Zuschauen wehtut. Dafür hat er es aber weit gebracht: zum ZeitMagazin, zur Süddeutschen Zeitung und zur Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die er als Kolumnist schreibt. Über das persönliche Scheitern. Berührend, bedrückend, ehrlich – und wahnsinnig lustig.
Wie scheitert man – und was lernt man daraus? Kann man durch ständiges Scheitern nicht eine Art Superheld werden – weil einem das Scheitern neue Fähigkeiten lehrt? Weil es eine Herausforderung ist, an der man immer, oft, manchmal, wenigstens aber ab und zu mal ein bisschen persönlich wächst?
Nach seinen sehr erfolgreichen Büchern »Letzte Wünsche« und »Acht Häftlinge«, für die er renommierte Preise gewonnen hat, jetzt also sein inoffizielles und vorgezogenes Lebenswerk (O-Ton Autor): »Gib mir das. Ich kann das. So, jetzt ist es kaputt.«
Was nimmt man aus dem Scheitern mit?
Alles übers Hinfallen, Wiederaufstehen und Weitermachen. Ein Best-Of aus 10 Jahren hinter der Paywall. Knallgrelle, absurd-lustige und emotionale Reportagen, Essays und Magazingeschichten.
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Copyright © 2025 by Maximum Verlags GmbH
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an uns:
Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Facebook: /MaximumVerlag
Instagram: @maximumverlag
1. Auflage 2025
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: Fadaway Creative / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: CPI Books GmbH
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-061-5
Widmung
Für Elias und Jakob
Vorwort
Alexander Krützfeldt, Superheld und Versager
Im ZEIT-Magazin erschien 2011 ein Interview mit der Autorin Katja Kullmann über ihre Zeit als Hartz-IV-Empfängerin. Es begann mit der Frage: „Frau Kullmann, 2002 waren Sie Bestsellerautorin, 2008 Hartz-IV-Empfängerin. Wie verlief der Absturz ins Prekariat?” Darin sagt Katja Kullmann den Satz: „Ich habe in Berlin in einer Charlottenburger Drei-Zimmer-Altbauwohnung mit Fischgrätparkett und Flügeltüren gelebt.” Beim Lesen dieser Stelle dachte ich: „Wenn ich jemals in einer Charlottenburger Drei-Zimmer-Altbauwohnung mit Fischgrätparkett und Flügeltüren gelebt hätte, würde ich mein Leben aber so was von als Erfolgsgeschichte erzählen! Für immer!” Warum ich das dachte, kann ich heute gar nicht mehr so genau sagen. Ich war eigentlich immer zufrieden mit meiner Anderthalb-Zimmer-Wohnung ohne eine einzige Flügeltür. Außerdem habe ich schon mal kurz in Charlottenburg gewohnt und fand es unpraktisch.
Jedenfalls fasste ich wegen Katja Kullmann den Plan, ein Buch zu schreiben. Es sollte, von vorne betrachtet, „Mein Leben als Superheld*in” heißen und von hinten betrachtet „Mein Leben als Versager*in”1. Beide Versionen hätten den Untertitel „24 Biografien von 12 Menschen” gehabt. Ich wollte zwölf Personen finden, die mir ihre Lebensgeschichte je zwei Mal erzählen sollten, einmal in der Versagensversion und einmal in der Erfolgsversion. Weil ich das Projekt zu lange vor mir hergeschoben habe, sind inzwischen zwei der Menschen gestorben, die ich interviewen wollte, nämlich der Autor Michael Rutschky und der Merkur-Mitherausgeber Kurt Scheel. Nach dem Tod der beiden wurde mir klar, dass sie mir sowieso nicht die Wahrheit gesagt hätten. Die Versagensversionen ihres Lebens wurden erst posthum sichtbar, und auch dann nur teilweise. Es ist schwer, über ernsthaftes Scheitern zu sprechen.
2014 besuchte ich in Berlin das Barcamp „Odyssey of Failure”, eine Miniaturtagung zum Thema Scheitern. Dort prägte jemand den Ausdruck „Zierscheitern”, um das zu beschreiben, worum es bei der Veranstaltung eben nicht gehen sollte: ein Scheitern, das einen insgesamt doch ganz schön gut aussehen lässt, kleinere Peinlichkeiten an den Rändern des großen Erfolgs. Das Zierscheitern ist ein Kollege des Humblebraggings, auf Deutsch Tarnprahlen2. Humblebragging heißt es, wenn man Angeberei als bescheidene Selbstkritik zu tarnen versucht: „Schon wieder die Goldbarrensammlung an irgendeinem ganz sicheren Ort versteckt und dann vergessen, wo, ich Schussel!” Forschung zum Humblebragging kommt zu dem Schluss, dass diese Strategie allgemein durchschaut wird und es besser wäre, ganz normal zu prahlen3.
Allerdings ist Humblebragging unterhaltsamer als der Besitz von Goldbarren und die ungebrochene Angeberei damit. Es wäre also eventuell okay, wenn das vorliegende Buch eine einzige große Zierscheiterei darstellte. Und dafür spricht manches! Wie man auf dem Umschlag dieses Buchs nachlesen kann, schreibt Alexander Krützfeldt für ungefähr alle wichtigen Zeitungen und Reportagemagazine. Er ist für Journalismuspreise nominiert worden und hat ein Literaturstipendium gewonnen, er kommt aus einem reichen Elternhaus, in das er jederzeit wieder einziehen kann (Seite 37 ff.), hat sich ein eigenes Haus gekauft, eindrucksvolle Handwerksfähigkeiten nur mit Hilfe von YouTube erworben (Seite 26 ff.), er hat einen Motorradführerschein (Seite 202 ff.), mehrere Kinder, denen er ein fürsorglicher Vater ist (Seiten 217-221), er denkt an alle Geburtstage und an die Geburtstage der Kinder der Geburtstagskinder (Seite 211), und so weiter. Alexander Krützfeldt ist ein Superheld ohne die geringste Ahnung vom Scheitern.
Andererseits. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber auf Seite 222 passieren objektiv katastrophale Dinge. Darauf folgen Trennung, Schulden im mittleren sechsstelligen Bereich, Privatinsolvenz, Scheidung, und das sind nur die Dinge, von denen wir in diesem Buch erfahren. Alexander Krützfeldt ist ein erfahrener Versager und Scheiterns-Profi.
Wenn wir hier im Internet wären und nicht in einem Buchvorwort ohne Kommentarfunktion, würde sofort jemand einwenden, dass es sich ja wohl um Luxus-Scheitern handelt, und mit Recht. Nur wer mal genug Geld oder wenigstens Kreditwürdigkeit für ein Haus hatte, kann dieses Geld verlieren. Aber es ist trotzdem kein Zierscheitern mehr.
Die Grenze vom Zierscheitern zum echten Scheitern verläuft da, wo die Scheiternden nicht mehr so gern davon erzählen. Katja Kullmann hat ihren Hartz-IV-Status geheim gehalten. Alexander Krützfeldts Text, in dem es ernst wird, ist viel kürzer als die anderen in diesem Buch. Man erkennt die Grenze auch daran, dass es gar nicht so angenehm ist, vom Scheitern zu erfahren. Wir müssten uns irgendwie dazu verhalten, Lachen reicht nicht mehr. Später geht es dann wieder. Autobiografien von Prominenten mit Drogenvergangenheit können sehr lustig sein, das Problem ist ja vorbei! Jedenfalls war es gerade nicht akut, als das Buch geschrieben wurde. Meistens.
Wenn dieses Buch erscheint, wird das Scheitern von Alexander Krützfeldt noch ganz aktuell sein. Es tut beim Lesen trotzdem nicht sehr weh, weil es in viele Schichten aus harmlosem Zierscheitern eingewickelt ist. Was man als Scheitern am Scheitern interpretieren könnte, ist eine Dienstleistung für uns Lesende.
Davon abgesehen ist ein Buch über das Scheitern ein bisschen wie eine Horrorgeschichte aus der Ich-Perspektive: Wir wissen die ganze Zeit, dass die Hauptfigur am Ende so einigermaßen okay sein muss, sonst könnte sie ja nicht mehr davon berichten. Alexander Krützfeldt befindet sich (jedenfalls am Tag der Manuskriptabgabe) nicht im Magen eines Monsters. Er hat es geschafft, ein ganzes Buch über den Zusammenhang zwischen Superheldentum und Versagen zu schreiben, anstatt sich nur einen Titel auszudenken. Und das ist, ohne jetzt seine Leistungen im Scheitern schmälern zu wollen: Schon ein Erfolg.
Kathrin Passig
1 Vergangenheit leicht geschönt, leider fand ich inklusives Schreiben damals noch überflüssig.
2 Ich glaube, diese Übersetzung stammt von Markus „slowtiger” Kempken.
3 Sezer et al.: „Humblebragging: A distinct – and ineffective – self-presentation strategy” (2018)
Kapitel 1: Hochwasser
Unsere Geschichte begann am 16. Dezember. Im Harz war das Wintereis geschmolzen und hatte die Flüsse unruhig werden lassen; die Böden waren satt und schwer vom tagelangen Regen. Er hatte gar nicht mehr aufhören wollen, und selbst wir, als Norddeutsche, als Bewohner der Kleinstadt Verden an der Aller, fanden den Regen zunehmend suspekt.
Wir haben schon viele Hochwasser erlebt, wobei „erlebt“ ist nicht das richtige Wort. Die Alten erzählten davon den Jüngeren, à la „Großvater erzählt von legendären Europa-Cup-Spielen“: 1946, ’56, ’81, ’87, und so weiter. Gut und richtig, davon zu erzählen, fanden wir ja auch. Aber wenn du zum fünfzigsten Mal hörst, warum die Häuser in der ersten Reihe alle keine Keller haben, macht das ein bisschen müde. Man hört zwar zu, aber auch nur, weil kurz einnicken viel zu unhöflich wäre. Zusammengefasst: Beim letzten schlimmen Hochwasser gab es noch Kassetten, beim ersten teilte sich die ganze Straße ein Radio. Den Rest haben wir leider vergessen. Ansonsten gibt es von hier nicht viel zu erzählen: Einmal im Jahr kommt ein Mann zu uns, verkleidet als Klaus Störtebeker, und verteilt Fische. Und da hören wir die Historiker jedes Mal scharf die Luft einziehen, weil keiner von ihnen mehr glaubt, dass Freibeuter wirklich aus Verden an der Aller kommen.
Wer zu uns kommen will, muss durch das Aller-Leine-Tal, das nördlich von Hannover beginnt und einerseits ein Urstromtal aus der Eiszeit ist und andererseits ein PR-Zusammenschluss der regionalen Tourismusbehörden samt Aller-Radweg. Die Gegend ist flach, und wir sagen gerne, dass man freitags schon sieht, wer sonntags zu Besuch kommen wird. Unsere Stadt hat etwa 27.000 Einwohner. Früher gab es hier viele Kneipen und einen Dom, den man in Großmannssucht in die Landschaft gestellt hatte. Aber die Kneipen sind größtenteils zu, die Kirchen größtenteils leer, und die Bischöfe sind längst tot; die Jungen wissen nichts mehr anzufangen mit sich. Unsere Innenstadt ist jetzt voller Ketten und Dönerbuden, sie endet am alten Hinrichtungsstein, und direkt dahinter, zum Fluss runter, beginnt dann unser Viertel, das Fischerviertel. Mit seinen schmalen, vielfarbigen Häusern, die so eng zusammenstehen, als würden sie sich gegeneinander lehnen. Direkt am Wasser, am Bollwerk, mit den verblassenden Hochwassermarkierungen, wo sie darauf warten, dass ihre Zeit gekommen ist.
Nicht alle sprechen mit einer Stimme, denn wir sind uns, auch in unserer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe, nicht immer einig. Durchmessen lässt sich das Viertel folgendermaßen: An der einen Seite beginnt es beim ältesten Haus Verdens, dem Ackerbürgerhaus, daneben wohnen die Leinwebers, ein Kunstmaler und eine Fotografin. Wir haben viele Künstler, Rotraud Scholz baut sehr schöne Marionetten, die in den Fenstern hängen, sodass man sich beim Vorbeigehen manchmal erschrickt. Arne von Brill fotografiert ebenfalls und macht Mucke. Auf der anderen Seite ist unsere Kneipe, sie gehört Leo, der sagt, wenn man die Zwiebelsuppe in vegetarisch bestellen möchte, dass die nicht vegetarisch sei, dass er da Speck reintue, und wenn man weiter lamentiere, gebe es vielleicht auch nichts mehr zu trinken. Wir lieben Leo. Ob Leo seine Gäste auch liebt, wissen wir nicht. Zwei bis drei Reihen unserer Häuser stehen am Wasser. Die ersten unmittelbar, mit den Gärten am Fluss, die anderen etwas weiter hinten, sodass man den Fluss nicht sieht.
Die Geschichte beginnt also am 16. Dezember, die Zeitungen hatten geschrieben, dass der Monat ungewöhnlich nass gewesen war. Wie das gesamte Jahr 2023, das regenreichste Jahr Niedersachsens seit 1931. Selbst unser Grundwasser war über den Schnitt der vergangenen 30 Jahre angestiegen.
Einer von uns, der stadtbekannte Fotograf Arne von Brill, war am 16. Dezember auf Fototour unterwegs, bei Rethem und Eilte, und meldete uns per WhatsApp wie der Bote von Marathon, dass da etwas im Gange sei. Dass sich beim Fährhaus Barnstedt das Wasser schon über alle Wiesen ausgebreitet habe. Da komme vielleicht was auf uns zu, schrieb er. Das werde möglicherweise eine Jahrhundertsache.
In unserer WhatsApp-Gruppe waren wir gespalten hinsichtlich der Frage, was zu erwarten sei. Einerseits möchte man aus Sorge sofort den Keller ausräumen. Andererseits sieht man dann den Keller und was das für Arbeit bedeutet und legt vielleicht auch erst mal die Wäsche zusammen. Die Alten, die schon lange in der Straße wohnen, ermahnten uns, ruhig zu bleiben. Sie sagten, es werde schon kein neues 1946. Und wir lieben unsere Alten, aber wir wissen nicht, wenn das eigene Haus dranhängt, ob wir ihnen vertrauen sollen. Sie wissen einerseits nie, wo ihre Hausschlüssel sind, andererseits geben sie sich bei Notlagen gezeitenerprobt, vollständig gesammelt und entschlossen, dass es uns ein wenig skeptisch macht.
Die Vorbereitung der Feiertage verbrachten wir also zunächst mit steigendem Wasser, unter dem ständigen Blick durch die Fenster und in relativer Gemütsruhe, die man wie folgt zusammenfassen könnte: Man sagt zwar, Niedersachsen sei das Land der Bauern, aber im Prinzip begreifen wir uns auch im Hinterland, 160 Kilometer hinter der Küstenlinie, noch als Seefahrernation.
Während wir also damit beschäftigt waren, die Lage draußen am Bollwerk im Blick zu behalten, trat kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, das erste Mal der Krisenstab der Stadt zusammen – bestehend aus Feuerwehrkräften, Mitarbeitenden der Stadt, Bereich Ordnung und Sicherheit, zuständig für die Gefahrenabwehr, sowie Personal des Betriebshofes. Seit Anfang des Monats hatte man dort die Lage beobachtet, seit Mitte des Monats „engmaschig“, um rechtzeitig „vor die Lage zu kommen“, wie es im Amtsdeutsch der Katastrophenschützer heißt.
Ein paar Kilometer von uns entfernt, weiter unten am Fluss, in Eitze und am Intscheder Wehr, funkten derweil hyperaktive, kleine Apparate ihre eingesammelten Daten nach Hildesheim, wo sie beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ausgewertet und mit Hochrechnungen versehen wieder zurückgeschickt wurden zu uns nach Verden, an das Hochwasserkompetenzzentrum, das die Stadt bei diesen Lagen beriet, von dort weiter als Fax oder E-Fax zurück in die zuständigen Abteilungen der Stadt. Die Daten waren vom vielen Hin-und-her-geschickt-Werden dann ganz erschöpft, aber so wusste man wenigstens früh, dass dieses Jahr mehr Regen und mehr Wasser kommen würden als erwartet. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes für die Feiertage, die Stände der Zuflüsse, die Sättigung der Böden und die Wasseraufnahmefähigkeit der Weser – all diese Werte sahen insgesamt relativ schlecht aus für uns.
Vorsorglich rief man also kurz vor Weihnachten alle Feuerwehrkräfte zusammen; die Antrittsrate war mit 75 Prozent erstaunlich gut, sogar für Feuerwehrkräfte. Positiv wurde dieser Wert beeinflusst, weil die meisten über die Feiertage Urlaub hatten und hoch motiviert waren, in der Heimat zu helfen. Außerdem durfte man endlich mal alle Gerätschaften auspacken. Negativ wurde der Wert beeinflusst, dass es zunächst nur darum ging, Sandsäcke von Hand zu füllen, was eine richtige Scheißarbeit ist, sogar für Feuerwehrleute, sagten die Feuerwehrleute. Aber es lief Weihnachtsmusik, und die Einsatzkräfte versuchten, durch die Vorbereitung im Stillen, Ruhe auszustrahlen und das Beste aus der Sache zu machen.
Der Anblick von Feuerwehrautos, die in zunehmender Frequenz im Stadtbild erscheinen, ist ein Anblick, der erst einmal beruhigt, dann aber zunehmend verunsichert. In unserer WhatsApp-Gruppe meldete Anke, sie habe gerade jemanden beim Deutschen Roten Kreuz getroffen, der gesagt habe, man bereite sich mit Sandsäcken vor und erwarte, dass das Wasser in die Fischerstraße komme: „Wie bereitet ihr euch vor?“ Zunächst einmal mussten wir uns um die Leinwebers kümmern, die langsam nervös wurden, weil sie a) nie ein Hochwasser erlebt hatten, seit sie vor einigen Jahren das schönste Haus der Straße gekauft hatten, und b) weil die Leinwebers eben Künstler sind, was bedeutet, dass das ganze Untergeschoss voller teurer Bildbände und Ölgemälde im Großformat steht. Alles daran erinnerte uns an eine Moritat.
Also wurden erste Hilfstrupps gebildet, um die Gemälde über die Straße zu tragen, ins Ackerbürgerhaus, das etwas höher liegt. Wir tauschten uns aus und begannen, vorsorglich unsere Türen zu verrammeln und Kellerfenster mit Spanplatten und Silikonkleber abzudichten; jeder half, wo er konnte. Jemand sägte die Platten zurecht, ein anderer fuhr zum Baumarkt, wieder ein anderer hatte noch eine Tube Silikon rumliegen. Wenn jeder an den anderen denkt, ist an alle gedacht. Die Feuerwehr fing an, strategisch wichtige Ziele im Stadtgebiet anzufahren und ständige Patrouillen einzurichten. Eine unten bei uns in der Fischerstraße.
Mittlerweile hörte man auch von Hochwassertourismus. Da Verden jetzt praktisch am Meer lag – statt Verden an der Aller jetzt Verden bald in der Aller, scherzten wir –, kamen also all diejenigen aus der Umgebung zu uns, die sonst in Cuxhaven-Duhnen regungslos auf dem Deich stehen, in Windbreakerjacken, Leuchtstreifen am Fahrradhelm. Die Feuerwehr war bestrebt, bei Social Media darauf hinzuweisen, dass die Deiche durchgeweicht und bitte nicht zu betreten seien. Aber manche Leute taten so, als wären sie nicht angesprochen. Sie kamen auch in die Fischerstraße und sahen uns bei den Arbeiten zu, anstatt zu helfen.
Die Nachrichten meldeten anhaltenden Regen, wobei die Ursache eine länger anhaltende Westwindlage infolge des starken Jetstreams sei, die zahlreiche Tiefdruckgebiete vom Nordatlantik mit nach Europa bringe. Das sagten die einen. Die anderen standen in Gummistiefeln, mit beiden Beinen im Wasser und meinten, den Prognosen der Medien sei nicht zu trauen. Fake-News auf Social Media nahmen Fahrt auf, von Deichbrüchen war die Rede, die niemals stattfanden.
Während die Feuerwehr einen Hochwasserwall aus Sandsäcken aufbaute, vertrieb die Polizei Schaulustige. Wir hörten aus Eissel, einem Dorf in der Nähe, dass es bereits eine Insel sei. Die Feuerwehr richtete einen Fährverkehr ein, damit die Kinder zur Schule und die Leute zur Arbeit kommen konnten. Aber einmal fuhren auch einfach nur mehrere Kisten Bier zurück mit dem Schiff über die spiegelglatten, grauen Wasserflächen, mit der Begründung: „zum gemeinsamen Pegelgucken“, was aber auch nichts mit Wasserstandsmeldungen zu tun hatte. Die ersten Reporter fuhren mit und fanden das drollig. Die Eissler fanden das nicht so drollig, meinten aber, dass sie endlich mal Ruhe hätten vom Festland und dass das Ganze eben doch sein Gutes habe, und wir sagten, wir wollen nicht unhöflich sein, aber dann könnte man die Eissler auch ganz sich selbst überlassen, wenn sie ständig der Auffassung sind, ohne uns sei es irgendwie besser.
Wir fühlten uns relativ sicher und gut gerüstet für die Apokalypse: Wir hatten eine gelernte Krankenschwester im Viertel, eine Redakteurin bei der Zeitung, eine Frau, die Kaffeemaschinen vertrieb, sowie diverse versierte Handwerkerinnen und Handwerker.
Am 27. Dezember änderte sich die Stimmung.
Der Abend begann zunächst mit einer Patrouillenfahrt der Feuerwehr bei uns im Viertel, als die Einsatzkräfte bemerkten, dass „die Lage dynamisch“ werde, wie es auf Amtsdeutsch heißt. Anders als Feuer ist Wasser geduldig. Wasser kommt langsam die Straßen rauf, Zentimeter für Zentimeter; es steigt langsam und lässt deiner Angst dabei extra viel Raum. Wie schnell es im Schutze der Dunkelheit allerdings herangekrochen kam, überraschte dann alle.
Zunächst war die Feuerwehr davon ausgegangen, unseren Stromkasten im Viertel trocken halten zu können, da dort alle Kabel zusammenlaufen, und man wollte, dass, falls man den Strom abstellen müsste, alles wieder schnell in Betrieb zu nehmen sei. Als sie einmal zu einem anderen Einsatzort abberufen wurde und kurz danach zurückkehrte, stand ein Straßenzug, der eben noch komplett trocken gewesen war, schon unter Wasser. Das Hochwasser war offenbar gewillt, in unsere Geschichtsbücher einzugehen. Gullydeckel wurden mit Folie abgedichtet, damit das Wasser nicht aus den Kanälen hochdrücken und zusätzlich auf die Straßen laufen konnte. Viele schliefen, als es gegen drei Uhr in der Früh an die Türen hämmerte.
Karin Green aus der Kleinen Fischerstraße wurde als eine der Ersten geweckt, warf sich etwas über und eilte nach unten, wo die Feuerwehr stand und alle auf die Straße bat. Hinten, von der Flussseite, lief das Wasser schon in ihr Haus. In der Nacht war es um vier Zentimeter gestiegen – pro Stunde. Diejenigen, die nicht direkt von der Feuerwehr geweckt wurden, riss das Blaulicht aus dem Schlaf. In den Straßen versammelten wir uns, wie man sich in den Straßen versammelt: aufgekratzt, aber auch neugierig natürlich.
Von Frau Green wissen wir, dass sie, nachdem sie bemerkt hatte, dass auch die Klospülung nicht mehr abzog und ihr Haus mit einem Wall aus Sandsäcken verbarrikadiert war, es sich nicht nehmen ließ, den Geschirrspüler noch einzuräumen und anzustellen, um anschließend für eine Woche zu ihrer Cousine zu ziehen. Jochen Aschmutat, unser patenter Automobilkaufmann, fuhr kurzerhand seinen Wagen raus und öffnete die Garage für alle Feuerwehrleute, damit sie es bei ihren Pausen einigermaßen warm hatten und nicht im Regen stehen mussten. Neben Aschmutats ist das Kurbad Heumer, das die Toiletten für die Feuerwehr bereitstellte. An der Glasscheibe des Schwimmbads, wo wochentags alte Leute über das Wasser trieben und gedankenverloren Schwimmbewegungen machten, stand das Wasser an der Außenscheibe, was eindeutige Titanic-Vibes auslöste. In unserer Straße ist auch noch ein Bestatter, der aber hoch genug liegt, da waren einige schon einigermaßen erleichtert, weil der ja Leichen im Keller hatte.
Derweil kündigte sich aber schon die nächste Hiobsbotschaft an, am Haus von Iris von Brill. Die Hausecke war bereits unterspült worden und das Haus drohte in der Mitte durchzubrechen. THW und Feuerwehr packten Sandsäcke in den Keller, der dann geflutet wurde, damit ein Gegendruck entsteht, um das Haus auf seinem Sockel zu halten. Wir standen natürlich allesamt gebannt an der Straße. Und als Iris nicht wusste, was aus ihrem Haus wird, waren wir da. Die gesamte Nachbarschaft. Die Feuerwehrleute schleppten Sandsäcke vor die Eingänge aller Häuser, verschafften sich Zugang zu Kellern, in denen das Wasser schon vorwurfsvolle 30 Zentimeter stand, dann unterstützten sie die Leute beim Auspumpen.
Den älteren Menschen, die versuchten, mit eigener Kraft der Notlage Herr beziehungsweise Frau zu werden, wie damals, 1946, als sie eimerweise Wasser die Treppen hochtrugen, wurden als Erstes die Eimer abgenommen. Dafür sind wir da, sagten die Jüngeren. Von Hannah Jänisch, immerhin alleinerziehend und einen Pflegedienst leitend, hörten wir, dass sie jeden Tag die Pumpen ihrer Nachbarn überprüfte, da diese das nicht mehr selbst machen konnten. Die Feuerwehrleute unterstützten uns die ganze Nacht, und wir unterstützten die Feuerwehrleute. Als der Morgen anbrach, brachten wir Kaffee, was auf eine Initiative von Rotraud zurückging, und später dann belegte Brötchen, und die türkisch-islamische Gemeinde brachte zwei ganze Pkw-Ladungen Baklava. Wir waren den Einsatzkräften dankbar, dass sie die gesamten Feiertage statt mit ihren Familien mit uns verbracht hatten; da wollten wir uns erkenntlich zeigen!
Bald schon brachten alle aus der Stadt Essen in die Garage von Aschmutats, unter den Einsatzkräften sprach sich herum, dass es in der Fischerstraße was zu holen gab. Wir fühlten uns gebraucht, und die Kinder malten den Feuerwehrleuten mit den Fingern Herzchen auf die nassen Scheiben, und wenn das THW im Supermarkt an der Kasse stand, zahlten wir Einwohner. Unser Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit, Philipp Rohlfing, brachte es auf folgenden Punkt: Es komme ja nicht oft vor, dass, wenn man für das Ordnungsamt arbeitet, die Leute mit dem Auto stehen bleiben, die Scheibe runterlassen und sagen, ihr macht da einen tollen Job. Weil es mittlerweile im Stadtgebiet viele große Einsatzlagen gab, die die Feuerwehr der Stadt mit denen des Umlandes allein nicht mehr schaffte, wurden auch Kreisfeuerwehrbereitschaften aus Cuxhaven und Diepholz alarmiert. Sogar die Feuerwehr aus dem Ahrtal meldete sich und meinte: Wir kommen jetzt hoch. Ihr habt letztes Mal uns geholfen, jetzt helfen wir euch! Insgesamt, so schien es, jedenfalls für einen Moment, war die ganze Stadt besoffen von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Als ließe sich das Wasser allein dadurch aufhalten, dass wir es – gemeinsam – so wollten.
Die Anspannung, die unser Viertel durchzog, war überall greifbar. Selbst der Kanzler musste noch kommen, am 31. Dezember war das, und in einem Pulk aus Pressevertretern auf unseren Fluss gucken, der jetzt einem Meer glich. Einige, die nicht aus unserem Viertel kamen, schrien im Hintergrund etwas von Corona und Gaza, aber wir gingen vehement dazwischen und sagten, dass augenscheinlich jetzt etwas anderes dran sei. Nur dass Scholz ohne Gummistiefel kam, nahmen wir ihm übel.
Am Silvesterabend standen wir zusammen in den Straßen, ein Glas Wein in der Hand. Wegen der Tiere und aus Rücksicht auf die schwer belasteten Einsatzkräfte sollte nicht geböllert werden. Wir sahen, dass in anderen Ortsteilen trotzdem die Feuerwerke hochgingen. Dennoch, sagte die Feuerwehr, habe man nie so wenige Einsätze und ein so friedliches Silvester erlebt wie 2023/24. Und das war vielleicht neu und erfreulich.
In den Tagen danach entspannte sich die Lage. Wir wollen nicht abergläubisch sein, aber was willst du machen, wenn über der Stadt zum ersten Mal die Sonne strahlt und einen riesengroßen Regenbogen über dem gesamten Stadtgebiet aufspannt? Wo sich das Wasser zurückzog, kamen die Möwen und pickten die Kadaver von Fischen und verendetem Wild auf, das sich retten konnte, dann aber eingeschlossen vom Wasser nichts mehr zu fressen fand. Frau von Brill durfte in ihr Haus zurück. Die Leinwebers brachten ihre Gemälde wieder ins Erdgeschoss, ein schönes Selfie inklusive. Bei Aschmutats räumten sie die Garage aus, aber den Jochen sah man noch oft, wie er morgens an der Straße stand, mit seinem Kaffee, als erwarte er, dass doch noch mal alle zurückkommen. Und wir nahmen die Pressholzplatten an den Eingängen wieder ab und begutachteten die Rückstände, die unsere Heißklebepistolen hinterlassen hatten.
Man hörte noch einzelne Pumpen, aber es war merkwürdig ruhig geworden. Geblieben ist das Gefühl jener Nächte: Das gemeinsame In-den-Straßen-Stehen, aus Angst, alles zu verlieren. Das hat uns zusammengeschweißt, auch wenn wir mindestens eine Woche nicht richtig geschlafen hatten. Dieses Gefühl, sagte Iris von Brill später, dass der Staat da war. Dass man sich auf die Stadt und die Behörden und die Einsatzkräfte so verlassen konnte. Dass dir geholfen wird. Dieses Vertrauen, sagte sie, das bleibt irgendwie. Wir grüßten einander jetzt anders in den Straßen, weil aus Fremden, die man bis dahin kaum kannte, Vertraute geworden waren. Freunde vielleicht. Und wenn du eine Geschichte hast zu jemandem, kann er dir schwerer egal sein, so gesehen haben wir Glück gehabt. Dass verhältnismäßig wenig passiert ist. Dass niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Jedenfalls sind wir froh, dass es vorbei ist und dass wir es erlebt haben. Nur eine neue Hochwasserschutzmauer haben wir noch nicht bekommen.
Wir wissen zwar, dass ein Hochwasser jederzeit wieder kommen kann, aber wir bleiben stoisch. Bald werden wir die Alten sein und mahnen und wertvolle Tipps geben und eine eigene Hochwassermarke an der Brücke am Bollwerk haben, die da sagt: Das letzte schlimme Hochwasser war 2023. Es geht als das sogenannte Weihnachtshochwasser in die Geschichte ein, und von diesem Weihnachten und Neujahr werden wir erzählen, sollten wir eines Tages selbst gefragt werden. Von der Nacht, als das Wasser kam und die Feuerwehr. Vielleicht werden wir auch bequem sein und digital – und nur dieses Posting zeigen, bei Facebook, von Helge Kühling:
„Liebe Einwohner von Verden! Wir waren vom 29. bis 31.12. mit unserer Kreisfeuerwehrbereitschaft in Verden, um euch und die Kameraden vor Ort im Kampf gegen die Fluten zu unterstützen. Was uns von euch an Respekt, Unterstützung und Warmherzigkeit entgegengebracht wurde, habe ich so in meinen über 30 Jahren Feuerwehr und Katastrophenschutz noch nicht erlebt. Uns ist es wichtig, euch allen zurückzuspielen, dass genau das die Gründe sind, warum sich Feuerwehrleute aus allen Richtungen aufmachen, um Menschen in Notlagen beizustehen.“
Diejenigen, die sich noch mit den Versicherungen rumschlagen, tun uns leid. Vielleicht steht auch irgendwo noch ein Bautrockner und lärmt in einem Keller, aber für die meisten ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt. Wir grüßen einander, aber wenn man danach fragt, sagen alle, man wisse zwar, dass man sich aufeinander verlassen könne, aber jeder habe nun auch wieder seine eigenen Sorgen. Und das ist vielleicht das Bedauerliche daran: Dass, egal, wie sehr es uns zusammengeschweißt hat, der Alltag wieder eingekehrt ist. Und aus jedem Wir doch langsam wieder ein Ich wird.
Erschienen im Zeitmagazin
Kapitel 2: Heimwerker
Als ich meinen Eltern eröffnete, dass ich zurück aufs Land ziehen werde, um einen maroden Bauernhof zu kaufen, schauten sie mich lange an. Ob ich verrückt geworden sei, wollten sie wissen.
Wir hatten eigentlich über etwas anderes gesprochen. Ich weiß nicht mehr, worüber. Es war auch nicht so, dass ich ihnen das Haus als felsenfesten Plan verkaufte, mehr so als Idee, als Angebot. Ich dachte, so ein Haus könnte nett sein, auch für meine Eltern, und darum ging es wohl, aber spätestens jetzt ging es wieder um das, worum es am Ende immer ging – den Vorwurf, keinen Nagel in die Wand zu kriegen.
Ich hingegen möchte niemandem einen Vorwurf machen. Mein Bruder baut alles Mögliche zusammen und wenn er mal nichts findet, baut er Dinge auseinander und anschließend wieder zusammen. Mein Vater hat Teile unseres Hauses gebaut, wobei das oft Teile waren, die nicht über lange Zeit einwandfrei funktionierten. Ich glaube, er hat auch mal Bauschutt im Kanal entsorgt, jedenfalls meine ich mich zu erinnern, aber mit den Jahren bestritt er das immer vehementer.
Wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, sind da tausend Momente, in denen mir dieses Vorurteil begegnet: Ich kriege keinen Nagel in die Wand. Ich sehe mich, wie ich gegen die Sonne blinzele, eine Zahnlücke im Mund und die Schultüte im Arm, und der Lehrer streicht mich beherzt von der Liste für den Werkunterricht. Damals war ich kompliziert aus einem Baum gefallen und hatte zwei Nägel im Ellenbogen.
Das ist natürlich Quatsch; ich wurde nicht von der Liste gestrichen. Aber ich fühlte mich eben schon immer unfähig, etwas zu bauen, das auch hält. Weil ich wohl schon als Kind den Eindruck machte, das nicht zu können. Und weil ich es immer wieder zu hören bekam. Es waren Gesprächsschnipsel, Blicke, kleine Dialoge.
Einer der ausschlaggebenden Momente war, als wir unser Elternhaus auflösten. Ich war 17 Jahre alt und meine Mutter bat mich, mein Zimmer im Erdgeschoss auszuräumen. Sie sagte, ich könne alles durch das offene Fenster schmeißen. Was ich auch tat. Ich warf Stühle hinaus, Bettgestelle sowie einen großen Bilderrahmen samt Glas, und als das Glas kaputt ging, sah mich meine Mutter schockiert an, weil sie das Klirren angelockt hatte, und das war der Moment, in dem die elterliche Liebe wich und man mir nichts mehr zutraute.
Ich bin mir sicher, sie hatte „schmeißen“ gesagt. Aber sie hatte es wohl nicht so gemeint. Ob ich ernsthaft Glas aus dem Fenster geschmissen hätte, wollte sie wissen. Es war ein trennender Blick, ein schmerzvoller. Und ich glaube, ab diesem Tag dachte meine Mutter, bei mir sei jetzt endgültig die Dachpappe runter.
Wenn ich heute tanke, meine Kinder sitzen im Auto, sagt meine Frau manchmal beiläufig, ich solle doch bitte darauf achten, das richtige Benzin zu zapfen, wobei sie nicht mal aufsieht. Ich stoppe dann die Zapfpistole, drehe mich langsam um und sage, das wisse ich schon selber, immerhin sei ich ja Mitte dreißig. Dann schaut sie nur so rüber, über ihre Sonnenbrillengläser, mit diesem langen, fürsorglichen Blick und sagt: „Natürlich weißt du das.“
Mein Leben ist geprägt von dieser Annahme aus der Vergangenheit, und überall ist sie auf geisterhafte Weise schon vor mir da und verfolgt mich wie ein Fluch. Aber dieses Mal würde ich ihn durchbrechen.
Ich hörte nicht auf meine Eltern. Und als ich nach der Erstbesichtigung einen Termin bei der Bank machte, ohne die ernsthafte Hoffnung auf einen Kredit, führte mich die Bankberaterin in einen Glaswürfel, der ein Büro darstellen sollte, drückte sich das Klemmbrett auf die Brust und sagte, es ginge ja weniger darum, einen Kredit zu bekommen, man könne ja über alles reden. Sie interessiere vielmehr die Frage, ob ich mir ein solches Projekt zutrauen würde.
Dieses Mal würde ich die Geister aufhalten, dachte ich. Ich würde nicht eskalieren, nicht rumschreien. Ich würde rein auf der Sachebene antworten. Als ich sinngemäß sagte, das werde wohl nicht so schwer, immerhin könne man kaum mehr kaputt machen, als ohnehin schon kaputt sei, warf sie schallend-lachend ihren Kopf zurück – und in meiner Erinnerung schlägt sie sich dabei auf die Schenkel, was sie vermutlich nicht wirklich tat.
Es wurde immer schwerer, das auszuhalten, aber ich biss mir auf die Lippe. Natürlich hatte mich das Lachen meiner Bankberaterin ins Mark getroffen. Natürlich traute ich es mir nicht zu. Wenn man etwas oft genug hört, wird es Teil der eigenen Identität und damit vollkommen real, und letztlich versucht man es irgendwann auch nicht mehr. Aber wer würde das zugeben im Gespräch mit seiner Bank, frei nach dem Motto: „Stimmt, jetzt, wo Sie’s sagen!“ Also unterschrieb ich.
Dieses Mal würde ich es nicht auf mir sitzen lassen und diesen Teufelskreis ein für alle Mal durchbrechen. Natürlich war ich nicht so dumm, gleich einen ganzen Bauernhof zu renovieren. Ich bin ja nicht Fynn Kliemann. Das kleine Backsteingebäude im Garten musste für meine Zwecke reichen. Es war das Testobjekt, bevor es an das Wohnhaus gehen sollte und es stand alleine auf einer Obstwiese in Niedersachsen. Ein Schreibhaus sollte es werden, für mich, den Schreiber. Ich stieß kräftig die Tür auf, was tatkräftig aussah, aber eigentlich meiner Spinnenphobie geschuldet war.
Die Fenster waren überwachsen und blind. An der Decke feuchte Flecken. Es war düster und kalt. Der Dielenboden war zerkratzt und mit Farbflecken übersät. An einem Kabel hing eine Bauleuchte lichtlos von der Decke. Dies, dachte ich, würde mein DIY-Moment werden. Ich würde es mir und allen beweisen. Wenn ich es geschafft hätte, würde die Landlust zu Besuch kommen, wir würden lachen und selbst gebackenen Apfelkuchen essen, und ich würde sagen, dass ich immer ein Faible hatte für das Handwerk und als kleiner Junge schon alles zusammenbauen musste. Eine gleißende Zukunft stand mir bevor.
Dann schloss ich die Tür, und etwas fiel mir in den Nacken.
Ich fuhr Richtung Baumarkt, drückte eine Münze in den Einkaufswagen und entriss ihn den anderen. Von den vielen praktischen und theoretischen Problemen, die ich zweifellos hatte, war das vielleicht drängendste, dass ich kein eigenes Werkzeug besaß. Abgesehen von einer Schachtel loser Ikea-Schrauben und einer Heugabel, auf die ich zufällig beim Ausmisten auf dem Dachboden gestoßen war. Werkzeug leihen oder anderweitig um Hilfe bitten, das kam nicht infrage. Leute leihen einem nur Werkzeuge, indem sie kommen und sagen, dass man bitte, bitte unbedingt aufpassen müsse – und dann packen sie alles aus und erklären einem stundenlang irgendwelche Einzelteile. Dafür war keine Zeit.
Ich schob den Wagen durch die Abteilungen – Lampen, Kabel, Tiere, Pflanzen, Duschvorhänge für 3.99 – bis ich einen Tresen erreichte mit der Aufschrift „Beratung“. Dort orderte ich ein Werkzeug, wobei ich sagte, es solle nicht zu schwer sein, nicht zu teuer und mindestens haltbar.
Ob es auch fliegen können sollte, fragte der Mann.
Ich kniff die Augen zusammen und antwortete: Das sei kein Muss.
In diesem Moment wurde mir klar, dass mir dieses Projekt mehr abverlangen würde als gedacht, und dass es nicht reichen würde, ein bisschen Arbeit zu investieren.