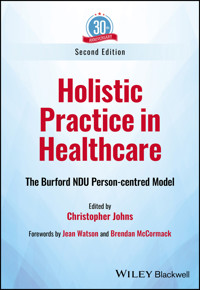35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Entwicklung der Führung in Gesundheitsorganisationen ist von vitalem Interesse für alle Beteiligten. Noch nie war es so wichtig angehende Leitungspersonen im Gesundheitswesen mit dem notwendigen theoretischen und praktischen Rüstzeug auszustatten, um im sich stets wandelnden Umfeld des Gesundheitswesens bestehen zu können. Diese Publikation kommt zum richtigen Zeitpunkt und bietet einen anregende Überblick und Einblick in die Aufgaben, Spannungsfelder und Herausforderungen, die sich Führungskräften im heutigen Gesundheitswesen stellen. Gleichzeitig bietet sie Hintergründe und Werkzeuge, um mit diesen widerstrebenden Anforderungen zurechtzukommen. Das Buch basiert empirisch auf Interviews mit über 80 Führungskräften im Gesundheitswesen und reflektiert deren Erfahrungen und spiegelt diese mit Beispielen aus der Managementpraxis wider. Der Autor befürwortet einen achtsamen und reflektierten Führungsstil und baut dabei auf seine umfangreichen Arbeiten aus dem Bereich der "Reflektierten Pflegepraxis" auf. Das Führungsverständnis dieses Buches ist nicht nur auf die höheren Kader in Pflegedirektion und -leitung beschränkt, sondern spricht auch Pflegende der mittleren Führungsebene bis hin zur Stations- und Teamleitung an. Johns legt somit das erstes Fachbuch zum Thema achtsame Führung für Pflegende vor, das "Leadership" als Kompetenz für alle leitendende Pflegekräfte fordert und fördert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Achtsames Führen in der Pflege
Achtsames Führen in der Pflege
Christopher Johns
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Pflege:
Jürgen Osterbrink, Salzburg; Doris Schaeffer, Bielefeld; Christine Sowinski, Köln; Franz Wagner, Berlin; Angelika Zegelin, Dortmund
Christopher Johns
Achtsames Führen in der Pflege
Mit Mindful Leadership überzeugen und verändern
Aus dem Englischen von Michael Herrmann
Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Prof. Dr. Volker B. Schulte
Prof. Dr. Christopher Johns.
University Bedfordshire und Canterbury Christ Church University, UK
Prof. Dr. Volker B. Schulte (dt. Hrsg.).
Head Health Management Competence Center, Fachhochschule Nordwestschweiz
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Pflege
z.Hd.: Jürgen Georg
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hogrefe.ch
Lektorat: Jürgen Georg, Martina Kasper, Lisa Marie Hempel
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Martin Glauser, Uttigen
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau, Bühl
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s.r.o., Český Těšín
Printed in Czech Republic
Das vorliegende Buch ist eine Übersetzung aus dem Englischen.
Der Originaltitel lautet „Mindful Leadership“ von Christopher Johns.
© 2016. Christopher Johns, Palgrave Macmillan, Macmillan Publishers Limited.
1. Auflage 2018
© 2018 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95716-6)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75716-2)
ISBN 978-3-456-85716-9
http://doi.org/10.1024/85716-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des deutschen Herausgebers
Geleitwort
Vorwort
1 Visionen von Leadership
1.1Einführung
1.2Vision
1.3Achtsamkeit
1.3.1 Transformierende und transformative Leadership
1.3.2 Die transaktionale Pyramide
1.3.3 Leadership ist nicht Management
1.3.4 Die transformative Organisation
1.4Servant Leadership
1.4.1 Gemeinschaft
1.4.2 Initiative
1.4.3 Weitsicht
1.4.4 Überzeugungskraft
1.4.5 Zentrale Prinzipien der Servant Leadership
1.5Leadership als Chaos
1.6Leadership als weiblich
1.6.1 Weibliche Wissensaneignung
1.7Leadership als fürsorgend
1.8Offensives Denken
1.8.1 Persönliche Vision
1.8.2 Gelassenheit
1.9Suche im Internet
1.9.1 Gegenwärtige Leadership-Initiativen im NHS
1.10Schlussfolgerung
2 Das Abenteuer hat erst begonnen
2.1Einführung
2.2Mich selbst zu führen beginnen
2.3Das Stationsteam führen
2.4Durchhalten in schweren Zeiten
2.5Personenzentrierte Leadership
2.6Herausfordern des Transaktionalen
2.7Den Wandel einleiten
2.8Der weitere Weg
2.9Schlussfolgerung
3 Die lernende Organisation
3.1Die fünf Disziplinen
3.1.1 Vision
3.1.2 Denkmodelle
3.1.3 Systemisches Denken
3.1.4 Lernen im Team
3.1.5 Dialog
3.1.6 Positives Feedback
3.1.7 Persönliche Meisterschaft
3.1.8 Leadership
3.2Schlussfolgerung
4 Es geht automatisch, nicht wahr?
4.1Einleitung
4.1.1 Attribute der Servant Leadership
4.2Normale Konflikte
4.3Nachgeben
4.4Beatrice
4.5Weiter geht’s
4.6Noch mehr Konflikte
4.7Spaß beiseite
4.8Die Kultur der Schuldzuweisungen ändern
4.9Die Wende
4.9.1 Vertrauen
4.10Schlussfolgerung
5 Wandel steuern, Konflikte verringern, Qualität ist Sache der Führungsperson
5.1Ausbalancieren von Macht
5.2Furcht
5.3Lob der Autorität
5.4Teilnahmslosigkeit
5.5Burford Hospital
5.6Konflikte
5.7Das harmonische Team
5.8Mike
5.9Rogers Lamento
5.10Sheila
5.11Schlussfolgerung
6 Niemand hat gesagt, es würde einfach
6.1Einleitung
6.2Alarm schlagen
6.3Zurück zum Ausgangspunkt
6.4Und weiter voran
6.5Positive Fortschritte
6.5.1 Selbstbewusste Entwicklung
6.6Zurück zum Ausgangspunkt
6.6.1 Transaktionsanalyse
6.7Empowerment
6.8Endungen
6.9Schlussfolgerung
7 Der Weg nach Oz
7.1Einführung
7.2Schlussfolgerung
8 Die Blase in der Maschine
8.1Der gute Reisende
8.2Die Blase in der Maschine
8.3Arbeiten durch kreative Spannung
8.4Verändern von Normen
8.5Wohin jetzt?
8.6Gemeinschaft
8.7Leadership – Wunsch oder Bedrohung?
8.8Auf-und-ab-Schieben der Blase
8.9Anmerkung
9 Anhang 1: Das MSc Health Care Leadership Programm
9.1Forschungsgemeinschaft
9.2Reflexion
9.3Das Modell für strukturierte Reflexion
9.4Gefühle
9.5Was habe ich zu erreichen versucht?
9.6War ich effektiv?
9.7Welche Folgen hatte mein Handeln für mich selbst und andere?
9.8Sachkundig durch Wissen
9.9Rückblick
9.10Im Labyrinth der Moral
9.11Einflussfaktoren
9.12Der Blick nach vorn
9.13Wie fühle ich mich jetzt?
9.14Sich selbst und andere unterstützen
9.15Erkenntnisse gewinnen
10 Anhang 2: Narrative
10.1Sechs Dialogschritte
10.1.1 Erster Dialogschritt
10.1.2 Zweiter Dialogschritt
10.1.3 Dritter Dialogschritt
10.1.4 Vierter Dialogschritt
10.1.5 Fünfter Dialogschritt
10.1.6 Sechster Dialogschritt
10.1.7 Hintergrund
Literaturverzeichnis
Sachwortverzeichnis
Vorwort des deutschen Herausgebers
In den vergangenen Jahren hat sich in der Managementlehre der Trend herausgebildet, die Führung von Menschen mit einer achtsamen Grundhaltung zu verbinden. Es geht dabei nicht nur um einen partizipativen Führungsstil, der den Mitarbeitenden möglichst viel kreativen Raum bietet. Vielmehr geht es zunächst um einen Prozess der Selbstkultivierung. Dieser dient dazu, zunächst selber Techniken zu erlernen, die es uns erlauben, ein achtsames Leben zu führen, mit einer entsprechenden Haltung und im täglichen Verhalten. Meines Erachtens machen fünf Eigenschaften Achtsamkeit aus: Beobachten, Beschreiben, Handeln mit Gewahrsein, Vermeiden vorschnellen Beurteilens sowie Non-Reaktivität gegenüber innerer Erfahrung. Achtsamkeit unterstützt unser Wohlbefinden, stärkt unsere Autonomie, unseren Selbstwert und unsere optimistische Grundhaltung. Drei zentrale Aspekte der Achtsamkeit stechen hervor, die miteinander interagieren und achtsame Haltung ausmachen: Es braucht zunächst die Intention als Ausdruck einer bestimmten Absicht, achtsam zu sein und sich weiterentwickeln zu wollen. Zweitens die Aufmerksamkeit als Zeichen des aktuellen Erlebens ohne Gedankenfixierung, Gefühlsfokussierung oder Bewertung. Drittens den Aspekt der Einstellung als eine akzeptierende, mitfühlende Grundhaltung gegenüber jeglicher Erfahrung und Begegnung.
Diese Aspekte wiederum sind Voraussetzung, um in Führungspositionen Führung und Achtsamkeit zu verbinden. Das neue Schlüsselwort dafür ist auch in die deutsche Sprache übergegangen, die sogenannte „Mindful Leadership“. Zu diesem Führungsansatz findet sich nun vermehrt auch und gerade im angelsächsischen Raum die entsprechende Literatur. Gerade für den Gesundheitssektor, der sehr stark von zwischenmenschlicher Interaktion geprägt ist, sind Erfahrungsberichte über achtsame Führung überaus sinnvoll.
In diesem nun in seiner deutschen Übersetzung vorliegenden Buch von Christopher Johns beschreibt ein Praktiker aus dem Pflegemanagementbereich, wie einerseits Leistungsfaktoren wie verbesserte Versorgung, bessere Qualität der Pflege und Kostendruck mit achtsamer Führung andererseits in Einklang gebracht werden können. Der Autor bedient sich ausgiebig des Mittels der Narration. Er beschreibt in Erlebnisschilderungen von Managerinnen und Pflegeleitenden, wie auch aus eigener Erfahrung, wie der oft mühsame Weg zu Mindful Leadership im Gesundheitsversorgungsbereich erreicht werden kann. Dabei scheut er sich nicht, auch die Rückschläge zu schildern, die ihn oft genug an den Anfangspunkt zurück katapultierten und ihm fast die Hoffnung raubten, den Weg zu einer achtsamen Haltung in der Führung weiterzugehen.
Johns’ These lautet, dass hierarchische Systeme grundsätzlich transaktional geprägt sind. Betont werden Zwang und Macht (Befehl und Kontrolle), vor allem autoritäre Macht (geringes Vertrauen, ein hohes Maß an Furcht und Unsicherheit). Das Personal ist so konditioniert, dass es in der Organisation „seinen Platz kennt“, um deren reibungslose Abläufe sicherzustellen. Es handelt sich um Selbstregulation auf der Grundlage von Furcht. Diesem Ansatz stellt er den Gegenentwurf der transformativen Leadership entgegen. Hier ist das Zusammenspiel von Führung und Personal durch hohe Wertschätzung und intrinsische Motivation geprägt. Auf allen Hierarchieebenen wird ein Maximum an Freiheit gewährt, das den Menschen ein Höchstmaß an Kreativität einräumt. Der Praxisbezug macht dieses Werk zu einem einzigartigen Lehrbuch für achtsame Führung in der Gesundheitsversorgung.
Volker Schulte, Wallbach im Mai 2018
Geleitwort
Wer heutzutage ganz und gar präsent ist und mit dem Herzen hört, kann das tiefe Sehnen im Gesundheitswesen spüren. Es ist, als riefen Millionen Stimmen nach Hoffnung und Führung inmitten des Chaos aus steigendem Erkrankungsgrad und Pflegebedarf der Patienten, Reibungsverlusten durch Fluktuation, Problemen der Kostenerstattung, der Ausrichtung am Nettoprofit sowie abnehmender Gesundheit und rückläufigem Engagement der Beschäftigten. Da ist ein Verlangen nach Leadership, die einen Weg zurück zu diesem Gefühl von Bedeutung und Relevanz bahnt – jener Verbindung zu unserer innersten menschlichen Bestimmung, die das Beste in uns hervorbringt und uns in gemeinsamer Mission eint. Da ist ein Sehnen nach sozial engagierten Führungspersonen, die eine klare Sprache führen und Momente des Friedens und der Freude in Umfelder voll Turbulenzen, ständigen Veränderungen, stetigem Katastrophenmanagement und Adrenalinsucht bringen – eine kraftvolle und wahrhafte Stimme, die Hindernisse beseitigt, Probleme angeht, Konflikte eingrenzt, die Verletzlichen schützt, Talente anzieht und gedeihen lässt und die Infrastruktur für beispielhafte Berufspraxis in gesunder Arbeitsumgebung aufbaut. Führungspersonen mit einem klügeren und mitfühlenderen Verhältnis zur Menschlichkeit sind entscheidend für unser Überleben.
Der erste Schritt auf dem Weg zur Führungsperson besteht in der Selbsterkenntnis. Sich zu kennen ist ohne kontinuierliche, disziplinierte Reflexion unmöglich. Die Bereitschaft, sich auf diese freud- und leidvolle Studienreise zur Bewusstheit und dann zur Selbsterkenntnis zu begeben, erfordert Mut und eine Orientierungshilfe. In diesem Buch hat Johns Berufstätige, die achtsam danach streben, sich als Führungspersonen zu entwickeln, in ihren täglichen Interaktionen dargestellt. Aus ihren Stimmen hört man Freude, Leid, Mühen und Entdeckungen. Durch Schaffen einer strukturierten Reflexion und Integrieren der Komponenten transformativer Leadership werden wir in diesem Buch Zeugen, wie sich die Entwicklung von Führungspersonen beschleunigen lässt. Indem sich Praktiker durch Reflexion immer besser selbst verstehen, sind sie imstande, den nächsten Schritt ihrer Entwicklung als Führungspersonen zu tun, und zwar den der Einstimmung auf andere. Leadership wird möglich durch Beziehungen. Bei Leadership geht es um unsere Fähigkeit, durch jene Beziehungen Einfluss auszuüben. Ohne Respekt und die im Einklang liegende Empathie sind Beziehungen unmöglich.
Führungspersonen sind Paradoxa. Es sind Künstler, die die kreative Spannung des Richtigen zusammen mit dem politischen Eiertanz und dem Fokus auf dem Nettoprofit managen. Sie können sanft und mitfühlend und dennoch furchtlose, zähe und hartnäckige Kämpfer sein. Führungspersonen sind Stahl im Samthandschuh. Ihnen geht es darum, hohe Standards zu setzen, andere Menschen zu entwickeln, sie durch Feedback bei sich zu halten und dann loszulassen. Bescheiden gehen sie dennoch selbstbewusst Risiken ein. Es geht ihnen um Ausgewogenheit, und dennoch erkennen sie, dass der Status quo keine Option ist. Ständig praktizieren sie Reflexion und lernen kontinuierlich.
Führungspersonen schaffen einen sicheren Raum, ein Ökosystem innerhalb von Systemen, eine Subkultur innerhalb einer Kultur, in der Menschen gedeihen und ihr maximales Potenzial verwirklichen. Dieser sichere Raum findet sich in den minütlichen Interaktionen, wenn voll erwachte Führungspersonen jede Gelegenheit nutzen, sowie in den mikrointimen, achtsamen Momenten totaler Präsenz und kann dazu dienen, Verbindung zu Individuen aufzunehmen, Maßnahmen zu ergreifen, die zu einem Ziel führen und dabei keine Chance zu übergehen. Viele dieser Interaktionen werden in den Tagebucheinträgen der Praktiker in Johns’ Buch veranschaulicht.
Führungspersonen sind Leucht- und Signalfeuer in dem famosen Sturm der Gesundheitsversorgung, werfen Licht auf Probleme, lassen Talent aufscheinen, klären, was wirklich getan werden sollte, bringen das Beste in anderen Menschen hervor und schaffen eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Weg, dem man folgen sollte. Durch ihr Leuchten, den steten moralischen Kompass und authentischen Stil ziehen sie Anhänger an und geben Hoffnung. Damit Gesundheitsversorgung wieder zu ihrer Bestimmung zurückfindet, muss es auf allen Ebenen des Organisationslebens transformative Führungspersonen geben – angefangen von der Verwaltungsspitze, wo der Patient durch die Stimme eines Praktikers am Tisch des Sitzungssaals sichtbar wird, bis hin zum Ort der Pflege, wo ein kundig engagierter Praktiker bei jedem Austausch Geist und Seele, Herz und Hand beisteuert. Sinn und Zweck der Gesundheitsversorgung ist es, heilende Umgebungen zu schaffen, wo Patienten, Familien und Praktiker zum Team werden, um voneinander zu lernen, einander in den Freuden und Herausforderungen des menschlichen Daseins zu unterstützen und auf diese Weise mit unserem Lebensweg verflochten zu werden.
Führungsperson zu werden erfordert – ganz gleich, welches Adjektiv wir davorsetzen – eine mutige Bereitschaft, wirklich in uns zu gehen und unser wahres Selbst zu entdecken, das Engagement, zu dienen, im alltäglichen Dialog präsent zu sein, Feedback zu suchen und bereit zu sein, kontinuierlich zu wachsen, indem man ständig innehält, um das Geschehen um uns herum wahrzunehmen und geistig zu verarbeiten. Führungspersonen haben einen angeborenen Sinn für Generativität – die Leidenschaft, zu wachsen und andere zu entwickeln. Indem der Leser die Stimmen der Praktiker in diesem Buch wahrnimmt, spürt er das Unbehagen im Wachstum, während sie sich, getrieben von der Leidenschaft, zu wachsen, über ihre Komfort-Zone hinausrecken.
Beim Lesen dieses Buches sorgt eine wunderbare Darstellung der Stimmen von Praktikern, verflochten mit der Analyse und gestützt durch die Literatur über Leadership für eine besinnliche Gelegenheit, den „lernenden Leser“ aufzufrischen und neu zu orientieren. Lernen bedeutet „Verhaltensumstellung“ und wenn eine Passage vielleicht eine Saite zum Schwingen bringt und wir alle nur eine Sache aus diesem Buch mitnehmen und für unser berufliches Handeln entwickeln, so sind wir als Gemeinschaft der Pflegenden eine Verpflichtung zur weltweiten Veränderung der Gesundheitsversorgungslandschaft eingegangen.
Pamela Klauer Triolo
Chief Nursing Officer, UPMC
Associate Dean, Academic-Service Partnerships
University of Pittsburgh School of Nursing, Pittsburgh, PA
1 Visionen von Leadership
1.1Einführung
Führungsperson zu werden, ist eine ernste Angelegenheit. Aber was ist Leadership? Lassen Sie uns mit der Behauptung beginnen, dass Leadership bei einem selbst beginnt. Ein Narrativ ist hilfreich, um den Ort der Handlung festzulegen. Rebecca ist eine Pflegefachkraft auf Gemeindeebene („health visitor“), die mit einer jungen Mutter arbeitet.
Rebecca schreibt: „Ich begegnete Tanya zum ersten Mal, als ihr Baby 11 Tage alt war. Nach der Entlassung aus der Versorgung durch die Gemeinde-Hebamme [’community midwife‘] am zehnten Tag war dies ihr erster Kontakt mit der Gemeinde-Pflegefachkraft. Vielen Frauen in diesem Stadium muss dies einfach nur wie eine weitere Gesundheitsfachperson erscheinen, die man kennenlernen und zu der man Vertrauen fassen muss. Noch bevor ich klingeln konnte, wurde die Eingangstür rasch von einer Frau geöffnet, die sich als Tanyas Mutter vorstellte. Mit einer gewissen Dringlichkeit werde ich ins Wohnzimmer gebeten und mit Tanya alleingelassen. Sie sitzt auf dem Sofa, umgeben von den Paraphernalia der Elternschaft – Nesseltücher, Cremes, Windeln, Fläschchen, Einlagen und Wischtücher. Es scheint, als würde der gesamte Raum von dem Drumherum eines winzigen Babys eingenommen. Tanya wirkt verloren und panisch inmitten all dessen, als treibe sie in einem Ozean umher. Ich setze mich neben sie und frage sie einfach nur, wie es ihr geht. Ihre Geschichte bricht aus ihr hervor und den nächsten Teil jenes grauen, feuchten Nachmittags lausche ich einer sich entfaltenden Erzählung über falsche Hoffnungen, Träume und Erwartungen, die nun verstreut und aufgelöst in einem Meer von Tränen liegen. Die geplante minimalinvasive Wassergeburt, die zur Notfallsektio wurde; das erwartete natürliche, intensive Vergnügen des Stillens, das zu schmerzhaften, frustrierenden und ängstlichen Stunden wurde, genährt von der Furcht vor unzureichender Gewichtszunahme ihres Säuglings. Während der Regen ununterbrochen gegen die hellen Verandatüren schlägt, gebe ich alle geplanten Schreibarbeiten auf und höre einfach nur der traurigen Geschichte einer Frau zu, die ihr Leben immer so gut geplant, so gut unter Kontrolle gehabt hatte und sich jetzt dennoch so hilflos und verloren fühlt. Ich rate ihr nur sehr wenig, eingedenk dessen, dass ich mich früher darauf konzentriert hätte, Dinge in Ordnung zu bringen, ein erfolgreiches Ergebnis zu erreichen. Ich bin mir der Dokumentationsrichtlinien und der Notwendigkeit von Standards bewusst, aber Tanyas Bedürfnisse sind stärker. Ich fürchte mich nicht vor Sanktionen, wie ich es vielleicht früher getan hätte.
Ich bin zufrieden, Tanya zu ermöglichen, ihre Gefühle mit mir in der Erkenntnis zu erkunden, dass sie diesen Prozess selbst dann durchlaufen muss, wenn es dabei kein Happy End geben kann. Ich schlage vor, es könne ihr helfen, Sinn in ihre Gedanken und Gefühle zu bringen, wenn sie sie aufschriebe. Sie scheint überrascht, dass man ihr ,erlaubt‘, selbst die Richtung vorzugeben; sie hatte erwartet, man würde ihr sagen, was sie tun solle. Auf dem Rückweg in die Chirurgie lächle ich, als ich plötzlich der Parallelen zwischen meinem Vorschlag gegenüber Tanya und meinem eigenen Erleben gewahr werde, Tagebuch als eine Art des Erkundens der Widersprüche zwischen der wünschenswerten und der tatsächlich gelebten Erfahrung zu führen. Ich bin mir bewusst, dass ich viel zugänglicher für Tanya bin als dies bei ähnlichen Visiten der Fall war. Warum? Das „Einflussraster“ (Johns, 2013) hilft mir zu klären, welche Faktoren meine Handlungen mit Tanya beeinflusst haben.2 Die Anwendung des Rasters schafft Raum, um mich selbst zu überprüfen und meine Werte zu bestärken. Jetzt, beim Überlegen, kann ich sehen, dass ich mich achtsam mit Tanya beschäftigt hatte, verfügbar im Augenblick, statt distanziert. Das Wort ,beschäftigen‘ zu verwenden, ist tiefgründig. Ich erinnere mich, eine Arbeit von Davies (1995) gelesen zu haben, die dieselbe Terminologie verwandt hat. Ich suche ihre Arbeit nochmals heraus und sehe, wie gut sie zu meiner eigenen Praxisvision passt. Sie argumentiert, Pflege würde entwertet, indem sie nur als weiblich betrachtet würde (und die Medizin durch ihre Maskulinität die Oberhand bekäme); obwohl die Gesellschaft Pflegende schätzt, entwertet sie den fürsorgenden Akt des Pflegens. Kann das immer noch stimmen? Ich fürchte ja. Sie schlägt eine gender-freie Definition von Pflege vor, mit Merkmalen, die eine Fusion sowohl männlicher als auch weiblicher Qualitäten in einem nicht geschlechtsgeprägten Beruf darstellen:
weder distanziert noch involviert, aber engagiertweder autonom noch passiv/abhängig, sondern interdependentweder selbstorientiert noch zurückhaltend, sondern ein verkörperter Einsatz des Selbst als Teil der therapeutischen Begegnungweder bestimmend noch passiv, sondern Schöpfer einer aktiven Gemeinschaft, in der sich Lösungen aushandeln lassenweder Herr/Besitzer von Wissen noch Anwender von Erfahrung, sondern reflexiver Nutzer von Erfahrung und Sachkenntnis.Davies hilft mir, meine Rolle als Führungsperson zu visualisieren. Sie bietet insofern Wesentliches, als ich besser weiß, was ich zu tun versuche, während ich mich in meiner praktischen Tätigkeit selbst führe.
Wie also spiegelt dieses kurze Narrativ meine Leadership wider? Höchst signifikant: Es geht um Leadership. Ich wandle mich von autoritativ in fazilitativ bzw. fördernd.3 Ich bin erfüllt von der Idee, mit Tanya, meinen anderen Müttern und meinen Kolleginnen eine ,aktive Gemeinschaft‘ zu kreieren. Weder ließ ich mich so weit auf Tanya ein, dass ihre Sache zu meiner wurde, noch war ich so distanziert, dass ich gleichgültig erschien, sondern hielt diese beiden Extreme durch aktives Engagement im Gleichgewicht. Pinar (1981, S. 178) warnt, dass Empathie ,verbirgt wie aufdeckt‘ und dabei potenziell einen politischen Papiertiger schafft, wenn übermäßige Anteilnahme zur Komplizenschaft bei den Täuschungen einer anderen Person führt. Meine Handlungen auf dieser tieferen, kritischeren Ebene zu verstehen, indem ich mir neben der ästhetischen Perspektive auch organisationale und kulturelle Sichtweisen zu eigen mache, hilft mir, die Erfahrung zu dekonstruieren und Wege zu erkennen, um sie auszuhalten. Ich konnte nicht anders, als zwischen meinen Reaktionen hier und Cassie im Narrativ ,Seelen in Not‘ zu vergleichen, das ich einige Monate zuvor geschrieben hatte. Als ich Cassie nicht ,reparieren‘, ihre Gefühle nicht kontrollieren konnte, vermochte ich für mich keine Rolle mehr zu erkennen und zog mich rasch zurück. Hier, bei Tanya, konnte ich im Jetzt bleiben, ihr ohne meine eigene Agenda zur Verfügung stehen, unser beider bewusst, den sich entfaltenden Moment managend und sie in ihrer Krise unterstützend. Das ist wahre Präsenz – dem Augenblick Menschliches zu verleihen und zugleich dem anderen, der die Bedeutung der Situation zu erkunden sucht, von sich selbst zu geben (Liehr, 1989).
Führungsperson zu werden, war eher so etwas wie ein unbewusster Akt – andere haben es gesehen und Veränderungen bemerkt, deren ich mir selbst nicht so bewusst war. Es ist wie ein Kind, das wächst – andere sehen es wachsen, aber das Kind merkt es nicht. Die Veränderungen treten täglich ein, so winzig, dass sie nicht wahrzunehmen sind, kaum vorhanden, aber kumulierend. Im Zusammensein mit Tanya fühlte ich mich wirklich wachsen, war aktiv achtsam gegenüber dem Prozess und konnte die Verwandlung spüren. Die reflexive Spirale ist bisweilen eine sich schrittweise entfaltende Erfahrung und manchmal ein dramatischer Augenblick der Offenbarung (Johns, 2013) – dies war mein dramatischer Moment.“
1.2Vision
Rebeccas Geschichte gibt zu einem bestimmten Zeitpunkt Einblick in ihren Weg zur Leadership. Eingedenk ihrer Leadership-Vision versucht sie, sie als Realität zu leben. Diese Spannung zwischen ihrer Vision und ihrer Realität bildet den Schwerpunkt ihrer Reflexion. In der Theorie eröffnet sich Rebecca ein Dialograum, um im Kontext ihrer Erfahrung darüber nachzudenken, und formt ihr berufliches Handeln. Durch Reflexion kann sie Theorie in Praxis umsetzen.4 In diesem Sinne verleiht die Theorie jeder Suche nach einer Leadership-Vision Substanz.
Eine Vision gibt dem Handeln Ziel und Motivation. Zwar sollte sich jede Führungsperson über ihre persönliche Vision deutlich im Klaren sein, jedoch sollte diese Vision weder vorgeschrieben noch aufgezwungen sein. Bei der Arbeit in Organisationen könnte die Vorstellung, eine Leadership-Vision sollte auch wirklich Ihre eigene sein, problematisch werden, wenn ihr niemand sonst zustimmt. Mehrere voneinander abweichende Visionen verschiedener Teammitglieder könnten dazu führen, dass jeder in eine andere Richtung zieht. Stellen Sie sich vor, unter solchen Umständen geführt zu werden. Vermutlich kennen viele Lesende dieses Szenario und seine demoralisierenden Folgen.
Beim Aufbau einer Leadership-Vision sind sich Führungspersonen wie Rebecca der Konzepte von Leadership bewusst. Ein Ansatz besteht darin, einfach ein Konzept, wie zum Beispiel die Vorstellungen von Bass über transformative Leadership, zu übernehmen. Dieser Ansatz ist verlockend, weil solche Vorstellungen weitgespannt und anerkannt sind. Ein konstruktiverer Ansatz besteht darin, eine aus verschiedenen Quellen konstruierte, eklektische Vision aufzubauen. Dieser Ansatz erfordert mehr Nachdenken und es fehlt im vielleicht an Autorität. Die Führungsperson muss sich jedoch ständig fragen: „Was bedeuten diese Worte aus der Theorie als etwas Gelebtes?“ Nur dann kann sie über Ideen hinaus zu einer ihr wirklich eigenen Leadership-Vision gelangen. Und selbst dann bleibt die Vision in stetem Fluss, da sie sich angesichts der Reflexion über ihre Natur immer wieder verändert. Bei der Durchsicht der zeitgenössischen Literatur über Leadership in der Gesundheitsversorgung gilt das Konzept der transformativen Leadership weithin als wünschenswert. Dies steht in deutlichem Gegensatz zur vorherrschenden Leadership vom transaktionalen Typ, wie sie für Organisationen des Gesundheitswesens charakteristisch ist (Bass, 1990; Sofarelli & Brown, 1998). Sofarelli und Brown (1998) zufolge ist transformative Leadership das Modell, welches die Pflege darin unterstützen wird, zu einer befähigten Profession zu werden, die das Potenzial hat, bei der Neugestaltung des Gesundheitsversorgungssystems der Zukunft eine dominante Stimme zu haben.
Es müssen aber auch andere Leadership-Konzepte betrachtet werden, vor allem Servant Leadership. Sie bietet eine radikal andere Perspektive, bei der die Führungsperson zuvörderst eine dienende statt eine führende Person ist. Die Rolle der Leadership besteht im wörtlichen Sinne darin, jenen, welche die Dienstleistungen erbringen, zu dienen. Stellen Sie sich vor, wie diese Form von Leadership die Art der Beziehungen in der Organisation verändern würde. Mit Ideen und Konzepten zu spielen ist kreativ, was ebenfalls eine Leadership-Qualität darstellt.
Wheatley (1999) schreibt:
„Verhaltensweisen ändern sich nicht, nur weil man neue Wertvorstellungen verkündet. Nur schrittweise vermögen wir nach und nach, in Übereinstimmung mit diesen Werten zu handeln. Um dies zu tun, müssen wir eine viel stärkere Bewusstheit der Art unseres Handelns entwickeln; wir müssen viel selbstreflexiver als normal werden […] Stück für Stück, erprobt durch Ereignisse und Krisen, lernen wir, diese neuen Wertvorstellungen umzusetzen. Wir entwickeln andere Verhaltensmuster. Ganz langsam werden wir zu denen, die wir erklärtermaßen sein wollten.“ (Ebd., S. 130)
„Viel selbstreflexiver als normal“ (s. obiges Zitat) führt dazu, achtsam zu werden.
1.3Achtsamkeit
Kabat-Zinn (1994) schreibt:
„Sie werden eine Vision brauchen, die wahrhaft Ihr Eigen ist – eine, die tief gehend und fest ist und dicht am Kern dessen liegt, was Sie zu sein glauben, was Sie in ihrem Leben werthalten und wohin Sie sich gehen sehen. Nur die Kraft solch einer dynamischen Vision und die Motivation, aus der sie entspringt, kann Sie jahrein, jahraus auf diesem Weg halten, mit einer Bereitschaft, täglich Achtsamkeit zu praktizieren und sie bei jedem Geschehen zum Tragen zu bringen, sich jeder Wahrnehmung zu öffnen und sie aufzeigen zu lassen, wo das Festhalten und das Loslassen liegen und wo Wachstum erfolgen muss.“ (Ebd., S. 76)
Kabat-Zinns Betonung der Achtsamkeit ist der Schlüssel. Goldstein (2002, S. 32) beschreibt Achtsamkeit als „die Qualität, dem Augenblick volle Aufmerksamkeit zu widmen, indem man sich der Wahrheit des Wandels öffnet“. Es ist die Fähigkeit, uns selbst deutlich, ohne Verzerrung, ohne Vorurteil zu betrachten. Die meiste Zeit ist unser Kopf gefüllt mit ,Zeug‘. Unser Geist ist überall, wir werden abgelenkt. Wir sehen die Dinge nicht klar. Führungspersonen lernen, ihren Geist zu leeren. Wie Susuki (1999) schreibt: „Wenn Dein Geist leer ist, ist er stets bereit für alles; er ist offen für alles. Im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Kenners nur wenige.“ (Ebd., S. 21).
Achtsamkeit umfasst die Fähigkeit, die kreative Spannung zwischen einer Vision von Leadership und ihrer Verwirklichung als gelebte Realität aufrecht zu erhalten. Es ist eine Sache, eine Vorstellung von etwas zu haben, und eine ganz andere, es als wahrhaft Gelebtes zu kennen. Achtsam zu sein, ist eine reflexive Selbstbewusstheit, eine stetige und natürliche Selbstbefragung und ein Handeln im Sinne der Umsetzung eigener Leadership-Werte (oder der Vision) in gelebter Wirklichkeit. Die achtsame Führungsperson ist sich ihrer Annahmen und der Art, wie sie ihre Wahrnehmungen beeinflussen, bewusst. Es ist, als betrachte man sich im Spiegel: mit Warzen und allem anderen! Zweifellos wischen die Menschen über den Spiegel, um ihr Spiegelbild zu verzerren, damit es zu einem idealen Selbst passt. Um sein Selbst klar zu sehen, säubert die Führungsperson ständig ihren Spiegel, auch wenn die Bilder unangenehm sein mögen. Unsere Illusionen über uns selbst werden weggerissen, um das nackte Selbst zu enthüllen. Um unsere Selbstidentität aufrechtzuerhalten, tragen wir Masken. Werden uns unsere Masken genommen, wie schützen wir dann unsere Verletzlichkeit? Dies ist die Arbeit der Reflexion, die Kunst, sich selbst gegenüber aufmerksam zu sein, um die eigene Realität zu sehen und nach Bedarf zu verändern, um eine echte Führungsperson zu werden. Zugang zu den eigenen Annahmen zu finden, sie kritisch zu sichten und zu verändern, ist jedoch nicht leicht, da sie sozial konstruiert sind und durch Beziehungsmuster als normal erlebt werden. Veränderte ich meine Annahmen, würde sich dies auf andere auswirken und dabei Störungen des normalen Ablaufs alltäglichen Handelns verursachen.
Jede Erfahrung ist einzigartig, ein sich entfaltendes Geheimnis. Sie wurde noch nie zuvor gemacht, auch wenn die Führungsperson vielleicht ähnliche Erfahrungen zu erkennen vermag. Sobald wir zu wissen glauben, sehen wir nur noch, was wir kennen. Der Geist verschließt sich Möglichem.
Auch wenn Achtsamkeit die Eigenschaft ist, achtsam zu sein für das, was sich im Jetzt entfaltet, ist sie dennoch mit einem Gefühl sowohl für die Zukunft als auch für die Vergangenheit verbunden. Im Hinblick auf die Zukunft ist Leadership zielgerichtet; die Führungsperson hat beständig die Absicht, ihre Vision von Leadership zu verwirklichen. Hinsichtlich der Vergangenheit finde ich das buddhistische Wort apramada hilfreich. Es bedeutet den stets für Bedrohungen wachen Wächter am Tor der Sinne. Sangharakshita (1988) schreibt: „Ständig versuchen Unaufmerksamkeit und Fehler, an uns heranzukommen, aber unser stets wacher Geist versucht, sie zu vertreiben“ (ebd., S. 148). Somit ist der Geist zwar zielgerichtet, beseitigt aber auch Hindernisse auf dem Weg zu diesem Ziel. Greenleaf (2002) weist auf Achtsamkeit als eine Leadership-Qualität hin: „Die Kultivierung von Bewusstheit gibt einem die Grundlage für Losgelöstheit, die Fähigkeit, beiseite zu stehen und sich selbst in der Perspektive des Kontexts der eigenen Erfahrung, inmitten der immer präsenten Gefahren, Bedrohungen und Ängste zu sehen.“ (Ebd., S. 41). Es ist durch Reflexion, dass sich die Führungsperson in ihrem beruflichen Handeln ihrer selbst zunehmend bewusst wird, die Art ihres Denkens, Fühlens und Reagierens bewusster wahrnimmt und sich jener Kräfte stärker bewusst wird, die ihr Vorankommen einschränken. Auf diese Weise wird Achtsamkeit genährt.
1.3.1 Transformierende und transformative Leadership
Der Begründer und Vater der transformativen Leadership ist James McGregor Burns. Er prägte das Konzept einer transformierenden Leadership als notwendig für eine gerechte und zunehmend komplexe globale Gesellschaft und rückte dabei die Vorstellung von Leadership von früheren Leadership-Theorien ab, die auf Grundeigenschaften, Verhalten oder Aufgaben (Northouse, 2001) oder Situationstheorien (Hersey & Blanchard, 1982) beruhten.
Burns (1978) schreibt: „Transformierende Leadership tritt auf, wenn eine Person sich in einer Weise auf andere einlässt, dass Führungsperson und Geführte einander auf höhere Ebenen der Motivation und Moralität heben.“ (Ebd., S. 20). Diese kurze Beschreibung ist in ihrer Klarheit und Kürze inspirierend. Sie eröffnet einen Weg, Leadership als etwas zu empfinden, das als relational, moralisch und wechselseitig befähigend gelebt wird. Jede Maßnahme der Führungsperson dient dem Ziel, eine bessere Welt zu schaffen.
Aus den grundlegenden Arbeiten von Burns entwickelte Bass (1985) die transformative Leadership, die mehr mit organisationaler Leadership als mit Burns´ weitergefasster sozialer Agenda zu tun hatte. Bass kümmerte sich mehr um wesentliche, miteinander vernetzte Aspekte transformativer Leadership, die einen dynamischen Bezugsrahmen zur Einschätzung ihrer fundamentalen Natur liefern:
idealisierter Einfluss – dass Leadership auf wahrem Vertrauen