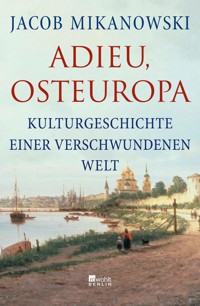
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Oder bis Sibirien, von der Krim bis zum Baltikum – zum ersten Mal wird der osteuropäische Kulturraum insgesamt ins Auge gefasst, ja nachgerade neu entdeckt: Jacob Mikanowski entwirft das Panorama einer ungemein reichen Welt, die dem Westen stets fremd war und zugleich starke Impulse gab – sei es in Musik und Kunst um 1900, in der Erfindung des Nationalismus oder im jüdischen Leben. In weiten Bögen schildert er die Fährnisse von großen wie unbekannten Volksgruppen, Reichen, Religionen. Imperien wie Österreich-Ungarn oder Russland, auch der Islam werden im Gesamtbild neu begreiflich. Entlegenes beschreibt Mikanowski romanhaft spannend: die jüdische Kriegersekte der Karäer, nomadische Räuberdynastien oder Werwolf-Familien; er porträtiert illustre Figuren wie den «Guru» Jakob Frank, der Goethe erstaunte, den türkischen Dandy und Reiseautor Evliyâ Çelebi, der ab 1630 halb Europa und Afrika erkundete, oder die kaiserliche Augenärztin Salomea Pilsztyn. Jacob Mikanowski lässt eine ganze Welt lebendig werden, die in ihrer Vielfalt an Sprachen, Ethnien, Künstlern, Spielern und Herrschern verblüffend modern war, lange bestand und die erst im Kapitalismus des späten 20. Jahrhunderts untergeht. Eine glänzend erzählte, große Kulturgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jacob Mikanowski
Adieu, Osteuropa
Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt
Über dieses Buch
Von der Oder bis Sibirien, von der Krim bis zum Baltikum – zum ersten Mal wird der osteuropäische Kulturraum insgesamt ins Auge gefasst, ja nachgerade neu entdeckt: Jacob Mikanowski entwirft das Panorama einer ungemein reichen Welt, die sich im Kern vom Westen unterschied: In Jahrhunderten des Sklavenhandels und der Unterdrückung herrschte zugleich ein tolerantes Nebeneinander der Kulturen, Religionen. Aus diesem Reservoir gab der Osten dem Westen starke Impulse – sei es in Musik und Kunst um 1900, in der Erfindung des Nationalismus oder im jüdischen Leben. Mikanowski schildert die Fährnisse von großen wie unbekannten Volksgruppen, Reichen, Sekten. Imperien wie Österreich-Ungarn oder Russland, auch der Islam werden im Gesamtbild neu begreiflich. Entlegenes beschreibt Mikanowski romanhaft spannend: die jüdische Kriegersekte der Karäer, längst vergessene Weltstädte, in denen sich einst Kulturen kreuzten, oder Werwolf-Familien; er porträtiert illustre Figuren, falsche Heilige und echte Lichtgestalten, darunter der «Guru» Jakob Frank, der Goethe erstaunte, oder der türkische Dandy und Reiseautor Evliyâ Çelebi, der ab 1630 halb Europa und Afrika erkundete. Nicht zuletzt erhellt dieses Buch das komplexe wie fragmentierte Erbe des östlichen Europas, wie es bis heute zu finden ist.
Jacob Mikanowski lässt eine ganze Welt lebendig werden, die in ihrer Vielfalt an Sprachen, Ethnien, Künstlern, Spielern und Herrschern verblüffend modern war, lange bestand und die erst im Kapitalismus des späten 20. Jahrhunderts untergeht. Eine glänzend erzählte, große Kulturgeschichte.
Vita
Jacob Mikanowski, Historiker, Kritiker und Publizist, schreibt u.a. für den «New Yorker», den «Guardian» und die «New York Times». Er wurde 1982 in den USA geboren, als sein polnisch-jüdischer Vater und seine Mutter aus adliger ungarischer Familie aufgrund des in Polen verhängten Kriegsrechts nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «Goodbye, Eastern Europe. An Intimate History of a Divided Land» bei Pantheon.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 2023 by Jacob Mikanowski
Covergestaltung Frank Ortmann
Coverabbildung «Pskow». Gemälde von Pjotr Petrowitsch Wereschtschagin, 1876, Moskau, Tretjakow-Galerie/akg-images
ISBN 978-3-644-01203-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Prolog
Teil I Glauben
Kapitel 1 Heiden und Christen
Kapitel 2 Juden
Kapitel 3 Muslime
Kapitel 4 Ketzer
Teil II Imperien und Völker
Kapitel 5 Imperien
Kapitel 6 Völker
Kapitel 7 Wanderer
Kapitel 8 Nationen
Teil III 20. Jahrhundert
Kapitel 9 Modernen
Kapitel 10 Propheten
Kapitel 11 Krieg
Kapitel 12 Stalinismus
Kapitel 13 Sozialismus
Kapitel 14 Tauwetter
Epilog
Dank
Bildnachweis
Prolog
Dies ist die Geschichte eines Ortes, den es nicht gibt. So etwas wie Osteuropa existiert nicht. Niemand kommt von dort. Die Menschen kommen aus einzelnen Ländern – Slowakei, Lettland, Bulgarien – oder Städten: Sarajewo, Łódż, Mariupol. Manchmal kommen sie aus Regionen oder Landschaften: aus den Kiefernwäldern von Masowien, den regennassen Hügeln von Maramureş, der kargen Felswelt des Lunxhëri-Massivs.
Aber wo auch immer sie herkommen, die Menschen identifizieren sich nicht als Osteuropäer. Der Begriff ist eine Bequemlichkeit für Außenstehende, ein Sammelbegriff, hinter dem sich ein ganzes Nest von Stereotypen verbirgt. Einige dieser Stereotype – Armut, Gangstertum, ethnische Konflikte – richten durchaus einigen Schaden an. Andere sind einfach nur traurig. Ein Freund von mir, Professor für polnische und deutsche Geschichte, wurde einmal allen Ernstes von einem Studenten gefragt, ob es denn stimme, dass Osteuropa «eine graue Gegend ist, wo nie jemand lacht».
Angesichts solch düsterer Assoziationen ist es kein Wunder, dass die Menschen auf keinen Fall mit Osteuropa in Verbindung gebracht werden wollen. Selbst auf der Ebene der internationalen Beziehungen verliert Osteuropa an Boden. In den letzten dreißig Jahren hat ein Land nach dem anderen versucht, das Etikett loszuwerden. Noch vor dem Fall der Berliner Mauer erklärten sich die Tschechoslowakei, Ungarn und Polen zu einem Teil Mitteleuropas. Die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland haben sich für eine nördliche Alternative entschieden und gelten heute am liebsten als Mitglieder einer «nordischen» Zone. Auf beiden Seiten des Balkans haben Länder von Montenegro bis Rumänien eine maritime Option gewählt und identifizieren sich mit Gemeinschaften, die entweder an der Adria oder am Schwarzen Meer liegen.
Angesichts so vieler Abtrünniger ist Osteuropa als geopolitischer Begriff so gut wie tot. Dabei schien seine Existenz vor nicht allzu langer Zeit noch absolut selbstverständlich zu sein. Ich bin alt genug, um mich an die Zeit zu erinnern, als Osteuropa noch eine ins Auge springende Realität war. Als ich 1986 die Rollbahn des Chopin-Flughafens in Warschau verließ, betrat ich eine völlig andere Welt als die, die ich in der Vorstadt von Pennsylvania zurückgelassen hatte. Wie in den übrigen Ländern hinter dem Eisernen Vorhang war es eine Welt, die nach ihren eigenen Regeln funktionierte. Man konnte keinen Schinken im Laden kaufen, aber die Leute standen Schlange für neue Übersetzungen ausländischer Romane. Niemand wählte, aber die Politik war in aller Munde. Sogar der Geruch in der Luft war anders. Im Winter brennende Braunkohle, im Sommer die kühle Ausdünstung nicht geputzter Treppenflure. Wenn ich heute einen dieser Gerüche wahrnehme, fühle ich mich sofort in die verlorene Welt meiner Kindheit versetzt.
Damals war das, was Osteuropa greifbar machte und zusammenhielt, der Kommunismus. Vor der epochalen Umwälzung durch die Revolutionen von 1989 bis 1991 gehörte der gesamte riesige Kontinent zwischen Estland im Norden und Albanien im Süden, der Ukraine im Osten und der Tschechoslowakei im Westen zum Reich des Roten Sterns.
Aber die Wurzeln dieser Einheit reichen viel tiefer. Es gibt etwas, das Osteuropa auszeichnet, etwas, das es von Westeuropa auf der einen Seite und dem übrigen Eurasien auf der anderen Seite unterscheidet. Dieses wesentliche, bestimmende Merkmal ist die Vielfalt – die Vielfalt der Sprachen, der Ethnien und vor allem des Glaubens.
Als religiöses Grenzland hat sich Osteuropa zum ersten Mal als etwas anderes definiert als der Rest Europas. Das Heidentum hielt sich hier länger als irgendwo sonst auf dem Kontinent und hinterließ tiefe Spuren in der Folklore und im Volksglauben. Als um das Jahr 1000 das Christentum aufkam, trat es in zwei verschiedenen Formen auf – katholisch und östlich-orthodox – und sorgte für die erste von vielen Glaubensspaltungen in der Region. Der Islam kam ein paar Jahrhunderte später, verbreitet durch die eindringenden osmanischen Türken und Tataren. Im Jahr 1492 gehörte die gesamte Balkanhalbinsel zum dar-al-Islam, und Moscheen gab es (und gibt es immer noch) bis nach Vilnius in Litauen.
Im selben Jahr, als Ferdinand und Isabella von Spanien die letzten Juden aus ihrem Königreich vertrieben, lud das Osmanische Reich sie ein, sich in seinen größten Städten niederzulassen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Osten zur Wiege des europäischen Judentums. Während die westeuropäischen Länder eins nach dem anderen ihre Juden auswiesen (Spanien war nur am letzten in einer langen Reihe), nahmen die osteuropäischen Königreiche sie auf.
Während eines Großteils seiner Geschichte war Osteuropa eine Grenzgesellschaft, die in Gebiete vordrang, die zuvor unkultiviert waren oder durch lang andauernde Grenzkriege entvölkert worden waren. Mehrere Besiedlungswellen gaben dem Land einen Charakter, der sich von dem Westeuropas (oder auch des größten Teils von Russland) deutlich unterschied. In Osteuropa war es üblich, dass katholische und orthodoxe Christen in enger Nachbarschaft mit Juden und Muslimen lebten. Diese Überlappung mehrerer Religionen hatte zur Folge, dass es schwierig war, das Dogma eines einzelnen Glaubens durchzusetzen. Osteuropa wurde so zu einem Zufluchtsort für religiöse Außenseiter und Ketzer. Gruppen wie die Bogomilen, die Hussiten, die Frankisten und die Aleviten haben die Kultur der Region tief geprägt. Gleiches gilt für eine Vielzahl von Magiern, Alchemisten und Okkultisten, deren gemeinsame Präsenz Osteuropa zum wichtigsten Übungsareal des Kontinents für die dunklen Künste machte.
Heute sind die meisten Juden verschwunden, und die islamische Präsenz ist deutlich zurückgegangen. Noch schwerer zu finden sind aktive Alchemisten. Dennoch ist das Gewicht dieses Vermächtnisses vielerorts zu spüren. Jahrelang bin ich überallhin gereist, von den Sufi-Schreinen von Dobruja in Rumänien bis zu den letzten Holzsynagogen von Samogitia in Litauen, um nach Spuren dieser verschwindenden religiösen Vielfalt zu suchen. Für mich war das auch eine persönliche Suche. Mein familiärer Hintergrund – halb jüdisch und halb katholisch – enthält ein Bruchstück dieser vergangenen Vielfalt.
Dieses Buch ist keine Familiengeschichte, aber die Geschichte meiner Familie zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Der polnische Dichter Czesław Miłosz hat einmal davon gesprochen, dass «die Erinnerung an meine Vorfahren wie ein Anker ist, dessen Kette tief hinabreicht» und ohne den «man schwerlich ein Gefühl für Geschichte entwickeln kann».[1] Und so ist es auch für mich; meine Vorfahren sind die Wurzel all dessen, was ich schreibe.
Als Mitglied einer sehr kleinen Gemeinschaft polnischsprachiger Juden wurde ich in eine Kultur hineingeboren, die fast völlig verschwunden ist. Es war die Welt der säkularen jüdischen Intelligenz, die dem literarischen Erbe Polens leidenschaftlich zugetan war, aber der Verbindung von Katholizismus und Nationalismus misstraute. Doch das ist nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte besteht aus konkurrierenden Strängen, die nach Klassen unterteilt sind, Bauern, Handwerker und Adlige. Einige dienten den Fürsten, andere schufteten im Verborgenen. Es dauerte jedoch Jahrhunderte, bis sie sich zu Angehörigen dessen zusammenfügten, was wir heute «Polen» nennen.
Religion, Ethnie und Klasse waren in Osteuropa nie streng voneinander getrennt. In einem Ausmaß, das in den meisten anderen Ländern der Welt unbekannt ist, wirkten diese drei Merkmale der sozialen Aufteilung zusammen, um Berufs- und Kastengrenzen abzustecken. Hier war es üblich, dass Grundbesitzer, Pächter und Stadtbewohner verschiedene Sprachen sprachen und unterschiedlichen Religionen angehörten. Selbst im kleinsten Dorf konnte ein zehnminütiger Spaziergang an Gotteshäusern vorbeiführen, die drei verschiedenen Religionen gewidmet waren und in denen die Gemeindemitglieder jeweils eine andere Sprache sprachen. Wenn man eine gewisse Zeit auf der Straße verbrachte, stieß man auf eine ganze Reihe verschiedener Sprachen und Glaubensrichtungen, die zu den zahlreichen Nomaden, fahrenden Händlern und anderen professionellen Wanderern der Region gehörten.
Jahrhundertelang glichen die traditionellen Gesellschaften Osteuropas meist einem bunten Wandteppich. Die Vielfalt war kein Nebenprodukt dieses Systems, sie war dem Ganzen eingewoben. Doch diese räumliche Nähe zwischen verschiedenen Religionen und Sprachen führte nicht unbedingt zu Harmonie. Die alte Ordnung beruhte auf einer strikten Trennung zwischen den Klassen und zwischen den Religionen. Als diese Trennungen im 20. Jahrhundert aufbrachen, gewannen die Menschen ein neues Maß an Freiheit, sahen sich aber auch neuen Gefahren ausgesetzt. In meiner eigenen Familie wurde die Vermischung von Christen und Juden, Bauern und Adligen erst durch die totale Katastrophe des Zweiten Weltkriegs möglich. Und selbst jetzt war es nicht so einfach, die Grenzen zu überschreiten; ich bin aufgewachsen mit Geschichten von Familienmitgliedern, die gemieden wurden oder sich jahrzehntelang nicht gesehen haben. Auch diese Geschichte ist in Osteuropa gang und gäbe – zahllose Familien wurden durch neue Grenzen, alte Religionen oder die Zugehörigkeit zu rivalisierenden Ideologien getrennt.
Mein eigenes geteiltes Erbe hat mich mit einem komplizierten Vermächtnis ausgestattet. Aus diesem Grund neige ich dazu, die Geschichte Osteuropas weniger als eine Geschichte von Nationen und Staaten zu sehen, sondern eher als eine Geschichte konkurrierender Glaubenssysteme. Politische Debatten in Osteuropa drehen sich sehr oft um Kämpfe um das Heilige. Während des gesamten 20. Jahrhunderts boten Faschismus, Kommunismus und Nationalismus den Menschen wirkmächtige Quellen der Sinnstiftung. Wo immer diese Ideologien von vielen Menschen übernommen wurden, waren religiöse Modelle nicht weit, entweder als Vorbild oder als Konkurrenz.
Seit Jahrhunderten ist Osteuropa ein Ort der Suchenden. Wirtschaftlich weniger entwickelt als der Westen, aber offen für eine Fülle religiöser und messianischer Traditionen, war es lange Zeit ein Ort, an dem die Menschen von einem plötzlichen, alles verändernden Sprung in die Zukunft träumten. Es ist zudem ein Ort, der von der Sehnsucht nach einer eher irdischen Art der Befreiung geprägt ist.
Als größerer Widersacher als die Armut erwies sich für viele Revolutionäre das jeweilige Imperium. Freiheit hieß für sie zunächst, dass ein Land in der Sprache seiner Bevölkerung innerhalb ihres Gebiets regiert wird. Dieses Ziel war schwer zu erreichen, aus mindestens zwei Gründen. Der eine lag darin, dass kaum eine Landschaft Osteuropas nur von einem einzigen Volk besiedelt wird. Der andere Grund bestand darin, dass die meisten dieser Völker recht klein, die Imperien, die sie umspannten, dagegen sehr ausgedehnt waren. In den meisten Fällen erforderten Unabhängigkeitsbestrebungen deshalb brudermörderische Kämpfe in einer kaum zu bewältigenden Gesamtsituation.
Die Osteuropäer hatten nur selten die volle Kontrolle über ihr Schicksal. Im Laufe der Jahrhunderte wurde ein Großteil ihrer Geschichte in den imperialen Hauptstädten Wien, Istanbul und St. Petersburg (und später in Berlin und Moskau) geschrieben. Aber das sind nicht die Orte, an denen diese Geschichte gelebt wurde. Für mich besteht die Geschichte Osteuropas aus all dem, was zwischen diesen Machtzentren geschah. Es ist keine Geschichte von Königen und Kaisern oder von Armeen der Achsenmächte und der Alliierten. Es ist vielmehr die Geschichte von Bauern, Dichtern und Provinzbeamten – von Menschen, die das Aufeinanderprallen von Imperien und Ideologien unmittelbar und am eigenen Leib erfahren haben.
Die Stürme des 20. Jahrhunderts zerstörten das uralte Gefüge des osteuropäischen Lebens. Von der mehrsprachigen und multikonfessionellen Welt, in der meine Großeltern lebten, sind heute nur noch Spuren übrig. Da ich mich als ein kleiner – sehr kleiner – Teil dessen fühle, was übrig geblieben ist, habe ich mich animiert gefühlt, diese verschwundene Vielfalt zu rekonstruieren, die im Zentrum dessen steht, was es bedeutet, Osteuropäer zu sein. Für mich ist das weniger eine bestimmte Identität als vielmehr eine Sammlung gemeinsamer Zugehörigkeiten, die sich um eine gemeinsame Erinnerung an das Zusammenleben ranken.
Inmitten all unserer Unterschiede gibt es jedoch ein weiteres gemeinsames Erbe der Osteuropäer, nämlich die Gabe, inmitten der Tragödie das Komische zu sehen. Die lange Bekanntschaft mit der Geschichte in ihrer extremsten Form hat den Menschen in Osteuropa eine außergewöhnliche Fähigkeit zum Absurden verliehen. Das zeigt sich in der Literatur der Region und noch mehr in den Geschichten, die die Menschen über ihr eigenes Leben erzählen.
Chassidische Juden pflegten zu sagen, dass man ihre wundertätigen Rabbiner am besten durch die Geschichten kennenlernt, die ihre Schüler über sie erzählen. So ist es auch mit der osteuropäischen Geschichte. Ein Leben in Osteuropa, insbesondere im 20. Jahrhundert, bedeutete, eine verwirrende Abfolge von Katastrophen und Umwälzungen zu erleben. Eine simple historische Aufzählung würde aus dieser schwindelerregenden Erfahrung kaum mehr machen als eine Auflistung von Herrschern und Ereignissen. Aber Erzählungen – Geschichten, Gerüchte, exemplarische Situationen und symbolische Gegenstände – führen uns zum Kern dessen, was diese Ereignisse bedeuteten. Nur sie können wirklich ergründen, was es hieß, die Schrecken der faschistischen Anti-Utopie, das kurze Hochgefühl und den langen Schrecken des Stalinismus, den Stillstand und den Mangel des Spätsozialismus und die plötzliche Verdampfung feststehender Werte zu erleben, die mit der Ankunft des Kapitalismus einherging.
Für mich sind diese tragikomischen Geschichten voller plötzlicher Katastrophen, unerwarteter Wendungen und wundersamer Fluchten die wahre lingua franca Osteuropas – die gemeinsame Sprache seiner ansonsten diffusen Identität. Ich sammle sie schon seit Jahren. Während meiner Jahre in Polen habe ich damit begonnen und das Ganze durch meine Recherchen in Bibliotheken und Archiven sowie auf meinen zahlreichen Reisen in die Region weitergeführt. Diese Geschichten sind, so glaube ich, die beste Erinnerung daran, dass Osteuropa nicht nur ein Ort des Leidens ist, sondern auch eine eigene Kultur, die unendlich viel Faszination und Staunen birgt.
Hier sind einige dieser Geschichten, wie ich sie in meinen Notizbüchern festgehalten habe:
Aus einem Ausstellungskatalog: der tschechische Künstler, der seinen Pelzmantel an deutsche Soldaten verschenkte, die nach Stalingrad aufbrachen. Diese dramatische, aber unüberlegte Geste kostet ihn später seine Karriere, seine Familie und fast sein Leben.
Aus einem Film:[2] die rumänischen Zeitungsredakteure, die eines Tages ein offizielles Foto von Nicolae Ceauşescu und Valéry Giscard d’Estaing betrachteten und entsetzt feststellten, dass der rumänische Diktator viel kleiner war als der französische Präsident und – noch schlimmer – nicht einmal einen Hut trug. Um diesen potenziell verhängnisvollen Fehler zu korrigieren, klebten die Redakteure Ceauşescu einen Hut auf den Kopf, bemerkten dann allerdings viel zu spät, dass er bereits einen Hut in der Hand hielt. Und so machte sich die Polizei auf, alle Ausgaben der Zeitung abzufangen und zu vernichten, die es bis in den Druck geschafft haben.
Aus einer literarischen Enzyklopädie: der gelehrte albanische Dichter, der nach der kommunistischen Machtübernahme zum Kulturminister seines Landes aufstieg, dann allerdings schnell mit dem furchterregenden Innenminister in Konflikt geriet. Der Dichter wurde zu jahrelanger Haft in einem berüchtigten Gefangenenlager verurteilt und kam frei, nachdem der Innenminister bei einer Säuberungsaktion zum Tode verurteilt wurde. Doch der Preis für die Freiheit des Dichters war seine Stimme. Er konnte nicht mehr veröffentlichen. Er durfte nicht einmal mehr sprechen. Die nächsten zwanzig Jahre arbeitete er als Lagerist in einer Provinzstadt, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Wenn jemand versuchte, etwas zu ihm zu sagen, kniff der Dichter die Lippen zusammen, um das Gegenüber an sein Schweigegelübde zu erinnern. Jeder in der Stadt kannte seine Gedichte, aber niemand wagte es, sie laut auszusprechen, und als der Dichter starb, traute sich niemand, an seiner Beerdigung teilzunehmen. So wurde er im Beisein seiner Schwester, eines Totengräbers und zweier Geheimpolizisten bestattet.[3]
Und schließlich eine Geschichte von Jadwiga, der Tante meiner Mutter, die sie mir an dem Tag erzählte, an dem ich mich verlobte: Tante Jadwiga und Onkel Turnowski haben dreimal versucht, zu heiraten. Das erste Mal war 1940 in Minsk. Nur mit Mühe bekamen sie das Geld für die Gebühr zusammen. Auf dem Weg zum Standesamt trafen sie einen Freund von ihnen, Icek, der ihnen keuchend hinterherlief. Er brauche sofort Geld, denn in den Geschäften seien soeben Teekessel aufgetaucht. Sie gaben ihm das Geld, das eigentlich als Gebühr für die Heiratsurkunde gedacht war. Das musste einfach sein. Eine Hochzeit ließ sich immer verschieben, aber man wusste nie, wann wieder ein Teekessel erhältlich war.
Das zweite Mal versuchten sie in Tadschikistan zu heiraten, zwei Jahre später. Diesmal hatten sie Geld, und sie lebten bereits zusammen in einer kleinen Stadt, in der jeder jeden kannte. Als sie zum Standesamt gingen, wunderte sich der zuständige sowjetische Beamte, dass sie noch nicht verheiratet waren, da sie bereits zusammenlebten. Er sagte, dass die Reihenfolge falsch sei – sie hätten erst heiraten und dann zusammenleben sollen –, und verweigerte ihnen deshalb die Heiratserlaubnis.
Das dritte Mal war in Warschau nach dem Krieg. Onkel Turnowski hatte seine beiden Trauzeugen (einer von ihnen war derselbe Icek, der so dringend den Teekessel hatte kaufen müssen), und sie kamen zur vereinbarten Zeit im Standesamt an. Nur Jadwiga fehlte. Der Verlag, in dem sie arbeitete, ließ sie den Tag nicht freinehmen. Aber dieses Mal – endlich, nach sechs Jahren – haben sie es dann doch geschafft. Der zuständige Beamte erklärte sich bereit, die Heiratsurkunde auch ohne Braut zu unterschreiben.
Diese letzte Geschichte fängt für mich meine Großtante Jadwiga und ihre ganze Generation ein. Sie wurden in die Verwerfungen und Verheißungen des Ersten Weltkriegs hineingeboren und überlebten die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs, ohne jemals die Zuversicht oder den Sinn für Humor zu verlieren. Sie maßen ihre Tage in Teekesseln und verpassten Terminen ebenso wie in Revolutionen, Invasionen und Kapitulationen. Das Folgende ist im Schatten dieser gigantischen Leben geschrieben.
Teil IGlauben
Kapitel 1Heiden und Christen
Ein großer Wald, voller lauernder Gefahren und gelegentlich schimmernder Schätze: So müssen die Gebiete Osteuropas den durchschnittlichen Römern zur Zeit von Kaiser Mark Aurel erschienen sein. Für sie waren die Länder nördlich der Reichsgrenzen weitgehend ein Mysterium. Mark Aurel selbst reiste 170 n. Chr. in die Region nördlich der Donau, um einen Krieg gegen eine Konföderation von Barbarenstämmen zu führen. Dort begann er mit seinen Selbstbetrachtungen, als er mit seinen Soldaten am Ufer des Flusses Hron in der heutigen Slowakei kampierte. Dieses Werk, ein Klassiker der stoischen Philosophie, ist möglicherweise das erste Stück Literatur, das in Osteuropa geschrieben wurde. Allerdings erwähnt Mark Aurel seine Umgebung darin nicht ein einziges Mal. Das sollte uns freilich nicht allzu sehr überraschen. In den Gebieten nördlich des Imperium Romanum gab es keine Städte, keine Schrift, keine Tempel und keine anderen Hinweise, die jemandem, der von der Mittelmeerküste kam, das Vorhandensein von zivilisiertem Leben angezeigt hätten. Für die Römer kamen aus diesen kalten und furchteinflößenden Gegenden genau zwei Dinge: schier unerschöpfliche Horden von Feinden und ein leichter, kostbarer Stein namens electrum, der Bernstein.
Ich hatte einmal eine Zigarrenkiste, die meinem Großvater gehörte. Sie war voll mit den rauen orangefarbenen Kieseln aus rohem Bernstein, die er mit meinem Vater an polnischen Stränden gesammelt hatte. An den Küsten der südlichen Ostsee, von Dänemark bis Estland, ist Bernstein ganz leicht zu finden: Man muss nur nach einem Sturm an den Strand gehen oder wissen, wo man im Sand graben muss. Die Wege, die diesen auf geheimnisvolle Weise leuchtenden Edelstein an die Küsten des Mittelmeers brachten, waren schon alt, als Mark Aurel seine Kriege führte. Ein Jahrhundert zuvor, während der Herrschaft Kaiser Neros, war ein römischer Ritter von einem Grenzposten im heutigen Österreich nach Norden aufgebrochen. Er hatte den Auftrag, so viel Bernstein mitzubringen, wie er kaufen konnte, denn der Kaiser brauchte ihn zur Verzierung seines neuen Kolosseums. Der Ritter reiste Hunderte von Kilometern nach Norden, bis an die Ostseeküste. Zum Erstaunen aller kehrte er mit einer Wagenladung Bernstein zurück, mit kürbisgroßen Stücken, die ausreichten, um das gesamte Amphitheater zu schmücken, bis hin zu den Knöpfen der Netze, die die Zuschauer vor den wilden Tieren in der Arena schützten.[4]
Der Bernsteinhandel zwischen der Ostsee und dem Mittelmeerraum reicht mindestens bis in die Bronzezeit zurück. In diesem Fall freilich hat der Handel die Verbindung zwischen den beiden Gebieten nicht gefördert. Im östlichen Europa selbst haben diese Reisen nur schwache Spuren hinterlassen, allenfalls ein paar zerbrechliche Relikte: Knöpfe einer Reitertracht, die an einem polnischen See gefunden wurden, ein Kavalleriehelm in einem litauischen Grab. Und Münzen – eine Unmenge an Münzen. Diese wurden in den Ländern, in die sie gelangten, nicht als Geld verwendet, sondern waren im wahrsten Sinne des Wortes Schätze – Zeichen aus einer anderen Welt. Es gibt in der russischen Enklave zwischen Polen und Litauen (eine Gegend, die besonders reich an Bernstein ist) alte Friedhöfe, auf denen jedes Grab mindestens einen glänzenden Messing-Sesterz enthält. Diese Münzen wurden neben den Kopf des Verstorbenen gelegt, in Gefäße aus der Rinde der heiligen Birke, als Bezahlung für einen mythischen baltischen Fährmann, dessen Name sich im Fluss der Zeit verloren hat.[5]
Aufblitzendes Silber, ausgegraben von einem Pflug: So sieht die antike Welt in den meisten osteuropäischen Ländern aus. Ansonsten: Schweigen. Die Geschichte beginnt hier erst mit dem Aufkommen des Christentums und damit des geschriebenen Wortes. Für die Zeit davor wissen wir kaum etwas mit Sicherheit. Das finstere Zeitalter ist hier wirklich finster: Nördlich der alten römischen Grenze ist es beinahe undurchdringlich. Aber auch südlich davon ist die Finsternis nur schwer zu durchbrechen. Als in den verzweifelten Jahrzehnten nach dem Untergang des Weströmischen Reiches im Jahr 476 n. Chr. die Slawen auftauchen, scheinen sie aus dem Nichts zu kommen und dann urplötzlich überall zu sein.
Heute werden die slawischen Sprachen in einem großen Teil Europas gesprochen, von Bulgarien und dem ehemaligen Jugoslawien im Süden bis Polen und ganz Russland im Norden. (Die wichtigsten Ausnahmen in diesem Block sind die Ungarn und die Rumänen, die eine finnougrische bzw. romanische Sprache sprechen, sowie die Balten – vor allem Litauer und Letten –, die einer eigenen Sprachfamilie angehören, die nur entfernt mit dem Slawischen verwandt ist. Am Rande der Region ist das Estnische eng mit dem Finnischen verwandt, während das Albanische zu einer eigenen Gruppe gehört.) Es handelt sich um ein riesiges Gebiet, von dem nur ein Teil schon früh von Slawen besiedelt gewesen zu sein scheint. Die ersten Erwähnungen der Slawen in antiken Quellen stammen jedenfalls vom Ende des 6. Jahrhunderts. Um das Jahr 1000 waren sie dann von Nordgriechenland bis an den Rand Finnlands überall zu finden.
Woher aber kamen die Slawen? Das ist für die Historiker eine verzwickte Frage, denn es gibt keine Lösung, dafür aber viele konkurrierende Thesen. Viele Jahrzehnte lang hing die Antwort auf diese Frage davon ab, wer man war. Die Russen behaupteten, die Slawen seien aus Russland gekommen, die Ukrainer sagten, sie seien aus der Ukraine gekommen, und die Polen sagten, sie seien aus Polen gekommen. Dann bildete sich eine Zeit lang ein lockerer Konsens heraus, der die slawische Urheimat in Polesien ansiedelte, einer Region mit endlosen Feuchtgebieten, die sich über die gesamte Länge der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus erstreckt. Man müsste es sich demnach so vorstellen, als ob die Slawen in großen ledernen Wathosen aus einem Sumpf auftauchten, das Wasser aus ihren Schnurrbärten tropfte und sie sich flugs bereit machten, Thessaloniki zu erobern, sobald sie sich nur abgetrocknet hatten.
Diese Ansicht wird inzwischen nicht mehr vertreten. Die modernste Theorie lautet, dass die Slawen aus dem heutigen Rumänien stammen (paradoxerweise gibt es dort heute keine Slawischsprecher mehr). Dieser Deutung zufolge taten sie sich zusammen, weil das Oströmische Reich dringend Arbeitskräfte brauchte, um die Festungen an der Donaugrenze zu besetzen. Vieles spricht für diese Ansicht, aber wir werden es nie mit Sicherheit wissen. Die frühen Slawen hatten nur wenige bemerkenswerte Anführer und keine bedeutenden Chronisten. Sie kamen nicht in einer Welle, sondern in einer Reihe von kleinen Strömen. Mit den Worten eines Historikers war es ein «undurchsichtiges Fortschreiten», das nur in sporadischen Momenten sichtbar war und von einer schwachen, flackernden Flamme erhellt wurde.[6]
Ähnliche Finsternis umgibt den Glauben der Slawen. Wir wissen nur sehr wenig über ihre Mythologie oder Rituale – nur, dass sie Heiden waren und eine Vielzahl an Göttern verehrten. Doch als die christlichen Priester kamen, um die alten Bräuche auszutreiben, hielt es niemand für sinnvoll, diese aufzuzeichnen. Eines der Paradoxa der Religionsgeschichte Osteuropas ist, dass das Heidentum dort so lange existierte und wir dennoch so wenig darüber wissen. Es gibt kein slawisches Äquivalent zu den großen Kompendien der nordischen Mythen, wie sie in der isländischen Edda erhalten sind, oder zu den keltischen Erzählungen, die im walisischen Mabinogion oder im irischen Táin gesammelt sind. Alles, was wir haben, sind Fragmente, aufgezeichnet von feindlichen Zeugen.
Eines der ersten derartigen Zeugnisse stammt (ausgerechnet!) aus Sizilien. Etwa um das Jahr 700 n. Chr. wurde eine Gruppe slawischer Krieger von der örtlichen Miliz gefangen genommen. Ein neugieriger Bischof fragte sie, woran sie denn glaubten. Mithilfe eines Übersetzers antworteten sie, sie würden «Feuer, Wasser und ihre eigenen Schwerter» verehren.[7] Siebenhundert Jahre später wurde das Großherzogtum Litauen immer noch von praktizierenden Heiden regiert, die etwas sehr Ähnliches glaubten. Litauen, ein riesiges Reich, das einen Großteil des heutigen Belarus und der Ukraine umfasste, war das letzte Land in Europa, das den alten Glauben aufgab. Als Großherzog Gediminas 1341 starb, bestattete man ihn mit der vollen, grausamen Pracht des heidnischen Ritus: Er wurde auf einem riesigen Scheiterhaufen zu Asche verbrannt, zusammen mit seinen Lieblingswaffen, Sklaven, Hunden und Pferden und als Dreingabe ein paar deutschen Kreuzrittern. Als das alles Feuer fing, heulten Gediminas’ heidnische Mitstreiter vor Kummer auf und bewarfen die Flammen mit den Krallen von Luchsen und Bären.
Zweihundert Jahre später war von diesem heidnischen Glauben kaum noch etwas übrig. Polnische und litauische Chronisten konnten sich allenfalls an ein paar heilige Namen erinnern. In der Renaissance begannen humanistische Gelehrte, sich einen Spaß daraus zu machen, immer ausgefeiltere Götterhimmel für ihre heidnischen Vorfahren zu erfinden. So fügten sie den alten Göttern des Donners, des Viehs und des Getreides Gottheiten hinzu, die für Schweine und Ehefrauen zuständig waren, einen Gott (und eine Göttin) der Bienenzucht sowie bescheidenere Geister, die über so ziemlich alles, von den Haselnüssen bis zur Hefe, wachten.
Keine dieser Gottheiten war real. So gut wie alles, was jemals über die alte Religion der Balten und Slawen geschrieben wurde, ist falsch. Das meiste davon beruht auf wenigen, späten Beobachtungen, verbunden mit den feindseligen Aussagen von Außenstehenden. Alles, was vorgibt, ein Mythos zu sein, ist reine Erfindung. Abgesehen von den Namen einiger Gottheiten und einigen wenigen, spärlichen archäologischen Funden ist nichts klar. Was können wir also mit Gewissheit über diese Götter sagen? Nur drei Dinge: dass sie in Bäumen lebten, dass sie durch Pferde zu den Menschen sprachen und dass sie den Geruch von frisch gebackenem Brot mochten.
Das Heidentum der Balten und Slawen war eine Freiluftreligion[8]. Ihr eigentlicher Tempel war der Wald. Bei den meisten Heiligtümern handelte es sich schlicht um Haine oder große Bäume, die an und für sich schon einen besonderen Ruf genossen. Auf einer Insel im Fluss Dnjepr stand einst eine riesige Eiche, die von den Vorbeikommenden mit Pfeil-, Fleisch- und Brotopfern verehrt wurde. Noch bis vor Kurzem opferten Frauen in Polesien in der heutigen Ukraine jedes Jahr zu Ostern der untergehenden Sonne speziell gebackenes Brot und beteten vor einem heiligen Baum für eine gute Ernte.[9] Darin klang ein jahrtausendealter Brauch nach, der sich bis 1986 hielt, als die Katastrophe von Tschernobyl das Land verwüstete und die Bewohner dazu zwang, anderswo Zuflucht zu suchen.
Die heidnischen Preußen – ein Baltenvolk – beteten in Hainen von heiligen Eichen. Jeder Hain hatte seine eigenen Priester und spezielle Opfergaben. Er war Versammlungsort, Heiligtum und Orakel. Solange der Götterkult noch lebendig war, stellten seine Anhänger den Bäumen und Seen, die sie verehrten, Fragen, meist über ihre Feinde. Die Götter sprachen durch die Landschaft, die sie bewohnten, doch der einfachste Weg, sie direkt zu befragen, war, ihren Geist rittlings auf ein Pferd zu setzen. Wenn die Slawen, die an der Odermündung lebten, in den Krieg ziehen wollten, befragten sie ein heiliges Pferd, indem sie es an einer Reihe in den Boden gesteckter Speere vorbeilaufen ließen. Wenn es die Speere nicht beachtete, machten sie sich auf in den Krieg.[10]
Als das Christentum immer näher rückte, ergaben sich für die Heiden des südlichen Baltikums zahlreiche Gelegenheiten, in den Krieg zu ziehen. Zwei Jahrhunderte lang, von etwa 1200 bis 1400 n. Chr., waren die südöstlichen Küsten der Ostsee Schauplatz eines blutrünstigen christlichen Kreuzzugs. Er wurde von den Deutschherren angeführt, einem Orden von (meist) deutschen Rittern, die gerade aus dem Heiligen Land zurückgekehrt waren und einen neuen Schauplatz für einen heiligen Krieg suchten. Von Nordpolen bis Estland predigten sie das Wort Gottes mit «eiserner Zunge» (um eine Formulierung Karls des Großen aufzugreifen). Überall waren die Kämpfe brutal. In Preußen kam es zu einem regelrechten Vernichtungskrieg, der mit dem Verschwinden der Preußen als Volk und dem Aussterben ihrer Sprache endete.
Hier lief die Christianisierung im Grunde auf eine Form der Kolonisierung hinaus. In einem Vorgeschmack auf das, was eines Tages in der Neuen Welt geschehen sollte, wurde das gesamte Gesellschaftssystem des mittelalterlichen Europas gewaltsam auf jungfräuliches Gebiet verpflanzt. Das osteuropäische Heidentum war eine Religionsform, die eng mit ihrem Ort verbunden war. Ihre Gesetze reichten nur so weit wie der Lauf eines einzelnen Flusses oder der Schatten eines bestimmten Baumes. Das Christentum hingegen war ein missionarischer Glaube. Es wollte die ganze Welt nach seinen Vorstellungen umgestalten. Es griff in Wellen an. Zuerst kamen die Missionare, um die heiligen Haine abzuholzen. Dann kamen die Kreuzritter, um die Macht der alten Stammesführer zu brechen und ihre Anhänger zu massakrieren. Nach getaner Schlächterarbeit kamen schließlich die christlichen Grundbesitzer, um die getauften Überlebenden zu Leibeigenen zu machen.
Die Chronik Heinrichs von Livland ist unsere beste Quelle dafür, wie sich dieser Krieg für die Beteiligten angefühlt haben muss. Heinrich von Livland war ein sächsischer Priester, der schon in jungen Jahren in Diensten von Bischof Albert von Buxhöveden stand, einem der Anführer bei der Eroberung des heutigen Lettlands. Im Jahr 1200 brach Albert von Hamburg aus mit einer Flotte von Schiffen und Soldaten auf und landete an der Stelle des heutigen Riga. Das sollte Alberts Bischofssitz werden, wenn er das Gebiet erobern und bekehren konnte.
Heinrichs Livländische Chronik ist die Geschichte dieser Eroberung. Sie wird in der ersten Person über zwei Jahrzehnte hinweg erzählt und ist in den Gebieten des heutigen Lettland und Estland angesiedelt. Es ist eine Geschichte, die inmitten unberührter Wälder, gefrorener Flüsse und tiefen Schnees spielt. Sie ist durchsetzt von schrecklicher Gewalt: Enthauptungen, Verstümmelungen, Ausweidungen. Männer werden bei lebendigem Leib verbrannt, und ihre Herzen werden gegessen, um an die Lebenskraft ihrer Besitzer zu kommen. Selbst unter den zum Christentum Bekehrten geht es drunter und drüber. Sobald die christliche Flotte, die sie bekehrt hat, wieder weg ist, stürzt sich eine Gruppe von Heiden in den nächsten Fluss, um sich die soeben empfangene Taufe wieder abzuwaschen. Dann hauen sie um, was ihnen als Götzen der Christen erscheint, und lassen all diese Dinge auf einem Floß zu Wasser, damit sie ihren abgereisten Herren hinterherfahren. Anderswo, in Estland, revoltieren die Heiden und entledigen sich der Herrschaft der Priester. Sofort danach stürmen sie auf die Kirchhöfe, um ihre Toten auszugraben und sie nach altem Brauch zu verbrennen.
Als besonders schwer auszurotten erwies sich der alte Kult der Bäume. Als Geistliche in Estland den schönen, dem Gott Tharapita geweihten Wald fällten, waren die Einheimischen erstaunt, dass die Bäume nicht wie Menschen bluteten. Als Missionare in Nordpolen das Gleiche versuchten, schlugen ihnen die Preußen die Köpfe ab. In Pommern, nahe der Grenze zwischen Polen und Deutschland, galten den dortigen Stämmen zwei Bäume als besonders heilig: ein prächtiger alter Nussbaum und eine riesige grüne Eiche mit einer Quelle darunter. Die Heiden konnten die Priester davon überzeugen, die beiden Bäume vor dem Abholzen zu verschonen, indem sie versprachen, zum Christentum zu konvertieren. Sie schworen feierlich, dass sie die Bäume von nun an nicht mehr verehren, sondern nur noch in ihrem Schatten ausruhen und ihre Schönheit genießen würden.[11]
Trotz der von den Kreuzrittern verübten Gewalt verschwanden die alten Bräuche nie ganz, sondern wurden ins Geheime gedrängt oder nahmen eine wie auch immer geartete christliche Tarnung an. Mancherorts schlossen die Heiden einfach einen Pakt mit ihren Eroberern, um ihre Traditionen beizubehalten. Im Westen Lettlands trafen die Deutschordensritter eine Vereinbarung mit einigen örtlichen Verbündeten, die als die «Kurischen Könige» bekannt wurden. Als Gegenleistung für die Unterstützung im Kampf gegen ihre heidnischen Brüder erhielten die Könige (eigentlich nur eine Gruppe freier Bauern) zwei Privilegien. Das erste bestand darin, dass sie ihre Toten weiterhin einäschern durften, eine Gewohnheit, die von den christlichen Ordensbrüdern schon seit Langem angeprangert wurde. Das zweite war, dass sie ihren heiligen Hain nicht abholzen mussten. Dieser Wald, von sieben Dörfern gemeinsam verehrt, war unantastbar. Dort durfte kein Reisig gesammelt werden, und die Jagd war nur einmal im Jahr, zur Wintersonnenwende, erlaubt. Alles erlegte Wild wurde bei einem großen Fest gemeinsam verspeist, bei dem viel Bier getrunken und die ganze Nacht durchgetanzt wurde. Das Ganze war eine wilde Jagd, deren Trophäen den Göttern gehörten.[12]
Spuren dieses Waldes, in dem die Kurischen Könige ihr Festmahl abhielten, haben sich bis heute erhalten. Ein Teilstück wird als Elka-Hain bezeichnet und befindet sich einige Kilometer südlich der Stadt Kuldīga in Lettland. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war es verboten, in dem Hain Feuer zu machen oder Äste abzubrechen. Jeder, der dieses Tabu brach, riskierte entweder einen Brand oder den Tod. Nach einer Beerdigung im Dorf wurde diese Regel jedoch aufgehoben. Alle gingen in den Hain, brachen einen Zweig ab und sangen: «Sterbt nicht, ihr Leute, auf dem Hügel [d.h. auf dem Friedhof] ist kein Platz mehr!»
Heute sind die sieben Dörfer der Kurischen Könige weitgehend entvölkert, Opfer der sowjetischen Bodenreformen und der massenhaften Auswanderung in den Westen. Ihr letzter heiliger Hain existiert jedoch noch. Es handelt sich um ein kleines Waldstück zu beiden Seiten der Landstraße zwischen Kuldīga und Aizpute. In der Hoffnung, eine materielle Spur des Glaubens zu finden, an dem die Menschen hier so viele Jahrhunderte lang so hartnäckig festgehalten hatten, begab ich mich an einem leicht nieseligen Juli-Tag auf die Suche danach. Eine Kombination aus Dauerregen und langen, nördlichen Tagen hatte die Landschaft in ein unheimliches, moosfarbenes Grün getaucht. Als die Sonne nach dem dritten Regenschauer in ebenso vielen Stunden herauskam, stieg Dampf von der Straße und den hohen Bäumen auf, die die nahen Hügel bekrönten. Ein Kranichpaar putzte sich am Rande eines Stoppelfeldes, während Störche geruhsam schreitend in den frisch gepflügten Furchen nach Nahrung suchten.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich in diesem Hain die Anwesenheit der alten Götter des Feldes, des Waldes, des Felsens und des Flusses gespürt habe, aber das wäre gelogen. Der Hain selbst ist sehr klein, nur ein paar Hektar groß. Seine Bäume, eine Mischung aus kräftigen Linden und dürren Birken, sehen aus wie ein Hinterhofdickicht. Die Aizpute-Autobahn verläuft wie eine Wunde mitten durch ihn hindurch. Aus der Ferne wirkt er dennoch ungeheuer mächtig. Der Wald von Elka steht auf einer Anhöhe, wodurch er ein klein wenig den Eindruck erweckt, als würde er über der umgebenden Landschaft schweben. Wenn man vom nächstgelegenen Dorf hinaufschaut, scheinen die Kronen der Bäume mit den Wolken zu verschmelzen. Wer kann schon mit Sicherheit sagen, welche Stimme spricht, wenn der Wind durch die Blätter rauscht?
Im heutigen Estland, Lettland, Nordpolen und dem ehemaligen Ostpreußen wurde das Christentum mit Gewalt durchgesetzt. Die einzige Ausnahme unter den baltischen Ländern bildete Litauen, wo es den litauischen Herzögen gelang, die Kreuzritter zu bekämpfen und aufzuhalten, wodurch sie bis zum Ende des 14. Jahrhunderts an ihrem heimischen Glauben festhalten konnten. 1387 konvertierten sie schließlich doch, als Großfürst Jogaila die polnische Königin Jadwiga heiratete und damit die Polnisch-Litauische Union einleitete; diese sollte bis 1795 Bestand haben, als beide Länder von ihren imperialen Nachbarn von der Landkarte gefegt wurden.
Für Jogaila war die Christianisierung der Preis für ein Bündnis. Das christliche Polen und das heidnische Litauen hatten mit dem Deutschen Orden einen gemeinsamen Feind. Der alte Kreuzritterorden hatte sich längst von seinen Ursprüngen entfernt und führte nur noch Eroberungskriege, ohne Rücksicht darauf, ob seine Feinde christlich oder heidnisch waren. Als König Władysław Jagiełło (sein neuer, christlicher Name) gelang es Jogaila, genügend Männer aufzubieten, um 1410 in der Schlacht von Grunwald die militärische Macht der Ritter zu brechen.
Die Konversion Litauens war eine politische Entscheidung. In früheren Jahrhunderten hätte man das Gleiche für die Polen, Tschechen (wenn auch getrennt, als Böhmen und Mährer), Ungarn, Bulgaren und Serben sagen können. Im Gegensatz zu den heidnischen Balten waren das starke Staaten, die zu mächtig und zu weit von ihren christlichen Nachbarn entfernt waren, um mit Gewalt bekehrt zu werden. Und doch nahmen sie alle zwischen 800 und 1000 n. Chr. das Christentum an. Mojmir von Mähren bekehrte sich im Jahr 831, Khan Boris von Bulgarien 864, Bořivoj von Böhmen 884 und Mieszko von Polen 966. Der heilige Stephan von Ungarn, der bereits Christ war, besiegte 997 einen heidnischen Verwandten, um das Christentum in seinem Reich durchzusetzen. Für all diese Herrscher war die Christianisierung eine Möglichkeit, Politik auf europäischer Ebene zu betreiben. Es war ein Signal an die rivalisierenden Reiche, sie auf dem Schachbrett der Heiratspakte und Militärbündnisse, die das große Spiel der europäischen Diplomatie bestimmten, als Gleichberechtigte zu behandeln. Doch woher bezogen diese frühen Könige und Herzöge überhaupt ihre Macht?
In den meisten osteuropäischen Ländern beginnt die Geschichtsschreibung erst mit der Konversion. Damit begannen aber auch die Lügen. Angeheuerte Chronisten – meist westliche Mönche – sponnen fromme Mythen darüber, woher ihre Herren ihre Krone hatten. Da gab es die weise Königin Libuše, die die Tschechen mittels Prophezeiungen regierte und den künftigen Glanz Prags voraussagte. Sie hörte sich Klagen an und sprach von ihrem prächtigen, komfortablen Bett aus Recht. Obwohl sie klug und gerecht war und in die Zukunft sehen konnte, waren die Männer aus der Sippschaft unzufrieden mit ihrer Herrschaft. Sie wollten einen Mann. Libuše verspottete die Tschechen wegen ihrer Engstirnigkeit, willigte aber schließlich ein. Sie würde einen großen König heiraten und sich seinem Urteil unterwerfen. Da sie eine Prophetin war, sagte sie den Herren auch gleich, wo sie diesen Gatten finden konnten.
Ihr zukünftiger Ehemann hieß Přemysl und pflügte gerade mit zwei Ochsen ein Feld mitten im Wald. Als die Boten Libušes ihn fanden, lud er sie in seine Hütte zu einer Mahlzeit aus schimmeligem Brot und altem Käse ein. Darauf wurde er an Libušes Bett gerufen, man vermählte die beiden, woraufhin sie sich betranken und Sex hatten. Die Dynastie, die sie so gründeten, währte vierhundert Jahre lang. Přemysl, der Pflüger, war nun Fürst, vergaß aber nie, woher er kam. Seine abgenutzten Bastschuhe bewahrte er immer ganz in seiner Nähe in der Schatzkammer in Vyšehrad auf.
Bevor die Polen ihre Gründungsdynastie bekamen, litten sie unter der Herrschaft von König Popiel, der so böse war, dass seine Untertanen ihn in einen Turm jagten, wo er von Mäusen aufgefressen wurde. Sein Nachfolger auf dem Thron war ein gastfreundlicher Stellmacher namens Piast. Berühmt wurde er dadurch, dass er einigen durstigen Reisenden Bier spendierte und sie zu einem Fest einlud. Seine Nachkommen regierten Polen ebenfalls für die nächsten vier Jahrhunderte.
Ein Krug Bier, ein Stück verschimmeltes Brot, eine Käserinde – das sind die mythischen Schwerter der Slawen. Diese Geschichten von bescheidenen Bauern und Handwerkern, die zu Königen aufsteigen, haben etwas sympathisch Demokratisches an sich. (Im Gegensatz dazu führte die türkische Dynastie, die über die Bulgaren herrschte, ihre Abstammung auf Attila den Hunnen zurück, während die ebenfalls nicht slawischen Árpáden von Ungarn behaupteten, von einem riesigen mythischen Vogel abzustammen.) Leider sind das alles Märchen. Die wahre Geschichte der Ursprünge der osteuropäischen Königreiche steht nicht in den Chroniken, sondern ist im Boden aufgezeichnet. Es ist eine Geschichte, die bis heute Stück für Stück ans Licht kommt.
2007 stießen Archäologen beim Ausbau der polnischen Autobahn A1, die nördlich von Warschau verläuft, auf einen Friedhof. Er stammte aus der Mitte des 10. bis Anfang des 11. Jahrhunderts, also aus der Zeit, als Polen christlich wurde und seine Herrscher erstmals die europäische Bühne betraten. Den Ausgräbern fielen schnell Merkwürdigkeiten der einzelnen Grabstätten auf. Die Leichen waren nicht eingeäschert, wie auf heidnischen Friedhöfen üblich, aber sie waren auch nicht nach Osten ausgerichtet, wie das auf christlichen Friedhöfen der Fall gewesen wäre. Stattdessen waren sie in Nord-Süd-Richtung zur letzten Ruhe gebettet, was sonst nur bei Wikingergräbern der Fall ist. Die Frauen wurden mit feinem Schmuck bestattet, mit Glasperlen, dazu Gold aus den königlichen Werkstätten von Bagdad und Byzanz. Die Männer waren mit prächtigen ausländischen Waffen versehen, beispielsweise fränkischen Breitschwertern oder chasarischen Beilen. Untersuchungen der Skelette bestätigten, dass die meisten Toten aus Skandinavien stammten, einige aber auch aus weiter entfernten Gebieten wie Zentralrussland im Osten und dem westlichen Norditalien.
Wer waren diese Menschen? Höchstwahrscheinlich handelt es sich um Mitglieder der polnischen königlichen Leibgarde, von der wir aus arabischen Quellen wissen, dass die ersten polnischen Könige sie mit Gunstbezeigungen überschütteten. Und das war auch gut so, denn sie bildeten die Stütze und das Fundament ihrer Herrschaft. Die Herzöge brauchten diese umherziehenden Experten in Sachen Gewalt, weil die eigentliche Quelle ihres Reichtums nicht aus der Besteuerung der Bauern stammte, sondern aus dem innerkontinentalen Sklavenhandel, der größten verfügbaren Ressource von Reichtum in der finsteren Zeit des 9. und 10. Jahrhunderts. Es ist kein Zufall, dass dieser Handel gerade da, als Böhmen, Mähren und Polen zu Staaten wurden, seinen Höhepunkt erreichte. Die Händler waren Christen, Juden und Muslime, die Gefangenen (meist) Heiden. Die Käufer kamen vor allem aus den silberreichen islamischen Kalifaten des Irak und Andalusiens. Dort waren Sklaven aus bestimmten Regionen sehr begehrt. Slawen wurden wegen ihrer Fähigkeiten als Haushaltssklaven besonders hoch geschätzt, Eunuchen galten als die besten. Einem zeitgenössischen Handbuch zufolge werde ein unkastrierter Sklave immer grob und einfältig bleiben, während ein kastrierter Sklave zu allen Raffinessen fähig sei.[13]
Die Geschichte des slawischen Sklavenhandels wurde größtenteils nicht in schriftlichen Quellen festgehalten; sie muss in der Erde gelesen werden. Horte arabischen Silbers, die überall von Schweden bis Böhmen vergraben sind, zeichnen die Schwankungen in den Fernhandelsnetzen nach, die Gefangene aus dem Norden nach Süden auf die Märkte von Bagdad und Córdoba brachten.
Zwei konkurrierende Handelsrouten, die beide menschliche Fracht lieferten, scheinen zur gleichen Zeit in Betrieb gewesen zu sein. Die eine führte von Nowgorod im Norden Russlands nach Süden zum Kaspischen und Schwarzen Meer; in Russland wurden die Sklaven auf Einbäume verladen und flussabwärts zur Krim und zu den südlichen Ausläufern der Wolga gepaddelt. Die andere führte auf dem Landweg von der Ostsee zum großen Sklavenmarkt von Prag: In Polen und Böhmen führten keine Flüsse durch die Karpaten, weshalb die Gefangenen marschieren mussten. Als die Archäologen diese spätere Route Richtung Süden verfolgten, erkannten sie etwas, das ihnen schon seit Jahrzehnten als Rätsel vor Augen stand: die Funktion der riesigen, scheinbar unbewohnten Festungsanlagen, die bisher unklar war. Es handelte sich um Lagerplätze, die errichtet wurden, um Sklaven in großer Zahl unterzubringen, ehe dann die Zeit kam, dass die Karawane gen Süden weiterziehen konnte.
Der hl. Adalbert befreit Christensklaven. Die seltene Darstellung des osteuropäischen Sklavenwesens findet sich an der Bronzetür des Doms zu Gnesen aus dem 12. Jahrhundert. Adalbert (pol. Wojciech, tsch. Vojtěch), Bischof von Prag, wurde 997 auf Missionsreise an der Ostsee erschlagen.
Polen und die tschechischen Reiche Böhmen und Mähren entstanden aus diesen Karawanenwegen. Ihre ersten Herrscher waren Gewaltunternehmer, die ihren Reichtum durch Raubzüge in den umliegenden Gemeinden erwarben und die dort lebenden Menschen – in Ketten – in die großen Imperien des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens exportierten. Kein Wunder, dass ihre Propagandisten Geschichten von ehrlichen Pflügern und bescheidenen Stellmachern erfanden, wo doch die wahre Grundlage ihrer Macht darin bestand, das eigene Volk zu versklaven und es auf den großen Märkten von Venedig und Córdoba zu verkaufen, so wie die ersten Fürsten der Rus ihr Vermögen machten, indem sie ebendiesen Handel nach Bagdad und Konstantinopel organisierten.
Russland, Polen sowie die tschechischen Gebiete Böhmen und Mähren wurden alle zu Staaten, indem sie Handel mit Waffengewalt verbanden. Im Gegensatz dazu betrieben die ersten Stammesfürsten Ungarns und Bulgariens offene Plünderei. Beide Völker waren ursprünglich Nomaden, die aus den Steppenregionen Südrusslands stammten. Als Verbände von Reiterkriegern kamen sie wie ein Blitz nach Europa. Ab dem 7. Jahrhundert drangen die Bulgaren tief in das Byzantinische Reich vor und gründeten schließlich südlich der Donau ihr eigenes Stammeskönigreich.
Die Ungarn (oder, auf Ungarisch, Magyaren) tauchten erst rund zweihundert Jahre später auf. Zunächst mit den Bulgaren verbündet, verließen sie schon bald den Balkan und unternahmen verheerende Raubzüge tief hinein nach Westeuropa. Sie waren ein furchterregender Haufen. Ein Chronist beschreibt, wie einer ihrer ersten Herzöge die Köpfe seiner Feinde zertrümmerte, als wären es «reife Kürbisse».[14] Selbst die Herrscherinnen der Magyaren waren wild: Von einer frühen Königin heißt es, sie sei eine «harte Trinkerin gewesen, die wie ein Ritter auf dem Pferd saß und einen Mann mit bloßen Händen tötete». Aber sogar diese hartgesottenen Krieger folgten schließlich ihren heidnischen Brüdern in den christlichen Schoß.
Für die verschiedenen bekehrten Stammesführer, die zu den ersten christlichen Königen Osteuropas wurden, war die Konversion eine pragmatische Entscheidung, die jedoch echte spirituelle Konsequenzen hatte. Wie kompliziert dieser Übergang sein konnte, geht aus einem Brief hervor, den der Bulgaren-Khan Boris im Jahr 866 an Papst Nikolaus schickte. Zu diesem Zeitpunkt lebten die Bulgaren bereits seit über zweihundert Jahren in Europa. Sie waren allmählich mit ihren slawischen, agrarisch geprägten Nachbarn verschmolzen, hielten aber immer noch vehement an den alten Steppenbräuchen fest – darunter auch am Heidentum. Als Khan Boris darüber nachdachte, welcher Kirche er sich anschließen sollte, der östlichen Orthodoxie oder dem römischen Katholizismus, wollte er zunächst die Einzelheiten des neuen Glaubens verstehen. Also erstellte er eine Liste mit Fragen an den Papst. Durften Männer als Christen noch Hosen tragen? Und war das Frauen gestattet? Wie viele Ehefrauen durfte ein Mann haben? War Sex nach einer Schwangerschaft oder während der Fastenzeit erlaubt? Waren Eide, die auf Schwerter geleistet wurden, noch bindend? Durften Männer freitags baden? Durften in der Kirche Turbane getragen werden? War es noch erlaubt, seine Wunden mit einem Zauberstein zu heilen?[15]
Der Papst beantwortete Punkt für Punkt jede der Fragen von Khan Boris: Hosen, Bäder und Turbane waren in Ordnung, Zaubersteine und Polygamie weniger. Diese Antworten gefielen dem Khan offenbar besser als die Antworten aus Konstantinopel. Nichtsdestotrotz entschied er sich schließlich für die Seite der Griechen. Der ausschlaggebende Faktor war ein politischer. Die byzantinischen Kaiser waren viel näher und besser bewaffnet als die weit entfernten Römer. Ähnliche Überlegungen bestimmten die Christianisierung der gesamten Region. Im 9. Jahrhundert folgte Serbien den Bulgaren in den byzantinischen Orbit.
Im Jahr 987 n. Chr. schlossen sich ihnen die Fürsten von Kiew an. Für diese halb wikinger- und halb slawenstämmigen Kriegsherren war die Anziehungskraft des byzantinischen Christentums gleichermaßen ästhetischer wie politischer Natur. Als man ihnen den Zutritt zu den Kirchen von Konstantinopel gestattete, waren die Rus-Fürsten sprachlos vor Staunen. Ein späterer Chronist berichtete, sie hätten beim Betreten der Hagia Sophia nicht gewusst, «ob wir auf Erden oder im Himmel wären», und sofort erkannt, dass «dort Gott unter den Menschen wohnt».[16]
Die Fürsten der Kiewer Rus schlugen sich also auf die Seite der Schönheit (wobei durchaus hilfreich war, dass Konstantinopel auch ihr wichtigster Handelspartner war). Anderswo bestimmten eher weltliche Überlegungen das Geschehen. Für die Tschechen, Kroaten und Polen kam die große Bedrohung ihrer Unabhängigkeit aus dem Westen, in Form des Frankenreiches und seines Nachfolgers, des deutsch dominierten Heiligen Römischen Reiches. Beide Gebilde folgten dem katholischen Glauben. Für die slawischen Königreiche war die direkte Hinwendung nach Rom deshalb eine Verteidigungsmaßnahme. Sie gab ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen christlichen Institutionen zu entwickeln, anstatt sie von einem deutschen Kaiser aufgezwungen zu bekommen.
Diese Entscheidungen, die von den besonderen politischen Umständen des 9. und 10. Jahrhunderts geprägt waren, hatten weitreichende Folgen. Sie führten dazu, dass Osteuropa zu einem Grenzgebiet zwischen den rivalisierenden Christenreichen Rom und Byzanz wurde. Die Trennlinie zwischen Orthodoxen und Katholiken verlief mitten durch viele Staaten und bot jahrhundertelang Anlass zu Unruhen. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein führten die durch dieses Schisma hervorgerufenen Spannungen dazu, dass Nationen zerfielen und in Flammen aufgingen. Doch für die ersten christlichen Herrscher Osteuropas lag dies alles noch in unvorstellbarer Zukunft. Ihre unmittelbare Sorge galt der Frage, wie sie das Christsein in den Alltag ihrer Untertanen einbinden konnten.
Denn damit das Christentum von Dauer sein konnte, musste es zunächst vor Ort verankert werden. Die einfachste Möglichkeit dazu bestand darin, ein paar einheimische Heilige ausfindig zu machen und um sie herum einen Kult aufzubauen. Gut war es, wenn diese Heiligen einige Reliquien hinterlassen hatten, die in königliche Hände übergehen konnten, und noch besser, wenn sie selbst der königlichen Familie angehörten. Das hatte den doppelten Vorteil, dass es der Dynastie intern Legitimität verschaffte und gleichzeitig der christlichen Welt gegenüber ein schönes Zeichen des Glaubens setzte.
In Ungarn war der Gründungsheilige der erste christliche König, der heilige Stephan, der sich seine Heiligkeit durch die Ermordung seines heidnischen Onkels verdiente. Auch in Serbien war der große heilige Sava ein Königssohn, der vor seinen Pflichten als Provinzgouverneur floh, um Mönch auf dem Berg Athos zu werden, und sich im Laufe der Zeit zu einem polyglotten Gelehrten und genialischen Verkünder des heiligen Wortes entwickelte. In Böhmen wurde ebenfalls ein königlicher Jüngling, ein Mitglied des Herrscherhauses namens Wenzeslaus, verehrt.
Von seinen Hagiografen wurde Wenzel als ein außergewöhnlich frommes Kind beschrieben. In den Nächten verließ er oftmals seine Gemächer in der königlichen Burg, um heimlich auf die nahe gelegenen Felder zu gehen. Dort erntete er im Mondschein Getreide, das er mahlte und zu Mehl sieben ließ, aus dem er dann Oblaten für die heilige Messe buk. In anderen Nächten unternahm Wenzel Spaziergänge im Weinberg des Schlosses, um Trauben zu sammeln, die er dann ebenfalls zu Messwein verarbeitete.[17] Diese nächtlichen Streifzüge dauerten an, bis Wenzel mit gerade einmal achtundzwanzig Jahren von seinem Bruder Boleslav dem Grausamen ermordet wurde.
Der heilige Adalbert (Wojciech auf Polnisch, Vojtěch auf Tschechisch), der erste Schutzpatron Polens, war ebenfalls ein hochgeborener Tscheche. Vojtěch wurde schon in jungen Jahren für das Priesteramt ausgebildet und bewegte sich bald in den höchsten Kreisen des Klerus. Noch in seinen Dreißigern wurde er Bischof von Prag und machte sich bald darauf unbeliebt, weil er in seinen Predigten gegen die Polygamie und die tschechische Gewohnheit, Christen zu versklaven, wetterte. Bald musste Adalbert zurück an den deutschen Kaiserhof fliehen, von dem er gerade gekommen war. Dort wusste niemand so richtig, was man mit ihm anstellen sollte. Adalbert verbrachte seine Tage mit Gebet und Studium. Nachts stand er auf, wenn alle noch schliefen, und putzte dem gesamten kaiserlichen Hof die Schuhe – ein Akt, der in seiner Bescheidenheit durchaus liebenswert, aber nicht gerade dazu angetan war, sein Ansehen zu steigern.[18] Schließlich wurde beschlossen, dass Adalbert Missionar werden sollte. Im Jahr 997 reiste er nach Norden an die Ostsee, um sich dort um die heidnischen Preußen zu kümmern. Diese fanden ihn anmaßend und schwer zu verstehen und schlugen ihm den Kopf ab. Der König von Polen löste seinen Körper gegen sein Gewicht in Gold aus, woraufhin sein Geist nützliche Wunder zu vollbringen begann.[19]
Fromme Schlaflose, grausam ermordet: Das waren die Heiligen der frühen katholischen Herrschaft, die wegen ihrer Nähe zur Macht und wegen der numinosen Kraft, die ihre Reliquien einer ansonsten heidnischen Landschaft verleihen konnten, ausgewählt wurden. Um der Politik willen heiliggesprochen, haben sie immer nur laue Verehrung erfahren. Weiter südlich, in der orthodox-christlichen Welt des Balkans, war der Heiligenkult deutlich ausgeprägter, vor allem weil er eine tiefere Verbindung zur heidnischen Vergangenheit bewahrte. Hier übernahmen die Heiligen zahlreiche Funktionen ebender Götter, die sie ersetzt hatten.
Der heilige Elias, der als Donnerer bekannt ist, brachte Blitze und Stürme, ähnlich wie Zeus oder der slawische Perun in vergangenen Zeiten.[20] Der heilige Theodor half jedes Jahr, den Sommer herbeizubringen, indem er mit seinen zwölf Reitern den Sonnenwagen lenkte.[21] Gleiches tat der heilige Bartholomäus, wenn der Herbst in den Winter überging. Auf diese Weise spielten die Heiligen eine wichtige Rolle als Vermittler im Gang der Jahreszeiten, dem großen Drama, das das Leben aller Agrargesellschaften strukturierte.
Jedes Jahr wurde die Sonne am Himmel groß und heiß und ließ die Ernte reifen, und jedes Jahr wurde sie in der Mitte des Winters so klein und kalt, dass es den Anschein hatte, als würde das Leben nie wieder auf die gefrorenen Felder zurückkehren. Und doch hing alles von ihrer Rückkehr ab. Das war alles andere als selbstverständlich. Denn die Sonne und der Frühling hatten ihre Feinde, gegen die Helden nottaten. Jedes Jahr im Winter versuchte ein Drache, die Sonne zu verschlingen, und so mussten der heilige Elias und der heilige Georg jedes Jahr in die Unterwelt reisen, um sie wieder zu befreien.
Im Sommer verbündeten sich verschiedene übernatürliche Kräfte und versuchten, die Pflanzen ihrer Fruchtbarkeit zu berauben, Getreide zu stehlen oder es durch Hagel zu verderben. Diese höllischen Gegner konnten die Gestalt von Schlangen, Drachen, Werwölfen oder Hexen annehmen. Manchmal kämpften Heilige gegen sie, doch meistens hielt man es für das Beste, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.
Hinter der Sonne und unter der Erde kämpften Ungeheuer gegen Ungeheuer um die Herrschaft über die Erde und den Himmel. In ganz Osteuropa gab es «gute Werwölfe» und «gute Drachen» (meist in Menschengestalt), die über ihre Gemeinschaften wachten und vor den Mächten des Bösen schützten, welche sie von außen bedrohten. Aus der Sicht des traditionellen Glaubens machte das Sinn; Angehörigen der christlichen Elite war es schwerer zu erklären.
Im Jahr 1692 wurde ein Mann namens Thiess in der lettischen Stadt Jaunpils (das damals Jürgensburg hieß) wegen Ketzerei vor Gericht gestellt. Thiess war über achtzig Jahre alt und in seinem Dorf hoch geachtet. Außerdem war er ein Werwolf. Dass er das freimütig zugab, schockierte seine Richter. Thiess erklärte jedoch, er sei kein böser Werwolf, der den Leuten die Ernte stehle, sondern ein guter Werwolf – einer der «Hunde Gottes», die gegen Hexer aus den Nachbarländern (Russland, Estland) kämpften, um die Feldfrüchte des Dorfes zu schützen. Diese Kämpfe fanden in der Hölle statt (der Eingang befand sich in einem nahe gelegenen Sumpf), und zwar jedes Jahr um Weihnachten herum. Die Werwölfe gewannen nicht immer, aber dieses Jahr, so Thiess, hätten sie gewonnen. Sie brachten reichlich Gerste und Roggen aus der Hölle mit und warfen das Getreide hoch in die Luft, damit es auf die Felder der Reichen und Armen gleichermaßen fiel.[22]
Die Richter akzeptierten Thiess’ Erklärungen nicht und verurteilten ihn zu Auspeitschung und Verbannung. Ihnen erschien es unmöglich, dass ein Mensch ein Werwolf und ein guter Christ sein konnte. Vielleicht hätten sie ihre Meinung geändert, wenn sie ein besseres Verständnis der Historie gehabt hätten; Livland war schon lange für seine Werwölfe berühmt. Noch im 16. Jahrhundert war bekannt, dass sie in den zwölf Tagen nach Weihnachten die meiste Arbeit verrichteten (anderswo in Osteuropa nannte man diese Tage die «Hundstage» oder «Heidentage»). In der landwirtschaftlich geprägten Vorstellung des alten Europa war das die gefährlichste Zeit des Jahres, in der die Welt den Atem anhielt in der Spannung, ob die Sonne wieder aus ihrem Gefängnis auftauchen würde – der Moment, in dem die Membran zwischen dieser Welt und der anderen am dünnsten war.
Das alles wussten die Lutheraner in den Städten, die Thiess zuhörten, nicht mehr. Aus diesem Grund ist das Protokoll der Gerichtsverhandlung eine faszinierende Lektüre. An einer Stelle sagt Thiess, dass er und seine Werwolfgefährten ein Schweinebratenmahl veranstalteten. Die Richter wollten sofort wissen, wie sie das hätten tun können, wenn sie doch «Wolfsköpfe und Wolfspfoten» hatten.[23](Die Antwort war, dass die Wölfe das Fleisch zerrissen und als Wölfe auf einen Spieß steckten, es aber als Menschen aßen.)
Historiker gehen heute davon aus, dass es sich bei dem, was Thiess zu beschreiben versuchte, um eine Form von Schamanismus handelte. Der Kampf, von dem er sprach, fand in Trance oder im Traum statt. Wir wissen von einem ganz ähnlichen Brauch, der etwa zur gleichen Zeit in Ungarn gepflegt wurde. Allerdings ging es dort um Drachen statt um Werwölfe, und einige der mächtigsten Schamanen waren Frauen.
Ein frühes Zeugnis des Exports osteuropäischer Schauergeschichten in den Westen: Lucas Cranachs des Älteren überzeugend gräuliche Darstellung eines Werwolfs und seiner Untaten, um 1512.
In der osteuropäischen Mythologie nahmen Drachen zahlreiche Formen an: Es gab Drachen, die Feldfrüchte stahlen, und es gab Drachen, die sie beschützten. Die ungarischen Drachenmagier, die sogenannten táltos, machten sich die Macht der guten Drachen zum Wohle ihrer Gemeinschaften zunutze. Sie besaßen die Macht des zweiten Gesichts: Sie konnten Kranke heilen, die Zukunft voraussagen oder verborgene Schätze finden. Vor allem aber waren die táltos Beschützer, die ihr Dorf oder ihre Region gegen übernatürliche Angriffe verteidigen mussten.
Wie die livländischen Werwölfe gerieten auch die táltos oft in Konflikt mit religiösen Autoritäten. Wenn dies geschah, wurden sie oft für Hexen gehalten. Wie die táltos sich selbst betrachteten und wie sie von ihren Nachbarn angesehen wurden, lässt sich aus den Aufzeichnungen über ihre Prozesse ablesen. In der Regel war das Verhältnis von Ehrfurcht geprägt. Als die táltos Erszébet Ormos 1626 vor einem ungarischen Gericht erschien, sagte einer der anderen Zeugen in der Verhandlung über sie: «Die Drachen sind ihre Gesellschaft.» Das bedeutete enorme Macht, und selbst die bescheidenste táltos wusste um sie. Erszébet Tóth, die 1728 vor Gericht stand und aus einer Kleinstadt östlich von Budapest stammte, hatte das Gefühl, über gewaltige Kräfte zu verfügen. Sie vermochte durch einen Doppelgänger mit der anderen Welt zu sprechen. Dieser Doppelgänger konnte bis in die Türkei reisen, und doch glaubte ihr Mann, dass sie direkt neben ihm war.
Erszébet konnte Schätze aufspüren und Diebe identifizieren. Jeden Mittwoch kam die Muttergottes zu ihr nach Hause, um mit ihr zu sprechen. Nachts streifte sie durch die Stadt und wusste, was hinter jeder Tür vor sich ging. Sie verteidigte ihre Heimatstadt gegen Erdbeben, doch ihre Verantwortung ging noch weit darüber hinaus. Ihr zufolge «wäre ein Drittel Ungarns verloren gegangen», wenn sie nicht eingegriffen hätte. Sie war eine Beschützerin, aber sie konnte sich auch erbittert selbst verteidigen: «Ich bin die Tochter Gottes. Wenn mich jemand bedroht, schaue ich demjenigen in die Augen, und er muss sterben.»[24]
Im traditionellen Glauben waren die Toten allgegenwärtig, verborgen unter Türschwellen, versteckt in Wasserstrudeln und an Wegkreuzungen. Ihr Segen garantierte gesunde Feldfrüchte. Ihre Unzufriedenheit hatte die Kraft eines Fluches. Zu bestimmten Zeiten waren sie präsenter als zu anderen. Allerheiligen, der 1. November, ist nach wie vor das große katholische Fest der Toten. Aber es gibt noch andere. Der Heilige Abend war eine Nacht, in der die verstorbenen Familienmitglieder ins Haus zurückkehrten; wie auch, manchmal, in den Tagen vor Ostern.[25] Am Karmittwoch wurden Lagerfeuer entzündet, um die Seelen der Verstorbenen zu wärmen.[26] Oft kamen die Toten unaufgefordert und aus eigenem Antrieb zurück. Ein Name für diese wiederkehrenden Toten ist upiór, Vampir. Das Wort upiór





























