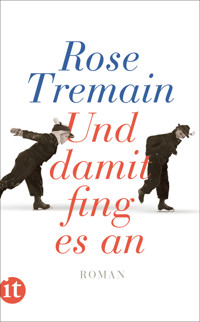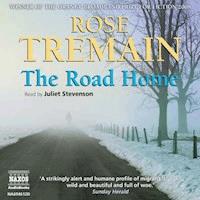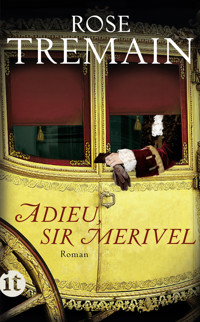
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Aussichten sind nicht rosig: Sir Robert Merivel, Medicus, Lebemann und Vertrauter Charles’ II., hat bessere Zeiten gesehen. War er nicht der Mann, der den König von England zum Lachen brachte? Soll er sich jetzt mit nur 57 Jahren bereits zurückziehen und auf seinem Landgut Trübsal blasen? Merivel denkt nicht daran und begibt sich nach Frankreich, zum Sonnenkönig in dessen soeben erbautes Wunderwerk Versailles. Statt mit Pomp und Zeremoniell empfangen zu werden und gar zum Leibarzt Ludwigs XIV. aufzusteigen, muss er sich jedoch im Gesindehaus den Nachttopf mit einem holländischen Uhrmacher teilen! Als er der charmanten Louise de Flamanville begegnet, glaubt er an einen zweiten Frühling – der jäh zu enden droht, als ihn ein Ruf des englischen Hofes erreicht: Sir Merivel soll umgehend ans Krankenbett Charles’ II. eilen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Traurig, rauschhaft, fröhlich, opulent – eine Verführung!
Die Aussichten sind nicht rosig: Sir Robert Merivel, Medicus, Lebemann und Vertrauter Charles’ II., hat bessere Zeiten gesehen. War er nicht der Mann, der den König von England zum Lachen brachte? Soll er sich jetzt mit nur 57 Jahren bereits zurückziehen und auf seinem Landgut Trübsal blasen?
Merivel denkt nicht daran und begibt sich nach Frankreich, zum Sonnenkönig in dessen soeben erbautes Wunderwerk Versailles. Statt mit Pomp und Zeremoniell empfangen zu werden und gar zum Leibarzt Ludwigs XIV. aufzusteigen, muss er sich jedoch im Gesindehaus den Nachttopf mit einem holländischen Uhrmacher teilen! Als er der charmanten Louise de Flamanville begegnet, glaubt er an einen zweiten Frühling – der jäh zu enden droht, als ihn ein Ruf des englischen Hofes erreicht: Sir Merivel soll umgehend ans Krankenbett Charles’ II. eilen …
Rose Tremain ist eine erfolgreiche und vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Sie lebt in London und Norwich. Für ihren Erfolgsroman Der weite Weg nach Hause (it 4037) wurde sie 2008 mit dem Orange Prize for Fiction ausgezeichnet. Zuletzt sind im insel taschenbuch erschienen: Zeit der Sinnlichkeit (it 4200) und Melodie der Stille (it 4242).
Rose Tremain
ADIEU, SIR MERIVEL
Roman
Aus dem Englischen vonChristel Dormagen
Insel Verlag
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel
Merivel: A Man of his Time
bei Chatto & Windus, London 2012
Copyright © 2012 Rose Tremain
Umschlagabbildung: Marcus Lyon/The Glassworks;
The Art Archive, London
eBook Insel Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 4314.
© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
eISBN 978-3-458-73177-1
www.insel-verlag.de
Für Penny natürlich
In Liebe
Inhalt
ERSTER TEILDie große Ungeheuerlichkeit
ZWEITER TEILDie große Gefangenschaft
DRITTER TEILDer große Trost
VIERTER TEILDer große Übergang
EPILOG
ERSTER TEILDie große Ungeheuerlichkeit
1
An diesem Tag, welcher der neunte Tag im November des Jahres 1683 ist, hat sich etwas äußerst Bemerkenswertes ereignet.
Ich verzehrte gerade, wie gewohnt, mein Mittagsmahl (gekochtes Hühnchen mit Karotten und ein kleines Bier), als mein betagter Diener Will das Speisezimmer auf Bidnold Manor betrat. In seinen knotigen alten Händen hielt er ein in brüchiges Papier eingeschlagenes und mit einem verblichenen Bändchen verschnürtes Paket. Er legte diesen Gegenstand zu meiner Rechten nieder, wodurch eine Staubwolke aufwirbelte und auf meinen Teller sank.
»Gib acht, Will«, sagte ich und merkte, wie ich die Luft anhielt und sie dann in einem derart gewaltigen Nieser wieder ausstieß, dass die Tischdecke mit winzigen Karottenstückchen verziert wurde. »Was ist das für ein Plunder?«
»Ich weiß es nicht, Sir Robert«, sagte Will und versuchte den Staub zu verteilen, indem er mit seinen missgestalteten Fingern wedelte.
»Das weißt du nicht? Aber wie ist er ins Haus gelangt?«
»Kammerzofe, Sir.«
»Du hast ihn von einer der Mägde bekommen?«
»Unter eurer Matratze entdeckt.«
Ich wischte mir den Mund und schnäuzte mich (mit einer sehr fadenscheinigen gestreiften Serviette, die mir einst der König geschenkt hatte) und legte die Hände auf das Päckchen, das mir wahrhaftig wie etwas erschien, das aus einem Pharaonengrab, tief unten in der trockenen Erde, entwendet worden war. Ich hätte Will wohl auch genauer nach dessen merkwürdiger Herkunft gefragt und warum es ausgerechnet an diesem Tag so plötzlich entdeckt wurde, doch er hatte sich schon umgewandt und auf den langsamen, hinkenden Rückzug von der Tafel zur Tür begeben, und ihn zurückzurufen hätte durchaus zu einer physischen Katastrophe führen können, die zu riskieren ich nicht das Herz hatte.
Wieder allein, zog ich an dem Band und bemerkte darauf einige Flecken wie von Mäuse- oder Fliegenkot, und die Vorstellung, dass irgendeine Kreatur womöglich ihr gesamtes elendes Dasein unter meiner Matratze verbrachte, erheiterte mich für einen Moment.
Dann war das Päckchen geöffnet, und vor mir lag etwas, das ich so lange vergessen hatte, dass es mir von allein nie und nimmer wieder in den Sinn gekommen wäre.
Es war ein Buch. Vielmehr hatte es einst den unsterblichen Status eines Buchs angestrebt, diese Unsterblichkeit jedoch nie erlangt, es war stets nur eine Zusammenstellung von Seiten geblieben, beschrieben in meiner tintenfleckigen, geschwungenen Handschrift. Vor langer Zeit, im Jahre 1668, als ich endlich wieder nach Bidnold Manor zurückgekehrt war, hatte ich die Vernichtung des Buchs in Betracht gezogen, dann aber Will die Seiten gegeben – mit der Anweisung, sie einem Versteck seiner Wahl anzuvertrauen und dann möglichst zu vergessen, wo dieses Versteck sich befand.
Die Seiten enthielten die Geschichte meines einstigen Lebens. Ich hatte diese Geschichte in einer Zeit großer Verwirrung, in den letzten Jahren meines vierten Jahrzehnts, niedergeschrieben, als zum ersten Mal der Glanz König Charles’ II. auf meine unbedeutenden Schultern fiel.
Ich hatte gehofft, dass ich durch die Niederschrift besser verstehen würde, welche Rolle ich in meinem Beruf als Arzt in meinem Land und in der Welt spielen könnte. Doch obgleich ich damals glaubte, mich in all meinem fieberhaften Gekritzel einer Art Weisheit zu nähern, kann ich mich nicht erinnern, sie jemals erreicht zu haben. Ich wurde, wie ein hungriger Hund, von einem Ort zum nächsten getrieben. Es war eine Zeit voller Glanz und Gloria und eine Zeit großer Kümmernisse. Und meine eigenen Worte jetzt zu lesen und jenes Leben nun wieder vor mir ausgebreitet zu sehen, versetzte mein Herz in einen nahezu unerträglichen Überschwang der Gefühle.
Ich nehme das Buch und begebe mich in meine Bibliothek. Ich lege das Buch auf meinen Sekretär und widme mich dem kümmerlich brennenden Feuer, lege noch ein paar Holzscheite hinein und ermahne es, nicht zu vergessen, wozu es da ist – dazu nämlich, mich zu wärmen. Doch ich zittere immer noch. Ich überlege, ob ich erneut nach Will rufen soll, der in langer, ermüdender Übung das Talent erworben hat, Flammen zum Leben zu erwecken. Doch in diesen vorgerückten Zeiten der 1680er Jahre, nun, da ich mich meinem siebenundfünfzigsten Geburtstag nähere, widerstrebt es mir mehr und mehr, Will angesichts seines hohen Alters (von vierundsiebzig Jahren) und seiner vielen Gebrechen überhaupt noch mit irgendwelchen Aufgaben zu betrauen.
In der Tat ist die ganze Angelegenheit Will eine Frage, die mich außerordentlich quält, denn ich bin mir durchaus bewusst, dass ich, was meinen treuen Diener angeht, in einer sehr schmerzlichen Falle sitze.
Ich kenne William Gates (stets und ständig von mir nur »Will« genannt) seit dem Jahre 1664, als der König mir zusammen mit den Ländereien in Norfolk den Hosenbandorden verlieh. Diese Auszeichnungen erhielt ich für einen bedeutenden Dienst, den ich Seiner Majestät erwies und der mein Leben von Grund auf änderte.
In eben diesem Jahr kam Will, zusammen mit dem Koch Cattlebury, in meinen Haushalt und zeigte mir in all meinen Freuden und Leiden nichts als treue Ergebenheit und Achtung, und das auf die berührendste Weise.
Obgleich die Innenausstattung meines Hauses eine Zeitlang sehr überladen und vulgär war, gab Will vor, sie zu bewundern. Obgleich ich mich Celia, meinem jungen Weib, gegenüber in einer Weise verhielt, die sowohl sie wie die Welt nur verabscheuen konnten, bedachte Will mich nicht ein einziges Mal mit einem auch nur versteckt betrübten oder vorwurfsvollen Blick. Und als mein geliebtes Haus und ich aufgrund meiner zahllosen Torheiten für einige Jahre voneinander scheiden mussten, wurde Will zum Hüter des Hauses und versorgte mich getreulich mit Nachrichten über das Kommen und Gehen dort und die veränderten Farben des Parks im Wechsel der Jahreszeiten. Kurzum, niemand hätte beinahe zwanzig Jahre lang einen trefflicheren, treueren und tüchtigeren Diener an seiner Seite haben können.
Doch mittlerweile sind Wills Körper und Geist sehr hinfällig geworden. Obwohl ich ihn weiter mit einem hübschen Sümmchen entlohne, ist er nicht länger in der Lage, die Aufgaben, die das Haus und meine Person betreffen und für die ich ihn bezahle, in befriedigendem Maße zu erledigen. Laufen kann er nur, indem er die Knie nach außen dreht und das Rückgrat beugt, wie den Rücken einer kleinen Ratte, und Räume durchquert er langsam und unter größten Schmerzen. Was er in seinen Händen trägt, sei es eine Suppenterrine oder ein Bierkrug, droht zu fallen, zu zerspringen oder überzulaufen, denn seine Hände sind von einer Krankheit verkrümmt und können Dinge nicht mehr sicher und fest umschließen.
Andere Gebrechen haben sich dazugesellt, als da wären Vergesslichkeit, Sehschwäche und eine Taubheit, von der ich jedoch vermute, dass sie eher auf eine Grille als auf den tatsächlichen Verlust des Gehörs zurückzuführen ist. Denn wenn ich Will einen Auftrag gebe, der ihm nicht behagt, etwa mich auf einem meiner Patientenbesuche zu begleiten, gibt er vor, kein Wort von dem, was ich geäußert habe, zu verstehen, während er jedem Befehl, der ihm zusagt, fraglos und ohne zu zögern nachkommt.
Die Welt jenseits der Tore von Bidnold macht ihm jetzt Angst. Früher konnte er mich noch in einer schnellen Kutsche nach London begleiten und geduldig in den Gärten von Whitehall warten, während ich eine Audienz beim König durchzustehen hatte, die mir fast das Herz brach, und Will ebenfalls; heute dagegen hält er sich stets im Innern des Hauses auf und wird kaum bei einem Gang durch den Park anzutreffen sein – »damit ich nicht«, wie er mir eines Tages erklärt hat, »von einem Winterfieberfrost befallen werde, Sir Robert, oder auf einem Grasbüschel ausgleite und stürze und mir das Schienbein breche und nicht mehr in der Lage bin aufzustehen und unentdeckt liegenbleibe, bis die Nacht oder der Morgen kommt und Frost oder Schnee mich gänzlich erledigt hat.«
»Ach, ist es das, was du von mir denkst, Will«, sage ich daraufhin, »dass ich dich dort liegen lassen würde, allein und verletzt unter den Sternen oder im Schnee?«
»Nun ja, so ist es, Sir«, entgegnet er, »weil Ihr nämlich nichts von meinem Sturz wissen würdet, denn ich bin ein Diener, Sir Robert, und habe mich in den vergangenen zwanzig Jahren in der Kunst der Unsichtbarkeit geübt, damit mein Anblick, ob aufrecht oder liegend, Euch niemals beunruhigt.«
Ich hätte gern geäußert, dass Wills Anblick in den letzten Jahren bei mir nichts als Beunruhigung weckt, tat es jedoch nicht. Denn irgendetwas Verletzendes zu Will zu sagen, stand außerhalb meiner Macht. Und wenn ich an das denke, was ich billigerweise tun sollte, ihn nämlich aus meinen Diensten entlassen, dann fühle ich in meinem Herzen einen entsetzlichen Schmerz. Denn in Wahrheit ist es so, dass ich eine äußerst tiefe Zuneigung zu Will hege, fast so, als wäre er eine Art Vater für mich, ein Vater, der in seiner Güte beschlossen hat, über meine Unzulänglichkeiten hinwegzusehen und mich für einen ehrenwerten Mann zu halten.
Was also soll ich tun?
Wenn ich Will seine Vorrangstellung in der Hierarchie der Bediensteten von Bidnold Manor nehme und ihn mit leichteren Pflichten betraue, solchen, die ein einfacher Lakai gut erledigen kann, weiß ich, dass ihn der Schmerz der Degradierung ins innerste Herz treffen wird. Er wird daraus schließen, dass ich ihn nicht mehr schätze. Die Liebenswürdigkeit seiner Natur wird sich in Bitterkeit denen gegenüber verkehren, die ihm dann im Rang überlegen sind.
Wenn ich ihn zu mir rufe und ihm erkläre, dass ich wünsche, er möge es sich fortan bequem machen und keiner Arbeit mehr nachgehen, sondern hier in meinem Hause in ehrenvollem Ruhestand leben, alle pekuniären Bedürfnisse würde ich begleichen – wird er vielleicht vor mir auf die Knie fallen, mich segnen, Tränen der Dankbarkeit vergießen und mir erklären, es lebe und atme in dieser Welt kein freundlicheres Wesen als ich, Sir Robert Merivel.
Doch auch wenn ich gestehe, dass ich mir diese Szene gerne vorstelle – meinen armen alten Diener, der vor mir auf den Knien liegt, als wäre ich der König höchstselbst, mit all seiner unermesslichen Macht, so sehe ich doch leider auch großes Ungemach voraus, das aus einer anderen Quelle entspringen würde, namentlich dem Rest meines Haushalts, eingeschlossen Cattlebury, der Will in Alter und geistiger Verwirrtheit kaum nachsteht und mich in Schrecken versetzt mit seinen gelegentlichen sehr heftigen aufrührerischen Ausbrüchen, bei denen er sich in blasphemischen Reden gegen den Monarchen und die Stuartdynastie und all ihre Taten gefällt.
Tatsächlich befürchte ich, dass ich zur Zielscheibe einer eifersüchtigen Meuterei werden könnte, dass man mir meine Ungerechtigkeit vorwerfen würde und meine mangelnde Anerkennung für Cattlebury, aber auch für die Hausmädchen, Diener, Waschfrauen, Holzknechte, Stallburschen und Küchenmädchen et cetera, et cetera. Und dann sehe ich im Geiste eine furchtbare Phalanx all meiner Bediensteten (ohne die dieser Haushalt schon bald im Chaos versinken würde) den Weg zum Tor hinaus marschieren und verschwinden, während ich zurückbleibe, allein, bis auf Will, für den ich, binnen kurzem, zur Krankenschwester werden würde … und auf diese Weise eine weitere zwar anständige, aber verdrießliche Drehung auf dem Rad des Schicksals vollzogen hätte.
Besser, sage ich zu mir, verhärte ich mein Herz und lasse Will seinen einsamen Abgang machen, »Arbeitshaus« wird auf seinem Rücken geschrieben stehen. Doch auch bei dieser Vorstellung schnappt die Falle zu. Denn ich habe die Arbeitshäuser gesehen. Wahrlich, das habe ich. Es sind nicht nur kalte und ungastliche Orte, voller Ungeziefer und Lärm und Gestank, sie müssen auch, laut Gesetz, ihrem Namen gerecht werden und verlangen deshalb von ihren Bewohnern, dass sie arbeiten. So schließt sich denn der schreckliche Kreis, und wir landen wieder bei der einen Sache, die Will Gates kaum noch leisten kann: Arbeit.
Ich frage erneut: Was soll ich tun?
Ich kann Will nicht zum Betteln auf die Wege und Felder Norfolks schicken. Er hat keine Familie (und auch, so weit ich feststellen kann, nie gehabt), die ihn aufnehmen könnte. Und so beschließe ich, dass mir nur – wie bei so vielen verdrießlichen Dingen dieses Lebens – eines bleibt, nichts zu tun, in der vergeblichen Hoffnung, dass die Angelegenheit Will sich irgendwie auf natürlichem Wege löst.
Doch kaum kommt mir der Gedanke, dass Will vielleicht bald stirbt, schon ergreift mich ein Gefühl äußerster Panik, und ich verlange, dass Will sofort zu mir in die Bibliothek geschickt wird, damit ich mich vergewissern kann, dass er noch nicht tot ist.
Zwischen meinem Befehl und Wills Erscheinen an meiner Tür vergeht einige Zeit. Und während es dauert – aufgrund der Langsamkeit, mit der Will sich bewegt –, fällt mein Auge wieder auf das Buch, das auf meinem Sekretär liegt, und ich erinnere mich, dass seine Seiten zahlreiche Berichte von Wills Liebenswürdigkeiten enthalten, wie ich wegen einer Audienz beim König in aller Eile und ohne Nachtmahl nach London reiten musste, zum Beispiel, und wie Will zwei gebratene Wachteln in die Tasche meines Reitmantels steckte und eine Flasche Weißwein an den Sattel meiner Stute Danseuse band, ohne welche Mahlzeit ich womöglich in Ohnmacht gefallen wäre, als ich schließlich vor seine Hoheit treten musste.
Es scheint in der Tat so, als hätte Wills Verstand fast zwanzig Jahre lang über meinen gewacht, seine zahlreichen Lücken und Unzulänglichkeiten vorausgeahnt und versucht, Abhilfe zu schaffen, noch bevor ich mir ihrer überhaupt bewusst wurde. Und diese Erkenntnis rührt mich zu plötzlichen Tränen, weshalb Will mich, als er endlich die Bibliothek betritt, schluchzend am Kamin vorfindet. Obwohl er schlecht sehen kann, weiß er sofort, dass ich weine, und sagt: »Oh, nicht schon wieder, Sir Robert! Meiner Seel, ich glaube, noch bevor das Jahr zu Ende ist, werdet Ihr all Eure Taschentücher aufgebraucht haben.«
»Zum Glück«, sage ich, »haben wir November, Will. Weshalb es nicht mehr viel Gelegenheit gibt, sie aufzubrauchen.«
»Wie wahr, Sir«, sagt er, »aber ich weiß nicht, und keiner von uns hier auf Bidnold weiß, warum Ihr immer weinen müsst.«
»Nein«, sage ich und schnäuze mich in ein seidenes Tuch, das mir meine einstige Geliebte, Lady Bathurst, schenkte und das inzwischen bis zur Durchsichtigkeit verschlissen ist. »Ich weiß es ebenso wenig. Nun, Will, ich habe nach dir geschickt, um dich über dieses Buch zu befragen. Eben jenes von mir in den Jahren 1664 bis 1667 geschriebene Buch, das ich in deine Hände gab, als dieses Haus mir 1668 wieder übereignet wurde. Hast du es damals unter meine Matratze gelegt?«
Will lässt die Augen über den Boden vor seinen Füßen wandern, als wäre dort eine dunkle Höhle, in die niemals ein Lichtstrahl dringt. Endlich fällt sein Blick auf das Päckchen mit dem Buch.
»1668?«, sagt er. »Das ist lange her, Sir Robert.«
»Das weiß ich. Fünfzehn Jahre, um genau zu sein. Hast du also damals das Päckchen unter meine Matratze gelegt?«
»Muss wohl so gewesen sein, Sir.«
»Aber sicher bist du nicht?«
»Welcher Sache könnte ein Mann sich schon sicher sein, Sir Robert?«
»Nun, es gibt so etwas wie das Gedächtnis. Hast du irgendeine Erinnerung daran, dass du dieses Objekt in mein Bett gelegt hast?«
»Ja, Sir.«
»Ach?«
»Ja. Ich nahm es und legte es unter Eure Matratze, wo Ihr es nicht sehen würdet.«
Ich entferne mich vom Kamin, schreite im Zimmer auf und ab, stecke mein Seidentuch weg und versuche, meiner Person einen Anschein von Würde zu verleihen, so als verstünde ich die Situation zu meistern. Dann wende ich mich um und blicke Will vorwurfsvoll an. »Willst du also behaupten«, sage ich, »dass meine Matratze in sechzehn Jahren keinmal gewendet wurde?«
Will rührt sich nicht, er steht neben dem Sekretär und hält sich daran fest, als müsste er sonst fallen. Endlich sagt er: »Es ist nicht meine Aufgabe, Matratzen zu wenden, Sir Robert.«
»Ich weiß. Und dennoch, Will. Sechzehn Jahre! Bist du denn nicht der Ansicht, dass du als Haupt der Dienerschaft von Bidnold eine gewisse Verantwortung trägst? Hätten nicht Flöhe und Bettwanzen sich dort sammeln und mir Schaden zufügen können?«
»Euch Schaden zufügen?«
»Ja.«
»Ich würde Euch niemals Schaden zufügen, Sir Robert.«
»Ich weiß, Will. Alles, was ich wissen möchte –«
»Aber da ist noch etwas.«
»Ja?«
»Manchmal sieht man Dinge einfach nicht.«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine … dieses Buch von Euch, es ist so verblichen und verstaubt mit der Zeit, dass es – für das Kammermädchen – vielleicht wie ein Keil aussah, der die Ecken der Bettstatt zusammenhält.«
Ein Keil, der die Ecken der Bettstatt zusammenhält.
Ich gestehe freimütig, dass ich über diese letzte Äußerung von Will tatsächlich lächeln muss. Mein Lächeln wird rasch zu lautem Lachen, worauf Will ein überaus erleichtertes Gesicht macht. Vermutlich ist es nicht sehr angenehm, für einen Herrn zu arbeiten, der so häufig von Melancholie und kindischen Tränen überwältigt wird, und ich weiß, dass ich einen Weg finden muss, mein Dasein heiterer zu gestalten. Im Augenblick jedoch bin ich ratlos, wie ich diese Aufgabe angehen soll.
Ich schicke Will weg. Erneut öffne ich das Buch (das ich fortan als den Keil bezeichnen werde) und beginne zu lesen.
Ich lese, bis sich die Novemberdunkelheit herabzusenken beginnt. Kein Diener erscheint in der Bibliothek, um eine Lampe anzuzünden, weshalb der Raum sich mit sehr blauen Schatten füllt.
Und ein noch dunklerer Schatten kriecht aus der Geschichte hervor und scheint stumm neben mir im Raum zu stehen. Ich bilde mir ein, dass ich den muffigen Geruch seiner Kleidung riechen und seine weißen Hände sehen kann, die einen Gegenstand umschließen, es ist eine blauweiße Suppenkelle aus Porzellan. Sein Name ist John Pearce.
2
Ich kann an John Pearce nicht denken ohne das Gefühl, beinahe ersticken zu müssen. Aus diesem Grunde bemühe ich mich nach Kräften, überhaupt nicht an ihn zu denken. Doch dies gelingt mir nicht immer.
Einst war er mein Freund und Kommilitone an der Medizinischen Fakultät in Cambridge. Sein Leben lang war er der Religion der Quäker verbunden, weshalb ich ihn sehr häufig neckte, in der Hoffnung, ich könnte in die düstere Landschaft seiner Gesichtszüge ein kleines Lächeln gravieren oder vielleicht sogar sein Lachen vernehmen, ein bemerkenswert krächzendes Geräusch, fast wie das Knarzen eines Ochsenfrosches.
Obgleich Pearce mir viele Freundlichkeiten erwies, weiß ich heute, dass er mich mit all meinen unbeherrschbaren Begierden, meinem Spott über die Welt und meinen gescheiterten Versuchen, die beständige Melancholie zu besiegen, in Wahrheit nie von Herzen geliebt hat.
Als er mich hier auf Bidnold besuchte, blickte er sich um, betrachtete mein scharlachfarbenes und goldenes Mobiliar, meine vergoldeten Spiegel, meine Gobelins und Marmorstatuetten und meine Sammlung von Zinngeräten und erklärte mir, dieser Luxus werde meine »Lebensflamme auslöschen«. Und als ich gemeinsam mit Will siebenunddreißig Stunden an Pearce’ Bett wachte, nachdem ein Fieber ihn niedergestreckt hatte, empfing keiner von uns beiden auch nur irgendeinen Dank von ihm.
Dennoch war es Pearce, zu dem ich ging, als der König es für angeraten hielt, mich aus dem Paradies zu werfen, in welches er mich zuvor versetzt hatte.
Ich war bestrebt, mich in dem Irrenhaus der Quäker in Whittlesea nützlich zu machen, wo Pearce und seine Freunde einigen jener Menschen Hilfe gewährten, die unter der Last der Welt wahnsinnig geworden waren. Doch die Torheiten, die ich dort beging, waren sehr groß, und als bekümmere ihn all das, was ich mir an Ausschweifung und Dummheit leistete, brütete Pearce’ schwächlicher Körper eine sehr hitzige Schwindsucht aus, an der er schließlich starb.
Wir legten blühende Birnenzweige in seinen Sarg. In die Hände gab ich ihm die blauweiße Suppenkelle aus Porzellan, an der er leidenschaftlich hing, weil sie das einzige Erinnerungsstück war, das seine Mutter ihm hinterlassen hatte. Dunkle Moorerde wurde über ihm aufgehäuft.
Von Zeit zu Zeit besuche ich Pearce’ Grab. Als sie neun oder zehn Jahre alt war, nahm ich meine geliebte Tochter Margaret mit mir, um sie den Quäker-Freunden vorzustellen, die so liebenswürdig zu mir gewesen waren. (Margaret ist und war immer schon ein sehr schönes Kind, mit glatter, heller Haut, einer Überfülle feuriger Locken und einem Grübchenlächeln von großer Anmut.) Ich bin maßlos stolz auf sie.
Als wir zu dem Fahrdamm kamen, der als Earls Bride bekannt ist und zu dem Ort führt, wo einst das Irrenhaus-Spital stand, sah ich sofort, dass die Gebäude verlassen waren. Das umgebende Gelände war verwildert, und keine Menschenseele wohnte noch dort. Wir stiegen aus der Kutsche, und ein wütender eisiger Wind empfing uns. Ich nahm Margaret bei der Hand und führte sie in das erste der Gebäude, in dem noch einige Strohmatratzen lagen, und ich sah, wie sich ihre Augen in Staunen und Verwirrung weiteten, und sie sagte zu mir: »Papa, wo sind denn all die Menschen hin? Sind sie ertrunken?«
»Margaret«, sagte ich, »ich weiß es nicht. Aber mir scheint, sie sind fort.«
Und das brachte mich in Verlegenheit. Ich hatte geplant, Margaret in der Obhut der Quäker-Wärter zu lassen und mich für eine kurze Weile an Pearce’ Grab zu begeben. Ich wünschte nicht, dass sie seinen traurigen Erdhügel sah (denn noch hatte der Tod keinen Eingang in ihre unschuldige Seele gefunden), und doch widerstrebte es mir, nach dieser langen Reise wieder umzukehren, ohne einen Augenblick unter freiem Himmel im stillen Gespräch mit meinem toten Freund verbracht zu haben.
Ich stolperte mit Margaret über das Feld, wo das Unkraut wild und hoch wucherte, und zeigte ihr die knorrige Eiche im Hof, unter der ich einst auf meiner Oboe und mein junger Freund David auf seiner Fiedel spielte und wir allesamt – die Wärter und die Wahnsinnigen – eine Tarantella tanzten –, aber ich sagte ihr nicht, dass ihre Mutter eine der Wahnsinnigen gewesen war.
»Was ist eine Tarantella?«, fragte Margaret.
»Oh«, sagte ich, »das ist ein wild wirbelndes Gehopse, es geht so …« Und ich nahm ihre beiden Hände und begann mit ihr zu tanzen, und sie hüpfte und sprang voller Freude, und ihr Lachen war wie der Klang von Glocken, die unter dem weiten Himmelsgewölbe geläutet werden. Und dann hob ich sie hoch und trug sie zur Kutsche und sagte zu ihr: »Ruh dich hier kurz aus, während ich einen letzten Rundgang durch die Häuser mache, um mich zu vergewissern, dass niemand zurückgelassen wurde, ich werde im Nu wieder hier sein.«
Ich hatte eine Tüte Korinthen mitgenommen, und ich gab ihr eine Handvoll, und sie begann, sie gehorsam zu essen, während ich dem Kutscher sagte, er solle auf mich warten. Und dann machte ich mich auf den Weg zu dem Ort, wo Pearce liegt.
Das Grab, nur geschmückt mit einem schlichten Holzkreuz (denn bei den Quäkern hat alles schlicht zu sein), war ganz und gar mit Holunder und Dorngestrüpp überwuchert, und ich konnte nicht umhin, mich an deren Beseitigung zu machen, und riss mir in meiner Hast die Hände auf, und ich spürte Pearce’ Verachtung für das, was ich tat, und hörte ihn im Geiste sagen: »Merivel, erklär mir, welchem Zweck dein Tun dient. Denn fürwahr, ich sehe keinen.«
»Nein«, sagte ich. »Es gibt absolut keinen. Nur den, dass diese Dinge mich erzürnen.« Und dann stieß ich einen schluchzenden Schrei aus und fragte: »Wohin sind sie alle gegangen, Pearce? Sag mir, wohin sie gegangen sind!«
Aber selbstverständlich kam keine Antwort aus dem vernachlässigten Grabhügel. Ich beseitigte alles Unkraut und verband meine Hände mit einem Schnupftuch und berührte die schwarze Erde mit meinen Fingern.
»John Pearce«, sagte ich, »du bist immer bei mir.«
Margaret hat nun das Alter von siebzehn erreicht. Sie wohnt schon ihr Leben lang hier bei mir auf Bidnold, und ich habe mich bemüht, ihr beides zu sein, Vater und Mutter, und zu meiner Freude und Erleichterung stelle ich fest – ohne mich rühmen zu wollen und ohne väterliche Blindheit –, dass sie ein wunderhübsches, keusches, warmherziges junges Mädchen ist, von arglosem Wesen, dem meinen nicht unähnlich, wundersamerweise jedoch ohne die Dummheit ihres Vaters.
Sie liebt mich, das weiß ich, so, wie es nur ein Vater von seinem Kind verlangen kann, doch als sie größer wurde, gefiel es ihr zunehmend, ihre Zeit im Hause Sir James Prideaux’ zu verbringen, meines nächsten Nachbarn in Norfolk, der ein höchst geachteter und der Jurisprudenz kundiger Mann ist und dreimal in der Woche den Vorsitz im Sitzungshaus von Norwich führt.
Prideaux’ Haus, Shottesbrooke Hall, ist, dank seiner vortrefflichen Gemahlin Arabella und ihrer vier Töchter, Jane, Mary, Virginia und Penelope, ein sehr lebhafter Ort. Und ich sehe wohl, dass es dort mehr gibt, was Margaret froh machen kann, als hier bei mir auf Bidnold.
Dass Prideaux keinen Sohn hat, muss für einen Mann seines Standes und Strebens eine Enttäuschung sein, doch er spricht nie darüber. Seinen Mädchen gegenüber zeigt er nichts als zärtliche Güte und ist bestrebt, ihnen alles zu bieten, was er glaubt, ihnen bieten zu müssen. Musiklehrer, Tanzmeister, junge Magister der Mathematik und Geografie, aber ebenso Schnitt-Entwerfer, Weißnäherinnen und Kurzwarenhändler (wie meine lieben Eltern es einst waren) gehen in Shottesbrooke ein und aus, und die Prideaux-Mädchen zeigen ein jedes die feinste Wissbegier auf die Welt.
Um Margaret, die dasselbe Alter hat wie Mary, ist die gesamte Familie rührend besorgt – gerade so, als gehörte sie zur Familie. Sie begreifen, dass Margaret, obgleich auch ich mich sehr um ihre Erziehung bemüht habe – mit dem Erfolg, dass sie ausgezeichnet Cembalo spielt, fließend Französisch sprechen kann und tanzt wie eine reizende Waldelfe –, die Tage bei mir häufig ein wenig öde finden muss. Sie studiert jetzt Geografie mit Mary und gerät darüber in wahres Schwärmen und sagt zu mir: »Ach, Papa, erst jetzt begreife ich, wie weit und groß die Welt ist. Und gewusst habe ich auch nicht, dass die großen Ströme als kleine Quellen im Schoß der Berge beginnen, und hast du gewusst, dass es mehr als zweihundert Sprachen auf der Erde gibt?«
»Nein«, sage ich, »gottlob wusste ich es nicht. Das Französische zu meistern fällt mir schon schwer genug.«
Margaret weilt in diesen grauen Novembertagen, als Der Keil so plötzlich in meinen Besitz gelangt ist, in Shottesbrooke Hall.
Ich möchte anmerken, dass ich, als ich meine Geschichte niederschrieb, glaubte, sie könne mehr als einen Anfang haben. Ich zog in der Tat fünf Anfänge in Betracht. Denn damals begriff ich, dass kein Leben nur da beginnt, wo es beginnt, sondern dass es auch noch andere Anfänge hat und dass ein jeder das, was kommen wird, mitbestimmt.
Und jetzt erkenne ich mit der gleichen Klarheit, dass das Leben eines Menschen mehr als ein Ende haben kann. Doch leider Gottes zeigen sich mir die Enden, die ich möglicherweise verdient habe, allesamt in einem düsteren Licht. Wenn es denn fünf gibt, so wie es fünf Anfänge gab, dann werden es gewiss die folgenden sein.
Ein Ende in Einsamkeit. Ich klammere mich an Margaret. Sie allein steht zwischen mir und einem sehr übermächtigen Gefühl für die Leere, die mich umgibt. Alles, was in mir gut und nobel sein mag, sehe ich einzig in ihr. Doch ich weiß, dass Margaret nur zu bald heiraten muss. Sie wird Bidnold für ein anderes (und besseres) Leben verlassen.
Schon spinne ich insgeheim Pläne für diese Zukunft, beratschlage mich, mit Prideaux und anderen mir bekannten Personen aus Norfolk, über die Eignung gewisser Söhne von Landedelleuten – oder sogar des Adels – als möglicher Ehemann für die Tochter eines Ritters des Hosenbandordens und engen Vertrauten des Königs.
Hugo Mulholland, Sohn und Erbe von Sir Gerald Mulholland, ein stattlicher junger Mann, aber mit seltsam stotternder Zunge, hat Margaret schon mehr als einmal seine Aufwartung gemacht. Ich weiß, dass sie nichts von ihm hält und, kaum ist er weg, über sein Stottern lacht und es meisterhaft zu imitieren versteht.
Bei seinem letzten Besuch, als dieser arme Hugo schon sicher und geborgen in seiner abfahrbereiten Kutsche saß, umarmt Margaret mich und flüstert: »Papa, ich bitte dich, wirf mich nicht einem stammelnden Gemahl in die Arme!« Und ich küsse ihr Haar und versichere ihr, dass sie nur heiraten wird, wenn sie es selbst will, und dass ich sie am liebsten bis ans Ende aller Zeiten bei mir auf Bidnold behalten würde. Doch ich weiß, dass ich das nicht darf. Margaret wird eines Tages heiraten, Punkt, aus.
Ein Ende in Armut. Obgleich ich immer noch als Arzt praktiziere und die Wunden und Leiden meiner Nachbarn in Norfolk so gut ich kann behandele, scheine ich zu den Menschen zu gehören, bei denen andere sich lieber verschulden als ihnen das zu zahlen, wozu sie sich verpflichtet haben.
Von Zeit zu Zeit rechne ich zusammen, was man mir noch schuldig ist, und diese Summen sind stets sehr hoch, und für eine Weile gebe ich mir redlich Mühe, meinen Schuldnern gegenüber Härte und Entschlossenheit zu zeigen. Einige haben darauf die Güte, meine Rechnungen zu begleichen, aber wenn dann der Rest der Gelder ausbleibt, schwinden nach und nach Härte und Entschlossenheit, ich werde meiner Verfolgungsjagd absolut überdrüssig, so als ginge es um ein in den Wäldern der Legenden umherirrendes Einhorn, das ich niemals finden werde.
Folglich wird mein Einkommen sich mit der Zeit womöglich auf fast gar nichts belaufen, und ich werde – sofern der König nicht an seinem sehr generösen Salär oder loyer festhält, das er mir zusprach, als er mir mein Haus 1668 zurückgab, um sicherzustellen, dass ich jederzeit in der Lage wäre, ihn auf Bidnold Manor zu empfangen – vielleicht in einen Zustand der Mittellosigkeit geraten, aus dem es keinen Ausweg gibt. Ohne den loyer würde ich zweifellos in großen Unannehmlichkeiten sein.
Ein Ende durch Gift. Mein Koch Cattlebury steht – wie schon erwähnt – Will mit seiner Konfusion kaum nach, weshalb er seine kulinarischen Aufgaben auch nicht länger verlässlich und mit wirklichem Geschick und Können erfüllen kann. Vergangene Woche süßte Cattlebury eine Fleischpastete und briet einen Hering in Sirup. Als ich diese Kunststücke in die Küche zurückgehen ließ, erschien Cattlebury, wie ein dampfumwehtes und schweißgebadetes Ungeheuer, in meinem Speisezimmer, hielt in seinen Händen keinen Knüppel, sondern ein hölzernes Sieb, durch dessen Löcher sein Gehirn fortgesickert sein muss, und fragte mich, wieso ich ihn, der sich solche Mühe mit der Erfindung neuer Gerichte für mich gegeben habe, und seine Kunst derart verächtlich behandele.
»Cattlebury«, sagte ich, »wenn dies Erfindungen sind, dann bitte ich dich, kehr zu dem zurück, was schon erfunden worden ist.«
Will stand neben ihm, tief gebückt und mit trauriger Miene. »Es war keine böse Absicht, Sir Robert«, sagte er.
»Wenn es keine Absicht war«, erwiderte ich, »dann tat er es aus Unachtsamkeit oder Verwirrung, und keines von beidem darf in einer Küche überhandnehmen.«
Die beiden Männer schienen ratlos, der eine war zu einem rechten Winkel zusammengeklappt, der andere sah aus, als wäre er in einem Kessel mit Brühe gekocht worden, und ich betrachtete sie und dachte bei mir: Ihr werdet noch mein Tod sein. Das Chaos, das ihr anrichtet, überlebe ich nicht.
Ein Ende durch Selbstmord. Von Sir James Prideaux, der manch einer Hinrichtung auf dem Schafott am Mouse Hill hinter Norwich beigewohnt hat, habe ich erfahren, dass unter all den Räubern, Münzfälschern, Taschendieben, Schuldnern, Piraten und Mördern, die auf dem von Menschenmengen gesäumten Weg zu ihrem Ende schreiten, nicht wenige sind, die ihn mit einem »gewissen Maß an Stolz« gehen. Es scheint, dass ein Verurteilter in seinem letzten Gang auf dieser Erde einen Augenblick wahrer Glorie sieht, als würde er plötzlich erhoben, um für seine fabelhaften Taten gepriesen anstatt für seine Bubenstücke und Betrügereien gehängt zu werden.
Er trägt dann den besten Rock, den er besitzt; seine Perücke, so er denn eine hat, ist gepudert; die Schnallen seiner Schuhe glänzen; und auf seinem Gesicht liegt – wie Prideaux behauptet – ein glückseliges Lächeln; und dann winkt er, fast wie ein königlicher Prinz, der Menge zu, und wenn für ihn der Augenblick kommt, das Schafott zu besteigen, tut er es mit stolzem Schritt und immer noch winkend, wobei man die schmutzige Spitze an seinem Ärmelaufschlag sehen kann oder die zerzauste Feder an seinem Hut.
Und das setzt mich wahrlich in Erstaunen, und ich denke bei mir: Warum nur, Merivel, scheust du, wenn solche Männer den Tod nicht fürchten, so feige vor dem Gedanken an ihn zurück? Und so befehle ich mir jetzt, dieses Entsetzen abzuschütteln und meine feige Seele zu stählen, auf dass sie das mir vorbestimmte Ende überspringt, indem sie wie ein Wegelagerer in die Arme ihres Schöpfers eilt. Schwierigkeiten bereitet mir einzig die Vorstellung dieses Schöpfers. Ich sehe ihn immer und ausschließlich als meinen armen Vater, der 1662 in einem Feuer mitsamt den Federn und Bändern seines bescheidenen Kurzwarenhandels verbrannte.
Ein Ende in Bedeutungslosigkeit. Dies ist, so meine ich, das mögliche Ende, welches mich am meisten bestürzt. Trotz eines gewaltigen Kampfes mit Gott und meiner Berufung und im steten Bemühen (wie einst vom König angemahnt), meinen eigenen Nutzen und Zweck auf der Welt zu entdecken, kommt mir stets wieder der Verdacht, mein Leben sei ein nichtig Ding, schlecht geführt, voller Fehlurteile, falscher Nachsichtigkeit und Faulheit, das mich nur immer tiefer in einen Abgrund von Wirrnis und Leere geführt hat; am Ende erinnere ich mich nicht mehr, warum ich überhaupt lebe. Und ein Mann, der diese besondere Erinnerung verloren hat, ist mit Sicherheit zum endgültigen Vergessen verurteilt.
Heute kehrt Margaret nach Bidnold zurück.
Da ist es nur angemessen, dass sich zwischen den Wolken ein Spalt auftut und in meinem Park die Sonne golden und kupferfarben auf Buchen und Eichen scheint. Ich mache einen Rundgang durch den Garten, wo ich erst jüngst eine Allee aus Hagebuchen gepflanzt habe, die mich über alle Maßen erfreut, und schaue dem Rotwild zu, wie es, ungestört von den Novemberwinden, im ruhigen Licht friedlich grast und mit den Stummelschwänzen zuckt. Und ich konstatiere, was ich schon hundertmal konstatiert habe, wie viel Schönheit es hier doch gibt.
Als die Kutsche mit Margaret die Zufahrt heraufgefahren kommt, gehe ich eilig zurück zum Haus, wo ich auf Will stoße, der sich schon auf die Begrüßung seiner jungen Herrin einzustellen versucht. Margarets Zofe Tabitha tritt ebenfalls vor die Tür, streicht sich die Schürze glatt und ordnet ihre Haare, die der Wind zerzaust hat, und ich sehe in den Gesichtern dieser beiden einen Ausdruck großer Freude.
Margaret entsteigt der Kutsche in einem neuen braunen Cape, vermutlich einem Geschenk von Lady Prideaux, und ich eile zu ihr, schlinge meine Arme um sie und sage ihr, wie froh uns alle hier auf Bidnold ihr Anblick mache. Obgleich sie doch mein Kind ist, erstaunt mich jedes Mal von Neuem der strahlende Glanz, den sie mit sich bringt. Sie ist wie ein Regenbogen oder wie ein funkelnder Lichtstrahl, der vorher nicht da war.
Beim Nachtmahl sagt Margaret zu mir: »Papa, ich habe dir Neuigkeiten zu berichten: Sir James wird den ganzen Dezember und noch bis über die zwölfte Januarnacht hinaus mit seiner Familie auf dem Landgut seiner Mutter in der Grafschaft Cornwall weilen. Und man hat mich eingeladen, sie zu begleiten.«
Cattlebury hat uns eine Carbonada serviert, eines der wenigen Gerichte, die er nur selten verhunzt oder anbrennen lässt. Bis zu diesem Moment habe ich diese Köstlichkeit genossen, aber nun spüre ich plötzlich, wie mein Appetit schwindet.
»Cornwall?«, frage ich hilflos.
»Ja«, erwidert Margaret. »Mary sagt, in jenem Teil des Landes wehe das ganze Jahr über ein warmer Wind, und Blumen blühten zu Weihnachten, und es gebe dort Wege mit Sand und Kamille, die vom Haus bis ans Meer führen …«
Ich sage nichts. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie Margaret in ihrem neuen braunen Cape auf diesen duftenden Pfaden zum Meer hinunterwandelt, sie geht immer weiter, entfernt sich immer weiter von mir, bis sie schließlich verschwunden ist.
»Papa«, sagt Margaret. »Ich hoffe, dass du mich gehen lässt. Es gibt dort jenseits der Bucht eine Insel, zu der wir mit einer kleinen Barke hinübersegeln können, auf der Insel leben Papageientaucher, und ich habe noch nie einen Papageientaucher gesehen.«
»Oh«, sage ich. »Ich auch nicht.«
Ich muss wohl bleich geworden sein, denn Margaret sieht mich an und sagt: »Ist dir nicht wohl, Vater? Was ist mit dir?«
»Gar … nichts …«, stammele ich (wie Hugo Mulholland). »Ich habe nur versucht, mir die Farben des Papageientauchers ins Gedächtnis zu rufen und wie ihre Schwanzfedern beschaffen sind.«
»Die Vögel sind schwarz und weiß mit einem gelben oder orangefarbenen Schnabel, sagt Penelope, aber was die Schwanzfedern betrifft, da werde ich, wenn du mich nach Cornwall reisen lässt, einige Zeichnungen oder Gemälde für dich anfertigen, und dann wissen wir beide genau, wie sie aussehen.«
Ich trinke einen Schluck Wein. »Es wird eine große Erleichterung sein«, sage ich, »wenn endlich alle Ungewissheiten über Papageientaucher beseitigt sind!«
Wir lachen, und ich versuche, mich wieder dem Fleischgericht zu widmen, während ich Margaret erkläre, dass sie selbstverständlich nach Cornwall reisen soll, welches eine der lieblichsten Gegenden ganz Englands sei. Und somit ist es beschlossene Sache. Margaret wird ungefähr zwei Monate fort sein. Und ich höre mich versprechen, dass ich ihr Geld für neue Kleider und einen neuen Pelzkragen geben werde, für den Fall, dass es an Bord der Barke ein wenig windig sei. Und dennoch denke ich unterdessen immerzu – nicht an Margaret, sondern an mich –, und ich sehe das Gespenst eines Todes in Einsamkeit auf mich zukommen, und ich spüre, ohne dass ich es will, schon jetzt seine Bitternis und die langsamen Schauer, die ihn begleiten.
Am Morgen vor ihrem Aufbruch nach Shottesbrooke – ein kalter Winde wehte an diesem Tag, und ein plötzlicher Hagelsturm verteilte weiße Eiskiesel auf dem gesamten Parkgelände – saß ich mit Margaret in der Bibliothek vor dem Kamin und versuchte, mein Gemüt durch kleine, regelmäßige Schlückchen von einem feinen Alicantewein zu stärken, obgleich ich wusste, dass meine Melancholie kaum zu übersehen war. (Ich habe es mir erst jüngst, nach der Lektüre des französischen Philosophen Michel de Montaigne, zur Gewohnheit gemacht, mich selbst de près anzuschauen, will sagen »aus der Nähe«, indem ich nicht nur nach außen blicke, sondern auch nach innen, auf mein eigenes Verhalten und meine eigenen Reaktionen, um, so das hochgesteckte Ziel, über die Person, die ich bin oder vielleicht werden könnte, einigen Aufschluss zu erlangen.)
Um mich ein wenig aufzumuntern, versprach Margaret, sie werde mir häufig Briefe aus Cornwall schreiben und darin die Schönheit der verborgenen Buchten schildern, welche die Gezeiten in ihrer ewigen Rastlosigkeit füllen und leeren, und auch die Feinheiten der Muscheln, die sie mit Mary dort sicherlich finden werde.
»Ach«, sagte ich, »und die Feinheiten der Wracks der Schiffe, die von Piraten angegriffen wurden und dann an den Felsen zerschellten, ebenso wie all die Toten, die an Land gespült wurden …«
Margaret betrachtete mich mit Sorge, wie eine Mutter, die das Verhalten ihres Kindes enttäuscht.
»Vater«, sagte sie nach einem kurzen Schweigen, »ich habe über etwas nachgedacht.«
»Das freut mich«, sagte ich, »denn ein gedankenleerer Geist neigt zu furchtbarem Irrtum.«
»Pscht! Und spotte einmal nicht.«
»Wieder die Papageientaucher? Hast du über sie nachgedacht?«
»Nein. Ich dachte an etwas, das Sir James bei meinem letzten Besuch in Shottesbrooke zu mir sagte. Der Mensch solle sich, meinte er, für seine kurze Zeit auf Erden unbedingt eine Art Lebensaufgabe setzen.«
»Darin stimme ich mit ihm überein. Aber sieh deinen Vater nicht so anklagend an, Margaret. Du weißt, dass ich schon jetzt eine große Anzahl von Aufgaben habe, und –«
»Er sprach vom Schreiben, Papa: vom Verfassen einer Abhandlung über ein Thema von Bedeutung. Er selbst hat sich an die Niederschrift eines sehr langen und bedeutenden Werks gemacht, dem er den Titel Traktat über die Armen und die Verbreitung des Verbrechens in England gab. Und er sagte mir, diese anstrengende Arbeit schenke ihm große Befriedigung, da er sich so aus seiner eigenen Welt entfernen könne …«
»Ganz und gar entfernt er sich nicht«, entgegnete ich scharf. »Sir James ist, wie du weißt, Friedensrichter, und insofern hat er sehr häufig mit den verbrecherischen Armen zu tun.«
»Wohl wahr. Aber er selbst ist keiner von ihnen. Er muss sein Leben nicht mit dem Verkauf von Austern oder mit kleinen Diebstählen fristen. Er wird nicht von einer Gemeinde in die nächste vertrieben, weil jeder die Kosten seines Unterhalts scheut …«
»Richtig. Jedoch –«
»Ich möchte dir gerne einen Vorschlag unterbreiten, Vater. Ich glaube, wenn du dich zu dem großen Wagnis des Schreibens entschließen könntest, würdest du weniger in Melancholie versinken und zufriedener mit der Welt sein.«
Ich glotzte meine Tochter an. Es ist wahr, ich habe sie zu einer gewissen Unabhängigkeit des Geistes erzogen, aber wenn diese Unabhängigkeit, wie ein mit Widerhaken versehener Pfeil, auf mich gerichtet ist, dann fühle ich … nun, was fühle ich denn? Vermutlich fühle ich mich einfach töricht. Doch diese Torheit mischt sich mit Furcht. (Wurde nicht das Leben des armen König Lear durch den unabhängigen Geist seiner jüngsten und am meisten geliebten Tochter gänzlich zerstört?)
Ich rückte näher ans Feuer und streckte die Hände aus, um sie zu wärmen. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte Margaret – als eine Art kläglicher Verteidigung dessen, was sie für Müßiggang und das Fehlen jeglicher Freude hält – von meinen einstigen Versuchen erzählt, die Geschichte meines Lebens im Keil niederzuschreiben, doch im letzten Moment fiel mir ein, dass diese Lebensgeschichte manch eine Torheit und Bosheit in ihrer ganzen nackten Entsetzlichkeit offenbart, darunter auch die Bosheit gegenüber Margarets eigener Mutter. Und so sah ich davon ab.
Ich wandte mich wieder dem Wein zu. Von diesem etwas erwärmt, sagte ich: »Es ist sehr freundlich von dir, dass du deine Gedanken meinem Wohlergehen widmest, und glaube nicht, es rührte mich nicht. Und du hast auch Recht, wir verbinden uns mit der Welt durch strebendes Bemühen, und dennoch …«
»Und dennoch was?«
»Ach, Margaret«, sagte ich, »du kanntest mich ja nicht, als ich jung war! Einst war ich nichts als strebendes Bemühen. Für jede Minute meines Daseins entwarf ich großartige und wunderbare Pläne. Ich versuchte sogar, ein Künstler zu werden – bis ein dünkelhafter Porträtmaler mir erklärte, ich hätte kein Talent. Der Tag hatte nicht genügend Stunden noch das Jahr genügend Tage für all meine Vorhaben. Doch nachdem du geboren warst und Bidnold mir wieder übereignet worden war, beschloss ich, meine Rastlosigkeit aufzugeben und mich hier in Norfolk niederzulassen, um mich um dich zu kümmern, meinem Beruf nachzugehen und nicht mehr an Glanz und Glorie, an Emporkommen und an sonstige weltliche Dinge zu denken.«
»Papa«, sagte sie sanft, »ich sprach nicht von Glanz und Glorie.«
Ich blieb noch lange, nachdem Margaret sich schlafen gelegt hatte, in meinem Sessel sitzen. »Merivel«, sagte ich zu mir, »hier Tag um Tag allein zu sitzen, während Margaret in Cornwall weilt, wird dich mit Sicherheit in dunkle Verzweiflung stürzen. Du musst aufstehen und dich umschauen, an einem neuen Ort.«
Vielleicht war es Margarets Erwähnung der Worte »Glanz und Glorie«, die mich auf die Idee brachten, nach Frankreich, an den Hof Ludwig XIV., zu reisen. Ich wusste, wonach ich mich in diesen mir noch verbleibenden Jahren sehnte: Ich wollte durch Wunder in Erstaunen versetzt werden. In Versailles würden sie sich gewisslich finden lassen.
3
Ich bin nun in London.
Ich trage einen sehr vornehmen rostroten Rock und braune Kniebundhosen, um den Hals eine Kaskade prächtiger Spitzen und auf dem Kopf einen sehr flotten Hut, der seine warme Last von Zeit zu Zeit zu verschieben scheint, als wäre es ein zahmer nistender Fasan, den ich in Norfolk aufgezogen habe.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!