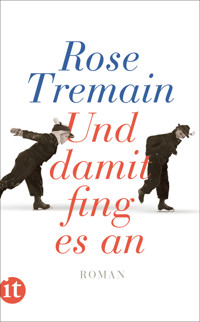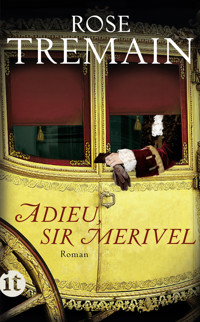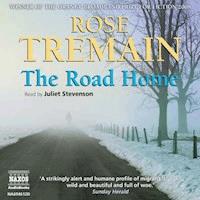9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kopenhagen im 17. Jahrhundert. Peter Claire, der engelhaft schöne englische Lautenspieler, kommt an den königlichen Hof und wird gleich in den Untergrund verbannt: Der König lässt seine Musiker im eiskalten Keller spielen, damit oben in den prunkvollen Sälen die Musik umso geheimnisvoller und schöner erklingt. Bald wird Peter zum Vertrauten des Königs und in dessen intime Geheimnisse eingeweiht. Die Königin betrügt den König – und das nicht sehr heimlich. Als sie es zu weit treibt, wird sie mit ihrer Hofdame Emilia in die Provinz verbannt. Peter ist hin- und hergerissen zwischen seiner Treue zum König und Emilia, in die er sich unsterblich verliebt hat … Ein pralles Sittenbild und ein unvergleichliches Lesevergnügen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 847
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Kopenhagen im 17. Jahrhundert. Peter Claire, der engelhaft schöne englische Lautenspieler, kommt an den königlichen Hof und wird gleich in den Untergrund verbannt: Der König läßt seine Musiker im eiskalten Keller spielen, damit oben in den prunkvollen Sälen die Musik um so geheimnisvoller und schöner erklingt.
Bald wird Peter zum Vertrauten des Königs und in dessen intime Geheimnisse eingeweiht. Die Königin betrügt den König – und das nicht sehr heimlich. Als sie es zu weit treibt, wird sie mit ihrer Hofdame Emilia in die Provinz verbannt. Peter ist hin- und hergerissen zwischen seiner Treue zum König und Emilia, in die er sich unsterblich verliebt hat …
»Melodie der Stille ist ein opulentes Lesevergnügen, ein Rausch.« Die Welt
»Ein himmlisches Buch, das man, während der letzte Satz noch nachklingt, sofort von vorn lesen will.« Brigitte
Rose Tremain ist eine erfolgreiche und vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Sie lebt in London und Norwich. Für ihren Erfolgsroman Der weite Weg nach Hause (it 4037) wurde sie 2008 mit dem Orange Prize for Fiction ausgezeichnet. Zuletzt erschienen im Insel Verlag Zeit der Sinnlichkeit (it 4200) sowie ihr neuester Roman Adieu, Sir Merivel.
ROSE TREMAIN
MELODIE DER STILLE
RomanAus dem Englischen von Elfie DeffnerInsel Verlag
eBook Insel Verlag Berlin 2013
© Insel Verlag Berlin 2013
Das englische Original erschien 1999 unter dem Titel Music & Silence
bei Chatto & Windus in London. © Rose Tremain 1999
Deutsche Erstveröffentlichung: Carl Hanser Verlag München Wien 2000
Umschlagfoto: Jeff Cottenden
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Cornelia Niere, München
ISBN 978-3-458-73174-0
www.insel-verlag.de
Für meine Tochter Eleonor in Liebe
ERSTER TEILKopenhagen 1629
FLIEDER UND LINDENBLÜTEN
Ein Licht flammt auf.
Bis zu diesem Augenblick, als die Flamme blau aufflackert, um dann ruhig und gelb in ihrer kunstvollen Glaskugel weiterzubrennen, war der junge Mann von der völligen Dunkelheit eingeschüchtert gewesen, der er sich bei seinem späten Eintreffen auf Schloß Rosenborg plötzlich gegenübergesehen hatte. Er war müde von der langen Seereise, seine Augen brannten, sein Gang war unsicher, und so war er sich über die Art dieser Dunkelheit nicht im klaren. Er hatte den Eindruck, sie sei nicht nur ein äußeres Phänomen, das mit dem tatsächlichen Fehlen von Licht zu tun hatte, sondern gehe von seinem Innern aus, als habe er die Schwelle zu seiner eigenen Hoffnungslosigkeit überschritten.
Er ist erleichtert, als er nun einen getäfelten Raum um sich herum Gestalt annehmen sieht und jemanden sagen hört: »Das ist das Vinterstue. Das Winterzimmer.«
Die Lampe wird hochgehoben. Sie brennt jetzt heller, als werde sie von reinerer Luft genährt, und der junge Mann sieht an der Wand einen Schatten. Es ist ein langer, gebeugter Schatten, sein eigener. Es sieht so aus, als habe er von den Schulterblättern bis fast zur Taille eine Mißbildung, einen Buckel. Doch ist das eine Täuschung. Bei dem jungen Mann handelt es sich um Peter Claire, einen Lautenspieler, und bei dem krummen Rücken um seine Laute.
Er steht bei zwei silbernen Löwen, die ihn durch das flackernde Licht zu beobachten scheinen. Dahinter erkennt er einen Tisch und ein paar hohe Stühle. Doch Peter Claire ist von allem abgetrennt, findet nirgends Halt, nirgends Ruhe. Und nun bewegt sich die Lampe weiter, und er muß ihr folgen.
»Möglicherweise«, sagt der große Herr, der mit der Lampe weitereilt, »müßt Ihr Seiner Majestät König Christian noch heute abend vorspielen. Er fühlt sich nicht wohl, und seine Ärzte haben ihm Musik verordnet. Deshalb müssen die Musiker des Königlichen Orchesters jederzeit spielbereit sein, bei Tag und bei Nacht. Ich hielt es für das beste, Euch gleich davon zu unterrichten.«
Peter Claires Unbehagen wächst. Er verflucht sich und schilt sich wegen seines Ehrgeizes, der ihn hierher nach Dänemark gebracht hat, so weit weg von all seinen geliebten Stätten und Menschen. Er ist am Ziel seiner Reise und fühlt sich doch verloren. In dieser Ankunft verbirgt sich eine schreckliche Abreise. Und plötzlich bewegt sich die Lampe seltsam schnell, alles im Zimmer scheint eine neue Gestalt anzunehmen. Peter Claire sieht seinen Schatten an der Wand länger werden, sich für ein paar Sekunden bis zur Decke hinauf ausdehnen, um dann von der Dunkelheit verschluckt zu werden, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen.
Sie erreichen nun das Ende des Flures, und der Herr bleibt vor einer Tür stehen. Er klopft und wartet, legt einen Finger an die Lippen und beugt sich zur Tür, um die Aufforderung zum Eintreten zu hören. Schließlich ertönt eine tiefe und gemächliche Stimme, und im nächsten Augenblick steht Peter Claire vor König Christian, der im Nachthemd auf einem Stuhl sitzt. Auf einem kleinen Tisch vor ihm befinden sich eine Waage und daneben ein Haufen Silbermünzen.
Als der König aufblickt, verbeugt sich der englische Lauten-spieler. Peter Claire wird sich immer daran erinnern, wie erstaunt König Christian aussieht, als er seiner in dieser dunklen Winternacht zum erstenmal ansichtig wird und ihm aufmerksam ins Gesicht schauend nur ein einziges Wort zuflüstert: »Bror.«
»Wie bitte, Sir …?« fragt Peter Claire.
»Nichts!« antwortet der König. »Ein Gespenst. Dänemark ist voller Gespenster. Hat Euch niemand davor gewarnt?«
»Nein, Euer Majestät!«
»Macht nichts. Ihr werdet sie noch selbst sehen. Wir gehören zu den ältesten Nationen der Erde. Ihr solltet jedoch wissen, daß wir jetzt eine stürmische Zeit haben, eine der Verwirrung, des Unfaßbaren, des brodelnden Durcheinanders.«
»Des Durcheinanders, Sir?«
»Ja. Deshalb wiege ich das Silber. Ich wiege dieselben Stücke immer wieder aufs neue, um jeden Irrtum auszuschließen. Auch die bloße Möglichkeit eines Irrtums. So versuche ich, dem Chaos Stück für Stück und Tag für Tag wieder Ordnung aufzuerlegen.«
Peter Claire weiß nicht, was er darauf erwidern soll; ihm wird bewußt, daß der große Herr, ohne daß er es bemerkt hat, aus dem Zimmer gegangen ist und ihn mit dem König allein gelassen hat. Dieser schiebt nun die Waage beiseite und macht es sich bequem.
Dann hebt König Christian den Kopf und fragt: »Wie alt seid Ihr, Mr. Claire? Woher kommt Ihr?«
In dem kleinen Raum, bei dem es sich um das königliche Studierzimmer, das Skrivestue, handelt, brennt ein Feuer, und es riecht süßlich nach Apfelbaumholz und Leder.
Peter Claire erwidert, er sei siebenundzwanzig Jahre alt und seine Eltern wohnten in Harwich an der Ostküste Englands. Er fügt noch hinzu, daß das Meer dort im Winter unerbittlich sein könne.
»Unerbittlich. Unerbittlich!« wiederholt der König. »Nun, wir müssen weitereilen, dieses Wort übergehen oder umgehen. Unerbittlich. Doch ich sage Euch, Lautenspieler, mich plagen die Läuse. Seht nicht so erschreckt aus! Sie sind nicht in meinen Haaren und nicht auf meinem Kopfkissen. Ich meine Feiglinge, Gauner, Lügner, Säufer, Betrüger und Lüstlinge. Wo sind die Philosophen? Das ist meine ständige Frage.«
Peter Claire zögert.
»Ihr braucht mir nicht zu antworten!« sagt der König. »Sie sind nämlich alle von Dänemark weggegangen! Nicht ein einziger ist geblieben!«
Nun steht Seine Majestät auf und geht hinüber zum Feuer und zu Peter Claire, greift nach einer Lampe und hält sie dem jungen Mann ans Gesicht. Er mustert ihn, und Peter Claire senkt den Blick, weil er angehalten worden ist, den König nicht anzustarren. Es ist ein häßlicher König. Die Könige Charles I. von England und Ludwig XIII. von Frankreich sind gutaussehende Männer in diesem bedrohlichen Augenblick der Geschichte, doch König Christian IV. von Dänemark soll zwar allmächtig, tapfer und kultiviert sein, hat aber ein Gesicht wie ein Laib Brot.
Der Lautenspieler, dem die Natur in grausamem Kontrast dazu ein Engelsgesicht verliehen hat, bemerkt Weingeruch im Atem des Königs. Er wagt es jedoch nicht, sich zu bewegen, nicht einmal, als der König die Hand ausstreckt und zart seine Wange berührt. Peter Claire galt mit seinen blonden Haaren und meerblauen Augen von Kindheit an als hübsch. Er macht nicht viel Wesens um sein Aussehen, vergißt es oft völlig, als warte er nur ungeduldig darauf, daß die Zeit es ihm nehme. Er hörte einmal, wie seine Schwester Charlotte Gott bat, ihr sein Gesicht zu geben, und dabei dachte er, daß es für ihn wirklich ziemlich wertlos sei und viel besser ihres wäre. Nun wird der Lautenspieler hier, an diesem fremden Ort, während er trüben und düsteren Gedanken nachhängt, wieder einmal unerwartet einer Musterung unterzogen.
»Aha! Aha!« flüstert der König. »Gott hat übertrieben, wie Er es so oft zu tun scheint. Hütet Euch vor der Aufmerksamkeit meiner Frau Kirsten, die ganz entzückt ist von blondem Haar. Ich rate Euch, in ihrer Nähe eine Maske aufzusetzen. Und alle Schönheit vergeht, doch das wißt Ihr natürlich, darauf brauche ich nicht eigens hinzuweisen.«
»Ich weiß, daß Schönheit vergeht, Sir.«
»Natürlich wißt Ihr das! Nun, Ihr solltet mir lieber etwas vor-spielen. Sicher ist Euch bekannt, daß wir Euren Mr. Dowland hier am Hof hatten. Es war mir ein Rätsel, wie so schöne Musik aus einer derart in Aufruhr befindlichen Seele kommen konnte. Dieser Mann war getrieben von Ehrgeiz und Haß, doch seine Weisen waren wie sanfter Regen. So saßen wir schluchzend da, und Meister Dowland tötete uns mit wütenden Blicken. Auf mein Geheiß hin nahm ihn meine Mutter beiseite und sagte zu ihm: ›Dowland, so geht das nicht, das können wir nicht dulden!‹ Doch er erklärte ihr, Musik könne nur aus Feuer und Zorn entstehen. Was meint Ihr dazu?«
Peter Claire schweigt einen Augenblick. Aus unerklärlichen Gründen tröstet ihn diese Frage, und er spürt, wie seine Erregung ein klein wenig abflaut. »Ich meine, daß sie zwar aus Feuer und Zorn entsteht, Sir«, erwidert er dann, »aber ebenso aus dem genauen Gegenteil – aus kühlem Verstand und Ruhe.«
»Das klingt logisch. Aber natürlich wissen wir eigentlich nicht, wo die Musik entsteht und warum, auch nicht, wann der erste Ton gehört wurde. Und das werden wir auch niemals wissen. Es ist die menschliche Seele, die ohne Worte spricht. Doch scheint die Musik Schmerzen zu lindern – das ist tatsächlich wahr. Ich sehne mich übrigens danach, daß alles durchsichtig, ehrlich und wahrhaftig ist. Nun, warum spielt Ihr mir nicht eine von Dowlands Lachrimae vor? Seine Begabung lag im sparsamen Einsatz der Mittel, und das liebe ich abgöttisch. Seine Musik läßt keinen Raum für Exhibitionismus auf seiten des Spielers.«
Peter Claire nimmt die Laute vom Rücken und drückt sie sich an den Körper. Beim Zupfen und Stimmen lauscht er angestrengt (in einem Ohr trägt er einen winzigen Edelstein, den ihm einst eine irische Gräfin geschenkt hat). König Christian seufzt in Erwartung der lieblichen Melodie. Er ist ein korpulenter Mann. Jede Veränderung seiner Position scheint ihm einen flüchtigen Augenblick lang Unbehagen zu bereiten.
Nun stellt sich Peter Claire in Positur: Er beugt sich aus den Hüften heraus vor, streckt den Kopf nach vorn, senkt das Kinn, und sein rechter Arm bildet ein zärtliches Halbrund, so daß er das Instrument genau an seine Mitte drückt. Nur so kann er die Musik aus sich herausströmen fühlen. Er beginnt zu spielen. Er hört den reinen Klang und denkt, allein dies werde beim König von Dänemark zählen.
Nach dem Lied blickt er zum König hinüber, doch dieser rührt sich nicht. Seine großen Hände umklammern die Armlehnen. Auf der linken Seite seines dunklen Kopfes fällt ein langer, dünner Haarzopf herunter, der von einer Perle gehalten wird. »Im Frühjahr«, sagt Christian plötzlich, »roch es in Kopenhagen immer nach Flieder und Lindenblüten. Wenn ich nur wüßte, was aus diesem himmlischen Duft geworden ist.«
KIRSTEN MUNK, GEMAHLIN KÖNIG CHRISTIANS IV. VON DÄNEMARK: AUS IHREN PRIVATEN PAPIEREN
Also, zu meinem dreißigsten Geburtstag habe ich einen neuen Spiegel geschenkt bekommen, und ich glaubte, ich würde davon begeistert sein. Ich glaubte, ich würde meinen neuen Spiegel unmäßig lieben. Er hat jedoch einen Fehler: Mit seiner Versilberung ist eindeutig etwas nicht in Ordnung, denn dieses heimtückische Ding läßt mich dick aussehen. Ich habe nach einem Hammer geschickt.
Meine Geburtstagsgeschenke, möchte ich hier einmal bemerken, waren nicht so wunderbar, wie die Schenkenden taten. Mein armer alter Herr und Meister, der König, der weiß, wie sehr ich Gold schätze, gab mir eine kleine goldene Statue von sich selbst mit einem goldenen Wurfstock in der Hand auf einem goldenen Pferd. Dieses hat eine tänzelnde Haltung mit erhobenen Vorderbeinen angenommen, so daß das dumme Ding umfallen würde, wäre da nicht ein kleiner Harlekin, der tut, als laufe er neben dem Pferd her, es aber in Wirklichkeit hochhält.
Dabei habe ich nicht um ein weiteres Abbild meines alternden Ehemannes gebeten. Ich habe mir Gold gewünscht. Nun muß ich so tun, als liebe und verehre ich die Statue, ich muß ihr einen Ehrenplatz einräumen und so weiter, um keinen Anstoß zu erregen. Dabei würde ich sie am liebsten zur Königlichen Münzanstalt bringen und zu einem Barren einschmelzen, den ich dann mit meinen Händen und Füßen liebkosen und sogar manchmal mit ins Bett nehmen könnte, um das massive Gold an der Wange oder zwischen den Schenkeln zu fühlen.
An dem Geschenk hingen die Worte: Dem Herzallerliebsten Mäuschen von Seinem Herrn C4. Ich habe den Zettel zerrissen und ins Feuer geworfen. Der Kosename »Mäuschen« geht auf die Zeit zurück, als ich seine junge Braut war und es mir Spaß machte, ihn mit meinen kleinen weißen Fingern zu kitzeln. Ich fand es damals lieb, daß er mich so nannte, lachte und schnupperte und machte alle möglichen Krabbelmaussachen. Doch diese Zeiten sind ein für allemal vorbei, nur noch mit Mühe kann ich mir vorstellen, daß es sie je gab. Ich habe nicht mehr den geringsten Wunsch, ein »Mäuschen« zu sein. Viel lieber wäre ich eine Ratte. Ratten haben scharfe Zähne, die zubeißen können. Ratten übertragen Krankheiten, die töten können. Warum wollen Ehemänner denn nicht verstehen, daß wir Frauen nicht lange ihre Schmusetiere bleiben?
Bei meiner Geburtstagsfeier, zu der viele aus dem ambitiösen Hochadel eingeladen waren, von denen mich die meisten völlig ignorierten, machte ich mir einen Spaß daraus, eine Unmenge Wein zu trinken und zu tanzen, bis ich auf den Brennholzstapel fiel. Als ich diesen nicht weniger gemütlich als ein Bett fand, rollte ich darauf herum und schüttete mich vor Lachen aus, bis ich merkte, daß die versammelte herausgeputzte Gesellschaft ganz still wurde, sich zu mir umdrehte, mir zusah und mich leise zu beschimpfen begann.
Dann läßt mir der König aufhelfen, mich zu ihm bringen und vor all den eifersüchtigen Herren und ihren ekelhaften Frauen auf seinen Schoß setzen. Er reicht mir seinen eigenen Wasserkelch und macht viel Aufhebens um mich, indem er mich auf Gesicht und Schultern küßt, um aller Welt zu demonstrieren, daß sie sich, egal, was ich tue, nicht gegen mich verschwören können, um meine Verbannung zu erreichen, weil ich die Gemahlin des Königs bin (wenn ich auch nicht den Titel einer Königin von Dänemark habe) und er mich noch immer abgöttisch liebt.
Das läßt mich kühne Überlegungen anstellen. Ich frage mich, was ich mir erlauben kann – wie weit ich es mit meiner Lasterhaftigkeit treiben kann –, ohne meinen Verbleib hier in Kopenhagen und in den Palästen sowie meine ganzen Privilegien aufs Spiel zu setzen. Ich spekuliere darüber, was meine Vertreibung zur Folge haben würde, und komme zu dem Schluß, daß wahrscheinlich nichts, was ich tun oder sagen könnte, dazu führen würde.
Daher gehe ich noch einen Schritt weiter und frage mich, ob ich nicht die Heimlichtuerei und Verstohlenheit bei meiner Liebesaffäre mit dem Grafen Otto Ludwig von Salm beenden und aus meiner Leidenschaft für ihn kein Hehl mehr machen sollte, so daß ich mit ihm schlafen könnte, wann und wo es mir beliebt. Denn warum sollte ich, der der Titel einer Königin nie zuerkannt wurde, nicht einen Liebhaber haben? Und außerdem finde ich, daß ich dem König, meinen Frauen und selbst meinen Kindern gegenüber viel freundlicher bin, wenn ich ein paar Stunden mit meinem wunderbaren deutschen Mann verbracht habe und er mir das gegeben hat, was ich so dringend brauche und ohne das ich wirklich nicht leben kann. Doch diese Freundlichkeit hält immer nur ein paar Stunden, höchstens einen einzigen Tag an, und dann werde ich wieder unleidlich. Daraus folgt, daß ich, wenn ich den Grafen jeden Tag oder jede Nacht sehen und mit ihm etwas Spaß haben könnte, immer und ewig freundlich und liebenswürdig gegenüber jedermann wäre, so daß unser aller Leben viel besser wäre.
Doch kann ich es wagen, meine Liebe zu Otto einzugestehen? Leider wohl nicht, wenn ich so darüber nachdenke. Er war ein tapferer Söldner, der in den jüngsten Kriegen an der Seite meines Gemahls gegen die Katholische Liga gekämpft und sein Leben für die dänische Sache aufs Spiel gesetzt hat. Er ist ein Held und wird vom König sehr geschätzt. Einem solchen Mann sollte man geben, worum er bittet und was er sich wünscht. Ich glaube aber, daß Männer einander nur Besitztümer abtreten, deren sie überdrüssig sind und die sie nicht wirklich lieben. Wenn man sie um etwas bittet, worauf sie großen Wert legen, dann weigern sie sich und geraten sofort in Zorn. Und genau das wäre der Fall, wenn ich jetzt vorschlagen würde, meinem Liebhaber Zugang zu meinem Bett zu gewähren. Daraus schließe ich, daß das, was meine kühnen Gedanken darüber, worum ich bitten könnte, erweckt hat – nämlich die Liebe des Königs zu mir –, mich gleichzeitig daran hindert, es auch zu tun.
Daher bleibt nur ein Weg. Ich muß es so einrichten, daß König Christian mir gegenüber nach und nach in einen Zustand der Gleichgültigkeit verfällt – von Tag zu Tag und Grausamkeit zu Grausamkeit mehr. Ich muß es so bewerkstelligen, daß mein Gemahl spätestens in einem Jahr von mir weder von Rechts wegen noch seiner Neigung nach irgend etwas Mäuschenhaftes erhofft oder erwartet, und zwar solange wir beide leben.
DAS GESCHLOSSENE FENSTER
Dänemark ist ein nasses Königreich. Die Menschen bilden sich ein, das Land sei an den Schiffen der großen Marine befestigt. Sie stellen sich vor, die Felder und Wälder würden von zehn Meilen langen Trossen über Wasser gehalten.
Und die Meeresbrise trägt noch immer eine alte Geschichte durch die salzige Luft: die von der Geburt König Christians IV. auf einer Insel mitten auf dem See von Schloß Frederiksborg.
Es heißt, König Frederik befand sich auf Elsinore. Es heißt ferner, Königin Sofie habe sich, als sie noch jung war und es sich noch nicht zur Gewohnheit gemacht hatte, zu schelten, zu fluchen und Geld anzuhäufen, oft in einem kleinen Boot zu dieser Insel rudern lassen, um dort in der Sonne zu sitzen und heimlich ihrer Strickleidenschaft zu frönen. Stricken war im ganzen Land verboten, weil man glaubte, es würde die Frauen in einen Zustand untätiger Trance versetzen, in dem ihre eigentlichen Gedanken davonflogen und der Phantasie Platz machten. Die Männer sprachen von »Wollträumereien«. Daß aus der Wolle nützliche kleine Bekleidungsstücke wie Strümpfe und Nachthauben entstanden, ließ ihre abergläubische Angst vor dem Strickwahn nicht geringer werden. Sie glaubten, jede gestrickte Nachthaube enthalte zwischen den Millionen Maschen die Sehnsüchte ihrer Frauen, die sie niemals befriedigen könnten und die ihnen daher düsterste Alpträume verursachten. Den gestrickten Strumpf fürchteten sie sogar noch mehr, weil sie in ihm ein Instrument ihrer eigenen Schwächung sahen. Sie stellten sich vor, wie ihre Füße anschwollen und die Beinmuskeln allmählich verkümmerten.
Königin Sofie hatte von Anfang an gegen das Strickverbot verstoßen. Das Garn wurde ihr per Schiff aus England in Kisten mit der Aufschrift »Gänsedaunen« geschickt. Hinter ihrem Ebenholzschrank versteckte sie zahlreiche weiche Kleidungsstücke in vielen Farben, für die sie, wie sie wußte, eines Tages Verwendung finden würde. Nur ihre Zofe Elizabeth kannte ihr Geheimnis, und dieser hatte sie gesagt, sie müsse es mit dem Leben bezahlen, wenn es je gelüftet würde.
Am Morgen des 12. April 1577, einem Tag mit blasser Sonne und zartblauem Himmel, machte sich die seit achteinhalb Monaten mit ihrem dritten Kind schwangere Königin Sofie um neun Uhr mit Elizabeth auf den Weg über den See, um zu stricken. Ihr Platz war eine Waldlichtung mit ein paar schattenspendenden Haselnußsträuchern und Heckenrosen, wo sie Kissen ins moosige Gras legte. Hier saß sie und strickte die letzten Maschen einer Unterhose, während Elizabeth an einer Socke arbeitete und die zwischen ihnen liegenden Garnrollen immer kleiner wurden, als die Königin plötzlich quälenden Durst verspürte. Da sie außer einer Holzkiste mit dem geheimen Strickzeug nichts mitgebracht hatten, bat Königin Sofie Elizabeth, zum Schloß zurückzurudern und einen Krug Bier zu holen.
Während die Zofe weg war, setzten bei der Königin die Wehen ein – ein Schmerz, der ihr seit den Geburten ihrer beiden Töchter so vertraut war, daß sie ihm kaum Beachtung schenkte, weil sie wußte, daß es noch lange dauern würde. Sie strickte weiter. Sie hielt die Unterhose ans Licht, um festzustellen, ob Maschen gefallen waren. Der Schmerz kam wieder, und diesmal war er so heftig, daß Sofie das Strickzeug beiseite legte und sich auf den Kissen ausstreckte. Noch immer dachte sie, bis zur Geburt viele Stunden vor sich zu haben, doch Christian – so heißt es in der alten Geschichte – wußte schon, bevor er auf die Welt kam, daß ihn Dänemark brauchte, daß das Königreich abdriftete, weil es auf Gedeih und Verderb den Polarwinden und dem Haß der Schweden auf der anderen Seite des Kattegats ausgeliefert war, und daß nur er genügend Schiffe bauen konnte, um es fest zu verankern und zu beschützen. Daher versuchte er mit ganzer Kraft, so schnell wie möglich das Licht der Welt zu erblicken. Er strampelte und plagte sich in den Gewässern seiner Mutter und machte sich dann kopfüber auf den Weg zu dem engen Kanal, der ihn in die klare, nach Meer schmeckende Luft hinausführen würde.
Als Elizabeth mit dem Krug Bier zurückkam, war er schon auf der Welt. Königin Sofie hatte die Nabelschnur mit einem Dorn durchtrennt und den kleinen Jungen in ihr Strickzeug gewickelt.
Die Geschichte geht noch weiter. Keiner kann sagen, was wahr ist, was hinzugefügt oder weggelassen wurde. Nur die Königinwitwe Sofie weiß es, ist es doch ihre Geschichte. Sie gehört nicht zu den Frauen, die verschenken, was ihnen gehört.
Es wird erzählt, die zu jener Zeit in Dänemark geborenen Kinder seien der Gefahr des Teufels ausgesetzt gewesen. Dieser sei von den unerbittlichen Lutheranern aus den Kirchen vertrieben worden und versuche sich nun in ungetauften Seelen einzunisten. So fliegt er nachts auf der Suche nach Muttermilch schnüffelnd durch die dichtbesiedelten Städte. Findet er welche, huscht er unbemerkt durchs Fenster ins Zimmer des Säuglings und versteckt sich in der Dunkelheit unter der Wiege, bis die Amme eingeschlafen ist. Dann streckt er seinen langen, dünnen Arm aus und verschafft sich mit seinen fadenförmigen Fingern durch die kleinen Nasenlöcher Zugang zum Gehirn des Kindes, in dessen Innern wie das Schuppenblatt eines Kiefernzapfens die Seele liegt. Diese nimmt er zwischen Zeigefinger und Daumen, zieht unendlich vorsichtig seine vom Eindringen ins lebende Organ schlüpfrige Hand zurück, und wenn er die Seele herausgezogen hat, steckt er sie sich in den Mund und saugt sie aus, bis er von einem Schauder der Ekstase und Freude gepackt wird, der ihn für mehrere Minuten erschöpft.
Gelegentlich wird er dabei gestört. Manchmal wacht die Amme auf, schnuppert, macht eine Lampe an und tritt gerade in dem Augenblick an die Wiege, wenn die Seele herauskommt. Dann muß der Teufel sie fallen lassen und fliehen. Die Seele wird, wo immer sie landet, von der umgebenden Materie geschluckt und bleibt für immer an diesem Ort. Fällt sie in die Falten einer Decke, verharrt sie dort, so daß es damals sehr viele Kinder gab, die ganz ohne Seele aufwuchsen. Wenn sie dem Kind auf den Magen sinkt, läßt sie sich da nieder, so daß das Kind für immer und ewig von dem Gedanken besessen ist, das Fleisch seiner hungrigen Seele ernähren zu müssen, und so fettleibig wird, daß es schließlich zum Herztod führt. Am schlimmsten sei es, sagten die Frauen, wenn die Seele auf die Genitalien eines kleinen Knaben falle. Denn dann wird das Kind ein teuflisch lüsterner Mann, der eines Tages seine Frau, seine Kinder und alle anderen, die ihm hätten teuer sein sollen, betrügt, nur um die Sehnsucht seiner Seele nach Beischlaf zu befriedigen. Derart ruchlos verhält er sich im Laufe seines Lebens gegenüber mehr als tausend Frauen und Knaben, ja sogar gegenüber seinen eigenen Töchtern oder den bemitleidenswerten Tieren im Haus und auf dem Feld.
Königin Sofie wußte, daß sie es nicht zulassen durfte, daß die Seele ihres Sohnes vom Teufel gestohlen wurde. Nachdem sie mit dem Kind über den See gerudert und es gewaschen und in die Wiege gelegt worden war (die blutbefleckte gestrickte Unterhose hatte sie rasch ins Feuer geworfen), habe sie angeordnet, das Zimmerfenster trotz des herrlichen Aprilmorgens zu schließen und so zu verriegeln, daß es Tag und Nacht nicht geöffnet werden konnte. Die Amme habe eingewandt, der kleine Prinz werde ersticken, doch die Königin habe sich nicht erweichen lassen. So sei dieses eine Fenster im Schloß die sechs Wochen bis zur Taufe des Kindes am 2. Juni in der Frue Kirke geschlossen geblieben.
Manchmal geht der König zu dem Zimmer, in dem er als Kind lag, und blickt auf dieses Fenster oder den dunklen Nachthimmel dahinter, und da er sich im Besitz seiner Seele weiß, dankt er Gott, daß der Teufel nicht hereinkonnte, um sie zu stehlen.
Ebenso wird berichtet, daß König Frederik II. und Königin Sofie zu jener Zeit auch den großen Astronomen Tycho Brahe kommen ließen, ihm ihren Sohn und Erben Christian vorstellten und darum baten, Vorhersagen für das Leben des künftigen Königs zu treffen. Tycho Brahe befragte die Sterne. Er fand Jupiter im Aszendenten und sagte dem König und der Königin, der Knabe werde ein fruchtbares Leben führen und auf der ganzen Welt zu Ehren und Würden kommen. Er warnte nur vor einem: Im Jahr 1630, dem Jahr nach Christians zweiundfünfzigstem Geburtstag, werde es Probleme und Gefahren geben.
DIE FALLTÜR
Es schneit auf Rosenborg. Zuerst fiel der Schnee in Nordjütland, und nun trägt ihn der eisige Wind in Richtung Süden.
Peter Claire wacht in seinem harten Bett auf und erinnert sich, daß er in Dänemark ist und seinen ersten Tag im Königlichen Orchester vor sich hat. Er hat nur drei Stunden geschlafen, und die Bangigkeit, die seine Ankunft begleitete, scheint bei Anbruch des neuen Tages kaum geringer geworden zu sein. Er steht auf und blickt aus dem Fenster in den Hof, wo der Schnee allmählich die Kopfsteine bedeckt. Böig und stiebend fallen die Flocken, und er fragt sich, wie lange der dänische Winter in diesem Jahr wohl dauern wird.
Heißes Wasser wird gebracht. Er rasiert sich und wäscht sich den Schmutz der Seereise von der Haut – angetrockneten Schweiß, Salz, Teerflecken und öligen Dreck. Er zittert dabei, weil es in dem Raum über den Ställen sehr kalt ist. Dann zieht er saubere Kleider und schwarze Lederstiefel aus der irischen Stadt Corcaigh an. Er kämmt sich das blonde Haar und steckt sich den juwelenbesetzten Ring ins Ohr.
Den Musikern wird in einem Speisesaal heiße Milch und warmes Zimtbrot serviert. Die dort bereits anwesenden Männer, die sich die Hände an ihren Milchschalen wärmen, drehen sich bei Peter Claires Eintreten um und mustern ihn: Es sind acht oder neun unterschiedlichen Alters, die meisten jedoch älter als er, und alle tragen sie dezente Anzüge aus schwarzem oder braunem Stoff. Er verneigt sich vor ihnen, und als er seinen Namen nennt, erhebt sich ein älterer Mann mit einer weißen Haartolle, der etwas abseits von den anderen sitzt, und kommt auf ihn zu. »Herr Claire«, sagt er, »ich bin Jens Ingemann, der Musikmeister. Seid willkommen auf Rosenborg! Hier, trinkt Eure Milch, und dann zeige ich Euch die Räume, in denen wir spielen!«
Der König ist auf der Jagd. Es gehört zu Seiner Majestät größten Freuden, durch die Wälder zu reiten und im fallenden Schnee die Witterung eines Keilers aufzunehmen. »Ihr werdet sehen«, sagt Jens Ingemann zu Peter Claire, »daß er völlig verzückt und ausgehungert zurückkommt und uns dann auffordert, ihm beim Essen vorzuspielen. Er glaubt, daß bestimmte Musikstücke beim Verdauen helfen.«
Sie befinden sich im Vinterstue, dem dunklen Raum, wo am Abend zuvor die Lampe angezündet worden war. Im Tageslicht sieht Peter Claire nun, daß das, was er an den Wänden für schlichte Holztäfelung hielt, in Wirklichkeit goldgerahmte Ölgemälde mit Waldszenen und Meeresansichten sind und daß die Decke mit prunkvollem, gold und blau bemaltem Stuck verziert ist. In einer Ecke des Raums stehen mehrere Notenständer.
»Nun«, meint Jens Ingemann, »hier spielen wir manchmal. Das sind dann gute Tage, doch sie sind selten. Seht Euch im Zimmer um und sagt mir, ob Euch darin nicht etwas Ungewöhnliches auffällt.«
Peter Claire bemerkt einen schönen, mit dem königlichen Wappen geschmückten Marmorkamin, die silbernen Löwen, die er schon bei seiner Ankunft gesehen hat, einen Thron, dessen Polster mit dunkelrotem Brokat bezogen sind, zwei Eichentische, mehrere Stühle und Schemel, eine Reihe Bronzebüsten, ein paar schwere Kerzenständer und ein Schiffsmodell aus Elfenbein.
»Nun?« fragt Jens. »Nichts Unerwartetes?«
»Nein …«
»Also gut! Gehen wir weiter! Folgt mir!«
Sie gehen in die Halle hinaus und wenden sich nach links in einen Steingang. Gleich darauf öffnet Jens Ingemann eine schwere, eisenbeschlagene Tür. Peter Claires Blick fällt auf Stufen, die in einer engen Kurve nach unten führen.
»Es ist dunkel auf der Treppe«, sagt Jens. »Paßt auf, daß Ihr nicht stolpert!«
Die Treppe verläuft um eine mächtige Steinsäule herum und endet in einem niedrigen Tunnel. Jens Ingemann eilt ihn entlang, auf ein fernes, flackerndes Licht zu. Als sie aus dem Tunnel kommen, findet sich Peter Claire in einem großen Kellergewölbe wieder, das von zwei an die Wände genagelten Eisenleuchtern erhellt wird. Es riecht nach Harz und Wein, und nun kann man auch Hunderte von Fässern sehen, die wie Miniaturschiffe im Trockendock auf gebogten Holzstützen liegen.
Jens Ingemann geht langsam weiter, seine Schritte hallen auf dem Steinboden leicht wider. Dann dreht er sich um und deutet auf ein freies Stück zwischen den aufgereihten Fässern. »Da wären wir!« sagt er. »Hier ist es!«
»Der Weinkeller!«
»Ja. Es gibt hier Wein. Und in einem Käfig dort drüben ein paar arme Hennen, die noch nie die Sonne oder etwas Grünes gesehen haben. Merkt Ihr, wie kalt es ist?«
»Nichts Ungewöhnliches für einen Keller!«
»Ihr werdet Euch daran gewöhnen? Wollt Ihr das damit sagen?«
»Mich daran gewöhnen?«
»Ja.«
»Nun, ich glaube nicht, daß ich hier unten viel Zeit verbringen werde. Ich bin nicht gerade ein Kenner von …«
»Die ganze Zeit!«
»Verzeiht, Herr Ingemann …«
»Natürlich hat Euch Seine Majestät das nicht gesagt! Niemand hat es Euch gesagt, weil Ihr sonst vielleicht nicht gekommen wärt. Das hier ist unsere Wirkungsstätte. Hier spielen wir – abgesehen von ein paar kostbaren Tagen, an denen wir ins Vinterstue hochgerufen werden.«
Peter Claire schaut Jens Ingemann ungläubig an. »Was für einen Sinn ergibt ein Orchester im Keller? Niemand kann uns hören!«
»Oh«, meint Ingemann, »es ist genial. Es soll nichts dergleichen sonstwo in Europa geben. Ich habe Euch gefragt, ob Ihr im Vinterstue nicht etwas Ungewöhnliches seht. Habt Ihr nicht die beiden am Boden befestigten Eisenringe bemerkt?«
»Nein.«
»Ich weiß jetzt nicht, ob die Seile daran befestigt waren. Wahrscheinlich nicht, sonst wären sie Euch aufgefallen. Nun, seht Ihr, wir sind direkt unter dem Vinterstue. Nicht weit vom Thron entfernt kann man mit Hilfe der Seile ein Stück Boden anheben und wieder absenken. Unter dieser Falltür ist ein Gitter, und wiederum darunter sind einige Messingrohre angebracht, die in dieses Kellergewölbe hier führen. Diese Rohre sind fast selbst Musikinstrumente. Sie haben so ausgeklügelte Kurven und Verengungen, daß die Klänge, die wir hier unten erzeugen, unverzerrt nach oben gelangen. Die Gäste des Königs rätseln dann immer, woher die Musik kommt und ob auf Rosenborg Musiker früherer Zeiten herumgeistern.«
Jens Ingemann ist beim Sprechen weitergegangen, doch Peter Claire ist stehengeblieben und schaut sich um. Er erkennt, daß die Leuchter nicht die einzige Lichtquelle in dem Keller sind, sondern zwei schmale Öffnungen in der Wand zum Garten direkt oberhalb des Bodens führen. Es handelt sich nicht um Fenster, sondern lediglich um Schlitze in der Mauer, die Luft einlassen. Als Peter Claire jetzt dorthin blickt, sieht er ein paar Schneeflocken hereindrängen, als wären sie ein fehlgeleiteter Schwarm Sommermücken.
Ingemann kann seine Gedanken lesen. »Sicher denkt Ihr, daß wir es hier unten wärmer hätten, wenn der Raum nicht nach außen offen wäre, und darin stimmen wir natürlich alle mit Euch überein. Ich habe den König persönlich darum gebeten, Bretter vor diese Öffnungen nageln zu lassen. Er weigert sich jedoch und meint, die Weinfässer müßten atmen können.«
»Und daß wir erfrieren ist ihm egal?«
»Manchmal denke ich, daß es ihn vielleicht dazu bewegen könnte, uns woanders unterzubringen, wenn einer von uns sterben würde. Es ist aber schwierig, dafür einen Freiwilligen zu finden.«
»Und wie sollen wir uns konzentrieren, wenn wir so frieren?«
»Es wird von uns erwartet, daß wir uns daran gewöhnen. Und vielleicht überrascht Euch das: Wir tun es tatsächlich. Am schlimmsten ist es für die Südländer in unserer kleinen Gruppe, für Signor Rugieri und Signor Martinelli. Die Deutschen, Holländer, Engländer und natürlich die Dänen und Norweger überleben einigermaßen. Ihr werdet es ja sehen.«
KNÖPFE
Nach der Taufe wurde der kleine Christian seiner Mutter weggenommen.
Es war seinerzeit üblich, Säuglinge einer älteren Frau anzuvertrauen – gewöhnlich der Großmutter mütterlicherseits –, weil man glaubte, ältere Frauen, die sich schon länger ihrer eigenen Sterblichkeit widersetzten, verstünden es besser als ihre Abkömmlinge, den Tod vom Kind fernzuhalten.
Königin Sofie fand Trost bei ihren beiden Töchtern und dem ungesetzlichen Stricken. Dennoch wird vermutet, daß ihre Streitsucht und ihr Verlangen, heimlich ein großes eigenes Vermögen anzuhäufen, auf diese Zeit zurückgehen, in der sie ihres kleinen Sohnes beraubt wurde, den sie abgöttisch liebte.
Prinz Christians kleines Leben wurde in die Obhut seiner Großmutter, der Herzogin Elisabeth von Mecklenburg, im deutschen Güstrow gegeben. Diese betraute zwei junge Trompeter damit, abwechselnd vor der Tür des Prinzen Stellung zu beziehen. Wenn das Kind schrie, mußten sie trompeten, dann kam die Herzogin oder eine ihrer Frauen angerannt. Es war ihr einerlei, daß das Trompeten den ganzen Haushalt störte. »Wichtig ist nur«, sagte sie ungeduldig, »daß dem Knaben nichts zustößt. Alles andere ist belanglos.«
Christian wurde ein Holzstock in die Windeln gelegt, weil er einen geraden Rücken und gerade Gliedmaßen bekommen sollte. Er schrie Tag und Nacht, und die Trompeter bliesen. Als eine der Frauen vorschlug, den Stock zu entfernen, bezichtigte sie die unerbittliche Herzogin der Verhätschelung und Sentimentalität. Sie beaufsichtigte jedoch in ihrer eigenen Küche die Herstellung einer Salbe aus Schwarzwurzblättern zum Heilen der zarten, vom Stock wundgescheuerten Haut. Und als der Prinz seine Milchzähne bekam, ordnete sie an, den Kiefer nicht einzuschneiden, sondern abzuwarten, bis dieser »von allein durchstoßen wird wie der Erdboden im Frühjahr von den blassen Schnäuzchen der ersten Blumen«.
Als die Windeln allmählich gelockert wurden, so daß sich die kräftigen Beinchen bewegen und strampeln und die dicken Händchen die Gegenstände in Reichweite erforschen konnten, nahm die Herzogin das Kind oft auf den Schoß und redete mit ihm. Sie sprach dann Deutsch. Sie erzählte ihm, wie alles im Himmel und auf Erden eingerichtet war, mit Gott und seinen Heiligen hoch oben im weiten Blau des Himmels und seinen zwischen den weißen Wolken schwebenden Engeln. »Siehst du«, erklärte sie ihm, »weil Dänemark wegen seiner tausend Seen ein so nasses Königreich ist, spiegelt sich der Himmel dort öfter als anderswo auf Erden. Die Menschen sehen diese Spiegelungen und tragen sie im Herzen und lieben daher Gott und die Natur. Deshalb sind sie ruhig, so daß du sie, wenn du eines Tages König wirst, regieren und ihr Vertrauen gewinnen kannst.«
Während sie sprach, spielte er mit den Haarlocken am Ende ihrer Zöpfe. Und heute heißt es, der König habe etwas Seltsames gestanden: Er glaube, sich an die langen, goldenen Zöpfe seiner Großmutter, der Herzogin von Mecklenburg, erinnern zu können und reibe und liebkose daher seine eigene dünne Haarsträhne, seine heilige lange Locke, zwischen Zeigefinger und Daumen, wenn er aufgeregt sei; dieses Streicheln seines eigenen Haars beruhige und besänftige ihn. Es scheint jedoch niemand zu wissen, ob das stimmt, und falls es stimmt, wem er es gestanden hat. Vielleicht Kirsten. Oder Kirsten hat es erfunden.
Er fing sehr früh zu sprechen an, allerdings auf deutsch. Er hatte eine so laute Stimme, daß man sein Schreien noch zwei oder drei Räume weiter hören konnte. So wurde bald beschlossen, den Tagestrompeter zu entlassen, da man ihn nicht mehr benötigte. Der Nachttrompeter blieb. Herzogin Elisabeth fürchtete die Macht der Träume. Sie meinte, wenn man ein Kind nach einem Alptraum nicht tröstete, könnte es mit der Zeit nicht mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden und würde allmählich melancholisch.
Der Nachttrompeter bekam ein neues Instrument und neue Verhaltensmaßregeln. Er sollte, wenn Prinz Christian im Dunkeln schrie, nicht nur in die Trompete stoßen, sondern ein munteres Lied spielen, um die Ängste des Kindes zu vertreiben.
Auch das, heißt es, hat Christian niemals vergessen. Manchmal werden die Musiker um drei oder vier Uhr morgens aus ihren Betten über den Ställen geholt und zum Schlafzimmer des Königs zitiert, um dort Quadrillen und Capriccios zu spielen.
Mit drei Jahren wurde Christian, der mittlerweile ohne Unterlaß Deutsch sprach, das mit ein paar Brocken Französisch vermengt war, die er bei seinen Besuchen in der Wäscherei in Güstrow aufgefangen hatte, wo ihn die französischen Wäscherinnen in ihre heißen, dicken Arme genommen und ihm schmatzende Küsse auf die Wangen gegeben hatten, seinen Eltern König Frederik und Königin Sofie in Frederiksborg zurückgebracht. Erst jetzt sah er, daß auch seine Mutter lange, blonde Haare hatte.
Damit er nicht ununterbrochen redete, bekam er rote und schwarze Kreiden und wurde angehalten, die Dinge seiner Umgebung zu malen: Hunde und Katzen, Holzsoldaten, Statuen, Modellschiffe, Kaminbestecke, Brunnen, Wasserlilien, Bäume und Fische. Er beherrschte dies sehr schnell, und so wurde dem großen Plauderrepertoire dieser kleinen Person noch ein weiteres Gesprächsthema hinzugefügt: seine Bilder. Niemand durfte sich diesem entziehen. Wenn hohe Herrschaften zu Besuch waren, mußten sie sich viele Blätter mit scharlachroten Soldaten und kohlrabenschwarzen Bäumen ansehen und sich dazu äußern. So wurde der König von Frankreich während eines prunkvollen Staatsbesuchs zu seiner Belustigung (in seiner Sprache) mit den Worten angesprochen: »Das ist ein Bild von Nils, meinem Kater. Finden Euer Majestät, daß er gut getroffen ist?«
»Nun«, antwortete König Ludwig, »wo ist der Kater? Hol ihn, damit ich es beurteilen kann.«
Doch der Kater Nils war nirgends aufzufinden. Die Diener riefen ihn stundenlang von den Toren aus und überall in den Gemüsegärten, doch er tauchte nicht auf. Dann spürte Seine Majestät, der König von Frankreich, plötzlich, wie ihn jemand am bestickten Ärmel zupfte. Neben ihm stand im Nachthemd Prinz Christian, im Arm seinen Kater, der ein blaues Satinband um den Hals trug. »Hier ist Nils!« verkündete der Knabe triumphierend.
»Ach ja, doch nun fehlt mir leider dein Bild!« sagte König Ludwig.
»Das braucht Ihr nicht!« antwortete der kleine Prinz. »Könige erinnern sich an alles. Das sagt mein Vater immer.«
»O ja, nur zu wahr!« erwiderte König Ludwig. »Ich hatte vergessen, daß wir uns an alles erinnern, doch jetzt erinnere ich mich wieder daran. Na, dann wollen wir doch mal sehen …« Er nahm dem Knaben Nils aus der Hand, legte ihn zwischen einer Obstschale und einem Weinkrug auf den Tisch und streichelte ihn, während die versammelten hohen Damen und Herren nachsichtig lächelten.
»Ich meine«, sagte der König von Frankreich, »daß du ihn hübsch und genau getroffen hast, bis auf eins!«
»Bis auf was?« fragte der Knabe.
»Dein Bild schnurrt nicht!«
Die Gäste der Abendgesellschaft lachten laut über diesen Scherz.
In jener Nacht ging dem Prinzen Christian die Bemerkung des Königs von Frankreich nicht aus dem Kopf. Da er allein war, öffnete er seine Zimmertür und fragte den Trompeter, ob er wisse, wie man ein Bild male, das Töne von sich gebe.
»Habt Ihr geträumt, Euer Hoheit?« fragte der junge Mann besorgt. »Soll ich eine Gigue spielen?«
Im Alter von sechs Jahren begann Christian, mit dem König und der Königin im Land herumzureisen.
Er sprach jetzt Dänisch, ohne aber sein Deutsch oder Französisch vergessen zu haben. Er schien ein erstaunliches Gedächtnis für alles auf Erden zu haben.
Sie reisten hauptsächlich aus zwei Gründen: Zum einen wollte der König die Zölle und Abgaben in den Lehen und Städten der Krone im Guten eintreiben, zum anderen wollte er sich dort frei bewegen und die Handels- und Werkstätten besuchen, um sicherzustellen, daß alle ordentliche Arbeit leisteten und Waren guter Qualität lieferten. Er sagte zu seinem Sohn: »Es gibt da etwas, was wir in Dänemark ausmerzen müssen, wenn wir stolz sein und mit der ganzen Welt Handel treiben wollen. Und das ist Schludrigkeit.«
Anfangs verstand der Knabe nicht den Sinn dieses Wortes, doch dann wurde er ihm von seiner Mutter erklärt: »Wenn du feststellst«, sagte sie, »daß die Schnallen deiner Schuhe verschieden groß sind, obwohl sie eigentlich gleich groß sein sollten, schließt du daraus, daß derjenige, der sie angefertigt hat, ein nachlässiger Handwerker ist. Und das nennen wir ›Schludrigkeit‹. Man kann es dir dann nicht übelnehmen, wenn du dir die Schnallen von den Schuhen reißt oder die Schuhe sogar ganz wegwirfst. Wir brauchen hier Vollkommenheit, weißt du. In allem, was wir herstellen, und in allem, was wir tun, stehen wir mit Frankreich, den Niederlanden und England im Wettstreit. Wenn du dereinst König bist, mußt du in allem Schludrigen eine Beleidigung unseres Namens sehen und die Schuldigen bestrafen. Verstehst du das?«
Christian sagte, er verstehe dies, und schon bald glaubte er, seine Eltern hätten ihm das erklärt, weil ihm selbst dabei eine wichtige Aufgabe zufiel. Denn immer wenn er nun mit seinem Vater in eine Werkstatt kam, sei es in die eines Handschuhmachers, Schusters, Brauers, Steinhauers, Zimmermanns oder Kerzenmachers, stellte er fest, daß er gerade die richtige Größe hatte, um über die Werkbänke zu blicken und so die zur Ansicht ausgelegten Gegenstände aus nächster Nähe und von der Seite zu besichtigen – eine Perspektive, die nur er hatte. Alle anderen nahmen sie von oben wahr, er jedoch befand sich auf gleicher Höhe. Er betrachtete sie, und sie sahen ihn an. Und sein Auge, das eines Zeichners, war so scharf wie eine neugeprägte Münze: ständig richtete es aus, paßte an und maß. Es entdeckte die kleinsten Fehler: die losen Fäden eines Seidenballens; den verlaufenen Rand eines Emailpokals; die ungleichmäßigen Beschläge eines Lederkoffers; den nicht genau passenden Deckel einer Kiste. Und dann rief er, völlig unbeeindruckt vom Unbehagen im Gesicht des Handwerkers oder Händlers, seinen Vater, den König, zu sich, machte ihn auf die Unvollkommenheit, die niemand außer ihm bemerkt hatte, aufmerksam und flüsterte feierlich: »Schludrigkeit, Papa!«
Eines Tages besuchte die königliche Gesellschaft in Odense einen Knopfmacher, den der König schon von klein auf kannte. Der alte Mann begrüßte den jungen Prinzen überschwenglich und voller Zuneigung und legte ihm sofort einen Sack Knöpfe in die Hände. Es waren Knöpfe aus Silber und Gold, Glas, Zinn, Knochen und Schildpatt, es gab welche aus Eisen, Messing, Kupfer, Leder, Elfenbein und Perlmutt. Christian war ganz hingerissen von diesem Geschenk. Seine Hand hineinzutauchen und die vielen Knöpfe durch die Finger gleiten und purzeln zu lassen erweckte in ihm ein bebendes Gefühl ungetrübter Freude.
Als er in jener Nacht zu seiner Unterkunft in Odense zurückgekehrt war, zu Abend gegessen hatte und sich nun allein in seinem Zimmer befand, stellte er eine Lampe auf den Boden und schüttete den Inhalt des Knopfsacks im Lichtkegel aus. Die Knöpfe glitzerten und glänzten. Er bückte sich und schob sie langsam mit den Fingerspitzen hin und her. Dann kniete er vor ihnen nieder und legte sein Gesicht hinein, so daß er ihre kalten, glatten Oberflächen an der Wange fühlte. Es war das schönste Geschenk, das er je bekommen hatte.
Erst am nächsten Morgen erinnerte sich Christian wieder an den heiligen Befehl des Königs, was Schludrigkeit anging. So breitete er nun im kalten, weißen Licht des in Odense heraufdämmernden Oktobertags die Knöpfe in einem weiten Bogen auf dem Boden aus, drehte geduldig jeden einzelnen um, der nicht mit der Vorderseite nach oben lag, und machte sich daran, sie zu überprüfen.
Er war erschüttert. Auf jeden perfekten Knopf – der einen glatten Rand hatte, gleichmäßig poliert war, weder einen Sprung noch eine Kerbe aufwies und symmetrische Knopflöcher besaß – kamen vier, fünf oder sogar sechs Knöpfe, die offensichtlich und unleugbar Fehler aufwiesen. Er war traurig. Die Knöpfe schienen ihn flehend anzuschauen, ihn zu bitten, ihre jeweiligen Unvollkommenheiten zu übersehen. Doch er kümmerte sich nicht um ihr sentimentales Flehen. Man hatte ihm gesagt, die Zukunft Dänemarks hänge vom Ausmerzen schludriger Arbeit ab, und er hatte seinem Vater versprochen, sie mit der Wurzel auszureißen, wo und wann immer sie entdeckt wurde. Hier hatte er sie nun entdeckt und würde dementsprechend handeln.
Er legte alle fehlerhaften Knöpfe auf einen Haufen, rief einen Diener und ließ sie fortschaffen. Später einmal würde er dem König berichten, daß der alte Knopfmacher ausgesprochen schlechte Arbeit leistete, und vorschlagen, ihm seinen Lebensunterhalt zu entziehen.
Als Prinz Christian ein paar Tage später wieder auf Rosenborg war, nahm er den Knopfsack (der jetzt nur noch perfekte Knöpfe enthielt) aus dem Koffer und steckte seine Hand hinein. Da es nur noch wenige Knöpfe waren, stellte sich diesmal das Glücksgefühl, das er beim erstenmal empfunden hatte, nicht ein. Es war nicht mehr das schönste Geschenk, das er je bekommen hatte, sondern etwas ohne jede Bedeutung. Schon bald legte er den Sack wieder beiseite.
Er mußte jedoch noch oft daran denken. Es verwirrte ihn. Er kam nicht hinter das Geheimnis. Er wußte, daß er nur einen Sack unvollkommener Dinge bekommen hatte, und dennoch war er davon geblendet und entzückt gewesen. Er hatte die Knöpfe geliebt. Das bedeutete, daß er etwas Fehlerhaftes geliebt hatte, etwas, was eine Schande für Dänemark war. Er wußte, daß es für all dies eine Erklärung geben mußte, konnte sich aber einfach keine vorstellen.
KIRSTEN: AUS IHREN PRIVATEN PAPIEREN
Ein Geburtstagsgeschenk, das ich nicht erwähnt habe, weil es noch nicht eingetroffen ist, bekomme ich noch von meiner Mutter Ellen Marsvin: Sie schenkt mir eine Frau.
Sie möchten »Zofen« oder »Hofdamen« genannt werden, doch ich sehe nicht ein, warum dergleichen Titel Personen verliehen werden sollen, die in jeder Hinsicht unter mir stehen und nichts als bessere Diener sind. Daher bezeichne ich sie nur als meine Frauen. Natürlich haben sie Namen: Johanna, Vibeke, Anna, Frederika und Hansi. Doch diese fallen mir nicht immer ein, wenn ich sie brauche, so daß ich sage: »Frau, bring das weg!« oder: »Frau, mach die Tür zu!« oder welchen der tausendundein Befehle sonst ich ihnen täglich geben muß, von denen viele überflüssig wären, wenn sie weniger Zeit damit verbringen würden, sich wunderbare Ehrenbezeichnungen für sich selbst zu erträumen, und sich statt dessen mehr auf ihre jeweiligen Aufgaben konzentrieren würden.
Vor nicht allzu langer Zeit beschloß ich, die Pflichten meiner Frauen in neue Kategorien einzuteilen. Ich finde meine Neuordnung wirklich genial. Jede von ihnen muß jetzt die Verantwortung für einen bestimmten Teil meines Körpers übernehmen, wie zum Beispiel meine Hände, Beine, meinen Kopf, Leib und so weiter. So brauche ich sie alle, um korrekt gekleidet zu sein, wodurch ich geschickt verhindere, daß sie mir auch nur einen Tag nicht zu Diensten stehen. Dieser Zwang, den ich dadurch auf sie ausübe, bereitet mir große Befriedigung und heimlichen Spaß. Mein Leben ist durch Beschränkungen und die Ausübung bestimmter, mir sehr unangenehmer Rituale stark eingeengt, und ich sehe nicht ein, warum das Leben einfacher Frauen frei von diesen Dingen sein soll, wenn es meins nicht ist.
Als ich diese neue Einteilung der Pflichten meiner Mutter gegenüber erwähnte, fragte sie mich doch, obwohl sie es auch glänzend fand, ob ich nicht mehr Teile an mir hätte als Frauen. Ich antwortete, ich sei bei meiner Unterteilung logisch vorgegangen, und Johanna nenne sich nun Frau für den Kopf, Vibeke Frau für den Körper, Anna Frau für die Hände, Frederika Frau für den Rock und Hansi Frau für die Füße. (Diese Titel klingen nach Gildezugehörigkeiten, weshalb ich zu meinen Frauen sagte: »Bitte sehr! Ihr, die ihr so auf Titel aus seid, nehmt nun diese Bezeichnungen und seid glücklich damit!«)
Dann meinte meine Mutter: »Aber das ist nicht alles, was du bist, Kirsten – Beine und Hände und so weiter.« Womit sie natürlich meint, daß alle Sterblichen seltsam vielschichtige wunderbare Wesen sind und gewisse Bedürfnisse und Gefühle in uns nicht genau oder völlig den von mir aufgestellten Kategorien zugeordnet werden können, aber dennoch gelegentlich der Betreuung durch eine Frau bedürfen. Und so hatte meine Mutter die Idee, mir eine Universalfrau zu bezahlen, die vielleicht keinen Gildenamen bekommt und nicht einem bestimmten Teil von mir zugeordnet wird, aber dennoch bereit ist, mir jederzeit, Tag und Nacht, in allen Funktionen zu dienen.
Ich halte dies für eine gute Idee. Und heute hörte ich nun, daß eine solche Frau gefunden worden ist und nächste Woche aus Jütland zu mir kommt. Sie heißt Emilia.
Im Winter, wie jetzt, ist hier alles ekelhaft trostlos, und die Langeweile, die ich an gewissen Tagen verspüre, versetzt mich in eine solche Wut auf die Welt, daß ich am liebsten ein Mann und Soldat wie mein Geliebter wäre, um jemanden mit der Lanze angreifen zu können.
Gestern waren ein paar Besucher hier: zwei davon Botschafter aus England und der dritte ein Elefant. Die Botschafter waren kränklich aussehende Männer, die nichts Interessantes taten und kaum ein paar Worte Dänisch oder Deutsch sprachen. Der Elefant jedoch war sehr unterhaltsam. Er konnte in die Knie gehen und tanzen. Er kam mit einer Truppe Akrobaten, die sich auf seinen Rücken und Kopf stellten und an seinen Beinen hochkletterten. Ich sagte zum König: »Ich möchte auf dem Elefanten reiten!« Und so trugen mich die Akrobaten (die klein aussahen, aber sehr stark waren) hinauf und setzten mich auf den Elefanten. Ich schwankte eine Weile herum und fand es phantastisch so hoch oben, während sie den Elefanten in einem kleinen Kreis herumführten. Von allen Fenstern Rosenborgs aus wurde ich beobachtet.
Doch natürlich forderten meine Kinder, als sie mich auf dem Elefanten sahen, mit viel Getöse, auch auf ihm zu reiten. Ich verbot es strikt und ließ mich von ihrem Jammern und Flehen nicht erweichen. Das ist das Hauptproblem mit Kindern: Man kann nichts tun, ohne daß sie es auch tun wollen, und dieser Nachahmungstrieb geht mir derart auf die Nerven, daß ich behaupten möchte, ich wünschte, ich hätte überhaupt keine Kinder, weil ich mich über alles, was sie tun, ärgern muß und mich erst wieder beruhige, wenn ich weit weg von ihnen und im Bett des Grafen bin.
Doch leider bin ich dort schon lange nicht mehr gewesen, sondern nur in meinem eigenen, wo ich von dem anderen geträumt habe. Es ist traurig, allein zu sein, doch ich kann es ertragen, weil ich mich auf das nächste Treffen mit meinem Geliebten freue. Was ich nicht mehr ertragen kann, sind die Gattenbesuche des Königs, und ich habe mich nun entschlossen, diese auch nicht mehr zuzulassen. So zeterte und schrie ich, als er letzte Nacht in mein Zimmer und Bett kam und versuchte, mir die Hand auf die Brust zu legen und sich an mich zu pressen. Ich behauptete, meine Brustwarzen seien wundgescheuert und mein ganzer Körper lädiert und müde, so daß man ihn nicht berühren dürfe. Ich dachte, er würde protestieren, denn wenn Männer lüstern sind, kümmert es sie nicht, wenn sie einem weh tun, doch statt dessen ging der König sofort weg und sagte, ihm täten meine Beschwerden leid und er hoffe, sie würden bei ein wenig Ruhe verschwinden.
Er ahnt nicht, daß dies keine Ruhe zuwege bringen kann. Auch wenn ich bis zum Frühjahr schliefe, würden sich meine Gefühle für ihn nicht ändern, und alle meine Anstrengungen müssen jetzt darauf abzielen, ihn mir gegenüber gleichgültig zu machen.
Das ist alles, was ich will. Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß es mir egal ist, wenn er mich aus Kopenhagen wegschickt, ja sogar, wenn die Zahl meiner Frauen eingeschränkt wird. Es macht mir nichts aus, wenn ich meine Kinder nie wiedersehe. Meine Zukunft liegt beim Grafen. Nichts und niemand sonst auf Erden bereitet mir soviel Vergnügen und Freude.
DIE AUFGABE
Peter Claire und Jens Ingemann kehren zum Speisesaal zurück, um auf die ersten Tagesbefehle zu warten. Der junge Lautenist nimmt mit seinen eiskalten Händen noch eine Schale heiße Milch entgegen.
Die anderen Musiker stellen sich vor: Pasquier aus Frankreich, Flötist, die Italiener Rugieri und Martinelli, Violinisten, sowie Krenze aus Deutschland, ein Violaspieler. Pasquier macht die Bemerkung, er hoffe, Peter Claire werde nicht weglaufen.
»Weglaufen? Ich bin doch gerade erst gekommen!«
»Englische Musiker laufen gern weg«, sagt Pasquier. »Carolus Oralli, der Harfenist, und John Maynard – beide sind von diesem Hof weggelaufen.«
»Aber warum denn? Was veranlaßte sie dazu?«
Rugieri meldet sich zu Wort: »Ihr werdet sehen«, sagt er, »was für ein Leben wir hier führen, die meiste Zeit im Keller, im Dunkeln. Heute wird so ein Tag sein. Man kann es niemandem verübeln, wenn er sich nach Licht sehnt.«
»Mir macht die Dunkelheit eigentlich nichts aus«, meint leise lächelnd der Deutsche Krenze. »Ich glaube schon immer, daß das Leben nur eine Vorbereitung auf den Tod ist. Und bereite ich mich im Dunkeln und in der Kälte nicht besser darauf vor?«
»Krenze tut so, als mache es ihm nichts aus«, schaltet sich Rugieri ein. »Wir glauben ihm das aber nicht. Wenn ich im Schein der Lampen in unsere Gesichter sehe, fühle ich mich unserer Gruppe verbunden, verbunden durch Leiden, denn das ist es, was ich bei jedem einzelnen von uns wahrnehme. Das stimmt doch, nicht wahr, Martinelli?«
»Ja«, erwidert Martinelli. »Und wir schämen uns dessen nicht, weil wir wissen, daß selbst so große Männer wie Dowland diese Bedingungen schwierig fanden und er seine Rückkehr hinauszögerte, als er Urlaub hatte. Er gab vor, sein Schiff aus England habe wegen Sturm und Frost umkehren müssen. Er dachte daran, wie wir hier die Zeit verbringen …«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!