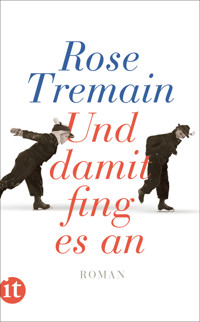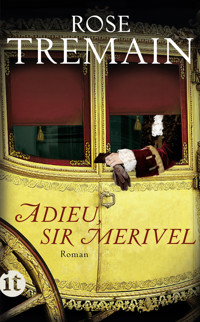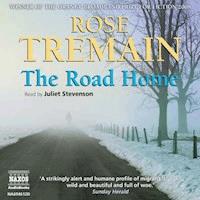9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Neuanfang soll es werden, als Harriet mit ihrem Mann Joseph im 19. Jahrhundert von England nach Neuseeland auswandert. Aber die erhoffte Liebe bleibt aus, genauso wie der Wohlstand, den sie sich erträumten. Als Joseph dem Goldfieber verfällt, bricht er Hals über Kopf auf und läßt seine Frau allein zurück. Doch Harriet gibt nicht auf und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Voller Abenteuerlust und Freiheitsdrang reist sie ihrem eigenen Traum entgegen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ein Neuanfang soll es werden, als Harriet mit ihrem Mann Joseph im 19. Jahrhundert von England nach Neuseeland auswandert. Aber die erhoffte Liebe bleibt aus, genauso wie der Wohlstand, den sie sich erträumten. Als Joseph dem Goldfieber verfällt, bricht er Hals über Kopf auf und lässt seine Frau allein zurück. Doch Harriet gibt nicht auf und nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Voller Abenteuerlust und Freiheitsdrang reist sie ihrem eigenen Traum entgegen ...
»In grau verschlammten, staubigen oder hitzeflirrenden Bildern, in heroisch leuchtenden, ausladenden Panoramen von großartiger Eindringlichkeit schildert Tremain die Weite, die Verlorenheit, die Furcht vor einer unverstandenen Natur. Die Schilderungen obskurer Topographien und lichtloser Abgründe zählen zu den metaphorischen Passagen eines an Realismus, aber eben auch an Empfindungsschattierungen und Fiebergesichtern reichen Romans.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Starke Charaktere, erzählerischer Reichtum und eine mitreißende Farbigkeit – der Stoff, aus dem die Träume sind.«
Norddeutscher Rundfunk
Rose Tremain ist eine erfolgreiche und vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Sie lebt in London und Norwich. Für ihren Bestseller Der weite Weg nach Hause (it 4037) erhielt sie 2008 den Orange Prize for Fiction. Zuletzt erschien ihr Roman Der unausweichliche Tag (st 4220).
ROSE TREMAIN
DIE FARBE DER TRÄUME
Roman
Aus dem Englischen vonChristel Dormagen
Insel Verlag
eBook Insel Verlag Berlin 2012
© Insel Verlag Berlin 2010
Die englische Originalausgabe The Colour erschien 2003 bei Chatto & Windus, London.
Copyright © Rose Tremain 2003
Umschlagfotos: Delphine Aures / laif; Susan Fox / Trevillion Images
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: bürosüd, München
eISBN 978-3-458-77470-9
www.insel-verlag.de
Für das Domino-Team,
in großer Liebe
Die Goldsuche bringt Unordnung in die Gesellschaft, zersetzt die Moral, hält von vernünftigeren Unternehmungen ab und ermuntert unerfreulicherweise den Abschaum aus China zur Einwanderung.
Lyttelton Times, Neuseeland 1861
Gold war einfach alles für uns.
West Coast Times, Neuseeland 1866
INHALT
ERSTER TEIL
Das Lehmhaus. 1864
Beautys Mantel
Die Orchard-Farm
Die Teedose aus China
Zwischen den weißen Steinen
Die Konservierung
Die Leine
Allerlei Geschäfte
D’Erlangers Hotel
ZWEITER TEIL
Der Aufsteiger
Ein sauberes, ordentliches Zimmer
Das zerrissene Bild
Tote Arbeit
Die Straße zum Taramakau
»Der kostbare Name eines Mannes«
Der weiße Wurm
Der Wald unter der Erde
Distanz
DRITTER TEIL
Zum Wasserfall
Die Macht der Träume
Zwischen zwei Welten
Die Flut
Der Glockenvogel singt
Zehn Meter Land
Paak Meis Gelächte
Häuser aus Holz
Danksagung
ERSTER TEIL
DAS LEHMHAUS. 1864
I
Die kältesten Winde kamen aus Süden, und das Lehmhaus stand diesen Winden im Weg.
Joseph Blackstone lag nachts wach. Er überlegte, ob er das Haus wieder auseinandernehmen und an einem anderen Ort, weiter unten im Tal, wo es geschützt stünde, wieder aufbauen sollte. Er zerlegte es im Geiste.
Und im Geiste errichtete er es neu im Windschatten eines sanften Hügels. Doch er sagte nichts und tat nichts. Es vergingen Tage und Wochen, und der Winter kam, und das Lehmhaus stand nach wie vor den verheerenden Winden im Weg.
Es war ihr erster Winter. Die Erde unter ihren Stiefeln war grau, das gelbe Tussockgras von Hagel wie mit Salz bestreut. Die violetten Nachmittagswolken versprachen ein großes Leichentuch aus Schnee.
Eine Haube gegen die Kälte des Raums auf dem Kopf, saß Josephs Mutter Lilian am Holztisch und reparierte Porzellan. Porzellan, das beim Transport aus England zerbrochen war. Aus Fahrlässigkeit, behauptete Lilian Blackstone, aus Ungeschick beim Ein- und Ausladen, aus Achtlosigkeit von Menschen, die nichts vom Wert persönlichen Eigentums verstanden. Joseph erinnerte sie sanft daran, dass man nicht durch die Welt reisen konnte – bis ganz an deren anderes Ende –, ohne dass unterwegs etwas kaputtging. »Etwas«, erwiderte Lilian empört. »Das hier ist sehr viel mehr als nur etwas.«
Ihr wütender Ton bestürzte ihn. Er betrachtete sie mit einer Furcht, die ihr bekannt vorkam. Sie schien völlig versunken in das Porzellan-Puzzle, fast als könne sie sich nicht mehr an die Form alltäglicher Gegenstände erinnern. Wie Buchstaben, die kein Wort ergeben wollten, schob sie die Teile hin und her. Nur ab und an sah sie, wie die Teile zusammenpassten, und wagte, eine Scherbe mit Klebstoff zu bestreichen. Dann drückte sie diese Scherbe mit fast übertrieben leidenschaftlichem Eifer an ihren Platz und bewegte dabei die Lippen, als spräche sie ein Gebet oder formte das einzige französische Wort, das sie kannte: voilà, was sie wie »wulla« aussprach. Und all das bestärkte Joseph nur in seiner Überzeugung: Er hatte seine Mutter nach Neuseeland gebracht, und er hatte sie enttäuscht, so wie er sie immer und immer wieder enttäuscht hatte. Sein ganzes Leben lang – so schien es ihm jedenfalls – hatte er versucht, ihr zu gefallen, aber er konnte sich an keinen einzigen Tag erinnern, an dem ihr sein Bemühen genügt hätte.
Doch jetzt hatte er eine Ehefrau.
Sie war hoch gewachsen, ihr Haar war braun, und sie hieß Harriet Salt. Lilian Blackstone hatte über sie gesagt: »Sie besitzt Haltung«, und Joseph fand diese Beobachtung zutreffend und scharfsichtiger, als Lilian ahnen konnte.
Er wandte den Blick von seiner Mutter und schaute voller Bewunderung zu dieser Frau, die vor dem unwilligen Feuer kniete und die jetzt sein war. Und plötzlich war sein Herz nur noch von tiefer Dankbarkeit und Zuneigung erfüllt. Er sah, wie sie still und geduldig den Blasebalg betätigte, mit »Haltung« selbst hier im Lehmhaus, um das der Wind toste; selbst hier in diesem kalten, verräucherten Zimmer, wo der Klebstoff roch wie eine strenge Medizin, zu der sie alle drei verurteilt waren. Am liebsten hätte Joseph Harriet umarmt und ihre Haare in seiner Hand zu einem Knoten geschlungen. Er hätte am liebsten den Kopf auf ihre Schulter gelegt und ihr gestanden, was er ihr nie würde gestehen können – dass sie ihm das Leben gerettet hatte.
II
Nach der Ankunft in Christchurch hatte Joseph sich um den Kauf der Baumaterialien für das Lehmhaus gekümmert, hatte Hilfskräfte eingestellt, Pferde und Wagen gemietet für den Transport von Blechen und Kiefernbrettern, Säcken mit Nägeln und Baumwollballen, bis endlich alles beisammen war und bereit für die Fahrt nach Nordwesten, zum Okuku-Fluss.
Harriet hatte ihren neuen Ehemann gebeten, er möge sie mitnehmen. Hatte sich an ihn geklammert und gefleht – sie, die niemals jammerte oder sich beklagte, die stets Haltung bewahrte. Doch sie war eine Frau, die sich nach dem Ungewohnten, dem Fremden sehnte. As Kind hatte sie dieses Andere in ihren Träumen gesehen und wie es in der ungeheuren Dunkelheit des Himmels auf sie wartete: eine wilde Welt, jenseits all dessen, was sie kannte. Und die Vorstellung, ein Haus aus Steinen und Erde zu bauen, Türen und Fenster einzusetzen, einen Kamin und ein Dach gegen das Wetter zu errichten und dann darin zu leben, begeisterte sie. Sie wollte sehen, wie es Gestalt annahm, wie aus dem Nichts etwas wurde. Sie wollte lernen, wie man aus Erde und dem gehäckselten gelben Tussockgras Lehm zum Bauen anmischt. Sie wollte bei allem selbst mit Hand anlegen. Auch wenn es viel Zeit erfordern würde. Auch wenn ihre Haut in der Sommerhitze verbrennen würde. Auch wenn sie jeden Handgriff wie ein Kind neu lernen müsste. Zwölf Jahre lang war sie Gouvernante gewesen. Jetzt hatte sie einen Ozean überquert und war an einem neuen Ort, aber sie wollte immer noch weiter, wollte in die Wildnis.
Joseph Blackstone hatte sie voller Zärtlichkeit angeschaut. Er sah, wie glühend sie sich wünschte, zur nächsten Station ihrer Reise aufzubrechen, doch, wie immer, war da noch Lilian, die berücksichtigt werden musste. Wie immer war die Entscheidung, die er zu treffen hatte, nicht einfach.
»Harriet«, sagte er, »es tut mir leid, aber du musst in Christchurch bleiben. Ich verlasse mich darauf, dass du Lilian hilfst, sich an das Leben in Neuseeland zu gewöhnen. Zum Beispiel muss ein Gesangverein für sie gefunden werden.«
Harriet erwiderte, mit Hilfe von Mrs Dinsdale, in deren sauberer, freundlicher Pension sie wohnten, könne Lilian doch selbst einen Gesangverein für sich finden. »Und dann«, fügte sie hinzu, »wird sie mich nicht mehr brauchen, Joseph, denn sie ist die Sängerin, nicht ich.«
»Hier ist doch alles so fremd«, sagte Joseph. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr diese neue Welt eine Frau von dreiundsechzig Jahren verstören muss.«
»Das Quartier ist nicht fremd.« Harriet blieb beharrlich. »Der Krug und die Waschschüssel haben fast dasselbe Muster wie der Nachttopf, den deine Mutter in Norfolk unter ihrem Bett stehen hatte …«
»Draußen vorm Fenster singen andere Vögel.«
»Ja, aber immerhin singen da Vögel und keine Affen.«
»Das Licht ist anders.«
»Heller. Aber nur eine Schattierung heller. Es wird ihr nichts anhaben.«
Und so ging sie immer weiter, diese Unterhaltung, die keine Unterhaltung war, sondern ein Krieg, ein kleiner Krieg, der allererste, den sie führten, den sie aber niemals ganz vergessen würden und den Harriet schließlich verlor. An dem Morgen, als Joseph zu der ockerfarbenen Ebene aufbrach, musste Harriet sich abwenden, damit Joseph und Lilian nicht sahen, wie zornig sie war.
Sie eilte die Holztreppe zu ihrem Quartier hinauf, ging in den grün gestrichenen Salon und schloss die Tür. Durch das offene Fenster konnte sie den Ozean hören, und sie stellte sich davor und atmete die salzige Luft. Sie wünschte, sie wäre ein Vogel oder ein Walfisch – irgendein Geschöpf, das zwischen dem Tun der Menschen und ihrem Vergessen hindurchschlüpfen und an sein eigenes Ziel gelangen könnte. Denn sie wusste, dass sie in all ihren vierunddreißig Jahren niemals auf die Probe gestellt worden war, niemals die von der Gesellschaft gesetzten Grenzen überschritten hatte. Und jetzt war sie wieder einmal zurückgelassen worden. Joseph würde ihr gemeinsames Haus in der leeren Ebene aus dem Nichts erschaffen, und Joseph würde ein Feuer unter dem Sternenhimmel machen und den Schrei des fernen Buschlands hören. Harriet gähnte. Sie spürte, wie ihr Zorn hier im gepflegten Salon allmählich einer tiefen, lähmenden Langeweile wich.
III
Siedler aus England hießen »Kakadus«, wurde Joseph belehrt.
»Kakadus«? Er konnte sich nicht vorstellen, wieso. Er wusste nicht einmal mehr, was für Vögel Kakadus eigentlich waren.
»Scharr ein bisschen in der Erde, nimm, was du von ihr kriegen kannst, kreisch ein bisschen, und dann zieh weiter, wie ein Kakadu.«
Joseph dachte an einen Papagei, der grau und grämlich zwischen Körnern in einem Käfig trauert. Er sagte, das treffe auf ihn nicht zu. Er sagte, er wolle sich am Okuku-Fluss ein neues Leben aufbauen, Gewinn aus seinem Grund und Boden ziehen, nach Dingen streben, die von Dauer seien.
»Schön für Sie, Mister Blackstone«, meinten die Männer. »Das ehrt Sie.«
Was Joseph nicht erwähnte, war, dass er in England etwas Schändliches getan hatte.
»Sie sind ja ein ganz Nachdenklicher«, sagten die Männer, als sie mit dem Bau des Lehmhauses begannen. Sie mischten Erde und Gras für die Mauern, brachen Steine für den Kamin, und sie waren stärker als Joseph, der häufiger ausruhte. Sie beobachteten ihn dabei, wie er hinunter in die Ebene starrte, die hier »Tafel« hieß – eine weite Fläche mit kaum einem Baum, die sich endlos unter ihm dehnte. Er blickte unbewegt wie eine Eule.
»Einen Penny für Ihre Gedanken? Heimweh?«
»Nein.«
»Würde ich Ihnen aber nicht verdenken, Mr Blackstone. Heimweh, davon verstehen wir hier eine Menge.«
»Nein«, sagte er noch einmal. Er nahm sein Messer, schärfte es und machte sich wieder daran, das Gras zu zerkleinern, und er pfiff dabei, damit die Männer seine Stimmung auch richtig deuteten, seine optimistische Stimmung. Denn während sein Blick über die Ebene schweifte und zu den fernen Bergen hochwanderte, keimte plötzlich so etwas wie Hoffnung in ihm auf. Er war hier. Er war auf der Südinsel Neuseelands, an einem Ort, der Aotearoa hieß – Land der langen weißen Wolke. Obwohl er in England etwas Schreckliches getan hatte, hatte er überlebt. Die Zukunft lag hier, lag in den Steinen, im rastlosen Wasser des Bachs, im fernen Wald.
Und mit Harriets Hilfe, sagte er sich, würde es ihm gelingen, ein ehrliches und gedeihliches Leben zu führen, ein Leben, in dem auch Lilian sich schließlich wohl und umsorgt fühlen würde. Irgendwann würde sie ihm die Hand auf die Wange legen und sagen, sie sei stolz auf alles, was er erreicht habe.
IV
Die Unterkunft, die Mrs Dinsdale Harriet und Lilian in Christchurch vermietet hatte, roch nach dem Firnis, den die Profilholzwände ausdünsteten, und nach Leinen, das mit hartem Wasser besprengt und mit glühendem Bügeleisen versengt worden war.
Mrs Dinsdale war von Dunedin nach Christchurch und von Edinburgh nach Dunedin gekommen. In Edinburgh, sagte sie, habe ihre Wäsche nicht eine einzige Falte aufgewiesen.
Sie war in Lilians Alter und ebenfalls Witwe, besaß aber jene hartnäckige Schönheit, die nie ganz vergeht und die vermuten ließ, dass Mrs Dinsdale – trotz ihres Alters – wahrscheinlich bald Mrs Jemand-anders sein würde.
Lilian sagte zu Harriet: »Ich glaube ja, dass sie eine Kokette ist. Heißt das nicht so?«
Und auch wenn ihre eigenartig kämpferische Bügelweise anderes vermuten ließ, hatte Mrs Dinsdale ein so heiteres, freundliches Wesen, dass es nicht lange dauerte, bis Lilian auf ihrer, wie Mrs Dindale sagte, »besten Veranda« saß, Limonade trank und ihr allerlei Sorgen und Bedrängnisse aus ihrem früheren Leben anvertraute.
Lilian Blackstones Gesicht unter dem stahlgrauen Haar, das sie in der Mitte gescheitelt und in einem strähnigen Zopf um den Kopf gelegt hatte, wurde kalkweiß, als sie Mrs Dinsdale die »Kämpfe« mit ihrem verstorbenen Ehemann Roderick beschrieb. Lilian überhörte Mrs Dinsdales Bemerkung, dass die »Ehe ein nie enden wollender schrecklicher Kampf zweier Willen« sei, und verriet ihrer neuen Freundin flüsternd, dass Roderick ein gewisses Laster besessen habe, und dieses Laster habe seinen peinlichen Tod verursacht.
Bei dem Wort »Laster« leuchteten Mrs Dinsdales blaue Augen erwartungsvoll auf, und sie beugte sich in ihrem Korbstuhl leicht vor.
»Oh, Laster«, sagte sie.
»Nicht jeder würde es ›Laster‹ nennen«, sagte Lilian. »Aber ich tue es.«
»Und was war nun das … Laster?«
»Neugier.«
»Neugier?«
»Ja. Roderick musste seine Nase überall reinstecken. Hätte er das sein lassen, wäre er nicht gestorben, und man hätte mich nicht um den halben Globus geschleppt.«
Mrs Dinsdale entfernte das perlenbesetzte Musselintuch vom Limonadenkrug und füllte die beiden Gläser erneut. Lilian entging nicht, wie geradezu unenglisch einladend die Sonne die blasse Flüssigkeit zum Funkeln brachte, und Mrs Dinsdales kleine Geste machte Lilian deutlich, dass Christchurch durchaus seinen Charme besaß. Sie sollte sich nicht dagegen sperren.
»Ich will Neuseeland nicht kritisieren«, beteuerte sie hastig. »Ich will nur sagen, dass mein dörfliches Leben in Parton Magna in Norfolk so war, wie ich es mir wünschte, und dass ich freiwillig nicht fortgegangen wäre. Mein Sohn hatte die Idee, die alte Welt zu verlassen. Und als diese Idee sich erst einmal in seinem Kopf festgesetzt hatte …«
»Oh ja. Wenn Männer erst einmal eine Idee haben, dann sind sie durch nichts davon abzubringen.«
»Wie richtig.«
»Und als Witwe hatten Sie vielleicht auch nicht die nötigen Mittel?«
»Absolut nicht. Roderick war nicht darauf vorbereitet zu sterben.«
Mrs Dinsdale kreuzte die Füße, die, wie Lilian bemerkte, in ausgesucht feinen braunen Stiefelchen steckten.
»Es war also seine Neugier?«, fragte Mrs Dinsdale, und ihre aufgerissenen Augen verrieten begieriges Interesse. »Aber wie kann Neugier einen Menschen töten?«
Lilian nahm einen Schluck Limonade. Sie hatte Limonade noch nie besonders gemocht, jedoch gehört, hier in Neuseeland laufe man Gefahr, Skorbut zu bekommen, wenn man sie nicht trank.
»Strauße«, flüsterte sie.
»Strauße, Mrs Blackstone?«
»Ja. Ich wage gar nicht, es laut auszusprechen, weil die Menschen sich gern darüber lustig machen. Aber ich kann es Ihnen leise zuflüstern: Roderick ist von Straußen getötet worden.«
Nachdem Joseph fortgezogen war, um das Haus zu bauen, legte Harriet ihr Sammelalbum an. Sie redete sich ein, dass sie es als Geschenk für ihren Vater, Henry Salt (einen Erdkundelehrer, der nie weiter als bis in die Schweiz gekommen war), plante, doch sie wusste, dass sie es für sich selbst tat.
In ihrem ersten Brief an Henry Salt schrieb sie, sie glaube nicht, dass das Sammelalbum anfangs »viel unerhört Interessantes« enthalten werde, aber wenn das Lehmhaus erst einmal fertig sei und sie dort draußen, in der Mitte von Nirgendwo, wohnten, »dann finde ich bestimmt etwas, das Dich faszinieren wird«.
Zu ihrer Überraschung hatte sie in einem Laden in der Worcester Street ein wunderschön gebundenes Buch gefunden, mit cremefarbenen Seiten so steif wie gestärkte Kissenbezüge. Sie war versucht, sich ihren Namen in goldenen Buchstaben vorne in den Einband punzen zu lassen, aber Joseph hatte sie ermahnt, kein Geld für »irgendwelche überflüssigen Liebhabereien« auszugeben. Das Geld, das sie besaß, werde zum Kauf von Gemüsesamen, Federvieh, Zaunpfählen, Draht und einer Milchkuh benötigt. Sie wusste, dass sie sich das Buch eigentlich nicht hätte leisten dürfen, aber mit seinem Kauf setzte sie gewissermaßen einen Trennstrich zwischen ihr altes und ihr neues Leben.
Das Erste, was Harriet in ihr Buch legte, war ein Blatt. Sie hielt es für ein Ahornblatt. Es war mitten in der Tasmanischen See einfach vom Himmel aufs Schiff gefallen – jedenfalls war es ihr so vorgekommen. Sie nannte es »Blatt vom Himmel, auf der SS Albert«. Das zweite Objekt war das Etikett einer chinesischen Teedose, die sie in einem Geschäft gekauft hatte, das »Reads Kolonialwaren« hieß. Umrahmt von chinesischen Schriftzeichen, war auf dem Etikett ein Bild von zwei Reihern mit ineinander verschlungenen Hälsen zu sehen. Harriet fand es eigenartig und wunderhübsch. Sie schrieb darauf »Erster Teeeinkauf«.
Genau das fand sie an dem Album aufregend: dass es sich mit all den Details ihres zukünftigen Lebens füllen würde. Ihrem Vater schrieb sie:
In Christchurch habe ich nicht das Gefühl, als sei ich schon angekommen. Erst dort, wo Joseph ist, werde ich dem wahren Aotearoa begegnen, erst dort werde ich spüren, wie außerordentlich anders die Dinge sind. Erst dort werde ich flügellose Vögel sehen und Gletscher, die in der Sonne leuchten.
Um sich die Zeit zu vertreiben, während Lilian und Mrs Dinsdale auf der »besten Veranda« saßen und Limonade tranken, entwarf Harriet einen Gemüsegarten für das Lehmhaus. Sie hätte ihn gern mit einem Holzzaun eingefasst, aber ihr war bedeutet worden, Holz sei teuer und sie könnten sich Holz nur für Fenster und Türen leisten, für nichts sonst. Also gab sie ihrem Garten einen Zaun aus Steinen. Sie malte sich aus, wie warm die Steine sich in der Sommersonne anfühlen würden und wie eiskalt im Winter. In den Garten kamen Karotten, Pastinaken und Kūmara, Süßkartoffeln – ein Grundnahrungsmittel in diesem Land, wie Mrs Dinsdale erklärte, »so lebenswichtig wie Brot«. Zwischen ihre Erbsen, Bohnen und Salatköpfe zeichnete sie Reihen mit Löwenzahn. Sie hatte gehört, dass die Farmer in Neuseeland ihre Schweine nur mit Löwenzahnblättern und Schnecken fütterten und dass diese Schweine unglaublich robust seien. Es seien muntere, bewegungslustige Tiere mit borstigen, kecken Schwänzchen, und ihr Fleisch schmecke wie Kalbfleisch.
Auf Joseph und Harriets Farm würde es irgendwann Schweine geben, doch wo, fragte Harriet sich, sollten dann die Schnecken herkommen?
V
Unterdessen nahm das Lehmhaus um seinen steinernen Kamin herum Gestalt an.
Die eisernen Türangeln glänzten in der Hitze. Das Blechdach wurde aufgesetzt. Innen wurde die Erde angefeuchtet, gestampft und fest- und glattgeklopft, aber es gab keine separaten Zimmer, keine geschlossenen, privaten Räume, nur Trennwände aus aufgespanntem Kattun.
Joseph saß gegen die Lehmwand gelehnt, rauchte eine Tonpfeife und beglückwünschte sich dazu, dass er den richtigen Platz für das Haus gefunden hatte, hier, wo eine Nachmittagsbrise die Buchenblätter erzittern und den Kattun sanft schwingen ließ. Obwohl die Männer ihm geraten hatten, weiter unten zu bauen, »tiefer in der Ebene, Mr Blackstone, wo die Winter nicht so hart sind«, war er bei seinem Entschluss geblieben. Er wünschte sich sein Haus hoch oben, nahe bei den Bäumen. Er wollte das Buschland im Rücken wissen und die Ebene unter sich. Er war ein Mann aus Norfolk, der Sohn eines Viehauktionators und gleichzeitig dessen Angestellter. Er war bei jedem Wetter auf Landstraßen und Farmwegen unterwegs gewesen. Der Winter hatte nichts Schreckliches für ihn. Und der Kamin war solide gebaut und stabil. Harriet und Lilian würden es warm im Lehmhaus haben, wenn der Schnee kam – falls Schnee kam. Und jedes Mal, wenn er durch die hübsch gearbeiteten Fenster mit ihren Holzrahmen schaute, sah er all das viele Land, das ihm gehörte, das erste Land, das er jemals besessen hatte und das ihn nur ein Pfund pro Morgen gekostet hatte. Mit der Zeit – in gar nicht allzu ferner Zeit – würde dieses Land verwandelt sein. Es würde eingezäunt und mit Hecken und Bäumen bepflanzt sein. Er würde einen Teich für Enten und Gänse ausheben. Weiden würden sich zu dem Teich hinneigen, so wie sie es an den Seen in Norfolk taten. Das Tussockgras würde untergepflügt und Klee für die Pferde und Weizen für den Haushalt gesät werden. Es würde eine Mühle geben.
Joseph arbeitete so hart am Lehmhaus, dass er in den heißen Nächten, während er dem melancholischen Schrei der Wekaralle lauschte, ohne Schwierigkeiten in einen traumlosen, betäubten Schlaf fiel. Eingerollt in eine gestreifte Decke, die nach Kampfer roch, lag er am Bach, den Kopf in die Armbeuge geschmiegt. Er war fünfunddreißig, ein schlanker, sehniger Mann mit hellen Augen. Sein Haar war dunkel, und seine Füße waren lang und schmal. Und er hatte schon die Angewohnheit entwickelt, sich über seinen dünnen, schwarzen Bart zu streichen, wenn er die Augen schloss.
Gewöhnlich weckte ihn das Geräusch des Wassers bei Sonnenaufgang, selten vorher. Als würde der Bach in den Stunden der Dunkelheit zu einem stummen Teich und sammelte erst morgens wieder genügend Kraft, um zu fließen.
Die Männer erklärten Joseph, dass dieser Wasserlauf keinen Namen trage, »aus dem einfachen Grund, weil niemand sich hier lange genug aufgehalten hat, um ihn zu benennen«.
Also beschloss Joseph, ihn »Harriet-Bach« zu nennen, weil er wusste, wie sehr das seiner neuen Frau gefallen würde. Er stellte sich vor, wie sie an dem alten Mahagonitisch saß, der auf der Albert von England hergekarrt worden war, und ihrem Vater, dem Erdkundelehrer, schrieb, wie schnell das Wasser über die Steine eilte, »und findest Du das nicht sehr romantisch von Joseph?«
Als die Zeit meiner Schande vorbei war, schenkte ich meiner Frau einen kleinen Fluss.
Lilian würde darüber natürlich nicht glücklich sein. Joseph wusste, dass sie es lieber gesehen hätte, wenn er nach ihr hieße und sie so im Zentrum von allem stünde, auch wenn dies alles lediglich aus einem Kattunzelt in einem Haus aus Lehm bestand. Aber mit der Zeit, sagte er sich, wenn es erst einmal den Teich gab und die Weiden, wenn das Land eingezäunt war und die Tiere gediehen … dann würde Lilian sicherlich auch für die Schönheit dieser neuen Welt empfänglich werden. Sicherlich würde sie dann endlich einsehen, dass ihr einziges Kind das Richtige getan hatte. Und wenn nicht, dann hätte er sich immerhin krummgelegt und es versucht.
Einen verdammt sturen Kakadu nannten ihn die Männer mittlerweile untereinander. Und in der Abenddämmerung erzählten sie ihm am Feuer Kakadu-Geschichten. »Wissen Sie, dass der Kakadu einen Falken imitieren kann, Mr Blackstone? Das tut er, um den Hühnern Angst zu machen. Er tut es nur aus Spaß, nur um zu sehen, wie die Hühner gackernd die Flucht ergreifen! Und er kann auch lachen. Hat Ihnen das mal jemand erzählt? Die Hühner spritzen auseinander oder fallen tot um vor Angst, und der alte, herzlose Kakadu lacht wie ein Hyäne.«
Joseph lächelte, weil sie sein Lächeln erwarteten und weil er gut mit diesen Menschen auskommen wollte, die ihm halfen und ihm alles beibrachten, was er zum Überleben brauchte. Aber das Wort »herzlos« ließ ihn erschauern. Er rückte näher ans Feuer. Er klammerte sich in Gedanken an Harriet, und als Trost rief er sich nicht ihr seidiges Haar oder ihren kräftigen Körper in Erinnerung, sondern ihren Schneidezahn, der schief vorschaute, wenn sie lächelte, was er eigentlich nicht sollte. Ohne diesen Makel, diesen kleinen elfenbeinernen Makel an ihrer, wie er es für sich nannte, unangreifbaren Erscheinung, hätte er vielleicht gar nicht den Mut gehabt, sie zu heiraten. Dieser Zahn hatte ihn hoffen lassen, dass es ihm gelingen werde, diese Frau zu lieben. Und wenn er sie dann schließlich liebte und ein anständiges Leben mit ihr führte, ein Leben ohne Hass und Zerstörung, dann könnte die Vergangenheit hoffentlich allmählich verschwinden. Es würde ihm möglich sein, ohne diese Vergangenheit alt zu werden, so wie ein Mann, wenn er achtgibt, ohne zerstörerisches Verlangen alt werden kann.
Das Einzige, wovor er sich fürchtete, war, dass Harriet ihn drängen könnte, ein Kind zu zeugen. Über dieses Thema hatte er nie mit ihr gesprochen, aber er hoffte, dass sie es spürte: Er hoffte, sie begriff, dass ein Kind nicht Teil des Handels war, den sie beide eingegangen waren. Sie war eine kluge Frau. Er betete, sie möge begreifen, dass es nur sie beide und Lilian und das, was sie daraus machten, geben durfte; nur sie beide – und das bis zum Schluss.
VI
Und so verging für Harriet Blackstone langsam der Sommer. Im Januar, als die Temperaturen in Christchurch derart anstiegen, dass Lilian zweimal auf Mrs Dinsdales Treppe ohnmächtig wurde, gab es Gerüchte, überall in der Stadt fielen die Häuser zusammen. Einige behaupteten, in Neuseeland verstehe man sich eben nicht auf Baustatik und noch vor Jahresende würde eins nach dem anderen in sich zusammenstürzen.
Harriet untersuchte die Wände und die Decke ihres Zimmers. In der Dunkelheit hörte sie kein Knarren und keine Bewegung. Zwar trat weiterhin Firnis in Blasen aus den Brettern, aber sonstige Vorboten einer drohenden Gefahr gab es nicht. Doch wie sollte jemand wie sie, die nichts vom Bauen verstand, auch darum wissen? Wie konnte sie sicher sein, dass das Dach nicht einstürzte und sie im Schlaf erschlug?
Sie ging zur McArthur Street und schaute sich ein eingestürztes Gebäude an. Sie versuchte, sich den exakten Punkt vorzustellen, an dem die Erde, seit das Haus dort stand, an den Dachsparren gezerrt, sie gerufen, ihnen zugezwinkert hatte. Sie wusste, wie abstrus und wie weiblich es war, zu glauben, dass die mächtige Erde schon von Anbeginn an alle existierenden Dinge durch Zerren und Zwinkern zu sich gerufen habe und dass jedes einzelne Ding zu seiner Zeit in sich zusammenfalle. Aber sie hoffte trotzdem, Joseph werde beim Bau des Lehmhauses auf so etwas achten und genügend Fantasie haben, um auf die Erde zu hören.
Joseph Blackstone. Sie kannte ihn noch gar nicht. Sie wusste nur – was sie gleich zu Anfang erkannt hatte, ohne sonderlich beunruhigt zu sein –, dass er ein ziemlich durchschnittlicher Mensch war. Sie wusste, dass sie beinahe nicht zusammengekommen wären. Doch dann war er, aus keinem für sie erkennbaren Grund, eines Herbstabends wieder erschienen, war irgendwie hastig zu ihr gestolpert, als sei ihm plötzlich eingefallen, was er sagen und tun wollte, als habe bei ihrem ersten Kennenlernen ein Teil von ihm gefehlt, den er dann wiedergefunden hatte.
Er umwarb sie mit Träumen von Flucht. Sie saß, den Kopf in seinem Schoß, auf dem Kaminvorleger, und er beschrieb ihr das Paradies, das er auf der anderen Seite der Erde erschaffen würde. Und seine Worte brachten sie dazu, ihn fest zu umklammern, als er sie berührte. Und als sie seine Wärme spürte und seine Kleidung roch, deren Duft sie an Birkenrinde erinnerte, merkte sie, wie satt sie ihr Leben als Gouvernante hatte, wie leid sie es war, nichts zu verdienen, nirgendwo hinzukommen und ihre Tage am kargen Feuer fremder Menschen zu verbringen. Und so wurde ihr binnen kürzester Zeit klar, dass sie nur zu gern mit Joseph Blackstone losziehen wollte, um die Aussteuer für eine neue Welt zu kaufen, um in den Himmel zu schauen und sich die Sternbilder einer anderen Hemisphäre auszumalen.
Es blieb jedoch kaum Zeit, um Hochzeit zu feiern. Kaum Zeit, um den Ring überzustreifen. Kaum Zeit, um in einem hohen Bett zu liegen, während er das tat, was er mit der Hand auf ihrem Gesicht tat (etwa, damit sie es nicht sah?), und sich zurückzog, kurz bevor er zu seinem Vergnügen kam. Und dann hastete er, in unbändigem Tatendrang, fast einer Art Raserei, mit ihr von Geschäft zu Geschäft, zog aus seinen muffigen Taschen Listen, Maßbänder und Geld. Stiefel, Schultertücher, Strümpfe, wollene Kleider und Schürzen – solcherlei Alltagsbekleidung schien die Währung ihrer Ehe zu sein, nicht Küsse – jedenfalls nicht viele –, nicht geflüsterte Vertraulichkeiten oder Lachen.
Aber er sprach weiter von Neuseeland, und sie hörte weiter zu, und während sie zuhörte, lag sie gerne ganz nah bei ihm, um das Heben und Senken seiner Brust beim Atmen zu spüren.
Eines Abends erzählte er ihr von den Ureinwohnern. Sie wurden Moa-Jäger genannt. Sie töteten den Riesenvogel Moa und ernährten sich von seinem Fleisch und bauten Hütten aus seinen Knochen und schliefen in seine Federn gehüllt. Sie jagten ihn so lange, bis er ausgestorben war, und dann blickten sie ungläubig um sich. Sie wussten nicht, wovon sie leben sollten, außer vom Moa, und so wurden sie krank und starben. »Und das«, sagte Joseph, »lehrt uns etwas Wichtiges, Harriet. Wir werden es nicht machen wie die anderen. Wir werden uns dort drüben als neugeboren betrachten. Auf dem Land, das ich kaufen werde, fängt alles von vorne an.«
Sie lagen in seinem Schlafzimmer in Lilians Haus, und die Dunkelheit Norfolks drang durch das halb geöffnete Fenster und legte sich schwer auf sie. Harriet gefiel es, dass ihr frisch angetrauter Ehemann das Wort »neugeboren« benutzte. Sie nahm seine Hand und schlief ein und träumte, sie schliefe, in die Federn eines braunen Vogels gehüllt.
Nachdem Harriet von ihrem Ausflug zum eingestürzten Haus in Mrs Dinsdales Quartier zurückgekehrt war, betrachtete sie ihr Gesicht im Spiegel. Ihr Haar hatte sich in der Nachmittagshitze gekräuselt, ihre Wangen waren rosig und feucht. So hatte sie noch nicht oft ausgesehen, so wild und erregt und verschwitzt. Aber es änderte sich ja auch alles in ihrem Leben. Es war keine sechs Monate her, da hatte sie Joseph Blackstone noch nicht einmal gekannt; jetzt war sie seine Frau und trug seinen Namen. Fast so wie die Erde nach den berstenden Dachsparren, hatte er nach ihr gerufen, und sie hatte geantwortet.
Obwohl Lilian klagte, es sei »zu heiß zum Singen«, begleitete sie Mrs Dinsdale eines Mittwochabends zu dem frisch gegründeten Laura-McPherson-Gesangverein.
Der Verein besaß keine eigenen Räumlichkeiten, sondern traf sich in der Lagerhalle eines Bekleidungsgeschäfts, in dem Mrs McPherson die Hutschachtelstapel und die Schränke mit Mänteln und Kleidern in Leinenhüllen »in einer akustisch vorteilhaften Weise« hatte anordnen dürfen. Der Raum, in den man ein kleines Klavier geschafft hatte, war dunkel und kühl wie eine Kirche. Laura McPherson drehte dort ihre Kontrollrunden, rückte alles noch einmal zurecht, sogar den Löscheimer des Tuchhändlers und seinen Bügeltisch. Dann staubte sie ihren mächtigen Busen ab, stellte sich vor die versammelten Frauen und trug ihnen mit ihrer weichen, kehligen Altstimme »Jesus, vernimm mein Lied am Nachmittag« vor.
Lilian hörte zu und war bewegt. Sie fühlte sich »in die Zivilisation« zurückversetzt und stieß einen langen, melancholischen Seufzer aus. Sie hoffte, ihre Stimme werde für ausreichend befunden. Und sie hoffte, dass auch diese Frauen zu Freundinnen wurden wie die gute Mrs Dinsdale. Einen Moment lang wagte sie sich sogar vorzustellen, sie könnten sich bei Joseph für sie verwenden und ihm erklären, von einer Person ihres Alters und ihrer Herkunft (als Tochter eines Pfarrers hatte sie sich dem Viehauktionator Roderick stets überlegen gefühlt) könne wirklich und wahrhaftig nicht erwartet werden, dass sie in die Berge oder in den Busch ging, um einsam und ungehört, nur für Vögel und Wind, Klavier zu spielen und zu singen …
Dann dachte sie an das Geld. Fast alles, was ihr und Joseph geblieben war, war für die Passage auf der SS Albert und für die »Farm« draufgegangen. Wie von Rüsselkäfern oder Staubmilben würde der Rest durch den trostlosen Kauf von Getreidesaaten, Geflügel und Schweinen aufgezehrt werden. Es würde nichts übrig bleiben, wovon sie in Christchurch leben könnte. Und betteln oder borgen, dankbar irgendeine Art von Almosen annehmen, das kam für Lilian Blackstone nicht infrage. Sie hatte ihren Stolz. Wulla. Und der würde sie in die Wildnis begleiten. Er wäre das Einzige, was niemand ihr nehmen konnte.
Jetzt blieb ihr nur noch, sich eine Halspastille in den Mund zu stecken und beim Austeilen der Noten zu helfen. Sie setzte ihre Brille auf und sah, dass sie als erstes Stück »Schwinget das flammende Banner« üben würden. Das hatte sie einst in Cromer gesungen. In einer für sie sehr stürmischen Zeit. Damals hatte das Meer sich vor ihr zu einer grauen Wand aufgetürmt und war auf sie zugerollt.
Während die Frauen sich in einer ordentlichen Reihe aufstellten und die schwierige zweistimmige Melodie vom »Flammenden Banner« zu üben begannen, öffnete Harriet die Tür zu Lilians Zimmer und trat ein.
Sie stand auf dem Perserteppich und blickte sich um. Neben Lilians Bett lag die Pastellzeichnung von einem Kind, das ein Kleidchen trug. Harriet nahm sie hoch, und an den dunklen Locken und dem etwas finsteren Blick erkannte sie, dass das Kind Joseph war. Er saß in einem großen Sessel und hielt sich mit seinen Babyfingern an den gepolsterten Lehnen fest, als wäre der riesige Sessel eine Kutsche, die holpernd durch eine gefährliche, unbekannte Landschaft fuhr. Sie legte das Bild wieder auf Lilians Nachttisch neben eine Flasche Kölnisch Wasser und ein leinernes Taschentuchtäschchen. Auf Lilians Bett war liebevoll, als wäre es für einen anderen und nicht für sie, eine wollene weiße Stola ausgebreitet, in die sie sich nachts gern einwickelte. Harriet berührte sie an einer Ecke und roch ihre Schwiegermutter; eine Mischung aus Rosenwasser und etwas Pfefferminzartigem – ein scharfer Geruch, den man nicht lange ertrug.
Harriet setzte sich aufs Bett. Das Zimmer sah sehr ordentlich aus. Alles schien an seinem Platz zu sein, sogar das Palmblattkreuz an der gegenüberliegenden Wand, das mit einem unauffälligen Nagel im Profilbrett befestigt war. Daneben hing eine gerahmte Zeichnung des großen Kreuzes auf dem Marktplatz von Parton Magna in Norfolk.
An die Tür des Kleiderschranks hatte Lilian ihre zweitbeste Haube gehängt, deren Bänder dort, wo sie sie unter dem Kinn stets fest zuband, verknittert waren. Und während Harriet all dies betrachtete, dachte sie, wie hart es sein musste, alt zu werden und ein bröseliges Kreuz an der Wand zu befestigen, einen kleinen Jungen in einem Kleid anzustarren und nicht zu wissen … nicht zu wissen, wie viel Zeit einem noch blieb und ob der Mann, der einst dieses Kind war, sich um einen kümmern würde oder nicht …
Arme Lilian.
Arme, unglückliche Lilian.
Harriet saß sehr still auf dem Bett und betete darum, dass sie, bevor ihr eigenes Leben sich auf solch ein unsicheres Ende zu bewegte, wenigstens irgendetwas Außerordentliches und Unvergessliches gesehen oder erlebt haben würde.
VII
Es war schon Herbst, als Joseph zurückkehrte. Herbst im April.
Er sah mager aus, und sein Gesicht war wettergegerbt und braun. Aber er triumphierte: Das Lehmhaus war gebaut. Es gab eine Weide für den Esel und ein Hühnergehege aus Binsen und Draht. Und die Abendwolken über der Ebene hatten die Farbe roten Lehms.
Lilian weinte. Halb hatte sie gehofft, das Haus würde nur in Josephs Kopf existieren und niemals Wirklichkeit werden. Doch jetzt war es da. Sie zog ein von Mrs Dinsdale gebügeltes sauberes Spitzentaschentuch hervor und hielt es sich, noch ordentlich zusammengefaltet, vors Gesicht. Joseph blickte sie bekümmert an. Dann versuchte er, ihr seinen Arm um die Schultern zu legen, aber sie stieß ihn fort.
Lilian dachte an Rodericks graues Marmorgrab in Parton und an seinen Namen, der so schön schwarz in den Stein graviert war, so beständig gegen Sonne und Regen.
Harriet verließ das Zimmer und wartete, dass Joseph zu ihr kam. Ihr Herz stand in Flammen, weil lehmrote Wolken und ein weißes Haus im Schatten schlanker Bäume sie erwarteten. Als seine Hand nach einiger Zeit ihr Gesicht bedeckte, schob sie sie weg. Denn Harriet wollte ihn jetzt in seiner Nacktheit, seinem aufgeregten Bemühen sehen – ihren Ehemann, der am Ende der Welt ein Haus gebaut und überlebt hatte. Sie zog sein Gesicht zu sich herunter und küsste ihn wie einen Fremden, mit einem harten, trockenen Kuss. Und während er sich aus ihr zurückzog, flüsterte er, dass er dem Bach ihren Namen gegeben hatte.
»Ja«, sagte sie. »Mein Bach. Meiner!« Und sie umarmte ihn sehr fest.
Sie wollte sofort zu der Farm aufbrechen. Rollwagen zum Transport von Lilians Porzellan und den Möbeln ließen sich problemlos mieten. Aber Lilian weigerte sich. Sie wollte es nicht einmal in Betracht ziehen. Der Laura-McPherson-Gesangverein würde am neunzehnten April sein erstes öffentliches Konzert geben, und sie hatte versprochen dabei zu sein, denn in »Flammendes Banner« gab es eine bestimmte hohe Note, die aus dem gesamten Anfängerchor allein ihre Stimme mühelos traf.
»Eine Note«, sagte Harriet zu Joseph. »Wollen wir etwa die ganze Pflanzsaison einer einzigen Note opfern?«
Er erklärte ihr freundlich, dass es im Herbst wenig zu pflanzen gab und dass sie im ersten Winter von dem leben müssten, was sie mitnahmen – Tee, Mehl, Kekse, Sardinen, Zucker und Schinken –, und von Hammelfleisch, das sie von der Orchard-Farm, der größten Schafzucht in der Okuku-Ebene, kaufen würden. Und er gestand ihr auch, dass er Ruhe brauche. Seine Füße waren voller Blasen, seine Hände rissig und rau. Und vom Schlafen mit dem Kopf in der Armbeuge tat ihm der Nacken weh.
Und so blieben sie noch drei weitere Wochen in Mrs Dinsdales Quartier und machten Listen: fünfundzwanzig Legehennen und ein Hahn, eine Milchkuh, ein Esel, Hafer, Maissamen, Setzlinge, Zaunpfähle, Draht …
Joseph und Harriet taten jetzt alles gemeinsam, machten Notizen und rechneten, handelten fieberhaft, sichteten, verwarfen und kauften, während gleichzeitig Lilians Singstimme, wie aus Protest gegen die drohende Vertreibung aus dem letzten Zipfel der zivilisierten Welt, plötzlich eine neue, unerträgliche Perfektion zu erreichen schien. Unterdessen liefen die beiden Arm in Arm von einem Ende der Stadt zum anderen. In einigen Läden kannte man sie inzwischen, den hoch aufgeschossenen Joseph Blackstone und seine fast ebenso große, leicht erregbare Frau.
Harriet fiel der überstürzte Kleiderkauf in England ein, und sie erklärte Joseph, wie viel besser ihr dies hier gefalle, diese »Farmbesorgungen«, und dass sie sich jetzt endlich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen könne. Sie sei so stolz auf ihn, sagte sie. Sie sah ihn mit einem neuen Gefühl des Verlangens an. Und während sie in McKinleys Eisenwarenladen mit ihren langen Fingern über die Schneide einer Sense fuhr, sagte sie: »Joseph, wir sollten nicht zulassen, dass unser neues Leben nur irgendwie anfängt und dann einfach so weggleitet.«
Weggleitet? Was meine sie denn damit?
Oh, das wisse sie auch nicht so genau, sagte sie. Aber sie finde, dass es etwas geben müsste – eine Art Markierung. »Es muss einen Sinn haben«, meinte sie schließlich.
Im Stillen beschloss Joseph, sich Mühe zu geben und in jedem Tag einen »Sinn« zu finden. In der Morgendämmerung, die sich mit ihrem Licht durch die blaugrünen Blätter arbeiten würde; im unaufhörlichen Rauschen und Strudeln des Harriet-Bachs; sogar in den kalten Nächten, wenn die flugunfähigen Vögel rufen, aus ihren Höhlen und Verstecken rufen würden. Er wollte sich Mühe geben, und er hoffte, mit Erfolg.
Doch dann sah er Harriets Gesicht, das sich in der geschliffenen Schneide der Sense spiegelte. Meinte sie etwas anderes? Er wartete, stand stumm und aufrecht da und verbarg den plötzlichen, brennenden Schmerz in der Brust.
»Also?«, fragte sie.
»Natürlich wird es … einen Sinn haben«, stammelte er.
»Und«, sagte sie fröhlich, drehte sich zu ihm um und berührte seinen Arm, »nach uns?«
Da war sie. Die gefürchtete Frage. Jetzt war sie da und würde immer da sein.
»Nach uns?«
Für einen kurzen Moment lehnte sie ihr Gesicht an seine Schulter. Er roch nach dem Staub in diesem Laden, nach Schlacke oder Asche, nach etwas Verbranntem und Vergangenem.
»Meinst du nicht, es könnte ein Kind geben?«
Mehr als ohnehin schon versuchte er jetzt, sich aufrecht zu halten, sie nicht spüren zu lassen, wie gern er sich ihr entwinden würde und seine Herzgegend so lange massieren, bis es nicht mehr weh tat. Er versuchte zu schlucken, aber sein Speichel klebte im Mund, und er musste ein Taschentuch nehmen und sich die Lippen abwischen.
»Harriet«, begann er, »ich habe nie…«
»Was hast du nie?«
»Das habe ich mir nie vorgestellt. Ich dachte immer, dein Alter …«
»Ich bin vierunddreißig, Joseph.«
»Eben.«
Sie hätte ihm sagen können, wie heftig sie jeden Monat blutete, wie viele elende Lappen eingeseift und gewalkt und gespült und an einer Stelle aufgehängt werden mussten, wo niemand sie sah. Aber sie kannte ihn nicht gut genug, um über so etwas zu reden. Sie legte die Sense aus der Hand und lief an der langen Reihe funkelnagelneuer Gerätschaften entlang, die an McKinleys provisorischen Wänden angebracht waren, und er folgte ihr in einigem Abstand.
BEAUTYS MANTEL
I
Harriet wusste, dass Joseph nachts wach lag. In ihrem Zimmer aus zitternden Kattunwänden hörte sie ihn seufzen.
»Was ist?«, fragte sie immer wieder.
Er konnte ihr nicht sagen, dass er fürchtete, das Haus stehe am falschen Platz, konnte ihr auf keinen Fall sagen, dass er zu verbohrt gewesen sei, um den Rat der Männer zu befolgen, die ihm geholfen hatten. Denn er wollte unbedingt ihre Liebe und ihre Achtung erringen. Daran hing sein Heil.
Er sagte nur, er mache sich Sorgen um seine Mutter. Lilian hatte begonnen, wütend mit der schmutzigen Wäsche zu reden, während sie den schweren Kessel umrührte. Sie fragte das Unterzeug, wieso einmal Einseifen und Spülen nicht länger hielt, wieso die Wäsche »den Schmutz so anzog«. Wenn sie sie draußen zum Trocknen aufhängte, schlug sie sie mit einer hölzernen Schaufel. Zu anderen Zeiten saß sie, wahrscheinlich entnervt vom erfolglosen Beschimpfen nie antwortender Kleidungsstücke, still und abwesend in ihrem Sessel und rollte einen Stopfpilz zwischen den Fingern.
»Wir müssen mehr für sie tun«, sagte Joseph.
»Was denn noch?«, fragte Harriet.
Er wusste es nicht. Er wünschte sich, Harriet würde es ihm sagen, würde selbst auf etwas stoßen. Frauen verstanden einander doch, jedenfalls glaubte er das, weil jemand sie verstehen musste, und er wusste, dass er es nicht tat. Nur, dass Frauen sich immerzu sehnten, wusste er. Und dass ihr Sehnen so hartnäckig sein konnte, dass ein Mann sich manchmal zu Dingen hinreißen ließ, die er nie für möglich gehalten hätte. Ihr Sehnen konnte einen Mann zerstören …
Wonach seine Mutter sich sehnte, war jedoch nicht schwer zu erraten. Sie gab sich gar keine Mühe, es zu verbergen: Sie sehnte sich danach, weit weg zu sein. Und daran, wie finster sie die Kattunwände und wie mitleidig sie ihre persönlichen Möbel anblickte, die wie verlegene Gäste auf dem Lehmboden gestrandet waren, sah Joseph, dass sie auch keine Anstalten machte, gegen ihr Sehnen anzugehen; sie überließ sich ihm einfach.
»Ich weiß nicht, was sonst noch«, sagte er. »Außer dass du ihr eine engere Gefährtin sein könntest. Dass du etwas mehr im Haus sein könntest, statt immer nur draußen …«
»Joseph«, sagte Harriet. »Ich habe mein bisheriges Leben nur im Haus verbracht. Was glaubst du denn, was eine Gouvernante den ganzen Tag lang macht? Sie sitzt drinnen, liest und schreibt und atmet Stubenluft.«
»Ich weiß. Aber ich fürchte, Lilian ist zu viel allein.«
»Wenn mein Gemüsegarten angelegt ist, werde ich mehr mit ihr zusammen sein. Aber du weißt auch, dass sie mir da draußen bei der Arbeit auch helfen könnte, wenn sie wollte.«
Joseph sagte nichts, drehte sich im harten Bett nur auf die andere Seite. Harriet lag still neben ihm. Über ihr ließ ein sanfter Regen das Blechdach leise singen.
Sie hatten eine Milchkuh, aber kein Pferd. Joseph sagte, ein Pferd könnten sie sich erst im nächsten Jahr leisten, wenn sie Weizen und Mais und Jungtiere verkauft hätten. Also wurde ein Esel mit großen Scheuklappen vor den Pflug gespannt, und Joseph und der Esel liefen den ganzen Tag lang auf und ab und hin und her, und allmählich wurde immer mehr Tussockgras in schlingernden Reihen untergepflügt.
Lilian sagte: »Ich dachte, ein Feld hätte gerade und rechteckig zu sein.«
»Ich versuche, es so gerade und eckig zu machen, wie ich kann«, sagte Joseph.
»Ich finde, es sieht aus, als wäre es betrunken«, sagte Lilian. »Ich bin froh, dass wir keine Nachbarn haben, die spitze Bemerkungen machen könnten.«
Joseph gestattete sich ein Lächeln. Er erinnerte seine Mutter daran, dass »wir alles, was wir hier machen, zum ersten Mal machen, aber mit der Zeit lernen wir.«
»Ich bin keineswegs sicher«, meinte Lilian, »ob ich jemals lerne, auf diesem Herd zu kochen.« Und sie gab dem alten eisernen Kochherd, auf dem gerade ein Wasserkessel heiß wurde, einen verächtlichen Tritt. Er wurde mit schwelender Braunkohle befeuert und dachte nicht daran, die Brotlaibe, die Lilian hineinschob, richtig auszubacken. Er dämpfte sie nur. Sie gingen in dem Blechgefäß gar nicht ordentlich auf und hatten schließlich die Konsistenz von Talg. Wenn man eine Scheibe abschnitt, hinterließ sie auf dem Messer einen traurigen feuchten Film. In Parton Magna war Lilians Brot knusprig und gehaltvoll gewesen, unwiderstehlich für Roderick Blackstone, der es genoss, wenn die Kruste an seinem Gaumen kratzte, und der noch am Morgen seines Todes mächtige, mit Rinderfett bestrichene Scheiben davon vertilgt hatte.
»An diesem gottverlassenen Ort ist alles schlimmer«, sagte Lilian.
Harriet verzog sich rasch. Sie verzog sich hinter das Lehmhaus, wo ihr Garten wartete. Es gab dort noch nichts zu sehen, nur ein Rechteck nackter Erde, wo Vögel, die sie nicht kannte, frühmorgens miteinander schwatzten, wenn die Sonne über dem Tal aufging und die Buchenblätter wie geölt funkelten. Nach und nach sammelte sie die Steine aus dem Boden, unterteilte die Fläche mit Totara-Kiefernbrettern und setzte einen Zaun aus Blechen. »Eine steinerne Mauer um ein so großes Stück Land«, hatte Joseph ihr erklärt, »ist ein frommer Wunsch. Hast du eine Ahnung, wie lange drei Männer gebraucht haben, um den Steinkamin zu bauen?«
Harriet hatte sich eine Steinmauer vorgestellt, aber die konnte warten. Sie strich die Bleche weiß und befestigte sie an jungen Baumstämmen. Ein Tor gab es nicht. Der Blechzaun lief um den gesamten Garten. Jedes Mal, wenn Joseph oder Lilian hinauskamen, um ihn zu betrachten und auf der einen Seite des Zauns standen, wirkte Harriet auf der anderen Seite wie eine Gefangene, die sie nicht besuchen durften. Sie sahen ihr zu, wie sie in gebückter Haltung arbeitete, das Haar unter einem Kopftuch versteckt, in der hochgebundenen Schürze ihre Saatkartoffeln, die Stiefel voller Lehmklumpen.
»Ist sie glücklich dabei?«, fragte Lilian.
»Ja«, sagte Joseph.
Lilian schnaubte. »Es sieht aus wie Sträflingsarbeit«, verkündete sie.
Der Bach schlängelte sich hinter Harriets Garten entlang, rauschte besonders laut nach heftigen Regengüssen, rüttelte die Steine durcheinander, führte Schwarzbuchenäste und Zweige der roten Matipo aus dem Hochwald mit sich. Noch nie hatte Harriet Wasser von solch eisiger Frische berührt oder gekostet. Wenn die Nachmittagsdämmerung hereinbrach und sie das erste Aufschimmern von Lilians Lampen in den Lehmhausfenstern sah, stellte sie sich ans Ufer und horchte auf ihre neue Welt. Und wenn der Wind ein wenig nachließ, hörte sie vielleicht in den fernen Bäumen eine Eule oder das klagende Ku-li, Ku-li der Wekaralle, das sie dank Joseph inzwischen erkennen konnte. Manchmal breitete sie auch ihre lehmbeschmutzte Schürze aus, kniete darauf nieder, wusch die Hände und schöpfte sich Wasser in den Mund. Oft verharrte sie, das Gesicht dicht über dem Wasser, so lange in dieser Haltung, dass, wenn sie sich endlich erhob, vollkommene Dunkelheit herrschte.
II
Im ersten Brief an ihren Vater Henry Salt schrieb Harriet:
Wir essen Hammel und noch mehr Hammel: Hammelbeine, Hammeleintopf und Hammelkoteletts, Aufläufe und Pasteten mit Hammel. Ich glaube, wir riechen schon wie Schafe.
Dann erzählte sie ihm von der Kuh, der sie den Namen Beauty gegeben hatten,
weil sie von Natur aus so freundlich ist und ihre Augen schön wie Bernsteinseen sind und die Locken auf ihrem Kopf aussehen, als wären sie tatsächlich auf Lockenpapier gewickelt worden.
Beauty, diese Schönheit, hatte weder Stall noch Scheune. Aber aus einem alten Läufer und einigen Metern Zwirn hatte Lilian einen Mantel für sie angefertigt. Das war bisher die einzige Aufgabe, die Lilian Blackstone mit fast so etwas wie Begeisterung erledigt hatte, und es war ein ebenso seltsamer wie rührender Anblick, dass dort auf dem Feld jetzt eine Kuh herumlief, die ein menschliches Kleidungsstück trug und dabei gelbes Heu fraß.
Wenn die Sonne schien und sie vergessen hatten, Beauty den Mantel abzunehmen, dampfte es durch die Wolle. Harriet fand Beautys Geruch fast so angenehm wie den der Menschen, denen sie in ihrem Leben begegnet war, und sie malte sich aus, dass ihre eigenen Kinder vielleicht auch so riechen würden – nach Milch und nach Erde und nach warmer Wolle.
Das Melken von Beauty gehörte zu ihren Lieblingsaufgaben. Die Kuh stand jedes Mal vollkommen still, wenn Harriet mit ihren von der Gartenarbeit roten und rauen Händen an den warmen, gummiartigen Zitzen zog. Nur Beautys Flanken zuckten gelegentlich, oder sie drehte ihr gelocktes Haupt und blickte mit ihren dicht bewimperten Augen in die untergehende Sonne oder den Regen.
Manchmal legte Beauty sich in ihrem Mantel direkt an der Mauer vom Lehmhaus nieder, und Harriet konnte sie atmen hören. An Henry Salt schrieb sie: Meine Nächte sind voller Seufzer – vom Wind und Beautys Atem und Josephs Sorgen. Und sie wusste, dass er, der Erdkundelehrer, begreifen würde, was dieser Satz war: keine Klage, sondern ein Stück Schilderung ihrer Welt. Ihr Brief wäre eine Art Landkarte für ihn; er würde Harriet in ihrem neuen Leben sehen und hören können. Am Ende des Briefs zeichnete sie für ihn die Gegenstände, die sie am meisten mochte: ihre Hacke, den Eselpflug, den Melkschemel, das Butterfass. Zu dem Fass schrieb sie:
Ich finde es so aufregend, auf die Butter zu warten. Diese erstaunliche Veränderung der Farbe! Ich glaube, mich haben schon immer alle Prozesse fasziniert, bei denen ein Ding sich in ein anderes verwandelt. Ich kann die Besessenheit der Alchimisten des Altertums gut verstehen.
Ganz allmählich füllte sich ihr Album. Zwischen den festen, steifen Seiten lagen hauchdünne, fast transparente Bögen, und manchmal betrachtete Harriet ihre Objekte durch das Seidenpapier, und dann wirkten sie, als wären sie schon fast verschwunden und Teil der Vergangenheit. Das Ahornblatt, das mitten in der Tasmanischen See auf die SS Albert heruntergesegelt war, verblasste und bröselte schon, das Etikett vom chinesischen Tee war leicht vergilbt, und die Königin-Viktoria-Briefmarken wirkten irgendwie angestaubt oder waren fleckig, als hätten sie eine beschwerliche Reise auf einem Brief hinter sich.
Auf die dritte Seite ihres Sammelalbums klebte Harriet ein Stück Kattun mit der Beschriftung »Ein Stück von unserer Wand«, einen Grundriss ihres Gemüsegartens, den spitzen, grünen Wedel einer Ti-Ti-Palme, eine braune Wekarallenfeder und eine Locke von Beautys Kopf. Sie klebte sie mit winzigen Tropfen von Lilians Porzellankleber ein. Unterdessen beobachtete sie, dass neben ihr auf der Kommode ein Spode-Teeservice, Scherbe für Scherbe, langsam wieder zusammenwuchs.
Was hätte sie wohl in ihrem alten Leben, in den zwölf Jahren als Gouvernante, in so einem Album gesammelt? Vielleicht Locken – nicht vom Kopf einer Kuh, die, im neuseeländischen Winter in einen Läufer gehüllt, so süß verrückt aussah –, sondern von den Köpfen ihrer englischen Zöglinge, Locken, die nachdunkelten, während die Kinder größer wurden, fort in Schulen geschickt wurden und sie vergaßen; Zeichnungen und Texte, auf die sie stolz waren; kleine Strickproben oder Läppchen mit Kreuzstich, die sie angefertigt hatten.
Und vielleicht eine einzelne Banknote, einen Zehnschillingschein, den Mr Melchior Gable ihr geschenkt hatte, damit sie sich Sommerhandschuhe kaufte, die sie tragen sollte, wenn sie die Bank am Tag der offenen Tür besuchte. An diesem Tag konnten die Besucher eine schöne Sammlung von Maßen und Gewichten, einige römische Münzen und frühe Beispiele von »Gables Nietundnagelfest« besichtigen, einem patentierten Messingschloss, das Diebe angeblich nicht knacken konnten. Aber Harriet war nicht unter den Besuchern gewesen. Der Zehnschillingschein hatte sich nicht auf wundersame Weise in ein Paar Handschuhe verwandelt. Mr Gables Liebesbriefe an sie waren als Stapel hinter einem gesprungenen Waschkrug verschwunden – versteckt vor der Welt und auch vor Harriet, die kein Bedürfnis hatte, sie erneut zu lesen, und die sie wenig später ins Feuer warf.
Sie hatte versucht, Melchior Gable diesen Schein zurückzugeben. Sie hatte ihn an die Bank geschickt, zusammen mit einer handgeschriebenen Ablehnung seines Heiratsantrags. Aber er war wieder zurückgekommen. Sie hatte ihren Vater gebeten, ihn an Gable zu schicken, was er getan hatte, aber erneut kam er zurück. Also bewahrte sie ihn in einer Schachtel auf und gab ihn nie aus. Hin und wieder betrachtete sie ihn – dieses Symbol eines anderen Lebens, eines Reichs, das sie nicht betreten hatte. Und dann, am Tag ihrer Heirat mit Joseph Blackstone, verbrannte sie ihn.
III
Immer wenn der Esel eine Pause brauchte, grub Joseph an seinem Teich.
Er stellte sich den Teich ganz ruhig vor, als einen Ort, den der Wind kaum berühren würde und um den herum sich schon bald Wald aus dem fernen Busch aussäen würde – sofern die Samen nicht fortgeweht wurden. Obwohl er sich Norfolker Weiden vorstellte, wäre er auch mit Ti-Ti-Bäumen und Manuka-Büschen vollkommen einverstanden.
Er hatte für den Teich eine Stelle in einer Senke zwischen den Hügeln ausgesucht. Ein langer, gewundener Graben musste ausgehoben werden, durch den das Wasser aus dem Harriet-Bach in den Teich eingeleitet würde. Wie das geschehen sollte, war Joseph noch nicht ganz klar, auf jeden Fall musste es am anderen Ende wieder hinaus. Jetzt hätte er gern etwas mehr von einem Ingenieur gehabt.
In ihre Stola gehüllt, sah Lilian Joseph bei der Arbeit zu. Die Erde war hart wie Holz. Lilian betrachtete seinen gestiefelten Fuß auf dem Spaten, hörte das wiederholte Klacken der Schuhnägel gegen den Spatenrand. Obwohl Joseph sehr groß war, wirkte er in der weiten Landschaft aus gelbem Gras eigenartig unwirklich, fast wie eine Gestalt, die ihrer Fantasie entsprungen war. Würde sie kurz weg- und wieder hinschauen, wäre er plötzlich nicht mehr da. Sie fragte sich, ob sie Joseph überhaupt jemals wirklich als den gesehen und verstanden hatte, der er war.
Denn wie war es möglich, dass der Joseph, den sie zu kennen glaubte – von dem kleinen Jungen im handgenähten Kleid bis zum schlaksigen jungen Mann mit rabenschwarzem Haar und einer herrischen Stimme –, jetzt plötzlich überzeugt war, seine und ihre Zukunft liege hier in dieser Graswüste? Wer hatte ihm diese absurde Idee in den Kopf gesetzt?
Es war ein Tag mit leichtem Wind und einem Wechsel zwischen Sonne und kurzen Schauern, die direkt aus einem leuchtenden Regenbogen zu fallen schienen. Zum ersten Mal seit langem blickte Lilian hoch zum Horizont. Sie liebte Regenbögen, da sie taten, was Gott ihnen befohlen hatte: »Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.« Doch diesen hier musterte sie kritisch, als würde ein neuseeländischer Regenbogen dem Gebot Gottes womöglich nicht ordentlich Folge leisten. Sie zählte die Farben, prüfte die Neigung des Bogens, bestimmte seine Helligkeit. Und sie hörte kaum hin, als Joseph ihr jetzt den Teich erklären wollte; sie war nur mit dem Regenbogen beschäftigt. Nach einer Weile entschied sie, dass er zu groß war: Seine gewaltigen Dimensionen ließen jegliche Demut vermissen. Mit halbem Ohr hörte sie Joseph sagen, im Frühling, wenn die grünen Triebe durch den Schlamm am Teichrand brächen, würden Stockenten und blaue Bergenten den Fluss verlassen, sich häuslich im Teich niederlassen und ihre hübschen Kreise ziehen. Sie fühlte sich zu einer Bemerkung bemüßigt. »Dein Teich muss sich doch nicht notwendig wie englische Teiche verhalten«, sagte sie.
Joseph drehte sich zu ihr um. »Was meinst du damit?«, fragte er.
»Ich meine, dass hier gar nichts so ist, wie man es sich vorgestellt hat«, erwiderte sie.
Auf ihrem Rückweg zum Lehmhaus tröstete Lilian sich mit dem Gedanken, dass sie inzwischen an einem Fluchtplan arbeitete. Der Plan war noch sehr vorläufig und baute viel zu sehr auf unwägbare Faktoren, aber es war ein Plan, und das war immerhin etwas. Es war wichtig, fand sie, im Leben immer einen Plan zu haben. Zum Beispiel hätte sie einen Plan für Rodericks möglichen Tod haben sollen, doch den gab es damals nicht, und jetzt hatte sie ihr altes Leben verloren und die tägliche Prise Hoffnung, die dazugehörte, ebenfalls.
Wenn sie gelegentlich über all das so ehrlich, wie es ihr möglich war, nachdachte, musste sie einräumen, dass dieses riesige leere Land mit seinem stürmischen Wetter und seinen billigen Grundstückspreisen für jemanden, der jung war – und auch Joseph war noch jung – und der sein Herz nicht allzu sehr an irgendetwas gehängt hatte, ein Versprechen sein mochte. Sie wusste, dass Joseph sich vorstellte, er wäre in sechs oder sieben Jahren der erfolgreiche Besitzer einer großen Farm, eines Hauses aus Stein und Holz mit einer Veranda wie bei Mrs Dinsdale und einer Hängematte zum Träumen. Sie wollte nicht ungerecht sein, denn er hatte nie behauptet, dass die ersten Monate ein Kinderspiel sein würden, und er hatte auch die richtige Frau für dieses harte Leben geheiratet. Tief im Innern bewunderte Lilian die feste Zuversicht ihres Sohnes und Harriets Zähigkeit. Zusammen sind die beiden nichts als Muskeln und Knochen und beharrlicher Wille, dachte sie, und wenn diese Eigenschaften etwas zählen, dann werden sie Erfolg haben.
Sie war aber ebenso fest überzeugt, dass es für die beiden sehr viel besser wäre, wenn sie all diese mühselige Arbeit ohne sie verrichten würden. Für Joseph und Harriet gab es hier eine Zukunft, und Lilian wusste durchaus, dass der Mensch das meiste, was er tut, auf einen Traum aufbaut, auf eine Zukunft hin ausrichtet, in der er glücklicher sein wird als in diesem Augenblick. Nur hatten Joseph und Harriet nicht bedacht, dass Lilian in ihrem Alter und an diesem Ort so wenig eine Zukunft hatte, dass sie genauso gut hätte tot sein können. Tage und Wochen und Jahre würden vergehen ohne ein Publikum für ihren Gesang. Die Winde würden in ihrem Kopf lärmen und ihre Gedanken verwirren. Ihr Porzellan würde wieder an denselben Stellen brechen, an denen sie es zusammengeklebt hatte. Sie würde allen Mut verlieren.
Deshalb versuchte sie, sich einen Plan zurechtzulegen.
Und als Joseph das nächste Mal mit Wagen und Esel nach Christchurch fuhr, um Vorräte zu kaufen, gab sie ihm einen Brief an Mrs Dinsdale mit. Sie erklärte Lily Dinsdale, dass sie einige Wertsachen besitze, die sie von ihrer Mutter, der Pfarrerswitwe, geerbt habe. Dazu gehörten, schrieb sie, ein schöner Elfenbeinfächer, Kamm und Bürste aus Schildpatt mit passendem Necessaire, eine Perlenschnur, eine Rubinbrosche und mehrere Ringe. Sie wolle diese Dinge ins Pfandhaus bringen (denn sie ging davon aus, dass es in Christchurch Pfandleiher gab, weil Siedler an einem neuen Ort stets Phasen von Armut durchstehen mussten) und mit dem erhaltenen Geld ihr altes Zimmer bei Mrs Dinsdale so lange mieten, bis sie eine Arbeit in der Stadt gefunden hätte.
Obwohl sie noch nie in ihrem Leben »auswärts« gearbeitet hatte, sah sie darin kein unüberwindliches Hindernis. Sie überlegte, ob man sie nicht möglicherweise in dem Bekleidungsgeschäft brauchen könnte, wo der Laura-McPherson-Gesangverein seine Proben abhielt. Sie hatte ein Talent zum Ordnen und Sortieren. Und daran fehlte es ganz eindeutig, wie ihr der Anblick all der Kartons in dem Lagerraum klargemacht hatte. Sie wusste nicht, wie viel eine Person ihres Standes für eine derartige Arbeit verlangen konnte, aber vermutlich würde es für das Leben in Christchurch reichen. Und sie hatte vor, dort zu bleiben. Sie würde nicht versuchen, übers weite Meer zurück nach England zu reisen. Ihr Haus in Parton Magna gab es nicht mehr, es war für Rodericks Spielschulden draufgegangen. Und bei der Vorstellung, eine Wohnung in England zu mieten, musste sie ganz plötzlich weinen. Immerhin würde sie in Christchurch in der Nähe der Küste sein. Sie würde wissen, welche Schiffe gerade aus der Alten Welt kamen und welche dorthin fuhren. Und während sie sich mit Mrs Dinsdale und Laura McPherson und deren Freundeskreis ein einigermaßen erträgliches Leben einrichtete, bliebe die Möglichkeit einer Rückkehr nach England stets in Sichtweite.
Lilian ging in ihr Zimmer, das natürlich gar kein richtiges Zimmer war, sondern nur eine Art Zelt im Haus ohne jede Privatsphäre, von wo sie alles hören konnte – wirklich alles –, was um sie herum vorging.
Sie holte ihren Fächer, den Kamm und die Bürste, das Necessaire und ihren Schmuck hervor und betrachtete alles. Es war eine hässliche Tatsache des Lebens, dass man für den Erwerb von etwas Wertvollem stets mehr bezahlen musste, als man gedacht hatte, und wenn man es wieder veräußern wollte, hatte sich der Wert stets auf geheimnisvolle Weise verflüchtigt. Aber wohin hatte er sich verflüchtigt? Lilian hätte gern in einer Gesellschaft gelebt, in der die Menschen die Antwort auf solche Fragen wussten.