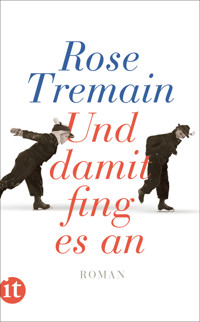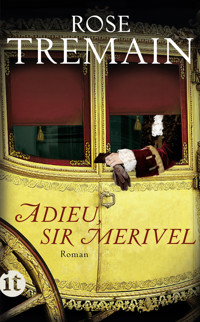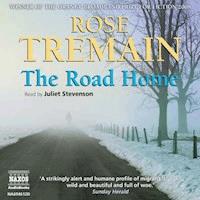10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lev ist ein Glückssucher: Er ist nach London gekommen, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Fremd und einsam denkt er zurück an seine jung verstorbene Frau Marina, seine kleine Tochter Maya und die verrückten Erlebnisse mit seinem Freund Rudi. Doch Lev ist entschlossen, sich eine Zukunft zu erkämpfen: Er entdeckt ein ungeahntes Talent, findet Freunde und sogar eine neue Liebe. Kraftvoll und klar, voller Menschlichkeit, Herzenswärme und befreiendem Humor erzählt Rose Tremain von einem, der akzeptieren muß, daß bei jedem Aufbruch etwas zurückbleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Lev ist ein Glückssucher: Aus seinem osteuropäischen Dorf ist er nach London aufgebrochen, um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Stadt ist ihm fremd – der Rhythmus des Lebens, die Sprache, die Ambitionen der Menschen. In seiner Einsamkeit denkt er zurück an seine geliebte, jung verstorbene Frau Marina, an seine kleine Tochter Maya und an die verrückten Erlebnisse mit seinem besten Freund Rudi. Doch Lev ist entschlossen, sich eine Zukunft zu erkämpfen: Er entdeckt ein ungeahntes Talent, er findet Freunde und sogar eine neue Liebe, er schickt Geld nach Hause. Und als ihn von dort schlechte Nachrichten erreichen, hat er eine große, eine abenteuerliche Idee …
Rose Tremain ist eine erfolgreiche und vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Sie lebt in London und Norwich. Nach Der weite Weg nach Hause erschienen 2011 Die Farbe der Träume, Roman (it 4002), und Der unausweichliche Tag, Roman (st 4220).
Rose Tremain
Der weite Weg nach Hause
Roman
Aus dem Englischen vonChristel Dormagen
Suhrkamp
Die englische Originalausgabe
The Road Home
erschien 2007 bei Chatto & Windus, London.
© Rose Tremain 2007
Umschlagfoto: Look-foto / Millennium Images
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Deutsche Erstausgabe
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels
eISBN 978-3-518-74120-7
www.suhrkamp.de
Inhalt
1 Wichtige Zigaretten
2 Die Diana-Karte
3 »Ein Mann mag weit reisen, aber sein Herz hält nicht Schritt«
4 Elektrisches Blau
5 Zwei Komma fünf Meter Abtropffläche aus Stahl
6 Elgars bescheidene Anfänge
7 Die Eidechsentätowierung
8 Notwendige Schocks
9 Wieso sollte ein Mann sich nicht für das Glück entscheiden?
10 »Die reinste Anarchie hier ...«
11 Rückwärts fließen
12 Ein Besuch im Museum für Rettungsboote
13 Der Höhepunkt
14 Hopp, hopp ...
15 Neun Uhr abends
16 Alle außer Hamlet ab
17 Das Nobelfräulein der Gemüsewelt
18 Fast wie ein Geruch
19 Das Zimmer der bunten Gläser
20 Darlehen für Träume
21 Fotos anschauen
22 Das letzte Biwak
23 Kommunistisches Essen
24 Podrorskystraße 43
Danksagung
Quellennachweise
»Wie sollen wir leben ohne unsere Leben?«John Steinbeck, Früchte des Zorns
Für Brenda und David Reidin großer Zuneigung
1Wichtige Zigaretten
Im Bus suchte Lev sich einen Platz ganz hinten, und er lehnte sich ans Fenster und starrte hinaus auf das Land, das er verließ: auf die vom trockenen Wind verdorrten Sonnenblumenfelder, die Schweinefarmen, die Steinbrüche und Flüsse und auf den wilden Knoblauch, der grün am Straßenrand wuchs.
Lev trug eine Lederjacke und Jeans und eine tief ins Gesicht gezogene Lederkappe, sein hübsches Gesicht war grau vom Rauchen, und in seinen Händen hielt er ein altes rotes Baumwolltaschentuch und ein zerdrücktes Päckchen russischer Zigaretten. Bald würde er 43 Jahre alt sein.
Nach einigen Kilometern, die Sonne ging gerade auf, zog Lev eine Zigarette heraus und steckte sie sich zwischen die Lippen, und die Frau, die neben ihm saß, eine pummelige, zurückhaltende Person mit Leberflecken im Gesicht, die wie Schmutzspritzer aussahen, sagte sofort: »Entschuldigen Sie, aber in diesem Bus ist Rauchen nicht erlaubt.«
Das wusste Lev, hatte es schon im Voraus gewusst und versucht, sich seelisch auf die lange Qual vorzubereiten. Aber selbst eine unangezündete Zigarette war eine Gefährtin − etwas zum Festhalten, ein Versprechen −, und das einzige, wozu er sich jetzt bereit fand, war, zu nicken, einfach um der Frau zu zeigen, dass er sie verstanden hatte, um ihr zu signalisieren, dass er keinen Ärger machen würde; denn sie würden noch fünfzig Stunden oder länger nebeneinander sitzen müssen, mit ihren jeweiligen Schmerzen und Träumen, wie ein verheiratetes Paar. Sie würden einander schnarchen oder seufzen hören, würden riechen, was beide zu essen und zu trinken mitgenommen hatten, spüren, wie groß ihre Furcht oder ihre Unbekümmertheit war, würden kleine Unterhaltungsversuche wagen. Und später, wenn sie endlich in London angekommen wären, würden sie sich wahrscheinlich fast ohne Worte oder Blicke trennen, würden, jeder für sich, in einen regnerischen Morgen hinaustreten und ein neues Leben beginnen. Und Lev wusste, dass all dies seltsam, aber notwendig war und ihm schon etwas über die Welt verriet, in die er fuhr, eine Welt, in der er bis zum Umfallen arbeiten würde − wenn sich denn eine solche Arbeit finden ließ. Er würde sich von anderen Menschen fernhalten, würde Ecken und Winkel finden, wo er sitzen und rauchen könnte, würde zeigen, dass er keine neue Heimat brauchte, dass sein Herz in seinem eigenen Land blieb.
Es gab zwei Busfahrer. Diese Männer würden sich mit Fahren und Schlafen abwechseln. Es gab eine Bordtoilette, weshalb der Bus nur zum Tanken haltmachen würde. An den Tankstellen würden die Passagiere vielleicht aussteigen, ein paar Schritte tun, Wildblumen an einem Seitenstreifen, schmutziges Papier in den Büschen, Sonne oder Regen auf der Straße betrachten. Sie würden die Arme recken, dunkle Brillen gegen den Ansturm natürlichen Lichts aufsetzen, nach einem Kleeblatt Ausschau halten, rauchen oder vorbeifahrende Autos anstarren. Dann würden sie zurück in den Bus getrieben werden, würden ihre alten Haltungen wieder einnehmen, sich wappnen gegen die nächsten paar hundert Kilometer, gegen den Gestank eines weiteren Industriegebiets oder das plötzliche Aufglänzen eines Sees, gegen Regen und Sonnenuntergang und das Nahen der Dunkelheit über stillem Sumpfland. Zwischendurch würde es Zeiten geben, in denen die Reise scheinbar kein Ende nehmen würde.
Im Sitzen zu schlafen war etwas, das Lev nicht gewohnt war. Die Alten schienen es zu können, aber 42 war noch nicht alt. Levs Vater Stefan hatte manchmal im Sitzen geschlafen, im Sommer, auf einem harten Holzstuhl, während seiner Mittagspause in der Baryner Sägemühle, wenn die Sonne auf die in Papier gewickelten Wurstscheiben auf seinem Knie und seine Thermoskanne mit Tee brannte. Stefan und Lev konnten beide ausgestreckt auf einem Heuhaufen oder einem Moosteppich im Wald schlafen. Häufig hatte Lev auf einem Flickenteppich neben dem Bett seiner Tochter geschlafen, wenn sie krank war oder sich fürchtete. Und als seine Frau Marina im Sterben lag, hatte er fünf Nächte lang zwischen Marinas Krankenhausbett und einem Vorhang mit rosa- und lilafarbenen Gänseblümchen geschlafen, auf einem Stück Linoleum, nicht breiter als sein ausgestreckter Arm, und der Schlaf war auf eine verwirrende Weise gekommen und gegangen und hatte seltsame Bilder in Levs Gehirn gemalt, die nie ganz verschwunden waren.
Gegen Abend, nach dem zweiten Tanken, wickelte die leberfleckige Frau ein hart gekochtes Ei aus. Sie pellte es schweigend. Der Eigeruch erinnerte Lev an den schwefligen Frühling in Jor, wohin er mit Marina gefahren war, für den Fall, dass die Natur heilen könnte, was der Mensch endgültig aufgegeben hatte. Marina hatte ihren Körper gehorsam in das schaumige Wasser getaucht, hatte dagelegen und beobachtet, wie die Störchin in ihr hohes Nest zurückkehrte, und zu Lev gesagt: »Wenn wir doch Störche wären.«
»Warum sagst du das?« hatte Lev gefragt.
»Weil man nie Störche sterben sieht. Es ist, als stürben sie nicht.«
Wenn wir doch Störche wären.
Auf den Knien der Frau war eine saubere Baumwollserviette ausgebreitet, und mit ihren weißen Händen strich sie sie glatt und packte Roggenbrot und etwas Salz aus.
»Ich heiße Lev«, sagte Lev.
»Ich heiße Lydia«, sagte die Frau. Und sie schüttelten einander die Hand, Lev hielt in seiner noch das zusammengeknüllte Taschentuch, und Lydias war ganz rau vom Salz und roch nach Ei, und dann fragte Lev: »Was haben Sie in England vor?«, und Lydia sagte: »Ich habe ein paar Vorstellungsgespräche für eine Stelle als Übersetzerin.«
»Das klingt vielversprechend.«
»Hoffentlich. Ich habe an der Schule 237 in Yarbl Englisch unterrichtet, deshalb spreche ich es fließend.«
Lev schaute Lydia an. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie sie vor einer Klasse stand und Wörter an die Tafel schrieb. Er sagte: »Aber wieso verlassen Sie dann unser Land, wenn Sie an der Schule 237 in Yarbl eine gute Stelle hatten?«
»Ach«, sagte Lydia, »ich war den Blick aus meinem Fenster so leid. Jeden Tag, im Sommer wie im Winter, sah ich auf den Schulhof und den hohen Zaun und den Wohnblock dahinter, und ich fing an, mir auszumalen, dass ich das alles noch im Sterben sehen würde, und das wollte ich nicht. Sie verstehen sicher, was ich meine?«
Lev nahm seine Lederkappe ab und fuhr sich mit den Fingern durch sein dichtes graues Haar. Er sah, wie Lydia sich für einen Moment zu ihm hindrehte und ihm sehr ernst in die Augen blickte. Er sagte: »Ja, das verstehe ich.«
Dann schwiegen beide, während Lydia ihr hart gekochtes Ei aß. Sie kaute sehr leise. Als sie aufgegessen hatte, sagte Lev: »Mein Englisch ist gar nicht so schlecht. Ich habe in Baryn Stunden genommen, aber mein Lehrer meinte, meine Betonung sei nicht besonders gut. Darf ich ein paar Wörter sagen, und Sie sagen mir, ob ich sie korrekt ausspreche?«
»Ja, natürlich«, sagte Lydia.
Lev sagte auf Englisch: »Herrlich. Entschuldigung. Ich bin legal. Wie viel kostet das, bitte? Vielen Dank. Was können Sie für mich tun?«
»Was kann ich für Sie tun«, verbesserte Lydia.
»Was kann ich für Sie tun«, wiederholte Lev.
»Fahren Sie fort«, sagte Lydia.
»Storch«, sagte Lev. »Storchennest. Regen. Ich habe mich verirrt. Ich brauche einen Übersetzer. Bier und Bier.«
»Bier und Bier?« sagte Lydia. »Nein, nein. Sie meinen wohl ›bye-bye‹, auf Wiedersehen.«
»Nein«, sagte Lev. »Bier und Bier. Familienpension, ziemlich billig.«
»Ach ja, richtig. B & B, die Frühstückspensionen.«
Lev konnte jetzt sehen, wie es hinter dem Fenster immer dunkler wurde, und er dachte daran, wie die Dunkelheit auf immer dieselbe Weise in sein Dorf gekommen war, aus derselben Richtung, über dieselben Bäume, ob früh oder spät, ob im Sommer, Winter oder Frühling, sein ganzes Leben lang. So wie dort in Auror würde der Einbruch der Dunkelheit − in Levs Herz − für immer aussehen.
Und deshalb erzählte er Lydia, dass er aus Auror komme, in der Baryner Sägemühle gearbeitet habe, bis die vor zwei Jahren schloss, und dass er seitdem überhaupt keine Arbeit mehr gefunden habe und seine Familie − seine Mutter, seine fünfjährige Tochter und er − von dem Geld lebe, das seine Mutter mit dem Verkauf von Schmuck aus Blech verdiene.
»Oh«, sagte Lydia. »Wie erfinderisch, Schmuck aus Blech zu machen.«
»Ja, schon«, sagte Lev. »Aber es reicht nicht.«
In seinem Stiefel steckte eine kleine Flasche Wodka. Er zog die Flasche heraus und nahm einen tiefen Schluck. Lydia aß weiter ihr Roggenbrot. Lev wischte sich den Mund mit dem roten Taschentuch ab und sah, dass sein Gesicht sich in der Fensterscheibe spiegelte. Er schaute weg. Seit Marinas Tod mochte er sein Spiegelbild nicht mehr, denn stets erblickte er darin nur seine Schuld, selbst noch am Leben zu sein.
»Warum hat die Sägemühle in Baryn geschlossen?«, fragte Lydia.
»Ihnen gingen die Bäume aus«, sagte Lev.
»Wie furchtbar«, sagte Lydia. »Was können Sie denn sonst noch?«
Lev nahm einen weiteren Schluck. Jemand hatte ihm erzählt, in England sei der Wodka zu teuer zum Trinken. Immigranten würden ihren eigenen Alkohol aus Kartoffeln und Leitungswasser brauen, und während Lev über diese fleißigen Immigranten nachsann, malte er sich aus, wie sie in einem großen Haus um ein Feuer im Kamin saßen, redeten und lachten, während draußen vor dem Fenster der Regen fiel und rote Busse vorbeifuhren und der Fernseher in einer Zimmerecke flimmerte. Er seufzte und sagte: »Ich werde jede Arbeit machen. Meine Tochter Maya braucht Kleidung, Schuhe, Bücher, Spielzeug, alles. England ist meine Hoffnung.«
Gegen zehn Uhr wurden rote Decken an die Busreisenden verteilt, einige schliefen da schon. Lydia packte ihre Essensreste weg, hüllte sich in die Decke, knipste über ihrem Kopf ein kleines, helles Licht unter der Gepäckablage an und begann, in einem vergilbten, alten englischen Taschenbuch zu lesen. Lev sah, dass der Titel ihres Buchs The Power and the Glory lautete. Seit er den Wodka getrunken hatte, war sein Bedürfnis nach einer Zigarette ständig gewachsen, und jetzt war es dringend. Er konnte die Gier in seiner Lunge und in seinem Blut fühlen, und seine Hände wurden unruhig, und er spürte ein Zittern in den Beinen. Wie lange dauerte es noch, bis sie wieder tanken mussten? Es konnten noch vier oder fünf Stunden sein. Bis dahin würden alle im Bus schlafen, außer ihm und einem der beiden Fahrer. Sie allein würden eine einsame, ermüdende Nachtwache halten, der Fahrer angestrengt auf die Launen und Störungen der dunklen, vor ihm sich abspulenden Straße achtend; er selbst den Trost von Nikotin oder Vergessen ersehnend − und beides vergeblich.
Er beneidete Lydia, die in ihr englisches Buch versunken war. Lev wusste, dass er sich mit irgendetwas ablenken musste. Er hatte ein Buch mit Fabeln eingepackt: unwahrscheinliche Geschichten, die er einmal geliebt hatte und die von Frauen handelten, die sich während nächtlicher Stunden in Vögel verwandelten, und von einem Trupp wilder Eber, die ihre Jäger töteten und brieten. Aber Lev war zu aufgeregt, um solche phantastischen Sachen zu lesen. In seiner Verzweiflung zog er einen nagelneuen britischen Zwanzigpfundschein aus seiner Brieftasche, langte nach oben, knipste sein eigenes kleines Leselicht an und begann, den Schein zu untersuchen. Auf der einen Seite die vertrocknete Königin, E II R, mit ihrem Diadem, das Gesicht grau auf violettem Grund, und auf der anderen ein Mann, irgendeine Persönlichkeit aus der Vergangenheit mit einem dunklen, buschigen Schnurrbart, und über ihm ein Engel, der Trompete spielte, und aller Glanz des Engels fiel in senkrechten Strahlen auf ihn. »Die Engländer sind stolz auf die Geschichte ihres Landes«, hatte Lev in seinem Englischunterricht erfahren, »vor allem, weil sie nie von einer fremden Macht unterworfen wurden. Nur ab und an dämmert ihnen, dass einige ihrer vergangenen Taten nicht gut waren.«
Die auf dem Geldschein angegebenen Lebensdaten des Mannes lauteten 1857−1934. Er sah aus wie ein Bankier, aber was hatte er getan, um im 21. Jahrhundert auf einem Zwanzigpfundschein zu landen? Lev starrte auf sein entschlossenes Kinn, blickte, angestrengt blinzelnd, auf den unter dem Kragen hingekritzelten Namen, konnte ihn aber nicht lesen. Er dachte, dass dieser Mensch bestimmt nie ein anderes System als den Kapitalismus gekannt hatte. Er mochte die Namen Hitler und Stalin gehört haben, aber ohne sich zu fürchten − er hätte auch nichts zu befürchten gehabt, außer den Verlust von etwas Kapital bei dem, was die Amerikaner den Crash nannten, damals, als Menschen in New York aus Fenstern und von Dächern sprangen. Er war wahrscheinlich in seinem Bett gestorben, bevor London von Bomben zerstört, bevor Europa auseinandergerissen wurde. Bestimmt hatten die Strahlen des Engels die Stirn dieses Mannes und seine altmodische Kleidung bis zum Ende seiner Tage beschienen, da die ganze Welt doch wusste: Die Engländer habenGlück. Aber, dachte Lev, jetzt fahre ich in ihr Land, und ich werde sie zwingen, es mit mir zu teilen: ihr verteufeltes Glück. Ich habe Auror verlassen, und dieser Abschied von meiner Heimat war hart und bitter, aber meine Zeit wird kommen.
Lev wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Lydias Buch auf den Boden fiel, und er schaute zu ihr und sah, dass sie eingeschlafen war, und er studierte ihr von Leberflecken heimgesuchtes Gesicht. Er schätzte sie auf ungefähr 39. Sie schien entspannt zu schlafen. Er stellte sich vor, wie sie in einer Kabine saß, Kopfhörer über ihr mausgraues Haar geklemmt, strahlend und hellwach, beim unerbittlichen Simultandolmetschen. Was können Sie für mich tun. Nein. Was kann ich für Sie tun.
Als die Nacht vorrückte, beschloss Lev, sich versuchsweise an bestimmte wichtige Zigaretten aus der Vergangenheit zu erinnern. Er besaß eine lebhafte Phantasie. In der Baryner Sägemühle hatte man ihn abschätzig einen »Träumer« genannt. »Das Leben ist nicht zum Träumen da, Lev«, hatte sein Chef ihn gewarnt. »Träumen führt zu Subversion.« Lev wusste, dass er ein empfindsames Naturell besaß, leicht abzulenken war und wegen der seltsamsten kleinen Dinge schnell fröhlich oder melancholisch wurde und dass diese Veranlagung seine Kindheit und Jugend geprägt und ihn womöglich als erwachsenen Mann daran gehindert hatte, mit dem Leben gut zurechtzukommen. Besonders seitdem Marina nicht mehr da war. Weil ihr Tod ihn jetzt ständig begleitete, wie ein Schatten auf einem Röntgenbild seiner Seele. Andere Männer wären vielleicht in der Lage gewesen, diesen Schatten zu verjagen − mit Trinken oder mit jungen Frauen oder mit dem neuen Reiz des Geldverdienens −, aber Lev hatte es nicht einmal versucht. Er wusste, dass er noch nicht fähig war, Marina zu vergessen.
Überall im Bus dösten die Reisenden. Einige waren zum Gang hin gesackt, mit herunterhängenden Armen, in einer Geste der Kapitulation. Ständig wurde irgendwo geseufzt. Lev zog die Kappe noch tiefer ins Gesicht und beschloss, sich an das zu erinnern, was seine Mutter Ina und er »das Weihnachtsstern-Wunder« genannt hatten, weil es sich um eine Geschichte handelte, die zu einem guten Ende führte, zu einer Zigarette, so makellos wie die Liebe.
Ina war eine Frau, die sich nie gestattete, ihr Herz an etwas zu hängen, denn, so sagte sie häufig: »Wozu, wenn das Leben einem alles wieder nimmt?« Aber ein paar Dinge gab es doch, die ihr Freude machten, und dazu gehörten Weihnachtssterne. Die scharlachroten Blätter, die tannenbaumartige Form und die Tatsache, dass sie eher einem exquisiten Kunstwerk als einer lebenden Pflanze ähnelten, weckten in Ina eine sachliche Bewunderung für ihre befremdliche Einzigartigkeit und ihre scheinbare Beständigkeit in einer Welt des ununterbrochenen Vergehens und Sterbens von Dingen.
Vor einigen Jahren, kurz vor Inas 65. Geburtstag, war Lev eines Sonntagmorgens sehr früh aufgestanden und mit dem Rad vierzig Kilometer bis Yarbl gefahren, wo hinter dem Bahnhof auf einem Markt unter freiem Himmel Blumen und Pflanzen verkauft wurden. Es war ein beinah herbstlicher Tag, und auf die schweigenden Gestalten, die ihre Stände aufbauten, fiel ein zartes Licht. Lev sah vom Bahnhofsimbiss aus zu, rauchte und trank Kaffee und Wodka. Dann trat er ins Freie hinaus und begann, sich nach Weihnachtssternen umzuschauen.
Das meiste, was auf dem Yarbler Markt verkauft wurde, waren Nutzpflanzen: Kohlstecklinge, Sonnenblumensamen, Kartoffelschösslinge, Johannisbeerbüsche, Heidelbeerstöcke. Aber immer mehr Menschen entsannen sich ihrer halbvergessenen Vorliebe für nutzlose Dinge, und das Angebot an Zierpflanzen stieg von Jahr zu Jahr.
Weihnachtssterne waren schon aus der Ferne zu erkennen. Lev bewegte sich langsam und achtete auf Rot. Die Sonne beschien seine abgewetzten schwarzen Schuhe. Ihm war seltsam leicht zumute. Seine Mutter würde 65 Jahre alt werden, und er würde sie überraschen und in Erstaunen versetzen, indem er ihr einen Kübel mit Weihnachtssternen auf die Veranda stellte, und abends würde Ina dort sitzen und stricken und sie bewundern, und die Nachbarn würden kommen und ihr gratulieren − zu den Blumen und zu ihrem Sohn, der sich so viel Mühe gemacht hatte.
Doch es gab keine Weihnachtssterne auf dem Markt. Er marschierte auf und ab und starrte niedergeschlagen auf Möhrengrün, auf Zwiebelbündel, auf Plastiktüten, gefüllt mit Schweinemist und Asche.
Keine Weihnachtssterne.
Allmählich dämmerte Lev das Ausmaß der Katastrophe. Und so lief er von neuem die Reihe der Stände ab, blieb hier und da stehen und bedrängte die Standbesitzer und merkte, dass dieses Bedrängen etwas Anklagendes hatte, den Leuten unterstellte, sie seien Schwarzhändler, die die roten Pflanzen unter den Tapeziertischen versteckt hielten und auf Käufer warteten, die amerikanische Dollars oder Motorteile oder Drogen boten.
»Ich brauche unbedingt Weihnachtssterne«, hörte er sich sagen, wie ein vor Durst völlig ausgetrockneter Erwachsener oder ein bockiges Einzelkind.
»Tut mir leid, Kamerad«, sagten die Händler. »Nur zu Weihnachten.«
Ihm blieb nichts anderes übrig, als nach Auror zurückzuradeln. Hinter seinem Rad zog er einen selbstgebauten Anhänger (aus Holzresten, vom Baryner Holzhof stibitzt), und die Räder dieses Anhängers quietschten spöttisch, während er Kilometer um Kilometer hinter sich ließ. Die gähnende Leere von Inas 65. Geburtstag kam Lev vor wie ein verlassenes Bergwerk.
Lev bewegte sich vorsichtig in seinem Sitz und versuchte, Lydias Schlaf nicht zu stören. Er lehnte seinen Kopf an die kühle Fensterscheibe. Dann musste er an das Bild denken, das ihn damals am Straßenrand irgendeines verlorenen Dorfs empfangen hatte: eine alte Frau in Schwarz, schweigend auf einem Stuhl vor ihrem Haus, und neben ihr ein Plastikkinderwagen mit einem schlafenden Baby darin. Und zu ihren Füßen ein Sammelsurium von Dingen zum Verkauf: ein Grammophon, ein paar Waagen und Gewichte, ein bestickter Schal, ein lederner Blasebalg. Und ein Karren voller Weihnachtssterne, mit Blättern, die sich gerade rot färbten.
Lev hatte auf dem Rad geschlingert und sich gefragt, ob er träume. Er setzte einen Fuß auf die staubige Straße. »Das sind Weihnachtssterne, Großmütterchen, oder?«
»Heißen die so? Ich nenne sie rote Fahnen.«
Er kaufte sie alle. Der Anhänger war übervoll und schwer. Sein Geld war weg.
Er versteckte sie unter Säcken, bis es dunkel war, pflanzte sie bei Sternenlicht in Inas Kübel und blieb daneben stehen und sah zu, wie der Tag anbrach, und als die Sonne auf die Pflanzen traf, verstärkte sich das Rot ihrer Blätter auf das Erstaunlichste, so wie Wüstenkrokusse nach einem Regen aufblühen. Und das war der Moment, als Lev sich eine Zigarette ansteckte. Er ließ sich auf den Stufen von Inas Veranda nieder und rauchte und schaute die Weihnachtssterne an, und die Zigarette war wie leuchtender Bernstein in ihm, und er rauchte sie bis auf den letzten Zentimeter und drückte sie dann aus, hielt sie aber weiter fest in seiner schmutzigen Hand.
Endlich schlief Lev dann doch.
Er erwachte, als der Bus zum Tanken hielt, irgendwo in Österreich, wie er vermutete, da die Tankstelle groß und hell war und an der einen Seite auf einem offenen Gelände eine stumme Versammlung von Lastwagen mit deutschen Aufschriften parkte, die von orangefarbenem Natriumlicht beschienen wurden. Freuhof, Bosch. Grunewald. Königstransporte ...
Lydia war wach, und gemeinsam stiegen Lev und sie aus dem Bus und atmeten die kühle Nachtluft. Lydia legte sich eine Strickjacke um die Schultern. Lev suchte am Himmel nach Anzeichen der Morgendämmerung, konnte aber keine entdecken. Er zündete sich eine Zigarette an. Seine Hände zitterten auf dem Weg zum und vom Mund.
»Es wird kalt sein in England«, sagte Lydia. »Sind Sie darauf vorbereitet?«
Lev dachte an sein imaginäres großes Haus mit dem fallenden Regen und dem flimmernden Fernseher und den vorbeifahrenden roten Bussen.
»Ich weiß nicht«, sagte er.
»Wenn der Winter kommt«, sagte Lydia, »wird es ein Schock für uns sein.«
»Unsere Winter sind doch auch kalt«, sagte Lev.
»Ja, aber nicht so lang. Ich habe gehört, dass in England manche Winter nie ganz aufhören.«
»Heißt das, es gibt keinen Sommer?«
»Doch, es gibt Sommer. Aber man spürt ihn nicht im Blut.«
Andere Reisende aus dem Bus wanderten auf der Tankstelle umher. Einige suchten die Waschräume auf. Andere standen, genau wie Lev und Lydia, einfach da, leicht zitternd, Zuschauer, die nicht recht wussten, was sie eigentlich sahen, Angekommene, die noch nicht angekommen waren, alle auf der Durchreise und unsicher, welche Zeit ihre Uhren jetzt anzeigen sollten. Hinter dem Areal mit den parkenden Lastwagen lag die tiefe, undurchdringliche Dunkelheit der Bäume.
Lev hatte plötzlich Lust, seiner Tochter Maya eine Postkarte von hier zu schicken, um ihr dieses nächtliche Zwischenreich zu beschreiben: den Natriumhimmel, die reglosen Bäume, den grellen Schein der Telefonzelle, die Menschen, die wie Besucher einer Kunstgalerie wirkten, ratlos vor unerklärlichen Ausstellungsstücken. Aber Maya war zu jung, um irgendetwas davon zu begreifen. Sie war erst fünf. Morgen früh würde sie Inas Hand nehmen und zur Schule gehen. Mittags würde sie kalte Wurst und Mohnbrot essen. Wenn sie nach Hause kam, würde Ina ihr Ziegenmilch mit Zimt in einem gelben Glas und Rosinenbrot mit Rosenblütenmarmelade servieren. Sie würde am Küchentisch ihre Schulaufgaben machen, danach hinaus auf die Dorfstraße von Auror laufen, um ihre Freunde zu treffen, und sie würden mit den Ziegen und Hühnern im Staub spielen.
»Mir fehlt meine Tochter schon jetzt«, sagte Lev zu Lydia.
Als der Bus die Grenze zwischen Deutschland und Holland überquerte, hatte Lev sich längst allem ergeben: seinem schmalen Platz am Fenster; dem ewigen Summen der Klimaanlage; der stillen Anwesenheit von Lydia, die ihm Eier und getrocknete Früchte und Schokoladenstückchen anbot; dem Geruch und den Stimmen der anderen Reisenden; dem Chemiegestank der Bordtoilette; dem Gefühl, langsam große Entfernungen zurückzulegen, immer in eine Richtung.
Während Lev die flachen Felder und die schimmernden Pappeln, die Kanäle und Windmühlen und Dörfer und grasenden Tiere der Niederlande vorbeiziehen sah, fühlte er sich so friedlich und ruhig, als wäre der Bus inzwischen sein Leben und niemand würde von ihm verlangen, die Starre dieses Busdaseins jemals zu beenden. Er wünschte sich, Europa wäre größer, so dass er noch viele Tage bei seinen Landschaften verweilen könnte, bis irgendetwas in ihm sich veränderte, bis hart gekochte Eier und der Anblick von Vieh auf grünen Weiden ihn anödeten und der Wille, sein Ziel zu erreichen, wieder in ihm erwachte.
Er wusste, dass diese wachsende Apathie gefährlich war. Er wünschte sich, sein bester Freund Rudi wäre bei ihm. Rudi gab nie klein bei, und er hätte sich auch dem Opium der dahinziehenden Kilometer nicht ergeben. »Das Leben ist nur ein System«, hatte Rudi ihn häufig erinnert. »Es kommt allein darauf an, es zu knacken.« Beim Schlafen lag Rudi zusammengekrümmt da und hatte die Fäuste, wie ein Boxer, vor der Brust geballt. Wenn er aufwachte, sprang er hoch und stieß das Bettzeug beiseite. Sein wildes dunkles Haar leuchtete mit dem ihm eigenen unbesiegbaren Glanz. Er liebte Wodka und Kino und Fußball. Er träumte davon, ein, wie er es nannte, »ernstzunehmendes Auto« zu besitzen. Im Bus hätte Rudi Lieder gesungen und im Gang Volkstänze aufgeführt und mit anderen Reisenden gehandelt. Er hätte widerstanden.
Wie Lev war Rudi Kettenraucher. Nach der Schließung der Sägemühle hatten sie einmal gemeinsam eine rauchgeschwängerte Fahrt zur fernen Stadt Glic unternommen, mitten in der purpurnen Kälte des Winters, als die Sonne tief zwischen den kahlen Bäumen hing und das Eis auf den Schienen wie ein diamantener Überzug aussah und Rudis Taschen randvoll mit Schwarzgeld waren und in seinem Koffer elf in Stroh gebettete Wodkaflaschen lagen.
Das Gerücht von einem zum Verkauf stehenden amerikanischen Auto, einem Chevrolet Phoenix, hatte Rudi in Auror erreicht. Hingerissen beschrieb Rudi dieses Auto und nannte es »Tschewi«. Er sagte, der Tschewi sei blau und weiß und chromverziert und habe erst 380 000 Kilometer auf dem Buckel und er werde nach Glic reisen und ihn anschauen, und wenn er den Besitzer im Preis herunterhandeln könne, dann werde er ihn verdammt noch mal kaufen und nach Hause fahren. Die Tatsache, dass Rudi vorher noch nie ein Auto gefahren hatte, kümmerte ihn überhaupt nicht. »Wieso auch?«, sagte er zu Lev. »In der Sägemühle habe ich jeden einzelnen Scheißtag meines Lebens einen Gabelstapler gefahren. Fahren ist Fahren. Und bei amerikanischen Wagen musst du dich nicht mal um Gänge kümmern. Du haust einfach den Knüppel in die ›D-for-drive‹-Stellung, und los geht’s.«
Im Zug war es heiß gewesen, da ein dickes Heizrohr direkt unter den Sitzen entlanglief. Lev und Rudi hatten ein Abteil für sich. Sie stopften ihre Schafwollmäntel und Pelzmützen ins Gepäcknetz und öffneten den Wodkakoffer und hörten Musik aus einem winzigen, scheppernden Radio. Der heiße Wodkamief im Waggon war herrlich und verrückt. Bald schon fühlten sie sich so verwegen wie Söldner. Als der Schaffner kam, küssten sie ihn auf beide Wangen.
Beim Aussteigen in Glic gerieten sie in einen Schneesturm, aber ihr Blut war noch heiß, und so kam der Schnee ihnen köstlich vor, als würde die Hand eines jungen Mädchens ihre Gesichter streicheln, und sie stolperten lachend durch die Straßen. Inzwischen brach die Nacht herein, und Rudi verkündete: »In der Scheißdunkelheit gucke ich mir den Tschewi nicht an. Ich möchte ihn strahlen sehen.« Also machten sie beim ersten bescheidenen Gasthaus, das sie fanden, halt und stillten ihren Hunger mit Schüsseln voller Gulasch und Klößen und übernachteten in einem engen Raum, der nach Mottenkugeln und Bohnerwachs roch, und rührten sich nicht bis zum nächsten Morgen.
Die Sonne stand hoch an einem klaren blauen Himmel, als Lev und Rudi das Haus des Tschewi-Besitzers fanden. Überall lag hoher, sauberer Schnee. Und da stand er, allein in der schäbigen Straße, unter einer einzelnen Linde, in seiner ganzen außerordentlichen Länge und Massigkeit, ein uralter himmelblauer Chevrolet Phoenix mit weißen Heckflossen und glänzender Chromverzierung; und Rudi fiel auf die Knie. »Das ist mein Mädchen«, sagte er. »Das ist mein Baby!«
Er hatte seine Unvollkommenheiten. Ein Scharnier der Fahrertür war durchgerostet. Die Gummiblätter der Scheibenwischer hatten sich in vielen kalten Wintern fast vollkommen verschlissen. Alle vier Reifen waren abgefahren. Das Radio funktionierte nicht.
Lev sah, wie Rudi zögerte. Er ging immer wieder um den Wagen herum, fuhr mit der Hand über die Karosserie, wischte Schnee vom Dach, untersuchte die Wischblätter, trat gegen die Reifen, öffnete und schloss die kaputte Tür. Dann sah er hoch und sagte: »Ich nehme ihn.« Anschließend begann er zu feilschen, aber der Besitzer merkte, wie sehr Rudi den Wagen haben wollte, und weigerte sich, mehr als nur ein winziges bisschen mit dem Preis herunterzugehen. Der Tschewi kostete Rudi alles, was er bei sich hatte, inklusive seines Schafwollmantels und seiner Pelzmütze und fünf der acht Wodkaflaschen, die noch im Koffer lagen. Der Besitzer war ein Mathematikprofessor.
»Ich wüsste gern, woran Sie gerade denken«, sagte eine Stimme. Und es war Lydia, die jetzt ihre neue Beschäftigung unterbrach, das Stricken.
Lev starrte sie an. Er dachte, dass es lange her war, seit ihn irgendjemand so etwas gefragt hatte. Oder vielleicht hatte ihn das noch nie jemand gefragt, weil Marina immer zu wissen schien, was in seinem Kopf vorging, und stets versucht hatte, sich auf das, was sie dort vorfand, einzustellen.
»Ach«, sagte Lev, »ich habe an meinen Freund Rudi gedacht und wie ich damals mit ihm nach Glic gefahren bin, um ein amerikanisches Auto zu kaufen.«
»Oh«, sagte Lydia. »Dann ist er reich, Ihr Freund Rudi?«
»Nein«, sagte Lev. »Oder nie für lange. Aber er handelt gern.«
»Handeln ist schlecht«, sagte Lydia naserümpfend. »Wir werden nie Fortschritte machen, solange es den Schwarzhandel gibt. Aber erzählen Sie mir von dem Auto. Hat er es bekommen?«
»Ja«, sagte Lev. »Das hat er. Was stricken Sie da?«
»Einen Pullover«, sagte Lydia. »Für den englischen Winter. Die Engländer nennen dieses Kleidungsstück ›Jumper‹, also Hüpfer.«
»Jumper?«
»Ja. Da haben Sie noch ein Wort. Erzählen Sie mir von Rudi und dem Auto.«
Lev holte seine Wodkaflasche heraus und nahm einen Schluck. Dann erzählte er Lydia, dass Rudi, nachdem er den Tschewi gekauft hatte, ein paar Mal durch die leeren Straßen des Wohnblocks gefahren war, um das Lenken zu üben, während der Mathematikprofessor, eine Astrachanmütze auf dem Kopf, mit amüsierter Miene von seinem Hauseingang aus zuschaute.
Dann hatten Lev und Rudi sich auf den Heimweg gemacht, die Sonne schien auf die stille, eisige Welt herab, und Rudi drehte die Wagenheizung voll auf und sagte, näher ans Paradies könne er nicht kommen. Der Motor machte tiefe, grollende Geräusche wie ein Schiffsmotor, und Rudi sagte, das sei der Klang Amerikas, melodisch und kraftvoll. Im Handschuhfach fand Rudi drei Tafeln Schweizer Schokolade, die vor Alter schon ganz bleich waren, und die aßen sie zwischen den Zigaretten, die sie sich mit dem glänzenden Zigarettenanzünder ansteckten, und Rudi sagte: »Jetzt habe ich meinen neuen Beruf in Auror: Taxifahrer.«
Gegen Nachmittag hielten sie, viele Kilometer von ihrem Dorf entfernt, an einer Tankstelle, die aus einer rostigen Zapfsäule in einem stillen Tal bestand und dazu einem getüpfelten Hund, der aufpasste. Rudi hupte, und ein älterer Mann humpelte aus einer Holzhütte, in der Kohlensäcke zum Verkauf lagerten, und er sah den Tschewi so ängstlich an, als wäre es ein Panzer oder ein UFO, und der getüpfelte Hund erhob sich und begann zu bellen. Rudi, der nur seine Hosen, die Stiefel und sein kariertes Hemd anhatte, stieg aus, und als er die Fahrertür hinter sich zuschlug, brach das zweite Scharnier, und die Tür fiel in den Schnee.
Rudi fluchte. Der Tankwart und er starrten auf dieses Missgeschick, für das es keine unmittelbare Abhilfe zu geben schien, und selbst der Hund verfiel in ein verblüfftes Schweigen. Dann hob Rudi die Tür auf und versuchte, sie wieder einzusetzen, und obwohl das klappte, hielt sie nicht und musste mit einem zerfransten Stück Tau am Sitz festgebunden werden, und Rudi sagte: »Dieser verdammte Professor! Er wusste, dass das passieren würde. Er hat mich nach Strich und Faden beschissen.«
Während der Tank mit Benzin gefüllt wurde, trampelte Rudi im Schnee herum, weil es wieder zu frieren begann und er weder Mantel noch Mütze hatte und die abgefallene Tür seine Glücksblase angestochen hatte. Lev stieg aus und untersuchte die kaputten Scharniere und sagte: »Es sind doch nur die Scharniere, Rudi. Die reparieren wir zu Hause.«
»Ich weiß«, sagte Rudi, »aber bleibt die Scheißtür auch die nächsten hundert Kilometer am Auto? Das ist doch die Frage.«
Randvoll mit Benzin, das Lev bezahlt hatte, fuhren sie weiter, dem Sonnenuntergang entgegen, und der Himmel war zuerst tieforange, dann rauchig rot, dann purpurfarben, und violette Schatten sprenkelten die Schneedecke der Felder, und Lev sagte: »Manchmal kann dieses Land wunderschön aussehen«, und Rudi seufzte und sagte: »Heute morgen sah es wunderschön aus, aber bald sind wir wieder zurück in der Dunkelheit.«
Als die Dunkelheit hereinbrach, bildete sich Eis auf der Windschutzscheibe, aber die abgenutzten Scheibenwischer schabten nur darüber, rutschten langsam, mit einem ächzenden Geräusch, hin und her, und schon bald war es unmöglich, die Fahrbahn zu erkennen. Rudi fuhr den Wagen an den Straßenrand, und beide starrten sie auf die Muster, die das Eis gebildet hatte, und auf den schwachen gelben Strahl, den die Scheinwerfer auf die filigranen Zweige der Bäume warfen, und Lev sah, dass Rudis Hände zitterten.
»Und was jetzt, verdammt noch mal?«, sagte Rudi.
Lev zog seinen Wollschal aus und legte ihn Rudi um den Hals. Dann stieg er aus, öffnete den Kofferraum und holte eine der drei restlichen Wodkaflaschen aus dem Stroh und sagte zu Rudi, er solle den Motor abstellen, und als der Motor starb, zogen die Scheibenwischer einen letzten vergeblichen Bogen und legten sich dann nieder, wie zwei erschöpfte alte Menschen, die Kopf an Kopf neben einer Schlittschuhbahn zu Boden sinken. Lev öffnete die Flasche, nahm einen langen Zug und goss dann sehr langsam Alkohol über die Windschutzscheibe und sah zu, wie er durchsichtige Rinnen ins Eis grub. Während die Eisschicht nach und nach verschwand, konnte Lev Rudis breites Gesicht direkt hinter der Scheibe sehen, ein ehrfürchtig aufschauendes Kindergesicht. Und danach fuhren sie weiter durch die Nacht, hielten von Zeit zu Zeit, um weiteren Wodka nachzugießen, und beobachteten, wie die beleuchtete Nadel der Benzinuhr sank und sank.
Lydia unterbrach ihr Stricken. Sie hielt sich den »Jumper« an die Brust, um zu sehen, wie viel sie noch stricken musste, bevor sie mit dem Abnehmen für die Schulternaht beginnen konnte. Sie sagte: »Dieser Ausflug fängt an, mich zu interessieren. Sind Sie zu Hause angekommen?«
»Ja«, sagte Lev. »Im Morgengrauen waren wir da. Wir waren ziemlich müde. Eigentlich waren wir sehr müde. Und der Tank war fast leer. Dieses Auto ist so gierig, dass es Rudi noch ruinieren wird.«
Lydia lächelte und schüttelte den Kopf. »Und die Tür?«, fragte sie. »Haben Sie sie repariert?«
»Na klar«, sagte Lev. »Wir haben neue Scharniere aus einem Kinderwagen angelötet. Das hat gut geklappt. Bloß dass die Tür jetzt nur noch mit Gewalt aufgeht.«
»Mit Gewalt? Aber Rudi fährt mit dem Tschewi immer noch Taxi? Mit dieser gewalttätigen Tür?«
»Ja. Im Sommer lässt er alle Fenster offen, und beim Fahren spürt man den Wind in den Haaren.«
»Oh, das würde ich nicht mögen«, sagte Lydia, »ich verbringe viel Zeit damit, mein Haar vor dem Wind zu schützen.«
Es wurde wieder Nacht, als der Bus Hook van Holland erreichte und in einer langen Schlange auf die Fähre wartete. Für die Busreisenden waren keine Kabinen gebucht; man hatte ihnen geraten, sich eine Bank oder einen Liegestuhl zum Schlafen zu suchen und möglichst keine Getränke von der Bar an Bord zu kaufen, da dort überhöhte Preise verlangt würden. »Wenn die Fähre in England anlegt«, sagte einer der Busfahrer, »sind wir nur noch etwa zwei Stunden von London und Ihrem Ziel entfernt, also versuchen Sie zu schlafen, wenn Sie können.«
Sobald Lev an Bord war, machte er sich auf den Weg zum Oberdeck und schaute hinunter auf den Hafen mit seinen Kränen und Containern, den riesigen Schuppen, Büros und Parkplätzen und dem ölig glänzenden Kai. Es fiel ein fast unsichtbarer Regen. Möwen schrien, als riefen sie nach einer lang verlorenen Heimatinsel, und Lev dachte, wie hart es sein müsste, am Meer zu wohnen und jeden Tag dieses melancholische Geräusch zu hören.
Das Meer war ruhig, und die Fähre legte so leise ab, als würden ihre großen Motoren von der Dunkelheit gedämpft. Lev lehnte an der Reling, rauchte und starrte auf den holländischen Hafen, der langsam davonglitt, und als das Land verschwunden war und Himmel und Meer sich in Schwärze vereinten, fielen ihm seine Träume aus der Zeit ein, als Marina starb, Träume, in denen er in einem Ozean trieb, der grenzenlos war und sich niemals an irgendeinem menschlichen Ufer brach.
Von der salzigen Meeresluft schmeckte seine Zigarette bitter, darum trat er sie mit dem Fuß aus und legte sich zum Schlafen auf eine Bank auf dem Oberdeck. Er zog sich die Kappe über die Augen, und um zur Ruhe zu kommen, stellte er sich vor, wie die Nacht sich über Auror senkte, so wie sie seit jeher über die tannenbedeckten Hügel und die vielen Schornsteine und den hölzernen Turm der Schule hereinbrach. Und dort in dieser weichen Nacht lag Maya unter ihrer Gänsedaunendecke, den einen Arm zur Seite gestreckt, als zeigte sie einem unsichtbaren Besucher das kleine Zimmer, das sie mit ihrer Großmutter teilte: die beiden Betten, den Flickenteppich, die grün und gelb gestrichene Kommode, den Paraffinofen und die geöffneten quadratischen Fenster, die die kühle Luft, die nächtliche Feuchtigkeit und den Schrei der Eulen hereinließen ...
Es war ein hübsches Bild, aber Lev konnte es nicht in seinem Kopf festhalten. Weil er wusste, dass Auror und ein halbes Dutzend anderer Dörfer durch die Schließung der Baryner Sägemühle dem Untergang geweiht waren, entglitten ihm immer wieder das Zimmer und das schlafende Mädchen und sogar das Bild von Ina, die im Dunkeln herumschlurfte, bevor sie zum Beten niederkniete.
»Scheißgebete nützen nichts«, hatte Rudi gesagt, als der letzte Baum zersägt und abtransportiert worden war und alle Maschinen stillstanden. »Jetzt kommt die Abrechnung, Lev. Nur die Findigen werden überleben.«
2Die Diana-Karte
Morgens um neun hielt der Bus an der Victoria Station und entließ die müden Reisenden in die unerwartete Helligkeit eines sonnigen Tags. Sie blickten um sich, sahen den Glanz auf den Gebäuden, die blitzende Reihe von Gepäckwagen, die dunklen Schatten, die ihre Körper auf den Londoner Gehsteig warfen, und versuchten, sich an das grelle Licht zu gewöhnen. »Ich habe von Regen geträumt«, sagte Lev zu Lydia.
Es kam ihm sehr warm vor. Lydias halbfertiger Jumper war in ihrem Koffer verstaut. Ihr Wintermantel lag schwer über ihrem Arm.
»Auf Wiedersehen, Lev«, sagte sie und streckte ihre Hand aus.
Lev beugte sich vor und küsste Lydia auf beide leberfleckigen Wangen und sagte: »Was können Sie für mich tun. Was kann ich für Sie tun.« Und sie lachten und machten sich auf den Weg − genau wie Lev es sich vorgestellt hatte −, jeder zu seiner eigenen Zukunft in der unbekannten Stadt.
Aber Lev drehte sich um und beobachtete, wie Lydia zu einer Reihe schwarzer Taxis eilte. Während sie die Tür ihres Taxis öffnete, schaute sie zurück und winkte, und Lev sah, dass etwas Trauriges in ihrem Winken lag − vielleicht sogar ein plötzlicher, unerwarteter Vorwurf. Als Antwort berührte er den Schirm seiner Lederkappe − eine Geste, die, wie er wusste, entweder zu militärisch oder zu altmodisch war oder beides −, und dann fuhr Lydias Taxi los, und er sah sie entschlossen geradeaus blicken, wie eine Turnerin, die auf einem Schwebebalken balanciert.
Lev nahm seine Tasche und machte sich auf die Suche nach einem Waschraum. Er wusste, dass er stank. Er konnte einen unangenehmen Tanggeruch unter seinem karierten Hemd ausmachen, und er dachte: Das passt ja auch, ich bin hier gestrandet, unter dieser unerwarteten Sonne, auf dieser Insel ... Er hörte, wie Flugzeuge über ihn hinwegdonnerten, und er dachte: Der halbe Kontinent ist hierher unterwegs, aber niemand hat es sich so vorgestellt, so heiß, und der Himmel so leer und blau.
Er folgte den Schildern zu den Bahnhofstoiletten und stellte fest, dass er durch ein Drehkreuz am Betreten gehindert wurde. Er setzte seine Tasche ab und beobachtete, was die anderen Menschen taten. Sie steckten Geld in einen Schlitz, und das Drehkreuz bewegte sich, aber das einzige Geld, das Lev besaß, war ein Stapel Zwanzigpfundscheine − von denen, wie Rudi ausgerechnet hatte, jeder eine Woche reichen würde, bis er Arbeit gefunden hätte.
»Können Sie mir bitte helfen?«, sagte Lev zu einem gepflegten älteren Herrn, der sich dem Drehkreuz näherte. Aber der Mann warf seine Münze ein, drückte mit dem Unterleib gegen das Kreuz und hielt den Kopf beim Passieren so hoch, als wäre Lev ihm nicht einmal ins Blickfeld geraten. Lev starrte ihm hinterher. Hatte er die Wörter falsch ausgesprochen? Der Mann schritt einfach zielstrebig weiter.
Lev wartete. Er wusste, dass Rudi, ohne eine Sekunde zu zögern, mit einem Satz über die Barriere gesprungen wäre, unbekümmert um die möglichen Konsequenzen, aber Lev hatte das Gefühl, Springen wäre ihm im Moment zu viel. Seinen Beinen fehlte Rudis unerschöpfliche Elastizität. Rudi machte sich seine Gesetze selbst, und die unterschieden sich von Levs, und das würde wahrscheinlich immer so bleiben.
Während Lev dort stand, wuchs sein Bedürfnis, sich zu waschen, mit jedem Augenblick. Überall auf der Haut spürte er stechende Schmerzen, wie von einer Wunde. Er begann, auf der Kopfhaut zu schwitzen, und Schweiß lief ihm in den Nacken. Er spürte eine leichte Übelkeit. Er nahm eine Zigarette aus dem fast leeren Päckchen und zündete sie an, und die Männer, die den Waschraum betraten und verließen, starrten ihn an, und dieses Starren ließ ihn auf ein Rauchen-verboten-Schild aufmerksam werden, das ein paar Schritte entfernt auf den Wandfliesen befestigt war. Er nahm einen letzten köstlichen Zug, trat die Zigarette mit dem Fuß aus und bemerkte, dass seine schwarzen Schuhe völlig verschmutzt waren, und dachte: Das ist der Schmutz meines Lands, der Schmutz ganz Europas, ich muss irgendwelche Lappen finden und ihn abwischen ...
Nach einiger Zeit näherte sich ein unrasierter junger Mann im Overall und mit einer Werkzeugtasche aus Segeltuch dem Waschraum-Drehkreuz, und Lev beschloss, dass dieser Mann − weil er jung war und weil der Overall und die Werkzeugtasche ihn als Angehörigen des einst ehrenwerten Proletariats auswiesen − vielleicht nicht so tun würde, als hätte er ihn nicht gesehen, darum sagte er, so deutlich er konnte: »Können Sie mir helfen, bitte?«
Der Mann hatte langes, ungepflegtes Haar, und sein Gesicht war ganz weiß von Gipsstaub. »Klar«, sagte er. »Was gibt’s?«
Lev zeigte auf das Drehkreuz und hielt einen Zwanzigpfundschein hoch. Der Mann lächelte. Dann wühlte er in der Tasche seines Overalls, fand eine Münze, reichte sie Lev und nahm ihm den Schein weg. Lev machte ein bestürztes Gesicht. »Nein«, sagte er. »Nein, bitte ...«
Aber der junge Mann wandte sich ab, passierte die Barriere und ging in Richtung Waschraum. Lev sah ihm mit offenem Mund hinterher. Kein einziges englisches Wort fiel ihm ein, und er fluchte laut in seiner eigenen Sprache. Dann sah er, wie der Mann mit einem Grinsen, das dunkle Linien in den weißen Staub auf seinem Gesicht zog, zurückkehrte. Er hielt Lev den Zwanzigpfundschein hin. »War nur ein Scherz«, sagte er. »Nur ein Scherz, Mann.«
Lev stand in einer Kabine und zog seine Kleider aus. Er nahm ein altes gestreiftes Handtuch aus seiner Tasche und wickelte es sich um die Taille. Er spürte, wie die Übelkeit verschwand.
Er ging zu einem der Waschbecken und ließ heißes Wasser laufen. Von einem Stuhl am Eingang aus beobachtete ihn, unter einem sorgfältig geschlungenen Turban, der Toilettenmann, ein älterer Sikh, unverwandt mit ernsten Augen.
Lev wusch sich Gesicht und Hände, holte seinen Rasierapparat hervor und rasierte sich die vier Tage alten Stoppeln vom Kinn. Dann seifte er sich Achseln, Leistengegend, Bauch und Kniekehlen ein, wobei er darauf achtete, dass das fadenscheinige Handtuch nicht verrutschte. Der Sikh rührte sich nicht, starrte nur immerfort auf Lev wie auf einen alten Film, den er auswendig kannte und der ihn immer noch faszinierte, ihm aber nicht mehr zu Herzen ging. Warmes Wasser und Seife an seinem Körper zu spüren tat Lev so gut, dass er fast geweint hätte. In den Spiegeln des Waschraums sah er, wie Männer ihn flüchtig anschauten, aber niemand sagte etwas, und Lev seifte und schrubbte seinen Körper, bis er rosig war und leicht brannte und der Meeresgeruch verschwunden war. Er zog eine saubere Unterhose an, wusch anschließend seine Füße und trampelte auf dem Handtuch herum, um sie zu trocknen. Er holte Socken und ein sauberes Hemd aus seiner Tasche. Er fuhr mit einem Kamm durch sein dichtes graues Haar. Im kalten Licht des Waschraums wirkten seine Augen müde und sein sauber rasiertes Gesicht hager, aber er fühlte sich wieder wie ein Mensch; er fühlte sich bereit.
Lev packte seine Sachen ein und ging zur Tür. Der Sikh auf seinem harten Plastikstuhl regte sich immer noch nicht, aber dann sah Lev, dass neben ihm eine Untertasse stand und dass darauf ein paar Münzen lagen − nur ein paar, weil die Menschen es hier offenbar viel zu eilig hatten, um sich Gedanken über ein Trinkgeld für den alten Mann mit den verletzten Augen zu machen −, und Lev war bekümmert, weil er keine Münze für die Untertasse hatte. Nachdem er so viel Seife benutzt und so viel Wasser auf den Boden gespritzt hatte, schuldete er dem Toilettenmann eine kleine Aufmerksamkeit. Er blieb stehen und suchte in seinen Taschen und fand ein billiges Plastikfeuerzeug, das er im Busbahnhof in Yarbl gekauft hatte. Er wollte es gerade auf den Teller legen, da dachte er: Nein, dieser Sikh hat eine Arbeit und einen Stuhl zum Sitzen, und ich habe nichts, weshalb jeder einzelne Gegenstand, der mir gehört, zu kostbar zum Weggeben ist. Levs Gedankengang, was das verweigerte Trinkgeld anging, wurde immer raffinierter, denn nun fand er, der Sikh wirke so ungerührt von allem, was um ihn her geschehe, dass er bestimmt auch durch ein armseliges Feuerzeug nicht zu rühren sei. Und so ging Lev, erst durch das Drehkreuz, dann in die Sonne und auf die Straße hinaus, und er stellte sich vor, der Sikh werde sich nicht einmal die Mühe machen, den Kopf zu wenden und ihm vorwurfsvoll nachzuschauen.
Dort, wo die Busse ankamen und abfuhren, blieb Lev stehen. Vor langer Zeit − zumindest schien es ihm lange her zu sein − hatte die junge Frau im Reisebüro, bei der er die Fahrt im Trans-Euro-Bus gebucht hatte, zu ihm gesagt: »Wenn Sie in London ankommen, werden Sie vielleicht von Leuten mit Arbeitsangeboten angesprochen. Wenn diese Leute auf Sie zukommen, unterschreiben Sie keinen Vertrag. Fragen Sie, um was für Arbeit es sich handelt und wie viel Ihnen gezahlt wird und was für eine Unterkunft man Ihnen anbietet. Wenn Ihnen die Bedingungen passend erscheinen, können Sie annehmen.«
In Levs Vorstellung ähnelten diese »Leute« den Polizisten in Städten wie Yarbl und Glic, massigen Typen mit muskulösen Unterarmen, gesunder Gesichtsfarbe und Handfeuerwaffen, die an unauffälligen Stellen ihrer Körper saßen. Und jetzt begann Lev darauf zu hoffen, dass sie erscheinen und ihm alle Verantwortung für die nächsten Tage und Stunden seines Lebens abnehmen würden. Im Grunde war es ihm egal, worin die »Arbeit« bestand, solange er einen Lohn, eine Tagesstruktur und ein Bett zu Schlafen bekam. Er war so müde, dass er sich am liebsten dort, wo er war, in der warmen Sonne hingelegt und gewartet hätte, bis jemand aufkreuzte, aber dann fiel ihm ein, dass er nicht wusste, wie lange ein Tag dauerte, ein Sommertag in England, und wie schnell es Nachmittag und Abend werde würde, und er wollte bei Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf der Straße sein.
Menschen kamen in Bussen, Taxis und Privatautos, andere fuhren weg, aber niemand näherte sich Lev. Er setzte sich in Bewegung, folgte der Sonne, plötzlich sehr hungrig, aber ohne einen Plan, nicht einmal, wie er seinen Hunger stillen könnte, wusste er. Er kam an einem Café vorbei, und der Geruch nach gutem Kaffee war verlockend, doch obwohl er auf dem Gehsteig vor dem Lokal zögerte, wagte er nicht, hineinzugehen, da er fürchtete, nicht den passenden Betrag für das zu besitzen, was er gern essen und trinken würde. Wieder dachte er an Rudi, wie der sich über diese jämmerliche Schüchternheit lustig gemacht hätte, einfach hineinspaziert wäre und die richtigen Worte und das passende Geld für das gefunden hätte, was er wollte.
Die Straße, in der Lev sich befand, war breit und laut, rote Busse schaukelten dicht am Bordstein entlang, und der Gestank von Abgasen verpestete die Luft. Es war windstill. Auf einem hohen Gebäude sah er Fahnen, die schlapp an ihren Stangen hingen, und eine Frau mit langem Haar stand an der Gehsteigkante, still und stumm wie eine Figur in einem Gemälde. Ständig flogen Flugzeuge über ihn hinweg und bestickten den Himmel mit Rauchgirlanden.
Vom belebten Boulevard bog Lev links in eine Straße, die mit Bäumen bepflanzt war, und er stellte sich in den Schatten eines dieser Bäume, setzte seine Tasche ab, die sich inzwischen schwer anfühlte, und steckte sich eine Zigarette an. Ihm fiel ein, wie er vor vielen, vielen Jahren, als er mit dem Rauchen anfing, entdeckt hatte, dass es den Hunger betäuben konnte. Er hatte es seinem Vater Stefan gegenüber erwähnt, und Stefan hatte erwidert: »Natürlich kann es das. Hast du das etwa noch nicht gewusst? Und es ist viel besser, am Rauchen zu sterben als an Hunger.«
Lev lehnte sich an den Baum. Es war eine junge Platane. Ihr Schattenmuster auf dem Boden war fein und präzise, als entwürfe die Natur gerade eine Tapete. Stefan war »am Rauchen gestorben« oder an den vielen, vielen Sägemehl-Jahren in der Baryner Mühle, war mit 59 gestorben, bevor Maya geboren wurde, lange bevor Marina krank wurde und bevor in Baryn Schließungsgerüchte kursierten. Und am Ende hatte er mit schwacher Stimme, wie ein Junge im Stimmbruch, nur gesagt: »Das ist ein elender Tod, Lev. Wenn es irgend geht, mach es nicht so wie ich.«
Plötzlich bekam Lev einen Erstickungsanfall. Er warf die Zigarette weg und trank den letzten Schluck Wodka aus seiner Feldflasche. Dann ließ er sich auf dem Eisenrost nieder, der auf dem Baumteller lag, und schloss die Augen. Der Baum, der seine Wirbelsäule berührte, war tröstlich wie ein vertrauter Stuhl, und sein Kopf sank zur Seite, und er schlief ein. Seine eine Hand ruhte auf der Tasche. Die Wodkaflasche lag auf seinem Schenkel. Ein im Baum nistender Spatz flog über ihm geschäftig ein und aus.
Lev erwachte, als ihn jemand an der Schulter berührte. Er starrte verwirrt auf ein fleischiges Gesicht unter einem Motorradhelm und auf einen dicken Bauch. Er hatte von einem Kartoffelfeld geträumt und wie er sich in dem riesigen Feld zwischen seinen endlosen Furchen verirrt hatte.
»Wachen Sie auf. Polizei.«
Der Atem des Polizisten roch schal, als sei auch er tagelang ohne Pause unterwegs gewesen. Lev versuchte, in seine Jackentasche zu langen, um seinen Pass hervorzuholen, aber eine breite Hand griff nach seinem Handgelenk und packte mit beängstigender Kraft zu.
»Immer mit der Ruhe! Keine Tricks, wenn ich bitten darf. Und jetzt hoch mit Ihnen!«
Er zog ihn unsanft auf die Füße, drückte ihn gegen den Baum und stieß ihm dabei mit dem Stiefel gegen den Knöchel, um seine Beine auseinanderzuzwingen.
Die Wodkaflasche fiel auf die Erde. An der Hüfte des Polizisten machte das Funkgerät plötzlich schreckliche Geräusche, fast als huste ein Sterbender.
Lev fühlte, wie der Polizist mit der freien Hand seinen Körper abtastete: Arme, Rumpf, Hüften, Lenden, Beine, Knöchel. Er verhielt sich so ruhig wie möglich und protestierte nicht. In irgendeinem entfernten Teil seines Gehirns fragte er sich, ob er wohl verhaftet und wieder nach Hause geschickt würde, und dann dachte er an all die endlosen Kilometer, die er zurücklegen müsste, und an die beschämende Ankunft in Auror, ohne dass er irgendetwas zum Ausgleich für den verursachten Kummer und Aufruhr in der Hand hätte.
Das Funkgerät hustete erneut, und Lev spürte, wie der eiserne Griff um seinen Arm nachließ. Der Polizist fixierte ihn und stand dabei so dicht vor ihm, dass sein dicker Bauch Levs Gürtelschnalle berührte.
»Asylant, was?«
Er sprach das Wort so aus, als ekele es ihn, als würde er am liebsten etwas von dem Essen wieder auswürgen, das seinen Atem sauer gemacht hatte. Und Lev verstand das Wort. Im Yarbler Reisebüro hatte die hilfsbereite junge Frau gesagt: »Denken Sie daran, Sie sind legal, Wirtschaftsimmigranten, keine ›Asylanten‹, wie die Briten diejenigen nennen, die enteignet worden sind. Unser Land gehört jetzt zur EU. Sie haben das Recht, in England zu arbeiten. Sie müssen sich nicht schikanieren lassen.«
»Ich bin legal«, sagte Lev.
»Kann ich bitte Ihren Pass sehen.«
Lev hielt die Arme immer noch über den Kopf, an den Baum gelehnt. Langsam ließ er sie sinken und fasste in seine Tasche und holte seinen Pass heraus, und der Polizist griff ihn sich. Lev sah zu, wie er vom Passfoto zu Levs Gesicht schaute und dann wieder zurück.
»Alle Milizen sind Arschlöcher«, hatte Rudi einmal gesagt. »Nur dumme Menschen fuchteln gern mit Handschellen und Scheißfunkgeräten herum.«
»In Ordnung«, sagte der Polizist. »Dann sind Sie also gerade angekommen?«
»Ja.«
»Kann ich einen Blick in Ihre Tasche werfen?«
Der Polizist ging in die Hocke, wobei sein Gürtel knarzte und seine Bauchfalten zu einem hinderlich aussehenden Wulst anschwollen. Er zog den Reißverschluss von Levs billiger Segeltuchtasche auf und holte den Inhalt heraus: die Kleidungsstücke, die Lev in der Bahnhofstoilette ausgezogen hatte, seinen schmierigen Kulturbeutel, saubere T-Shirts und Pullover, ein Paar neue Schuhe, mehrere Päckchen russische Zigaretten, einen Wecker, zwei Hosen, Fotos von Marina und Maya, einen Geldgürtel, ein Englischlexikon und seine Fabelbücher, zwei Flaschen Wodka ...
Lev wartete geduldig. Hunger rumorte in seinen Eingeweiden, die eindeutig von all den hart gekochten Eiern, die Lydia ihm aufgedrängt hatte, verstopft waren. Er starrte auf seine auf dem Gehsteig ausgebreiteten kümmerlichen Habseligkeiten.
Schließlich packte der Polizist die Tasche wieder ein und stand auf. »Sie haben doch eine Adresse in London? Was zum Schlafen? Hotel? Wohnung?«
»Bier und Bier«, sagte Lev.
»Sie haben ein B & B? Wo denn?«
Lev zuckte die Achseln.
»Wo ist Ihr B & B?«
»Ich weiß nicht«, sagte Lev. »Suche eins.«
Eine knurrige, drängende Stimme kam jetzt aus dem Funkgerät. Der Polizist (dessen Rang Lev nicht einschätzen konnte) presste sich das Gerät an den Kopf, und die Stimme entließ einen Strom unverständlicher Wörter in sein Ohr. Jetzt entdeckte Lev das Polizeimotorrad, das, üppig mit fluoreszierenden Abziehbildern bepflastert, schräg zum Bordstein geparkt war, und er dachte, Rudi hätte sich bestimmt für die Marke interessiert und wie viel Kubik sie hat, ganz im Gegensatz zu ihm, Lev. Er wartete schweigend und hörte zum ersten Mal, wie der Vogel die Blätter über seinem Kopf bewegte. Selbst im Schatten des Baums war es heiß. Lev hatte keine Ahnung, ob es noch Morgen war.
Der Polizist sprach in sein Funkgerät und entfernte sich dabei. Zwischendurch schaute er sich, wie ein Hundebesitzer ohne Leine, nach Lev um, ob er auch nicht weggegangen war. Dann kam er wieder und sagte: »Gut.«
Er hob Levs Tasche und die leere Wodkaflasche auf und drückte sie ihm zusammen mit seinem Pass in die Hand. Jetzt erinnerte er Lev an einen Schlägertypen in seiner Schule, der Dmitri hieß, und Lev fiel wieder ein, dass Dmitri in einer Straßenbahn gestorben war, die auf dem Yarbler Marktplatz entgleist war, und dass Rudi und er gelacht und vor Freude geschrien und getobt hatten, als sie von diesem Tod hörten.
»Los jetzt«, sagte der Polizist. »Auf der Straße wird nicht geschlafen. Das ist asoziales Verhalten und wird mit einer hohen Strafe geahndet. Also bringen Sie sich in Ordnung. Putzen Sie Ihre verdammten Schuhe. Lassen Sie sich die Haare schneiden, vielleicht haben Sie dann eine Chance.«
Lev blieb, wo er war. Langsam schob er seinen Pass wieder in die Jackentasche und sah zu, wie der Polizist seine massige Gestalt auf die schwere Maschine hievte und sie auf die Straße lenkte. Er erweckte den Motor zu lärmendem Leben und fuhr davon, ohne einen Blick auf Lev zu werfen, als existierte Lev in seinem Kopf nun nicht mehr.
Lev sah auf die Uhr. Sie zeigte 12.23, aber er hatte keine Ahnung, ob das englische oder noch die Zeit in Auror war, wenn die Kinder in Mayas kleiner Schule auf einer Bank saßen und ihr Mittagsessen verzehrten, das aus Ziegenmilch und Brot und sauren Gurken bestand und manchmal, im Sommer, wilden Erdbeeren von den Hügeln oberhalb des Dorfs. Am Fluss angekommen, setzte Lev seine Tasche ab und zog einen Zwanzigpfundschein aus seiner Brieftasche. Er kaufte zwei Hotdogs und eine Dose Coca-Cola an einem Kiosk, und es wurde ihm ein Berg Wechselgeld in die Hand gedrückt. Er war stolz auf diese Transaktion.
Er lehnte sich gegen die Ufermauer und schaute auf London. Das Essen kam ihm schwer und scharf vor, die Cola schien seine Zähne zu zwicken. Obwohl der Himmel blau war, hatte der Fluss eine schimmernde grüngraue Farbe, und Lev fragte sich, ob das für alle Flüsse in Städten galt − dass sie, wegen des jahrhundertealten dunklen Schlamms auf dem Grund, nicht mehr den Himmel widerspiegeln konnten. Auf dem Wasser bewegten sich schwerfällige Touristenboote in beide Richtungen, an Bord sorglose Menschen, die dicht gedrängt oben an Deck saßen und in der Sonne Fotos schossen.
Gebannt betrachtete Lev diese Menschen. Er beneidete sie um ihre Unbekümmertheit, ihre Sommershorts und um die Stimme des Reiseführers, die über das Wellengekräusel herüberklang und in drei oder vier verschiedenen Sprachen die Namen der Gebäude aufzählte, so dass die Menschen auf den Dampfern sich nie verwirrt oder verloren fühlten. Lev machte sich auch bewusst, dass deren Reise ein absehbares Ende hatte − ein paar Kilometer flussaufwärts, vorbei am weißen Riesenrad, das sich langsam um seinen allzu fragilen Stängel drehte, dann dorthin zurück, wo sie hergekommen waren −, während seine Reise in England noch kaum begonnen hatte; sie war unendlich, ohne ein benennbares Ende oder Ziel, und doch bekam er schon jetzt, während die Zeit verrann, Kopfschmerzen vor Verwirrung und Angst.
Hinter Lev liefen ständig Jogger vorbei, und ihr schneller Atem und das Schurren und Knirschen ihrer Turnschuhe klangen wie ein Vorwurf für ihn, der ohne jeden Plan regungslos dastand und seine Zähne in Cola badete, während diese Läufer mit Kraft und Willen hartnäckig das kleine Ziel der Selbstvervollkommnung verfolgten.
Lev trank die Cola aus und zündete sich eine Zigarette an. Er war sicher, dass sein »Selbst« ebenfalls Vervollkommnung nötig hatte. Seit Längerem schon war er launisch, melancholisch und gereizt. Selbst Maya gegenüber. Tagelang hatte er regungslos auf Inas Veranda gesessen oder in einer alten grauen Hängematte gelegen, geraucht und in den Himmel gestarrt. Wie viele Male hatte er sich geweigert, mit seiner Tochter zu spielen oder ihr beim Lesen zu helfen, hatte alles Ina überlassen? Und er wusste, dass das unfair war. Ina hielt die Familie mit ihrer Schmuckherstellung am Leben. Außerdem kochte sie ihnen das Essen, putzte das Haus, hackte das Gemüsegärtchen und fütterte die Tiere − während Lev dalag und die Wolken betrachtete. Das war mehr als unfair; es war erbärmlich. Aber schließlich hatte er es geschafft, seiner Mutter zu sagen, dass er sich bessern werde. Er würde Englisch lernen und dann nach England auswandern und sie so retten. Binnen zwei Jahren würde er ein erfolgreicher Mann sein. Er würde eine teure Uhr besitzen. Er würde Ina und Maya auf einen Touristendampfer mitnehmen und ihnen die berühmten Gebäude zeigen. Sie würden keinen Touristenführer brauchen, da er, Lev, die Namen von allem, was es in London gab, auswendig wissen würde ...
Während er sich Vorwürfe wegen seiner Faulheit und seiner Gedankenlosigkeit Ina gegenüber machte, zog er los zu einem Kiosk am Ufer, der Souvenirs und Ansichtskarten verkaufte. Der Kiosk stand im Schatten der Pfeiler einer hohen Brücke, und als Lev aus dem Sonnenlicht trat, wurde ihm plötzlich kalt. Er starrte auf die Wimpel, Spielzeuge, Minimodelle, Becher und Leinenhandtücher und überlegte, was er seiner Mutter kaufen könnte. Der Kioskbesitzer beobachtete ihn träge aus seiner Ecke im Schatten. Lev wusste, dass Ina die Handtücher gefallen würden − das Leinen fühlte sich dick und strapazierfähig an −, doch sie kosteten £ 5.99, deshalb schaute er sich weiter um.
Langsam drehte er den Postkartenständer, und gehorsam zogen Szenen des Londoner Lebens an ihm vorüber. Dann sah er das, wovon er wusste, dass er es kaufen müsste: eine Grußkarte in Form von Prinzessin Dianas Kopf. Ihr Gesicht lächelte das berühmte, herzbewegende Lächeln, in ihrem blonden Haar saß ein diamantenbesetztes Diadem, und das Blau ihrer Augen war umwerfend und traurig.