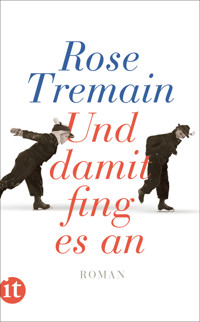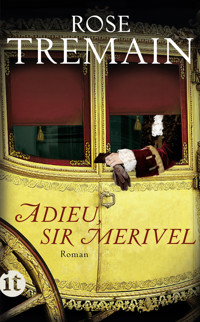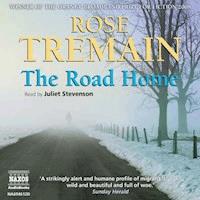11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bath, 1865: Jane ist eine begnadete Krankenschwester und findet die Aussicht, ihr Leben als Ehefrau und Mutter an der Seite des jungen Arztes Valentine zu verbringen, wenig reizvoll. Umso mehr, als sie bei einem Aufenthalt in Londons freizügiger Bohème die schöne Julietta kennenlernt … Während Jane mit ihrem inneren Konflikt ringt, zieht es Valentines Bruder Edmund an weit entfernte Orte: Auf der Suche nach exotischen Pflanzen und Tieren reist der Forscher in den tiefen Dschungel Borneos. Doch er hat die Gefahren der gewaltigen Natur und des drückenden Klimas unterschätzt – und so muss auch er sich fragen, was er sich von seinem Schicksal eigentlich erhofft …
Rose Tremains kühner und sinnlicher Roman erzählt mit unbändiger Abenteuerlust von Menschen zwischen Leidenschaft und Konvention, von Heils- und Glücksversprechen – und der Sehnsucht nach Erlösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rose Tremain
Die innersten Geheimnisse der Welt
Roman
Aus dem Englischen von Christel Dormagen
Insel Verlag
Für Richard, in Liebe
»Manch grüne Insel muss es geben
Im tiefen, weiten Meer des Elends,
Der erschöpfte, bleiche Seemann
Könnte sonst nicht weiterfahren.«
Aus: Lines written among the Euganean Hills, 1818
Percy Bysshe Shelley
Erster Teil
Die Rubinhalskette
Sie kam aus Dublin.
In dieser lebendigen Stadt hatte sie in einer Kurzwarenhandlung gearbeitet und den langsamen Tod ihrer Mutter begleitet, nach welchem sie in sich eine unerwartete Sehnsucht entdeckte, Irland zu verlassen und die Welt zu sehen. Ihr Name war Clorinda Morrissey, und sie war achtunddreißig Jahre alt, als sie in der englischen Stadt Bath ankam. Es war das Jahr 1865. Sie war nicht schön, aber sie besaß ein Lächeln von großem Liebreiz und eine weiche Stimme, die die Seele trösten und besänftigen konnte.
Clorinda wusste, dass Bath nicht gerade »die Welt« war. Aber man hatte ihr erzählt, es sei wie Rom auf sieben Hügeln erbaut, und in der Frühlings- und der Herbstsaison würden »Galas und Illuminationen« veranstaltet, und diese Dinge bekamen in ihrer Vorstellung etwas Glamouröses. Es sei außerdem, hörte sie, ein Ort, der sehr viele reiche Menschen anlocke, die sich einfach nur vergnügen oder aber einer Wasserkur unterziehen wollten; und wo die Reichen zusammenkamen, war Geld zu verdienen.
Anfangs sehr bescheiden in der Arvon Street am unteren Ende der Stadt logierend, wo die Gossen mit Unrat verstopft waren, in dem tagsüber Dutzende Schweine umherliefen, um sich nachts in ihrem eigenen Schmutz behaglich schlafen zu legen, begann Clorinda Morrissey ihren Aufenthalt in Bath als Hutmachergehilfin im kalten Keller eines Ladens in der Milsom Street. Eine Arbeit, die die Hände angriff. Obwohl sie sich immer wieder sagte, sie diene ihrem »Lebensunterhalt«, hatte Clorinda schon bald den Eindruck, dieser »Lebens«-Unterhalt ähnele sehr viel eher einer Art »Sterben«, und der Gedanke, dass sie Dublin verlassen hatte, nur um jetzt unter dem Gefühl zu leiden, dass dies ein gesellschaftlicher Abstieg war, machte sie wütend. Sie schwor sich, ihr Schicksal so rasch wie möglich in die Hand zu nehmen, damit ihr Unternehmungsgeist sie nicht vorschnell verließ.
Der einzige Wertgegenstand, den sie besaß, war eine Rubinhalskette. Es war ein schönes Stück: zwanzig blutrote Steine, aufgezogen auf einen zierlichen Goldfaden und mit einem goldenen Verschluss versehen. An Clorinda war die Kette von ihrer jüngst verstorbenen Mutter gekommen, die sie ihrerseits von ihrer Mutter bekommen hatte und jene wiederum, in eintöniger Erbfolge, von der ihrigen. Über lange, wenig bemerkenswerte Jahre war diese Halskette von einem sicheren Aufbewahrungsort zum nächsten gewandert. Sie war von all ihren Besitzerinnen kaum getragen worden und hatte eher den verhärteten Status eines Familienerbstücks angenommen, das in einer mit Satin ausgeschlagenen Schatulle aufbewahrt und hin und wieder in Brennspiritus getaucht wird, damit es gereinigt in neuem Glanz erstrahlen kann. Über lange Perioden wurde die Kette so vollkommen vergessen, als existiere sie überhaupt nicht.
Gerüchte, die Urgroßmutter habe sie »auf unehrenhafte Weise« erworben, wurden von Generation zu Generation weitergereicht, machten aber jede weitere Erbin nur noch begieriger, die Kette zu besitzen. Sie alle waren fest davon überzeugt, dass die Rubinhalskette eines Tages »ihren eigentlichen Zweck« erfüllen werde. Doch worin dieser Zweck bestehen könnte, wurde, auch wenn man viel darüber spekulierte, nie formuliert. Die Kette wurde weiterhin an seltsamen Orten versteckt gehalten: unter Fußbodendielen, im Innern einer defekten Standuhr oder im Geheimfach eines leeren Wandschranks, in dem Gefäße mit Hyazinthenzwiebeln die Winterdunkelheit überdauerten.
Doch nun traf Clorinda Morrissey, während sie sich in ihrem kalten Keller mit der Anfertigung von steifen Hauben und Stoffblumen für die Verzierung abplagte, eine schwindelerregende Entscheidung. Sie würde die Halskette verkaufen.
Ihrer inneren Stimme, die ihr vorwarf, sie verrate den Status der Halskette als Erbstück, das an zukünftige Generationen weiterzureichen sei, erwiderte sie, sie habe keine Kinder, weshalb es auch keine »zukünftige Generation« gebe, der es weiterzureichen sei. Und dem Gedanken, nach moralischen Kriterien müsste sie die Kette eigentlich einer der Töchter ihres Bruders überlassen, schenkte sie so gut wie keine Beachtung. Ihre beiden Nichten, Maire und Aisling, bedeuteten ihr überhaupt nichts. Sie hielt die beiden für beschränkte, mürrische Kinder, die wahrscheinlich nicht einmal von der Existenz der Kette wussten. Und die Rubine, das erkannte sie jetzt mit ungewöhnlicher Klarheit, hatten für niemanden irgendeinen Wert, solange dieser Wert nicht realisiert wurde. Nach all diesen stummen Generationen, die gelebt hatten und gestorben waren, wurde es doch wahrhaftig Zeit, dass jemand von den Edelsteinen Gebrauch machte.
Als Erstes trug sie die Kette zu einem Pfandleiher. Dieser ältliche Mensch klemmte sich einen napfartigen Gegenstand auf sein Auge und betrachtete durch ihn die Rubine. Clorinda Morrissey, die ihn scharf beobachtete, sah, wie ihm ein kleiner Speicheltropfen aus dem Mund trat und über das Kinn rann. Daraus schloss sie zu Recht, dass der Mann sofort erkannt hatte, dass er nach all dem Flitter, dem Messing, Glas, Elfenbein und Zinn, der ihm gewöhnlich angeboten wurde, hier endlich ein Objekt von ungewöhnlicher Schönheit und Kostbarkeit vor sich hatte. Er legte den Napf beiseite, wischte sich die Lippen mit einem schlaffen Taschentuch, räusperte sich und machte Clorinda ein Angebot.
Doch die genannte Summe genügte ihr nicht. Mrs Morrissey hatte die Absicht, ihr Leben zu ändern. Sie wusste, dass es ein knauseriges Angebot war, auch wenn es das überstieg, was sie in sechs Monaten bei dem Hutmacher verdienen konnte. Glühender Hass auf den zynischen Pfandleiher kochte in ihr hoch, eine Wut, so rot und herzlos wie die Edelsteine. Sie diskutierte gar nicht erst mit dem verabscheuungswürdigen Mann. Sie schnappte sich die Kette, legte sie wieder in die Schatulle und war schon im Begriff, wortlos den Laden zu verlassen, als sie kurz vor der Tür hörte, wie der Pfandleiher sie mit einem minimal erhöhten Angebot zurückrief. Doch sie ließ sich nicht aufhalten.
Am nächsten Tag lieh sie sich beim Hutmacher für Sixpence eine modische Haube, steckte sorgfältig ihre Haare darunter fest, zog ihren besten Mantel und saubere Schuhe an und begab sich zu einem Juwelier der gehobenen Gesellschaft in der Camden Street. Bei ihrem Eintritt klingelte ein melodisches Glöckchen über der Tür, was sie für ein freundliches Zeichen hielt.
Die Summe, die Clorinda Morrissey für die Rubine erhielt, in Goldmünzen ausgezahlt und von ihr auf einer geprägten Kaufurkunde mit so viel elegantem Schwung quittiert, wie sie aufzubringen vermochte, versetzte sie in einen tranceartigen Zustand, den sie »schiere Zielstrebigkeit« nannte. Sie konnte nicht schlafen. Sie nähte die Münzen in den Saum eines Batistunterrocks ein. Sie kam zu der Überzeugung, dass sie ihre achtunddreißig Jahre bislang in einer Art Halbdunkel verbracht hatte und ab jetzt dem Licht entgegenreisen werde. Und sie wusste sehr genau, wohin das Licht für sie fallen sollte.
Etwas weiter unten in der Camden Street gab es ein leerstehendes Ladengeschäft. Früher war es ein Bestattungsinstitut gewesen, das, wie Clorinda erfuhr, den Betrieb »wegen der unzureichenden Anzahl Verstorbener in der Stadt« aufgegeben hatte. Ihr wurde erklärt, der Anteil an Kranken und Leidenden in Bath sei zwar sehr hoch, doch es handele sich bei diesen hauptsächlich um »Importe in die Stadt«, die sich vom Heilwasser Genesung erhofften und entweder tatsächlich geheilt wurden – oder wieder zurück in ihre Heimat fuhren, um dort zu sterben. Die einheimische Bevölkerung sei dagegen extrem langlebig. Die steilen Hügel in der Umgebung sorgten für ein kräftiges Herz. Die Luft, die die Bewohner atmeten – zumindest im oberen Teil der Stadt –, sei, verglichen mit London und vielen anderen Städten, sehr rein. Und die vielfältigen Unterhaltungsangebote würden sie vor Verzweiflung bewahren. Gründe fürs Sterben seien vergleichsweise rar.
Das ehemalige Bestattungsinstitut war indes groß: ein hübsches Büro zur Straße hin, wo immer noch an die Wand geschraubte Mustersärge ausgestellt waren. Im hinteren Bereich hatten zwei Räume, die durch eine komplizierte Entlüftung über Eisenrohre in eine sonnenlose Hintergasse so kühl wie möglich gehalten und einst üppig mit teuren frischen Blumen dekoriert worden waren, als »Aufbahrungssalons« für diejenigen unter den trauernden Verwandten gedient, die den Anblick und Geruch einer einbalsamierten Leiche verkraften konnten.
Mrs Morrissey spazierte zwischen diesen beiden Bereichen, die den Konventionen englischer Bestattungen entsprechend eingerichtet waren, hin und her. Und sie sah sofort, dass ihr irischer Unternehmungsgeist sie höchst befriedigend den Bedürfnissen für das anpassen könnte, was sie für sich gern als ihre Wiederauferstehung bezeichnete. Sie stellte sich ans Fenster zur Camden Street und beobachtete die Menge gut gekleideter Menschen, die draußen vorbeiflanierten. Sie musste wieder an die Rubinhalskette denken. Halb erwartete sie, das Stück am schrumpeligen Hals einer reichen Witwe zu sehen, doch dann wurde ihr klar, dass es sich nicht unbedingt um die Sorte Schmuck handelte, die tagsüber getragen wurde, sondern eher einem jener »Gala-Abende« vorbehalten sein würde, die in ihrem Kopf solch glanzvolle Dimensionen angenommen hatten, von denen sie jedoch seit ihrer Ankunft in Bath wenig mitbekommen hatte. Und überhaupt, die Halskette war nicht länger »die Kette«. Sie war kurz davor, etwas anderes zu werden.
Nachdem Clorinda Morrissey den Mietvertrag unterzeichnet und Arbeiter angestellt hatte, die die Räume renovieren würden, schrieb sie einen Zettel und klebte ihn mit Hutmacherleim an die Eingangstür des Geschäfts. Darauf stand: Baldige Neueröffnung. Mrs Morrisseys eleganter Teesalon.
Was Clorinda Morrissey von ihrem Unternehmen erwartete, war nicht nur ein Lebensunterhalt, der keinesfalls irgendwie an »Sterben« erinnerte, sondern auch, dass sie selbst dadurch bekannt wurde – als Marke, Magnet, Adresse aus eigener Kraft. Obwohl sie in Dublin viele Freunde gehabt hatte, war es ihr immer so vorgekommen, als ob sie in den besseren Kreisen der Stadt nicht die geringste Rolle spiele. Im Kurzwarenladen war sie unsichtbar gewesen.
Damals, in den Schankwirtschaften, in denen sie den Männern, Krug um Krug, standhalten konnte, schenkte ihr niemand besondere Beachtung. Einmal hatte sie einen Verehrer gehabt, einen Jungen mit Karottenhaar, der den Kopf in den Wolken trug und von der Nachtpostkutsche überfahren worden war. Später hatte ein norwegischer Matrose ihr einen Heiratsantrag gemacht, und eine Zeitlang hatte sie sich gefragt, ob es ihr nicht gefallen könnte, in solch starken und fremden Armen zu liegen, die so abgehärtet gegen die Kälte waren. Doch schließlich hatte sie sich gegen ihn entschieden. Der Junge mit dem Karottenschopf war mit dem Gesicht zum Himmel gestorben; der Norweger würde wahrscheinlich ins Meer fallen und ertrinken. Und sie begriff, dass sie eigentlich nicht mit einem Mann leben wollte – zumindest jetzt noch nicht, sondern erst, wenn sie jemanden mit ruhigem Blick gefunden hatte, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand. Sie wollte für sich leben, wollte ihren eigenen Weg gehen. Als sie dann nach England aufbrach, erfand sie sich neu als Witwe, weil Witwen in der englischen Gesellschaft sehr viel unkomplizierter leben konnten als ein unverheiratetes Fräulein – das jedenfalls hatte man ihr erzählt.
Und nun würde ihr Name demnächst in Goldlettern über dem Laden stehen: Mrs Morrisseys eleganter Teesalon. Die Zukunft würde nach Erdbeermarmelade, frisch gebackenen Scones und aromatischem Zitronenkuchen duften. Bei einem Milchhändler in der Carter Street hinterließ sie den Auftrag für eine zweimal in der Woche zu liefernde große Portion dicker Sahne aus Devon.
Ein Nachmittag bei Mrs Morrissey
Vielleicht wegen seiner ausgezeichneten Lage in der Camden Street und vielleicht auch, weil die Bauarbeiter hinter den Mustersärgen einen hübschen Kamin freigelegt hatten, in dem Mrs Morrissey ein Kohlenfeuer entzünden konnte, das ihre Kundschaft an kalten Herbstnachmittagen wärmte, lockte der Teesalon schon sehr bald eine höchst zufriedenstellende Anzahl von Menschen herbei.
Bald hieß es in ganz Bath, Clorinda Morrissey verstehe eine Biskuittorte leicht wie ein Daunenkissen zu backen und der Tee sei stets bester Assam ohne jeden streckenden Zusatz; es herrsche dort eine Atmosphäre, die den Menschen das Gefühl vermittle, dass diese Teestube ein der Zeit enthobener Ort sei, eine Oase, eine wohlriechende Insel, wo ihnen, solange sie dort weilten, nichts Schlimmes widerfahren könne.
Das lag nicht nur an den hell lodernden Kohlen und den hervorragenden Kuchen, sondern auch an Clorinda Morrissey selbst – an der Art, wie sie sich ruhig zwischen ihren Gästen bewegte, an ihrer reizenden irischen Stimme, die die Luft wie sanfte Musik durchdrang. Sie begrüßte all ihre Kundschaft – ob Herzogin oder Bordsteinschwalbe, ob Baroness oder Bariton im örtlichen Gesangsverein – mit einem einfühlsamen Lächeln vorzüglicher Höflichkeit, als hätte sie diese Fremden und deren wechselvolles Leben schon seit jeher gekannt.
Darüber hinaus fiel ihr irgendwann mit Genugtuung auf, dass einige Leute Mrs Morrisseys Teesalon schon bald zu ihrem Lieblingsort für tiefgehende Gespräche oder Bekenntnisse von größter Wichtigkeit auserkoren. Von ihrem Beobachtungsposten an der Theke, hinter der verführerischen Auswahl an Linzer Törtchen, Crumpets, Scones und Obstmuffins, konnte Mrs Morrissey sehen, wie diese Gäste den Tortenständer, den sie immer mitten auf den Tisch stellte, beiseiteschoben, um sich so dicht zueinander zu beugen, dass ihre Köpfe sich fast berührten. Sie sah, wie Handschuhe ausgezogen und Hände ergriffen wurden. Sie hörte Seufzen und Lachen und erspähte manchmal Tränen, die über eine Alabasterwange rollten und in den Assam fielen. Solcherlei Dinge erfüllten ihr Herz mit großer Freude. Endlich war sie jemand. Sie war Mrs Morrissey von der Camden Street, und die Menschheit versammelte sich an ihrem beschützenden Busen.
An diesem speziellen Nachmittag erschien der Mann zuerst.
Mrs Morrissey wusste, dass es sich um Dr. Valentine Ross handelte, einen der unzähligen Ärzte, die bestens von der Kavalkade von Invaliden lebten, die Bath wegen der Wasserkuren aufsuchten und sich gern von beruhigend teuren Ärzten zu dieser und weiteren Behandlungsmethoden gegen ihre Leiden ermuntern ließen.
Er war ein kräftig wirkender Mann Mitte dreißig, von durchschnittlicher Größe und mit dunklem, schon leicht zurückweichendem Haar. Vielleicht lag ein Anflug von Grausamkeit in seinen schmalen blauen Augen, doch sein Verhalten gegenüber Mrs Morrissey war stets tadellos gewesen. Häufig war er allein in den Teesalon gekommen, nicht um etwas zu essen, sondern um Tee zu trinken, einen Stumpen zu rauchen und über eine verworrene oder abwegige Frage nachzusinnen, die man hinter seiner konventionellen äußeren Erscheinung nicht vermutet hätte. Manchmal verwickelte er Mrs Morrissey in eine höfliche Konversation und befragte sie zu Dublin, nach Wohl und Wehe der Stadt, ihrem Reichtum und ihrer Armut. Er hörte stets aufmerksam zu und bemerkte einmal zu ihr, dass er sich »schäme«, so wenig über die Welt außerhalb von Bath zu wissen.
Sein jüngerer Bruder, erzählte er ihr, sei Forscher auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und arbeite zurzeit auf der Insel Borneo im Malaiischen Archipel. Diese außerordentliche Abenteuerlust des Bruders gebe ihm, Valentine Ross, das Gefühl, »provinziell« zu sein, jedenfalls behauptete er das, fügte allerdings hinzu, das lasse sich aber nicht ändern. Er sei nicht die Sorte Mann, die sich danach sehnt, tobende Wasserfälle zu sehen oder den Regenwald, in den nie ein Lichtschein dringt. Er könne auch den Wunsch des weißen Mannes nicht ganz verstehen – erklärte er Clorinda Morrissey –, »vergessene Stämme« in Teilen der Welt zu entdecken, die noch niemand kartografiert hatte, und das Ganze geleitet von der Vorstellung, diese Menschen seien glücklich in ihrer »Vergessenheit« und führten ein Leben stiller Zufriedenheit.
»Ich bin absolut sicher, dass Sie recht haben!«, hatte Mrs Morrissey erwidert. »Was mich betrifft, so gefällt mir all dieser Lärm der Stadt. Aber als ich ein Mädchen war, fuhr meine Mutter öfter mit uns unseren Großvater besuchen, einen Hummerfischer an der Westküste, im County Clare. Und man könnte durchaus behaupten, dass er ein ›vergessener‹ Mann war – so wie er dort in einer niedrigen Hütte hauste, meilenweit entfernt von allem und den herzlosen Ozean direkt vor der Nase. Doch er wollte es gar nicht anders. Er pflückte gern Grasnelken für den Krug auf seinem alten, wurmzerfressenen Tisch und Meerfenchel für sein Abendessen. Wenn wir zu Besuch kamen, gab es abends immer Brot und Herzmuscheln, und tagsüber tobten wir am Strand. Er war freundlich zu uns, aber am liebsten mochte er es, wenn man ihn in Ruhe ließ. Unsere Abreise feierte er stets mit einem Krug Bier! ›Fort mit euch!‹, rief er. ›Fort, fort!‹ Also, wenn man ein Waldmensch wäre und auf keiner Karte verzeichnet, könnte man da nicht vielleicht sein wie er, die allerglücklichste Person der Welt? Aber wer wüsste das schon zu sagen?«
Als Clorinda Morrissey jetzt an Dr. Ross' Tisch trat, fiel ihr auf, dass seine Hand zitterte, während er seinen Stumpen anzuzünden versuchte. Seine Gesichtsfarbe, die gewöhnlich auf eine ruhige Gemütslage sowie die gehorsame Zirkulation seines Bluts schließen ließ, wirkte jetzt bleich, und zarte Schweißperlen bedeckten seine Stirn.
»Doktor Ross«, sagte Clorinda. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Sir?«
»Doch, ja, Mrs Morrissey. Und wie geht es Ihnen?«
»Danke, gut. Ich genieße die Herbstsonne. Darf ich den üblichen Assam bringen?«
Bei dieser Frage zögerte Ross und warf einen beklommenen Blick zur Tür.
»Nein«, erwiderte er. »Vielen Dank. Später. Ich erwarte einen Gast.«
»Oh, was für eine nette Abwechslung«, meinte Mrs Morrissey. »Wie wäre es dann mit Kuchen und Scones?«
»Ja«, sagte Ross. »Aber ich warte noch, bis …«
In dem Moment öffnete sich die Tür des Teesalons, und eine junge Frau kam herein. Man sollte besser sagen, sie schritt durch die Tür, und die Blicke all derer, die schon ihren Tee genossen, wandten sich ihr allein deshalb zu, weil sie außerordentlich hochgewachsen war. Mrs Morrissey schätzte, dass sie fast einen Meter neunzig groß sein musste – oder noch größer. Sie trug weder Haube noch Hut, und ihr dunkler Mantel war modisch tailliert und mit Pelz besetzt. Sie hielt den Kopf so hoch, dass ihr Blick beim ersten Umschauen auf die tapezierte Wand fiel und nicht auf die Kundschaft an den Tischen. Und dieser Blick, stellte Clorinda Morrissey sofort fest, war streng und durchdringend.
Als Valentine Ross sie sah, legte er seinen immer noch unangezündeten Stumpen hin und stand auf. Ein nervöses Lächeln fältelte seine Wangen, und er hob die Hand. Die hochgewachsene junge Frau erwiderte das Lächeln nicht oder hatte es nicht bemerkt. Sie zögerte einen Moment, als sei sie vielleicht kurzsichtig und fürchte, auf dem Weg zu ihm zwischen den Teetischen zu stolpern. Also kam er ihr entgegen. Mrs Morrissey beobachtete, wie er sie mit einer förmlichen kleinen Verbeugung begrüßte, ihr dann seinen Arm bot, den sie nahm, worauf beide zu dem Tisch gingen, an dem er gesessen hatte.
Clorinda zog einen Stuhl für sie vor, wobei sie feststellte, dass sie, die in Irland manchmal für groß gehalten worden war, trotz ihres gestärkten Spitzenhäubchens der Dame nur bis zum Kinn reichte.
»Mrs Morrissey«, sagte Valentine Ross, »darf ich Ihnen Miss Jane Adeane vorstellen. Miss Adeane ist die Tochter unseres hoch angesehenen Chirurgen, Sir William Adeane, mit dem zusammenzuarbeiten ich die Ehre habe.«
Auch wenn Mrs Morrissey die patronne ihres eigenen Unternehmens war und mittlerweile fast jeder in der Stadt ihren Namen kannte, achtete sie sorgfältig darauf, vor denen zu knicksen, die sie bediente. Dieser Knicks war allerdings eher ein charmanter kleiner Hüpfer, fast als besäßen ihre Schuhe unsichtbare Federn, und hatte schon manche Leute zum Lächeln gebracht, wie ihr nicht entgangen war. Doch sie hätte ihnen gern mitgeteilt, dass sie diesen Hüpfer nicht vollführte, um ihre Gäste zu amüsieren, sondern schlicht, um Zeit zu sparen, denn als Besitzerin eines Teesalons musste sie ununterbrochen von einer Aufgabe zur nächsten eilen, vom Herd zum Teekessel, vom Spülbecken zum Wäscheschrank, vom Marmeladenglas zum Sahnekrug, von der formellen Begrüßung zur Rechnungsstellung – und all das, ohne in irgendeiner Weise gehetzt oder angestrengt zu wirken. Sie hatte wirklich keine Zeit für echte Knickse.
Jetzt führte Clorinda Morrissey ihren Hüpfer aus und sah, wie ein Lächeln Miss Jane Adeanes strenge Miene erhellte. Miss Adeane streckte ihr die Hand entgegen, und Mrs Morrissey nahm sie.
»Ich habe von dem Zitronenkuchen gehört«, sagte Miss Jane.
Das Kohlenfeuer glühte in vulkanischem Rot. Zwischen den Teetrinkern lag ein kleiner Hund wachsam unter einem Tisch und wartete darauf, dass die Zeit verging, wartete, dass seine Herrin sich daran erinnerte, wie sehr er auf einen Spaziergang an der frischen Luft lauerte. Ein älterer Mann – oder, wie er lieber genannt worden wäre, ein Herr – saß allein an einem anderen Tisch, offenbar ein Geistlicher; gerade bekleckerte er das Tischtuch mit Sahne und klebrigen Sconeskrümeln. Er selbst schien sein Ungeschick gar nicht zu bemerken, aber andere Gäste von Mrs Morrissey mochten durchaus aufgeblickt und den angerichteten Schaden amüsiert zur Kenntnis genommen haben.
Wenn ebendiese Leute hinüber zu Valentine Ross geschaut hätten, wäre er ihnen auf den ersten Blick als der verlässliche, hart arbeitende, erfolgreiche Mann erschienen, der er auch war. Vielleicht würden die harten blauen Augen eine gewisse Rücksichtslosigkeit andeuten oder ahnen lassen, dass ihn gelegentlich unangemessene Sehnsüchte oder Vorstellungen überkamen; aber natürlich hätte man unmöglich erraten können, wie diese aussahen.
Doch die Person, die sie anstarrten, war Jane. Vielleicht flüsterten einige einander zu, sie hätten noch nie in ihrem Leben eine so große Frau gesehen, und ein paar von ihnen mochten sich gefragt haben, wie viele Extrameter Stoff für ihre Röcke und Unterröcke wohl bestellt werden mussten und welche Kosten das verursachte.
Jane Adeane war die Blicke gewohnt, die von Fremden auf sie fielen und bei ihr verharrten. Inzwischen war sie unempfindlich gegen diese Art von Zudringlichkeit. Ihr war häufig erklärt worden, dass niemand wisse, wo diese außergewöhnliche Statur »herkam«. Janes Mutter, die bei ihrer Geburt starb, war eine kleine, adrette Person gewesen. Und ihr Vater – ein dünner Mann mit einem üppigen grauen Haarschopf und von hitzigem Gemüt, den man gut für einen Orchesterdirigenten hätte halten können, war auch nicht besonders groß. Porträts der Adeane-Großeltern sowie der Verwandten auf mütterlicher Seite waren häufig hervorgeholt und mit immer neuem Blick begutachtet worden, weil man hoffte, irgendeinen mächtigen Vorfahren, eine Vorfahrin zu entdecken, der oder die ihre Körpergröße dadurch zu verheimlichen versucht hatten, dass sie auf niedrigen Stühlen saßen; aber Jane hatte immer gewusst, dass keiner gefunden werden würde. Die knapp ein Meter neunzig gehörten ihr und niemandem sonst.
Und in Wahrheit war sie ganz vernarrt in sie, diese unwahrscheinlichen Extrazentimeter aus Fleisch und Blut. In ihren Augen waren sie die Grundlage dessen, was sie außergewöhnlich machte. Manchmal stellte sie sich vor, dass die Menschen um sie herum – all die, die sie so unhöflich anstarrten – darum kämpften, nicht in den heftigen Wogen des menschlichen Lebens unterzugehen, während sie selbst vor den dunklen Tiefen sicher war. Sie war ihr eigenes Rettungsboot, ihre eigene kleine Insel. Ihr Kopf und ihre Schultern würden immer aus den Fluten ragen.
Clorinda Morrissey kehrte an Valentine Ross' Tisch zurück, um seine Bestellung aufzunehmen. Sie sah, dass Miss Adeane ihn ängstlich anblickte, fast als fürchte sie, er werde das Falsche bestellen, und Mrs Morrissey entging auch nicht, dass seine Stimme zitterte, als er seinen »üblichen Assam« mit zweimal gebuttertem Toast und einigen Scheiben Zitronenkuchen verlangte.
War er vielleicht krank? Es war bekannt in Bath, dass die Ärzte, die so viel Zeit mit den Kranken und Sterbenden verbringen mussten, anfällig waren für plötzliche Erkrankungen. Und wie Clorinda Morrissey erfahren hatte, herrschte immer noch Streit zwischen den Ansteckungsvertretern (die glaubten, Krankheiten würden sich durch »Bakterien« verbreiten, die über Nahrungsmittel nach England importiert worden seien) und Ansteckungskritikern (die dachten, Krankheiten entstünden spontan aus Schmutz und Fäulnis und würden dann als Dampf oder »Miasma« durch die Luft transportiert). Im Grunde wusste man aber noch wenig darüber, wie Infektionen sich von Mensch zu Mensch übertrugen, weshalb auch kaum Vorkehrungen getroffen werden konnten. Doch wieso, fragte Mrs Morrissey sich, hatte Dr. Ross, wenn er doch leidend war, Miss Jane zum Tee eingeladen?
Sie bereitete eilig den Toast vor und schnitt den Kuchen. Dann trug sie alles an den Tisch, stellte den Tortenständer in die Mitte und zog sich mit einem weiteren ihrer kleinen Hüpfknickse zurück.
Während sie mit ihrer jungen Helferin Mary am Tresen stand und die Bestellungen der anderen Gäste fertig machte, konnte sie nicht umhin, immer wieder zum Tisch von Dr. Ross und seiner Bekannten zu blicken. Sie sah, wie Miss Jane den Tee ausschenkte und dann ziemlich hungrig ihren Toast zu essen begann. (Mrs Morrissey überlegte, ob dieser hochgewachsene Körper wohl besonders große Mengen an Nahrung benötigte.) Ross nahm sich ein Stück Kuchen, rührte es aber nicht an. Jane schien sehr schnell zu sprechen, doch ihr Begleiter sah sie nur ängstlich an und nippte an seinem Tee.
Als Jane ihren Toast aufgegessen hatte, schob Dr. Ross den Tortenständer beiseite, um seinen Gast besser im Blick zu haben. Er streckte eine Hand über den Tisch, als wolle er Janes Hand ergreifen, doch sie zog ihre zurück und nahm sich ein Stück Zitronenkuchen. Und nun sah Mrs Morrissey, dass Ross, als habe er Wichtiges mitzuteilen, mit großem Ernst zu sprechen begann.
Nach Clorinda Morrisseys Eindruck verfügte die kleine Szene am Teetisch über alle Zutaten eines Dramas und war genauso packend wie all die Stücke, die sie im Theater in Dublin gesehen hatte. Doch da sie fürchtete, zu unverfroren hinzustarren – ähnlich wie ein ungehobelter Zuschauer im Parkett, der die Schauspieler angafft –, wendete sie sich wieder ihrer Arbeit zu und rauschte mit einer Ladung Scones in den Gastraum, die für die Besitzerin des Kaufhauses Tilney's und deren Freundin Mrs Earle gedacht waren. Sie plauderte kurz mit den beiden Damen über die neuen französischen Pelzmuffs aus Zobel und Nerz, die Tilney's gerade in Auftrag gab, »bevor der Winter über uns kommt«.
»Ein herrliches Weihnachtsgeschenk«, begeisterte sich Mrs Tilney, »aber warum schauen Sie nicht einfach bei uns vorbei und erwerben selbst einen?«
»Nun ja«, sagte Clorinda. »Natürlich würde ich es vorziehen, solch ein hübsches Stück geschenkt zu bekommen, aber leider fällt mir kein passender Schenker ein.«
Da mussten die Damen lachen; ihr Lachen konnte allerdings nicht das laute Geräusch eines heftig zurückgeschobenen Stuhls übertönen. Als Mrs Morrissey sich umwandte, sah sie, dass es sich um Miss Adeanes Stuhl handelte, der bewegt worden war, und dass Jane jetzt stand und an ihrem Mantel zupfte. Valentine Ross blickte mit einem Ausdruck tiefer Bestürzung zu der hoch aufgerichteten Gestalt empor. Auf Miss Janes Teller lag ungegessen ein Stück Kuchen. Die junge Frau drehte sich um, nickte Mrs Morrissey höflich zu, ging zur Tür und stürzte so schnell hinaus, als fürchte sie, noch bis auf die Straße verfolgt zu werden.
Der Engel der Bäder
Der Name, unter dem Miss Jane Adeane in Bath bekannt geworden war, hatte etwas Mythisches, fast Geisterhaftes. Sie wurde als »Der Engel« beschrieben, manchmal auch als »Der große Engel« oder »Der weiße Engel« oder, noch häufiger, als »Der Engel der Bäder«. Inzwischen hieß es, wem es gelänge, Jane als seine persönliche Krankenschwester zu gewinnen, dessen Suche nach Heilung in der Stadt würde erfolgreich sein. Vor allem Männer waren empfänglich für diesen Aberglauben. Von Janes starkem Arm zur Trinkkur geleitet zu werden, war fast so, als wäre man wieder ein kleiner Junge und befände sich in der sorgenden Obhut der eigenen Mutter. Manchmal konnte es einen Mann sogar zum Weinen bringen, wenn ihre Hand seine Stirn berührte.
Natürlich hatten sehr viele Bewohner der Stadt durchaus registriert, dass Miss Jane eine eigensinnige junge Frau war, stets darauf bedacht, genau das zu tun und zu sagen, was sie zu tun und zu sagen wünschte. Die Leute neigten dazu, ihrem Vater die Schuld dafür zu geben (falls man überhaupt von »Schuld« sprechen konnte), da er sein einziges überlebendes Kind geradezu vergötterte. Und es stimmte, dass Sir William Adeane außerordentlich an Jane hing. Ihre Anwesenheit im Haus war ihm rundherum angenehm, und manchmal merkte er, dass er sich unbehaglich fühlte, wenn sie nicht da war, fast als wäre er ein Kind und Jane seine angebetete Mutter.
Doch man sollte Sir William nicht dafür verantwortlich machen, dass Jane sich weigerte, irgendwelchen Urteilen außer ihrem eigenen zu folgen, wenn es darum ging, welchen Weg sie im Leben einzuschlagen gedachte. Diese Weigerung gehörte nur ihr, genauso wie ihre erstaunliche Größe allein ihr gehörte, und auf beides war sie stolz. Im Alter von vierundzwanzig Jahren hatte sie zu ahnen begonnen, dass sie und ihre großartigen Zentimeter eines Tages etwas vollbringen würden, was die Welt in Erstaunen versetzen könnte. Dass sie noch nicht wusste, was das sein mochte, beunruhigte sie nicht im Geringsten. Für sie war es einfach die »Große Sache«, ein Lichtstrahl in ihrer Seele. Sie begnügte sich damit, geduldig auf das zu warten, was der Lichtstrahl irgendwann enthüllen würde.
Sie trug gern Weiß. Zwar kamen ihre Ärmel und der Saum ihrer Röcke häufig mit Wasser in Berührung oder trugen Flecken von Blut oder Auswurf davon, doch sie hielt diese schneeweiße Kleidung so makellos und gestärkt wie möglich. Sie sollte nicht nur sauber sein, sondern Jane wünschte auch, dass sie auf ihre Patienten wie ein subtiler Vorwurf wirkte. Denn was ihr bei all den vielen Kranken auffiel, die sich zur Praxis ihres Vaters in der Henrietta Street schleppten, war deren außerordentliche Schmuddeligkeit. Manchmal waren ihre Zähne schwarz und locker und ihr Zahnfleisch war vereitert. Ihre Bärte waren übelriechende Nester voller verrottender Essensreste. Ihre Achseln stanken nach verborgenem Teichleben und ihre Geschlechtsteile nach Kanalisation. Und was ihre Füße anging … das häufige Vorkommen von Gicht bei den Patienten machte das An- und Ausziehen der Fußbekleidung zu einer solchen Qual, dass die armen Kranken in ihren Stiefeln schliefen und die Füße tage- oder wochenlang nicht wuschen – eine grässliche Verwesung war die Folge.
Das brachte Jane zu der Überzeugung, allein das Eintauchen in das Wasser des Heißen Bades werde den Patienten Erleichterung verschaffen, da ihr Körper von einigem Schmutz befreit wurde und die Haut wieder atmen konnte. Und abgesehen davon, dass das Weiß ihrer Uniform einen Vorwurf implizierte, hatte sie auch das Gefühl, die Andeutung von Reinheit und Jungfräulichkeit schenke Seelen, die von irdischem Kummer erdrückt wurden, unerwarteten Trost. Auch wenn ihr Vater und Dr. Ross die eigentlichen Ärzte in den Räumlichkeiten der Henrietta Street waren, war Jane keineswegs geneigt zu glauben, sie selbst habe nicht die Macht zu heilen. Sie wusste es besser.
Sie hatte verschiedene Methoden. »Stärken durch Sanftheit« lautete ein Motto, das sie im Stillen häufig wiederholte. Ihre Hände, Arme und Schultern waren kräftig, und mit ihrer gewissenhaften Massage schmerzender Glieder versetzte sie ihre Patienten oft in einen nahezu religiösen Schlaf, aus dem sie mit einem Lobpreis Gottes erwachten und sagten, sie seien plötzlich frei von Schmerz. Doch sie wussten, dass die Veränderung sich nicht irgendeinem Wunder verdankte, sondern dem unglaublichen Talent des Engels der Bäder.
Jane hatte von ihrem Vater auch gelernt, faulende Zähne zu ziehen. Ihr war bewusst, dass ein verseuchter Mund den Körper bis hinunter zu den Fußsohlen schwächen und vergiften kann. Ängstlichen Patienten hatte sie versprochen, sie könne sie ohne Schmerzen auf den Weg der Besserung bringen. Sie mussten nur ein wenig Lachgas einatmen, um in eine heitere Stimmung zu geraten; allein bei dem Gedanken an Krankheiten und ihre Angst davor würden sie in Gelächter ausbrechen. Und genau in dem Moment würde Jane mit ihrer linken Hand ihren Mund offen halten, mit der rechten ihren glänzenden Leopold-Extraktor ansetzen und den defekten Zahn herausdrehen und -ziehen, noch ehe der Patient begriff, dass sie seinen Kiefer berührt hatte. Das Austupfen der Wunde mit einem Wattebausch, der in destillierte Karbolsäure getaucht worden war, schützte die Stelle, wo der Zahn gesessen hatte, anschließend so gut vor Infektionen, wie man es erwarten konnte. Wenn die euphorische Wirkung des Lachgases nachließ, nahm sie sachte den Zeigefinger des Patienten, tauchte ihn in ein Glas mit Nelkenöl und hielt ihn dazu an, »für eine Weile ein kleines Baby zu werden« und an seiner eigenen Hand zu nuckeln, um die Schmerzen zu stillen.
Sie scheuchte ihre Patienten nie umgehend wieder aus dem zurückhaltend möblierten Zimmer, in dem sie ihre Zahnbehandlungen vornahm, sondern kniete sich neben sie und sah ihnen – sozusagen von Mensch zu Mensch – fest in die Augen, bis sie aufstehen und in die erfrischende Luft von Bath hinaustreten konnten. Wenn Jane auf diese Weise den Blick eines Patienten mit dem Balsam ihrer braunen Augen in Bann hielt, schien er innerlich zur Ruhe zu kommen, so dass Jane, ohne jemals Monsieur Mesmer bei seiner Arbeit zugesehen zu haben, zu der Überzeugung gelangte, dass ihr Wille den Aufruhr eines verzweifelten Herzens zu besänftigen vermochte.
So erfolgreich waren ihre Heilmethoden und so machtvoll Janes schiere Präsenz und ihre Berührung, dass die Patienten begreiflicherweise unbedingt wieder zu ihr kommen wollten und sich sogar einbildeten, sie seien verliebt in sie. Im Laufe der Jahre vergaßen sich manche dieser Leidenden, wenn sie auf ihrer Massagecouch lagen, derart, dass sie ihr zuflüsterten, ihre Heilung hänge einzig und allein von Janes Bereitschaft ab, andere Teile ihres Körpers bis zur beseligenden Erleichterung zu massieren. Eines Sommers wurde sogar das Gerücht in Umlauf gebracht, der Engel der Bäder mache dies tatsächlich, und zwar gegen die Summe von einer Guinea, was die Nachfrage von Patienten nur noch erhöhte. Doch diese Behauptung entsprach nicht der Wahrheit. Nicht im Geringsten. Miss Jane zog durchaus beträchtliche Befriedigung aus ihrer Fähigkeit, den Kranken und Sterbenden zu helfen; doch allein die Vorstellung, sie könne diese Fähigkeit dazu missbrauchen, Dinge zu tun, die ihren Ruf befleckten, bereitete ihr Übelkeit. Ja, sie respektierte die Männer, manchmal wegen ihrer Tapferkeit, manchmal wegen ihres Könnens und manchmal wegen ihres unerschrockenen Verlangens, Helden zu sein. Sie bemitleidete sie auch, wegen ihrer kindlichen Natur und ihrer emotionalen Feigheit, doch lieben tat sie sie wahrhaftig nicht.
Von daher hätte man glauben können, dass Dr. Valentine Ross, der schon seit fast zwei Jahren Seite an Seite mit Jane arbeitete und sie inzwischen so gut kannte wie ein Mann sie, von ihrem Vater einmal abgesehen, überhaupt kennen konnte, das begriffen hatte. Er war ein Mann mit einer gewissen Beobachtungsgabe. Doch mit der Hoffnung auf ein Heilmittel für seine eigenen aufgewühlten Gefühle hatte er sich geirrt. Es war eine vergebliche, absolut vergebliche Hoffnung, weil sie auf ein Heilmittel gesetzt hatte, das – wie er völlig übersehen hatte – einfach nicht bereitstand.
Ross hatte tatsächlich das Gefühl, er sei krank – »krank« vor Liebe zu Jane Adeane. In seinen Träumen suchten ihn Bilder ihres Alabasterkörpers heim. Wenn er neben ihr arbeitete, wirkte der zarte Duft ihres Haars so betörend auf seine Sinne, dass er manchmal die Konzentration verlor und mitten in einer Schröpfung oder einem chirurgischen Eingriff pausieren musste. Er wusste, was für eine geschickte Krankenschwester sie war, und erlaubte sich, in Fantasien über die glanzvolle Praxis zu schwelgen, die er gründen würde – mit dem Engel der Bäder an seiner Seite, aber außerhalb des langen Schattens, den Sir William Adeane warf. Er sah einen schimmernden Geldstrom auf sich zufließen.
Doch jetzt hatte er einen fatalen Fehler begangen.
Seine sexuellen und finanziellen Ambitionen hatten ihn zu einem schockierend unpassenden Heiratsantrag in Mrs Morrisseys Teesalon verleitet. Erst hatte Valentine Ross seine Gefühle grenzenloser Liebe hervorgestammelt und dann gesagt: »Selbstverständlich werde ich alles genau so machen, wie es sich gehört. Ich werde zu Ihrem Vater gehen und ihn um Ihre Hand bitten. Aber vorher muss ich von Ihnen wissen, ob mein Auftritt Ihre Zustimmung gefunden hat.«
Miss Jane hatte einen Moment lang geschwiegen und ihn nur missbilligend von Kopf bis Fuß gemustert, als wäre er ein Kind, das seine Kleidung völlig falsch zugeknöpft hat.
»Oh, Ihr Auftritt«, sagte Miss Jane schließlich. »Nun, Ihr Gehrock gefällt mir durchaus, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Weste nicht ein klein wenig aufdringlich ist – für einen Arzt, meine ich …«
Ross war bestürzt, dass sie sich über ihn lustig machte, worauf er allerdings hätte gefasst sein müssen – denn Miss Jane besaß einen scharfen Verstand, und sie schlug in jeder Unterhaltung instinktiv einen spöttischen Ton an. Doch er wünschte, sie hätte gerade in dieser Situation nicht der Versuchung nachgegeben.
»Machen Sie sich nicht über mich lustig«, bat er. »Ich liebe Sie, Jane. Ich glaube, ich liebe Sie schon so lange, dass es zu schmerzen beginnt, und deshalb suche ich auf diese Weise Heilung.«
»Heilung«, sagte sie nach einer Weile. »Das ist ein merkwürdiges Wort dafür.«
»Es ist das richtige Wort«, erwiderte Ross. »Meine Liebe zu Ihnen ist eine Art Krankheit, von der ich mich, wie ich weiß, nicht erholen werde. Ich werde nur gesund, wenn Sie bereit sind, mich zu heiraten.«
»Ach«, sagte Jane. »Dann ist es also jetzt die bescheidene Krankenschwester, die ein Heilmittel für den Doktor finden muss?«
»Ja! Haben Sie Mitleid mit mir, Jane. Erinnern Sie sich noch, dass wir im vergangenen Herbst ein Konzert mit Chopins Préludes in den Assembly Rooms besuchten und Sie –«
»O ja. Ich liebe Chopins Melancholie. Ich weiß, sie ist nicht nach jedermanns Geschmack, aber ich finde, das ist deren Pech, und –«
»Und Sie trugen ein scharlachrotes Kleid und irgendein hohes Gebilde im Haar …«
»Gebilde? Das war kein ›Gebilde‹. Das war eine Pfauenfeder.«
»Ach, tatsächlich. Nun, mein Bruder hätte es mit Sicherheit gewusst, aber ich nicht. Ich wusste nur, dass ich mich danach sehnte, die Feder zu berühren, Ihr Haar zu berühren. Und dann Ihre Hand in meiner zu spüren. Und seit jenem Augenblick begleitet mich diese Liebeskrankheit, und alles, was ich möchte, ist, Sie zu der Meinen zu machen.«
Jane Adeane hatte inzwischen ihre Teetasse bis auf den letzten Tropfen geleert, als könne sie mit dem Teetrinken irgendwie vom Thema »Gebilde« und Händchenhalten wegkommen. Beim Blick durch den Raum bemerkte sie den Hund zu Füßen seiner Herrin. Inzwischen kläffte er missmutig und wollte nur noch hinaus, und genau das wünschte sich jetzt auch Jane – weit weg von Valentine Ross zu sein. Was ihn betraf, so musste er mit Sicherheit begriffen haben, dass sein Heiratsantrag ein Fehler gewesen war, der schwerwiegendste Folgen haben würde, und dass sein Leben – wie auch das von Jane – in Bath niemals mehr dasselbe sein würde.
Jane richtete sich im Sitzen auf, reckte den Kopf so hoch sie konnte und blickte auf Ross hinunter.
»Es tut mir leid«, sagte sie. »Es tut mir wirklich leid, dass es Ihnen meinetwegen schlechtgeht, doch das ist nicht zu ändern. Die Heilung, die Sie sich wünschen, liegt nicht in meiner Macht.«
Sie erhob sich von ihrem Stuhl. Von einer Kurzsichtigkeit, die man bei ihrem Betreten des Teesalons noch hätte vermuten können, war nichts mehr zu bemerken. Sie warf einen Blick zurück zur Kuchentheke, wo Mrs Morrissey wartete, der sie höflich zunickte. Dann schritt sie rasch zur Tür.
In der Nacht beschäftigte Valentine Ross sein eigenes Verhalten und auch das von Jane vor der Tragödie (oder war es vielleicht nur eine Farce?), die sich im Teesalon ereignet hatte. Lange Zeit hatte er geglaubt, dass dieser Heirat eine absolute Logik innewohne und dass sich noch nie jemand seiner Zukunft so sicher gewesen sei wie er. Er hatte sich sogar dazu gratuliert, dass er noch Monate nachdem er begriffen hatte, wie viel Jane ihm bedeutete, abgewartet hatte, bis er um ihre Hand anhielt.
Er hatte abgewartet und darauf geachtet, ob es Anzeichen dafür gab, dass seine Zuneigung erwidert wurde – und er hatte geglaubt, sie zu entdecken. Doch jetzt wurde ihm bewusst, dass das, was er da gesehen hatte, nur Janes höflicher Respekt für ihn als Arzt war sowie ihre Freude daran, ihn zu necken; beides hatte er törichterweise für eine sublimierte Form leidenschaftlichen Interesses gehalten.
Er verfluchte sich für seine blinde Dummheit. Und doch hatte Ross ein oder zwei Mal ernstlich geglaubt, bei Jane einen Anflug romantischer Gefühle zu entdecken.
Eine dieser Situationen hatte es bei jenem Chopinkonzert in den Assembly Rooms gegeben – auf die er über den Tortenständer hinweg so ungeschickt angespielt hatte. Bis dahin hatte er sich stets mit wilder Freude an den Abend erinnert. In ihrem blutroten Kleid und mit ihrer Pfauenfeder hatte Jane so überwältigend gewirkt, dass sie zahlreiche Blicke anderer Konzertbesucher auf sich gezogen hatte, als sie gemeinsam zum Konzertsaal schritten. Und wie um sich vor den bewundernden Blicken zu schützen, hatte Jane seinen Arm genommen, und als er seine Hand auf ihre legte, die in seiner Ellbogenbeuge lag, hatte sie sie nicht weggezogen. Sie hatte ihn angelächelt. Angelächelt! Wie um ihm zu sagen: »Ja, so fühlen wir uns wohl. Das empfindest du, und das empfinde ich. Vielleicht sollte es mit uns genau so bleiben?«
Als das Konzert sich seinem Ende zuneigte, hatte Miss Jane zu weinen begonnen – so sehr hatten sie die süße Traurigkeit Chopins und das Talent des Pianisten ergriffen. Als Valentine Ross spürte, wie sie neben ihm schluchzte, war er so kühn gewesen, ihre Hand zu ergreifen und sich so dicht zu ihr zu neigen, dass seine Schulter die ihre berührte – und sie hatte sich nicht dagegen gewehrt. Als er ihr sein sauberes seidenes Taschentuch reichte, damit sie sich die Augen trocknen konnte, hatte sie es ihm nicht zurückgegeben, sondern es, sehr intim, in ihr Mieder gesteckt.
»Was um Himmels willen hätte ich denn aus solchen Gesten schließen sollen?«, fragte Ross sich jetzt in dieser quälenden, schlaflosen Nacht. »Sind das nicht exakt die Reaktionen einer Frau, die sich geliebt fühlt und beginnt, sich in dieser Zuneigung zu sonnen? Hätte nicht jeder andere Mann dasselbe gefühlt – dass dies ein Beweis der Liebe war? Und – verdammt soll sie sein –, sie hat mir das seidene Taschentuch nie zurückgegeben!«
Diese Frage des Taschentuchs beschäftigte ihn genauso wie alle anderen. Hatte sie sich nur wieder lustig gemacht über ihn, oder konnte er … durfte er ihr Handeln als List begreifen, mit der sie ihn zurückbeorderte, wie um ihm mitzuteilen: »Ein tollpatschiger Heiratsantrag mag für den Geschmack manch anderer Frauen ausreichen, aber nicht für meinen. Ich bin die Große Jane. Ich bin der Engel der Bäder. Meine Außergewöhnlichkeit verlangt, dass du über deine Worte nachdenkst, sie nachbesserst und mich dann erneut aufsuchst …«
Doch als die Morgendämmerung sein Fenster erhellte, überwog in ihm die Furcht, dass Jane, auch wenn er hundertmal um ihre Hand anhielte, immer noch nein sagen würde.
Golem
Sowie sie in der Henrietta Street durch die vertraute Tür trat, wusste Jane, dass sie jetzt Mittel und Wege finden musste, um Bath für längere Zeit den Rücken zu kehren. Die bloße Vorstellung, Seite an Seite mit Valentine Ross zu arbeiten und so zu tun, als ob nichts zwischen ihnen vorgefallen wäre, machte sie ganz schwach vor Angst.
Sie zog sich in ihr Zimmer zurück und schrieb eilig einen kurzen Brief an ihre geliebte Tante Emmeline in London, in dem sie darum bat, »für eine heilsame Zeitspanne« bei ihr zu wohnen.
Dann ging sie zu ihrem Vater und erklärte ihm, so ruhig sie konnte und ohne ihm – weder durch die kleinste Geste noch durch eine Veränderung von Stimmlage oder Betonung – zu verraten, dass irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen war, sie vermisse Emmeline und wünsche sich jetzt nichts sehnlicher, als nach London zu fahren, um Zeit mit ihrer Tante zu verbringen.
Angesichts der Tatsache, dass ihn das vor die Aufgabe stellte, eine neue Krankenschwester zu finden, die seine Tochter ersetzte, und gleichzeitig noch den Haushalt zu führen, war Sir William eigentlich geneigt, auf Jane böse zu sein, weil sie ihn in diese verdrießliche Lage brachte, und Jane wusste das. Verdruss war jedoch etwas, das er sich in Bezug auf seine Tochter nicht gestattete. Und so nahm er nur ihre Hand und sagte: »Du sollst genau das tun, was du möchtest, mein liebes Lämmchen. Du hast in dieser Saison sehr hart gearbeitet. Emmeline wird sich über deinen Besuch freuen. Und was uns hier angeht, so werden wir hervorragend zurechtkommen, da bin ich mir sicher. Ich werde dir Geld für die Londoner Mode mitgeben.«
Miss Emmeline Adeane bewohnte mit Nancy als einziger Bediensteten ein großes Haus in der Tite Street 2a, in Chelsea, London. Sie war eine gutaussehende Frau in den Fünfzigern mit einem sehr besonderen Geschmack und einer Neigung zu exotischer Kleidung nach der Mode von Madame de Staël – leuchtend bunte Turbane inbegriffen. Sie hatte es geschafft, in der männlich dominierten Londoner Kunstwelt einen gewissen Platz zu erobern, weil sie ihre Gemälde in eher kleinen Galerien ausstellte und außerdem bereit war, Gesellschaftsporträts nach Art von Sir Thomas Lawrence anzufertigen, die den Modellen schmeichelten – Männern und Frauen ebenso wie ihrer exquisit gekleideten Kinderschar, ganz gleich, wie dick oder reizlos sie sein mochten.
Ein bekannter Künstler der 1840er Jahre, Mr Jocelyn Hulton, hatte sich, ermutigt durch ihre schmeichelhafte Begeisterung für sein Werk, in die schöne junge Miss Emmeline verliebt. Und 1847 hatten Emmeline Adeane und Jocelyn Hulton einen Pakt geschlossen. Sie würde seine Geliebte werden, wenn er ihr jugendliches Talent unter seine Fittiche nahm und ihr half, die große Porträtistin zu werden, die sie ihrer eigenen Überzeugung nach war.
Dieses Arrangement dauerte etwa fünf Jahre, in denen Emmeline nicht weniger als viermal schwanger wurde. Zu ihrem Kummer und ihrer Beschämung konnte sie kein Kind austragen. Unter größten Schmerzen wurden die halb fertigen Babys, eines ums andere, in einem blutigen Chaos aus ihrem Leib in ein schweres Porzellangefäß ausgestoßen und von den Hulton-Bediensteten in den Nachttopf gelegt, um sich schließlich im Wasser der Themse mit sämtlichen gruseligen Londoner Entleerungen zu vermischen. Nach der vierten Fehlgeburt war Emmeline lange krank und fiel in eine tiefe Schwermut.
Auch wenn Jocelyn Hulton sich inzwischen eine jüngere Mätresse besorgt hatte, weil er Emmeline und ihr – wie er es nannte – »infernalisches Kopfgeschirr« leid war, erbarmte ihn ihre Notlage. Er war reich genug, ihr das Haus in der Tite Street zu kaufen und ihr darin ein schönes Atelier einzurichten. Er erklärte ihr, sie brauche ihn jetzt nicht mehr. Sie sei inzwischen eine Malerin »mit bewundernswertem Talent und großer Originalität«. Zum Abschied schenkte er ihr eine hübsche Töpferscheibe und zweihundert Pfund Ton.
Bevor er sie verließ, stellte er die Töpferscheibe auf und leitete Emmeline eine Stunde lang im Töpfern an. Diese Stunde gestaltete sich seltsam intim und aufwühlend. Jocelyn Hulton musste sich nämlich hinter seine geliebte Exmätresse und Beinahemutter von nicht weniger als vier Kindern stellen, sich dicht an sie pressen und seine Arme um sie legen, um ihre Hände beim Formen des sich drehenden Tons zu führen. Diese Gesten waren so zart und das gemeinsame Tun so sinnlich, dass Emmeline für einen Moment Hultons erneutes Begehren spürte und sich fragte, ob er schließlich nicht doch noch einmal mit ihr schlafen und danach seinen Entschluss, sie zu verlassen, rückgängig machen würde. Aber er wich rasch zurück, als nehme er sich sein plötzliches Verlangen übel. Er sagte, sie benötige keine weiteren Stunden mehr; sie sei jetzt in der Lage, sich alles, wozu sie Lust habe, selbst beizubringen.
Einige Wochen nach Hultons Abgang schnitt Emmeline sich eines Morgens, während ein kalter Frühlingsregen auf die Lichtkuppel ihres Ateliers prasselte, einen Klumpen Lehm zurecht, befeuchtete und knetete ihn, um ihn dann auf die Scheibe zu setzen. Das Geräusch des Regens klang wie ferner Applaus, und Emmeline, die die Zeit bis dahin hauptsächlich in einem Zustand großer Schwäche verbracht und sich Laudanum verabreicht hatte, um den Schmerz in Herz und Seele zu unterdrücken, beglückwünschte sich dazu, dass sie endlich wieder aufrecht dastand und ihre Hände sich an einem neuen Anfang versuchten.
Sie überlegte, was sie formen könnte, entschloss sich zu einem schlichten Gefäß und dachte dabei an eine Art Schale, die sie später glasieren und verzieren würde. Plötzlich packte sie eine seltsame Erregung.
Sie trat das Pedal, um die Scheibe in Bewegung zu setzen, und benutzte ihre Daumen – wie Jocelyn Hulton es ihr gezeigt hatte –, um die Mulde im Ton zu formen. Zuerst war sie erstaunt, wie einfach es schien. Doch bald schon zeigte das Gebilde einen hartnäckigen Drall nach links, sosehr sie auch versuchte, ihr Gefäß vollkommen rund zu machen. Immer und immer wieder mühte sich Emmeline, es mit den Händen in die Form zu zwingen, die ihr vorschwebte, doch jedes Mal verweigerte es sich ihr. Nicht nur, dass das Gebilde sich ganz entschieden weiter nach links neigte, sondern es begann sich auch auf eigentümliche Weise am Hals zu verengen, als sehne es sich – ohne jede Absicht der Töpferin – danach, ein Trinkgefäß zu werden.
Emmeline stoppte die Scheibe, trat einen Schritt zurück und betrachtete das Ding. Sie überlegte, ob sich auch erfahrene Töpfer manchmal mit einer solchen Meuterei ihres Materials zufriedengeben mussten oder ob dieses Ding hier nur mit ihrem mangelnden Geschick zu erklären war. Sie blickte auf, als ein Donnerschlag ihr Haus erzittern zu lassen schien. Die Sintflut über Chelsea wurde heftiger. Emmeline hatte das Gefühl, der wütende Regen könnte die Lichtkuppel in der Decke des Ateliers zerstören und all ihre kostbaren Farben und Leinwände dem offenen Himmel aussetzen. Und tatsächlich entdeckte sie nach einigen Minuten, dass das Wasser einen winzigen Riss im Glas gefunden hatte und jetzt Tropfen um Tropfen auf das halb geformte Objekt auf der Töpferscheibe fiel.
Während sie dies beobachtete, begann ihr Herz sehr schnell zu schlagen, und sie griff nach ihrem blauen Laudanumfläschchen und trank gierig. Jetzt schien klar zu sein, was da gerade geschah: Die Natur höchstpersönlich war dem Gefäß, das sie geschaffen hatte, nicht wohl gesinnt. Sie verlangte nach etwas anderem.
Die Geschichte mit der Töpferscheibe hatte Emmeline nur sehr wenigen Menschen erzählt, aber eine derjenigen, denen sie viele Geheimnisse ihres Lebens anvertraut hatte, war ihre Nichte Jane. Bevor sie das Ende der Geschichte verriet, hatte sie zu Jane gesagt: »Die Leute wollen es einfach nicht glauben. Anders als du, meine liebe Jane, das weiß ich, weil wir beide einander nicht anlügen; die anderen behaupten jedoch, ich sei einer Sinnestäuschung erlegen und hätte Dinge in einem Zustand krankhafter Veränderung gesehen, da ich gegen meine Schmerzen und meine Traurigkeit Laudanum nahm. Aber ich habe mich nicht getäuscht. Es würde eher der Wahrheit entsprechen, wenn man sagte, ich sei Zeugin von etwas Außerordentlichem geworden.«
»Ach«, hatte Jane erwidert, »das ist mir doch am allerliebsten! Wenn es nur mehr Außerordentliches in Bath gäbe …«
Jane hatte es sich auf der Couch in Tante Emmelines Atelier bequem gemacht, ihre Röcke um sich herum drapiert und höchst gespannt auf das gewartet, was sie jetzt hören würde. Ihr war durchaus bewusst, dass die Welt entsetzlich nach alten, verbrauchten Dingen stank. Ein langweiliger Tag konnte dem anderen folgen, ohne dass sich auch nur für einen einzigen Moment ihr Pulsschlag erhöhte. Doch jetzt würde Tante Emmeline – die bei weitem außergewöhnlichste und unabhängigste Person der Adeane-Familie – ihr etwas Neues offenbaren: Jane hätte ihre Tante am liebsten schon umarmt, bevor sie überhaupt mit der Geschichte begann.
Emmeline, die inzwischen regelmäßiger und öfter Laudanum nahm, als, wie sie wusste, gut für sie war, hatte einen Schluck aus dem Fläschchen genommen und begonnen, im Zimmer auf und ab zu marschieren. Aus ihren intelligenten braunen Augen hatte Jane ihr stumm und geduldig dabei zugesehen. Emmeline strich sich mit der Hand über die Stirn, und nachdem sie ihren Versuch geschildert hatte, ein Gefäß zu formen, während über Chelsea ein Gewitter tobte, begann sie von den Ereignissen danach zu berichten.
»Sie geschahen alle in einem Zeitraum von kaum mehr als einer Stunde«, sagte sie. »Und doch habe ich sie mein Leben lang nicht vergessen. Ich glaube, ich werde mich noch in hohem Alter an sie erinnern.«
»Oh«, sagte Jane, »ich habe noch nichts getan, an das ich mich in hohem Alter erinnern werde, aber ich bin fest entschlossen, da Abhilfe zu schaffen.«
»Das wirst du auch, Jane. Dein Leben wird sehr besonders werden. Wir alle wissen das. Dein Vater hat sogar Angst um dich.«
»Tatsächlich? Nun, das ist nicht zu ändern. Aber lass uns nicht von deiner Geschichte in meine Zukunft ausweichen. Ich sterbe schon vor Neugier …«
»So, und jetzt die Reihenfolge: Das Gewitter tobte, ich stand da, der Regen fiel, und ich sah zu, wie das Wasser Tropfen für Tropfen durch das Glas der Lichtkuppel sickerte, auf den Ton platschte und ihn durch diese Bearbeitung allmählich immer platter machte. Was vorher rund und voll gewesen war, fiel in sich zusammen wie ein Ballon, aus dem die Luft entweicht.«
»Du hast zugelassen, dass der Regen den Ton verändert?«
»Ja. Ich habe mir gewünscht, dass er ihn verändert. Und was ich sah – oder wie manche sagen würden, was ich zu sehen wünschte –, als das Ding zusammensackte, war, dass ich, ohne es zu wollen, ein Modell meines eigenen Mutterschoßes geschaffen hatte. Er trug kein Leben mehr in sich. Er war flach und leer. Und die armen Embryos, die sich danach gesehnt hatten, in ihm zu menschlichem Leben heranzuwachsen … wo waren sie? Sie waren durch den Gebärmutterhals weggesickert. Sie hatten sich im Gewitter aufgelöst!«
»Oh«, sagte Jane. »Oh.«
»Doch diese Vorstellung setzte einen wilden Impuls in mir frei. Du könntest sagen, ich war in Bann geschlagen. Ich sah eine andere Hand am Werk, nicht meine. Ich wartete, bis der »Mutterschoß« flach und formlos auf der Scheibe lag, dann packte ich eilig den tropfenden Tonkloß, presste auf meiner Arbeitsfläche etwas von dem Wasser heraus und trocknete ihn mit einem Tuch.
Dann begann ich, aus ebendiesem Kloß eine Figur zu formen. Ich wollte, dass sie wunderschön würde, so schön, wie ich mir ein Kind von mir vorstellte. Ich hatte schon viele Zeichnungen und Porträts von kleinen Kindern und Babys angefertigt und wusste, wie man Menschen vorteilhaft darstellt. Doch mit diesem Ton gelang mir das nicht! Das Ding, das ich herstellte, war ein kleiner, gebückter Homunkulus, eine Art Miniaturgolem.«
»Konntest du denn nichts daran ändern? Das Ding erneut kneten, mit den Händen bearbeiten und wieder von vorne anfangen?«
»Ich habe es versucht. Immer wieder versucht. Aber so angestrengt ich auch ständig neu modellierte, es wollte einfach keine liebenswürdige menschliche Form annehmen. Es war deformiert – verkrümmt und verbogen, mit dicken Gliedern, einem zu großen Kopf und traurigem Gesicht. Ich mühte mich immer weiter, und der Regen hörte auf, und ich wurde unvorstellbar müde. Ich musste an Mary Shelley denken und an ihre schreckliche Beschwörung der Geburt von Frankensteins Monster. Ich war entsetzt über das, was ich geschaffen hatte, nahm den Golem und warf ihn in die heiße Kaminasche.«
An dieser Stelle hatte Emmeline eine Pause gemacht und sich zu Janes Füßen gesetzt. Sie nippte noch einmal am Laudanum, reichte ihrer Nichte das Fläschchen, und Jane trank ebenfalls. Beide schwiegen. Jane spürte, wie unmittelbar tröstlich ihr das Laudanum ins Blut drang. Sie nahm die Hand ihrer Tante und hielt sie zärtlich. Sie wusste, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war.
Nachdem sie einige Zeit wortlos so gesessen hatten, fuhr Emmeline fort: »Ich ging in mein Zimmer und legte mich hin. Ich schlief ein und wachte erst am nächsten Morgen auf. Da fiel mir wieder ein, was geschehen war; ich stand auf, ging zum Kamin und schaute in die Asche. Ich hatte gedacht, der Golem sei verbrannt, aber das war er natürlich nicht. Er war nur gebrannt, als hätte ich ihn in einen Töpferofen gestellt. Er hatte sich geweigert zu sterben.
Ich wickelte das Ding in ein sauberes Tuch und legte es in meinen Schoß. Ich rieb die Asche weg. Das Ding war hart und spröde und hier und da gesprungen, aber ich wiegte es in meinen Armen. Und ich spürte, dass ich es liebte.«
»Du hast es geliebt? Als du es modelliertest, hat es dich verstört, und jetzt empfandest du Liebe dafür.«
»Ja. Und diese Liebe hatte etwas ungemein Tröstliches. Ich war so unglücklich gewesen – ich hatte meine Babys und schließlich auch meinen Liebhaber verloren. Und etwas von dieser Traurigkeit … schien mich jetzt zu verlassen. Ich spürte, dass ich mit meinem Leben und mit meiner Arbeit würde fortfahren können.«
Emmeline war aufgestanden und lief jetzt im Zimmer auf und ab. Jane folgte ihrem Weg von der Couch zum Fenster und zurück zum Laudanumfläschchen mit den Augen.
»Das ist das Ende der Geschichte«, sagte Emmeline. »Bisher dachte ich immer, es hätte etwas Magisches, Übernatürliches darin gelegen, doch jetzt begreife ich, dass es sich einfach um eine Abfolge von Ereignissen handelte, die zu einem abrupten Ende führten. Ich erzähle sie dir deshalb auch nur als Beleg für meine Überzeugung, dass unser Verstand in den seltsamsten Dingen Trost finden kann. Außerdem hat die Geschichte mir klargemacht, dass wir die Welt nicht nach den Vorstellungen von Glück formen können, die die Gesellschaft uns zugedacht hat. Wir müssen unkonventionell in unseren Freuden sein und sie dort finden, wo es uns möglich ist.«
»Das ist auch meine Meinung«, erklärte Jane. Dann fragte sie: »Hast du den kleinen Golem noch, Tante Emmeline?«
»Ja«, erwiderte Emmeline. »Ich bewahre ihn in einer alten hölzernen Schuhschachtel auf, die fast wie ein kleiner Sarg aussieht. Wenn ich ihn betrachte, empfinde ich immer noch Zärtlichkeit.«
Diese Geschichte hatte Emmeline Jane schon vor einigen Jahren erzählt, und Jane hatte sie nie vergessen. Mitgefühl für ihre Tante sowie ihre Bewunderung für deren Begabung hatten Jane zu der Überzeugung gebracht, dass Emmeline die Person sein könnte, die sie in jene außergewöhnliche Zukunft führen würde, von der sie selbst träumte. Und jetzt saß sie, nach Valentine Ross' lästigem Heiratsantrag, in einem Dampfzug nach London. Während die Felder von Wiltshire und Hampshire am Fenster vorbeizogen, verscheuchte Jane alle Gedanken an Ross aus ihrem Kopf und überließ sich der Freude darüber, dass sie Emmeline so rasch entgegengetragen wurde.
Auerhahn
Nach Janes Abreise gewöhnte Valentine Ross sich an, sehr früh morgens aus dem Bett zu steigen, irgendetwas überzuziehen, was gerade zur Hand war, sich ein Tuch um den Hals zu schlingen und, fast noch vor Sonnenaufgang, hinaus in den kalten Morgen zu spazieren. Manchmal lag eine leichte Schneedecke auf dem Gehweg. Manchmal war der Wind so stark, dass er ihm die abgefallenen Blätter von der Straße ins Gesicht wirbelte. Doch diese Dinge nahm Ross zwar wahr, doch spüren tat er sie nicht. Soll der Winter nur kommen, dachte er. Soll der Schnee nur fallen und Bath unter einer Decke des Schweigens begraben. Möge alles sich so erstickt und bandagiert anfühlen wie mein Herz.
Seine Lieblingsstrecke führte den Beacon Hill hinauf und weiter über einige Wiesen in das Dorf Charlcombe. Beim Aufstieg zum Beacon beklagte sich seine Lunge, doch er zwang sich, noch schneller zu marschieren, als wolle er seinen Körper testen, sogar auf die Gefahr hin, dass er den Test nicht bestand und zusammenbrach.
Doch er brach nicht zusammen. Eine der Gaben, die er geglaubt hatte, Jane offerieren zu können, war seine körperliche Stärke. In seiner Praxis konnte er, falls nötig, seine Patienten auf den Untersuchungstisch heben. Mit der Kraft seiner Hände und der genauen Kenntnis des menschlichen Skeletts verstand er es, schnell und effektiv Knochen zu richten und einzurenken. Und was seine Kondition als Liebhaber betraf, so hatten die Mädchen, die in den oberen Räumen der Neck Tavern in der Arvon Street arbeiteten, wo Ross ein gelegentlicher Besucher war, ihm den Spitznamen Sir Sturschädel gegeben, und er war eitel genug, um darauf stolz zu sein.
Er hatte sich so häufig vorgestellt, wie er Jane diese Gabe seiner Stärke zukommen lassen würde, dass er jetzt unmöglich akzeptieren konnte, dass sie sie nie kennenlernen sollte. Er hätte so gern zu ihr gesagt: »Lass mich dir zeigen, wie geschickt ich dich lieben kann. Danach entscheide, ob du mich heiraten möchtest oder nicht. Mich schon zu verstoßen, bevor ich mich dir selbst zum Geschenk gemacht habe, ist weder vernünftig noch fair …«
Doch selbstverständlich ließ sich so etwas nicht aussprechen. Jane hatte ihn abgewiesen, und nun war es an ihm, sich innerlich von ihr zu lösen und sich eine andere Zukunft auszumalen. Doch wo und wie war diese Zukunft zu finden? Eben das sollten ihm seine kalten Morgenspaziergänge enthüllen, hoffte er vergeblich. Aber während er jetzt seinen Körper zu einem immer schnelleren Tempo zwang, entging ihm nicht, dass in seinem Kopf eine schreckliche Leere herrschte. Irgendwo im Gehirn mussten Gedanken herumwabern, dachte er, aber es gelang ihm nicht, sie tatsächlich zu denken. Er fragte sich, ob diese Leere in seinem Kopf der erste Schritt zum Wahnsinn oder zum körperlichen Zusammenbruch war.
Normalerweise blieb er, wenn er oben auf dem Beacon Hill angelangt war, stehen und blickte hinunter. Das Panorama löste in ihm immer noch ein schwaches Gefühl des Staunens aus. Er sah, vor sich ausgebreitet, das Geordnete der Stadt, die über die Jahre gewachsen war, als Straßen und Plätze neu angelegt wurden. Er begriff, dass Bath sich im Laufe der Zeit neu definiert hatte und nicht in einer versteinerten Vergangenheit steckengeblieben war, und er fragte sich, ob er, ein Bürger dieses ruhigen Fleckens, sich nicht ebenfalls verändern konnte. Doch er fürchtete, sein leerer Kopf, dieses Nichtdenkenkönnen, würde ihn daran hindern.
Eines Morgens Ende November wanderte Ross vom Hill über die Felder nach Charlcombe. Das Gras trug noch eine dünne Reifschicht vom Frost der vergangenen Nacht. Und die aufgehende Sonne, die am blauen Himmel hochstieg, verlieh der Wiese einen überraschend edlen Glanz. In den Anblick versunken, blieb Ross stehen und ließ sich von dem Geglitzer blenden. Dann nahm er aus dem Augenwinkel einen außergewöhnlichen Vogel wahr, schwarz und grün schimmerte er vor dem weiß bereiften Feld. Der Vogel stand regungslos da, genau wie er selbst, und schien die stumme Szene sehr aufmerksam zu betrachten.