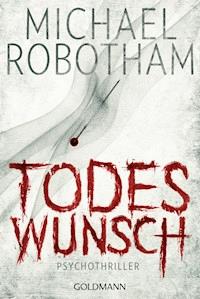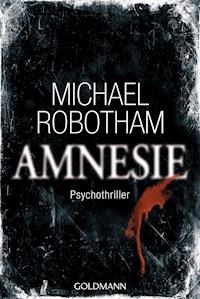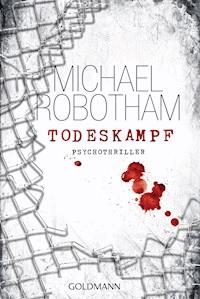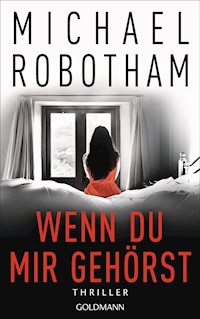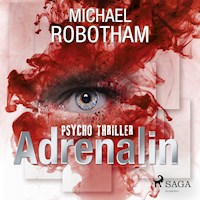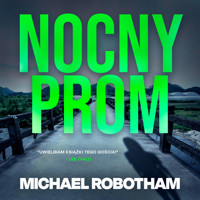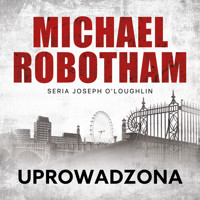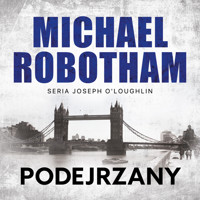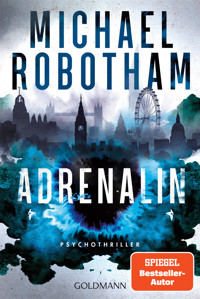
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe O'Loughlin und Vincent Ruiz
- Sprache: Deutsch
Eine junge Krankenschwester wird grausam ermordet aufgefunden. Als die Polizei den renommierten Psychologen Joe O’Loughlin um Hilfe bei den Ermittlungen bittet, beschleicht diesen schon bald ein böser Verdacht: Die Verletzungen des Mordopfers stimmen in erschreckender Weise mit den Gewaltfantasien seines Patienten Moran überein. Joe ahnt nicht, dass er Gefahr läuft, in eine heimtückische Falle zu geraten – und dass nicht nur sein eigenes Leben an einem seidenen Faden hängt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Joe O’Loughlin ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Psychologen Londons. Nur ein Patient bereitet ihm schon seit geraumer Zeit Kopfzerbrechen – der ebenso verschlossene wie zur Aggressivität neigende Bobby Moran.
Als die grausam zugerichtete Leiche einer jungen Krankenschwester gefunden wird, bittet die Polizei Joe um eine fachkundige Meinung. Joe beschleicht ein böser Verdacht, denn das Mordopfer weist Verletzungen auf, die in erschreckender Weise mit den Gewaltphantasien Morans übereinstimmen. Zunächst behält Joe seinen Verdacht für sich und gerät so auf einmal selbst ins Visier des ermittelnden Detectives. Um seine Unschuld zu beweisen, macht er sich daran, die dunkle Geschichte seines mysteriösen Patienten zusammenzusetzen. Dabei kommt er einem perfiden und grausamen Rachefeldzug auf die Spur, der die Handschrift eines besessenen Psychopathen trägt. Noch ahnt Joe nicht, dass er selbst das nächste Opfer sein soll …
Autor
Michael Robotham wurde 1960 in New South Wales, Australien, geboren. Er war lange Jahre als Journalist für große Tageszeitungen und Magazine in London und Sydney tätig, bevor er sich ganz seiner eigenen Laufbahn als Schriftsteller widmete. Mit seinen Romanen sorgte er international für Furore und wurde mit mehreren Preisen geehrt. Michael Robotham lebt mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Sydney.
Weitere Informationen zum Autor unter www.michaelrobotham.com.
Von Michael Robotham außerdem bei Goldmann erschienen: Amnesie. Psychothriller Todeskampf. Psychothriller Dein Wille geschehe. Psychothriller Todeswunsch. Psychothriller
Inhaltsverzeichnis
Die englische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »The Suspect« bei Time Warner Books.
Für die vier Frauen in meinem Leben: Vivien, Alexandra, Charlotte und Isabella
BUCH EINS
»Das habe ich getan« – sagt mein Gedächtnis. »Das kann ich nicht getan haben« – sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich – gibt das Gedächtnis nach.
Friedrich NietzscheJenseits von Gut und Böse
1
Wenn man von dem schrägen Schieferdach des Royal Marsden Hospital zwischen Schornsteinen und Fernsehantennen hindurchblickt, sieht man noch mehr Schornsteine und Fernsehantennen. Es ist wie die Szene aus Mary Poppins, in der all die Schornsteinfeger mit wirbelnden Besen über die Dächer tanzen.
Von hier oben kann ich gerade noch die Kuppel der Royal Albert Hall ausmachen. An einem klaren Tag könnte ich wahrscheinlich bis Hampstead Heath gucken, obwohl ich bezweifle, dass die Luft in London je so klar wird.
»Schöner Ausblick«, sage ich und blicke zu dem Teenager, der gut drei Meter rechts neben mir kauert. Sein Name ist Malcolm und er wird heute siebzehn. Er ist groß und dünn, mit dunklen Augen, die unruhig hin- und herflackern, wenn er mich ansieht. Seine Haut ist weiß wie glänzendes Papier. Er trägt einen Schlafanzug und eine Wollmütze, um seinen kahlen Kopf zu verbergen. Chemotherapie ist ein brutaler Frisör.
Es ist drei Grad über Null, aber der eisige Wind drückt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Meine Finger sind schon taub, und ich kann meine Zehen in den Socken und Schuhen kaum noch spüren. Malcolms Füße sind nackt.
Ich kann ihn nicht erreichen, wenn er springt oder fällt. Selbst wenn ich mich strecke und auf die Regenrinne stütze, fehlen mir immer noch zwei Meter, um ihn aufzufangen. Das weiß er. Er hat alles genau berechnet. Sein Onkologe sagt, Malcolm hat einen überdurchschnittlichen IQ. Er spielt Geige und spricht fünf Sprachen – aber in keiner mit mir.
Seit einer Stunde stelle ich ihm Fragen und erzähle ihm Geschichten. Ich weiß, dass er mich hört, aber meine Stimme ist nur ein Geräusch im Hintergrund. Er konzentriert sich auf seinen eigenen inneren Dialog und debattiert die Frage, ob er leben oder sterben soll. Ich würde gern an der Debatte teilnehmen, aber dazu brauche ich eine Einladung.
Der National Health Service hat eine ganze Latte von Richtlinien für den Umgang mit Geiselnahmen und angedrohten Selbstmorden. Ein Krisenstab ist gebildet worden, bestehend aus leitenden Ärzten des Krankenhauses, Polizisten und einem Psychologen – mir. Zunächst haben wir uns bemüht, alles über Malcolm in Erfahrung zu bringen, was uns dabei helfen könnte zu verstehen, was ihn zu diesem Punkt getrieben hat. Ärzte, Schwestern und Patienten sowie Freunde und Verwandte werden befragt.
Der erste Verhandlungskontakt ist der entscheidende Punkt des Einsatzes. Alles hängt an mir. Deswegen bin ich hier draußen und friere mir Hände und Füße ab, während die anderen drinnen Kaffee trinken, das Personal befragen und Flipcharts betrachten.
Was weiß ich über Malcolm? Er hat einen primären Hirntumor im rechten posterioren Schläfenbereich, gefährlich nahe an seinem Hirnstamm, der zu einer teilweisen linksseitigen Lähmung und Taubheit auf dem linken Ohr geführt hat. Er ist in der zweiten Woche seines zweiten Zyklus der Chemotherapie.
Heute Morgen haben ihn seine Eltern besucht. Der Onkologe hatte gute Nachrichten. Malcolms Tumor schien zu schrumpfen. Eine Stunde später schrieb er eine aus drei Wörtern bestehende Nachricht: »Tut mir Leid.« Er verließ sein Zimmer und krabbelte durch ein Gaubenfenster im vierten Stock auf das Dach. Irgendjemand musste vergessen haben, es abzuschließen, oder Malcolm hatte einen Weg gefunden, es zu öffnen.
Das ist es – die Summe meines Wissens über einen Jugendlichen, der sehr viel mehr zu bieten hat als die meisten Kinder seines Alters. Ich weiß nicht, ob er eine Freundin hat, einen Lieblingsfußballverein oder einen Leinwandhelden. Ich weiß mehr über seine Krankheit als über ihn. Deswegen hänge ich in der Luft.
Der Sicherheitsgurt unter meinem Pullover ist unbequem. Er sieht aus wie die Dinger, die Eltern ihren Kleinkindern anschnallen, damit sie nicht weglaufen. In diesem Fall soll er mich retten, falls ich abstürze, sofern jemand daran gedacht hat, das andere Ende irgendwo zu befestigen. Es klingt vielleicht lächerlich, aber solche Details werden in einer Krisensituation manchmal vergessen. Vielleicht sollte ich zum Fenster zurückkriechen und jemanden bitten nachzusehen. Wäre das unprofessionell? Ja. Vernünftig? Noch mal ja.
Das Dach ist mit Taubenkot gesprenkelt, und die Schieferziegel sind mit Flechten und Moos bedeckt. Es sieht aus wie versteinerte Pflanzen, doch es ist glatt und tückisch.
»Das ist wahrscheinlich egal, Malcolm, aber ich glaube, ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie du dich fühlst«, sage ich in einem weiteren Versuch, ihn zu erreichen. »Ich habe auch eine Krankheit. Ich behaupte nicht, dass es Krebs wäre. Das ist es nicht. Und solche Vergleiche sind so, als würde man Äpfel und Birnen durcheinander schmeißen, aber es ist immerhin beides Obst, oder?«
Der Empfänger in meinem rechten Ohr fängt an zu knacken. »Was in Gottes Namen machen Sie da?«, fragt eine Stimme. »Hören Sie auf über Obstsalat zu quatschen, und holen Sie ihn rein!«
Ich nehme den Ohrhörer heraus und lasse ihn über meine Schulter baumeln.
»Die Leute sagen immer: ›Es wird gut. Es kommt schon alles wieder in Ordnung‹, du kennst das ja. Das sagen sie, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, Malcolm. Ich weiß nicht mal, welche Fragen ich stellen soll.
Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie mit der Krankheit eines anderen umgehen sollen. Leider gibt es kein Benimmbuch oder eine Liste von Dingen, die man tun und lassen soll. Entweder kriegt man diesen wässrigen ›Ich ertrag das nicht, ich fang gleich an zu heulen‹-Blick oder krampfhafte Fröhlichkeit und Kopf-hoch-Reden. Die andere Möglichkeit ist komplette Verdrängung.«
Malcolm hat nicht geantwortet. Er starrt über die Dächer, als würde er aus einem winzigen Fenster hoch oben im grauen Himmel schauen. Sein Pyjama ist dünn und weiß mit einer gestickten blauen Borte an Kragen und Ärmeln.
Zwischen meinen Knien sehe ich drei Feuerwehrautos und ein halbes Dutzend Streifenwagen. Eines der Feuerwehrautos hat eine ausfahrbare Leiter auf einer Drehscheibe. Ich habe sie bis jetzt nicht groß beachtet, aber nun sehe ich, wie sie sich langsam dreht und nach oben ausgefahren wird. Warum tun sie das? Im selben Moment strafft Malcolm die Schulter gegen das Schrägdach und erhebt sich. Er hockt auf der Dachkante, die Zehen über der Regenrinne, wie ein Vogel auf einem Zweig.
Ich höre jemanden schreien und merke, dass ich es selber bin. Wild gestikulierend bedeute ich ihnen, die Leiter herunterzufahren. Ich sehe aus wie der Selbstmordspringer, während Malcolm vollkommen ruhig wirkt.
Ich taste nach meinem Ohrhörer und höre das Getöse drinnen. Der Krisenstab brüllt den leitenden Feuerwehrmann an, der seinen Stellvertreter anbrüllt, der irgendjemand anderen anbrüllt.
»Tu’s nicht, Malcom! Warte!« Ich klinge verzweifelt. »Siehst du die Leiter? Sie wird heruntergefahren. Siehst du? Sie wird heruntergefahren.« In meinen Ohren rauscht das Blut. Er bleibt am Rand des Daches hocken, krallt seine Zehen fest und entspannt sie wieder. Im Profil erkenne ich, wie seine langen dunklen Wimpern langsam blinzeln. In seiner schmalen Brust pocht sein Herz wie das eines Vogels.
»Siehst du den Feuerwehrmann mit dem roten Helm?«, frage ich, um in seine Gedanken zu dringen. »Den mit all den Messingknöpfen auf den Schultern. Was meinst du, wie stehen meine Chancen, ihm von hier aus auf den Helm zu spucken?«
Für den Bruchteil einer Sekunde blickt Malcolm nach unten. Es ist das erste Mal, dass er irgendetwas zur Kenntnis nimmt, was ich gesagt oder getan habe. Die Tür ist einen Spalt weit aufgegangen.
»Manche Leute spucken gern Kirsch- oder Wassermelonenkerne. In Afrika spucken sie mit Dung, was ziemlich eklig ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Weltrekord in Kudu-Dung-Spucken bei etwa zehn Meter liegt. Ich glaube, Kudus sind eine Antilopenart, aber die Hand ins Feuer legen würde ich dafür nicht. Mir ist gute altmodische Spucke lieber, und es geht nicht um Weite, sondern um Zielgenauigkeit.«
Er sieht mich jetzt an. Mit einem Zucken meines Kopfes schicke ich einen schaumigen weißen Knubbel im hohen Bogen auf den Weg nach unten. Er wird vom Wind erfasst, nach rechts abgetrieben und landet auf der Windschutzscheibe eines Streifenwagens. Schweigend sehe ich ihm nach und frage mich, was ich falsch gemacht habe.
»Sie haben den Wind nicht einkalkuliert«, sagt Malcolm.
Ich nicke weise und beachte ihn kaum, aber dort, wo ich noch nicht erfroren bin, spüre ich ein warmes Glühen in mir. »Stimmt. Zwischen diesen Gebäuden entsteht ein ziemlicher Windkanal.«
»Billige Ausreden.«
»Na, du hast es bisher ja noch gar nicht versucht.«
Er blickt nach unten und denkt darüber nach. Er schlingt seine Arme um die Knie, als wollte er sich warm halten. Das ist ein gutes Zeichen.
Einen Moment später segelt ein Spuckekügelchen in einem weiten Bogen nach unten. Gemeinsam sehen wir ihm nach, als wollten wir es mit schierer Willenskraft zwingen, auf Kurs zu bleiben. Es trifft einen Fernsehreporter direkt zwischen die Augen, und Malcolm und ich stöhnen harmonisch auf.
Mein nächster Schuss landet harmlos auf der Treppe vor dem Gebäude. Malcolm fragt, ob er das Ziel ändern kann. Er will noch mal den Fernsehreporter treffen.
»Schade, dass wir keine Wasserbomben haben«, sagt er und stützt das Kinn auf ein Knie.
»Wenn du auf irgendwen auf der Welt eine Wasserbombe werfen könntest, wer wäre das?«
»Meine Eltern.«
»Warum?«
»Ich will nicht noch mal Chemo kriegen. Mir reicht’s.« Er führt das nicht weiter aus, und das ist auch nicht nötig. Es gibt nicht viele Behandlungen mit schlimmeren Nebenwirkungen als Chemotherapie. Das Erbrechen, die Übelkeit, die Verstopfung, die Anämie und die schier überwältigende Erschöpfung können unerträglich sein.
»Was sagt dein Onkologe?«
»Er sagt, der Tumor schrumpft.«
»Das ist gut.«
Er lacht bitter. »Das haben sie beim letzten Mal auch gesagt. In Wahrheit jagen sie dem Krebs bloß durch meinen ganzen Körper hinterher. Er geht nicht weg. Er findet bloß ein Versteck. Sie sprechen auch nie von Heilung, sie sprechen von Remission. Manchmal reden sie auch gar nicht mit mir, sondern flüstern bloß mit meinen Eltern.« Er beißt sich auf die Unterlippe, und ein rotes Mal entsteht, wo das Blut in die Kerbe fließt.
»Mom und Dad denken, dass ich Angst vorm Sterben hätte, aber ich habe keine Angst. Sie sollten ein paar von den anderen Kindern hier sehen. Ich hatte wenigstens ein Leben. Noch fünfzig Jahre mehr wären nett, aber ich habe wie gesagt keine Angst.«
»Wie viele Chemozyklen sind es noch?«
»Sechs. Und dann warten wir ab und sehen weiter. Ich hab nichts dagegen, dass mir die Haare ausfallen. Eine Menge Fußballer rasieren sich den Kopf kahl. David Beckham zum Beispiel; er ist ein Wichser, aber ein verdammt guter Spieler. Keine Augenbrauen zu haben ist allerdings ziemlich bitter.«
»Ich habe gehört, Beckham lässt sich seine zupfen.«
»Von Posh?«
»Ja.«
Das entlockt ihm beinahe ein Lächeln. In der nachfolgenden Stille höre ich Malcolms Zähne klappern.
»Wenn die Chemo nicht wirkt, werden meine Eltern den Ärzten sagen, sie sollen es weiter versuchen. Sie werden mich nie gehen lassen.«
»Du bist alt genug, selbst zu entscheiden.«
»Versuchen Sie mal, denen das zu erklären.«
»Das mache ich, wenn du es willst.«
Er schüttelt den Kopf, und ich sehe die Tränen, die ihm in die Augen schießen. Er versucht, sie zu unterdrücken, doch sie quellen in dicken Tropfen unter seinen langen Wimpern hervor, die er mit dem Unterarm wegwischt.
»Gibt es jemanden, mit dem du reden kannst?«
»Ich mag eine der Krankenschwestern. Sie war echt nett zu mir.«
»Ist sie deine Freundin?«
Er wird rot. Bei seiner Blässe sieht es aus, als würde sein Kopf voll Blut laufen.
»Warum kommst du nicht mit rein und wir reden drinnen weiter? Ich kann keine Spucke mehr sammeln, wenn ich nicht einen Schluck zu trinken kriege.«
Er antwortet nicht, aber ich sehe, dass seine Schultern sacken. Er lauscht wieder seinem inneren Dialog.
»Ich habe eine achtjährige Tochter, die Charlie heißt«, sage ich, um ihn zu halten. »Ich weiß noch, wie wir, als sie vier war, zusammen im Park waren, und auf dem Spielplatz habe ich sie auf der Schaukel angeschubst. Und sie hat zu mir gesagt: ›Daddy, weißt du, wenn man die Augen ganz fest zumacht, bis man weiße Sterne sieht, und dann hinterher wieder auf, ist die Welt ganz neu.‹ Netter Gedanke, findest du nicht?«
»Aber es ist nicht wahr.«
»Es kann wahr sein.«
»Nur, wenn man so tut als ob.«
»Warum nicht? Was hält dich davon ab? Die Leute finden es leicht, zynisch und pessimistisch zu sein, dabei ist das unglaublich harte Arbeit. Es ist viel leichter, optimistisch zu sein.«
»Ich habe einen inoperablen Hirntumor«, sagt er ungläubig.
»Ja, ich weiß.«
Ich frage mich, ob meine Worte in Malcolms Ohren genauso hohl klingen wie in meinen. Früher habe ich diesen Kram geglaubt. In zehn Tagen kann sich viel ändern.
Malcolm unterbricht meine Gedanken. »Sind Sie Arzt?«
»Psychologe.«
»Sagen Sie mir noch mal, warum ich herunterkommen soll?«
»Weil es hier oben kalt ist und gefährlich und ich gesehen habe, wie Menschen aussehen, nachdem sie von hohen Gebäuden gestürzt sind. Komm rein. Zum Aufwärmen.«
Er blickt auf den Rummel aus Krankenwagen, Feuerwehrautos, Streifenwagen und Fernseh-Übertragungswagen hinab. »Ich hab den Spuckwettbewerb gewonnen.«
»Ja, hast du.«
»Und Sie reden mit Mum und Dad?«
»Auf jeden Fall.«
Er versucht aufzustehen, doch seine Beine sind kalt und steif. Wegen seiner linksseitigen Lähmung kann er seinen Arm nicht benutzen. Um sich nach oben zu hangeln, braucht er aber beide Arme.
»Bleib einfach, wo du bist. Ich sag denen, dass sie eine Leiter hochfahren sollen.«
»Nein!«, erwidert er drängend, und ich sehe seinen Gesichtsausdruck. Er will nicht im Scheinwerferlicht der Fernsehkameras und unter den Fragen der Reporter heruntergeholt werden.
»Okay, dann komme ich zu dir.« Ich bin erstaunt, wie mutig das klingt. Ich rutsche vorsichtig auf dem Hintern seitwärts, weil ich zu viel Angst habe aufzustehen. Ich habe meinen Sicherheitsgurt nicht vergessen, bin jedoch nach wie vor nicht überzeugt, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, ihn zu befestigen.
Während ich mich auf der Regenrinne vortaste, schießen mir lauter Bilder durch den Kopf, was alles schief gehen könnte. Wenn dies ein Hollywoodfilm wäre, würde Malcolm im letzten Moment ausrutschen und ich würde ihn mit einem Hechtsprung auffangen. Entweder das oder ich würde fallen und er würde mich retten.
Andererseits könnten wir – weil dies das wirkliche Leben ist – beide umkommen oder Malcolm könnte überleben, und ich könnte als rettender Fänger selbst in den Tod stürzen.
Obwohl er sich nicht bewegt hat, sehe ich in Malcolms Blick ein neues Gefühl. Vor ein paar Minuten war er, ohne einen Moment zu zögern, bereit, von diesem Dach zu springen. Jetzt will er leben, und das Nichts unter seinen Füßen ist zum Abgrund geworden.
Der amerikanische Philosoph William James (ein heimlicher Phobiker) hat 1884 einen Artikel geschrieben, in dem er über das Wesen der Angst sinniert. Als Beispiel wählte er einen Menschen, der einem Bären begegnet. Ergreift der Mensch die Flucht, weil er Angst hat, oder bekommt er erst Angst, nachdem er bereits zu rennen begonnen hat? Mit anderen Worten, hat ein Mensch Zeit genug zu denken, dass irgendetwas beängstigend ist, oder geht die Reaktion dem Gedanken voraus?
Seither drehen sich Wissenschaftler und Psychologen in einer Art Huhn-oder-Ei-Kontroverse im Kreis. Was kommt zuerst – das bewusste Empfinden von Angst oder das pochende Herz und das ausgeschüttete Adrenalin, das uns motiviert, zu kämpfen oder zu fliehen?
Jetzt weiß ich die Antwort, aber vor lauter Angst habe ich die Frage vergessen.
Ich bin nur noch ein paar Schritte von Malcolm entfernt. Seine Wangen sind blau angelaufen, und er hat aufgehört zu zittern. Ich drücke meinen Rücken an die Mauer, schiebe ein Bein unter meinen Hintern und drücke meinen Oberkörper nach oben, bis ich aufrecht stehe.
Für einen Moment betrachtet Malcolm meine ausgestreckte Hand und greift dann langsam danach. Ich packe sein Handgelenk und ziehe ihn nach oben, bis ich meinen Arm um seine schlanke Hüfte legen kann. Seine Haut fühlt sich an wie Eis.
Man kann den Sicherheitsgurt vorne aufschnallen und die Riemen verlängern. Ich ziehe sie um seine Hüfte und wieder durch die Schnalle, sodass wir jetzt aneinander gebunden sind. Seine Wollmütze schabt rau an meiner Wange.
»Was soll ich machen?«, fragt er mit brüchiger Stimme.
»Du kannst beten, dass das andere Ende irgendwo festgebunden ist.«
2
Auf dem Dach des Marsden Hospital war ich wahrscheinlich sicherer als zu Hause mit Julianne. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie mich genannt hat, aber ich glaube, dass sie die Worte unverantwortlich, fahrlässig, achtlos, unreif und als Vater unfähig benutzt hat. Das war, nachdem sie mit einer Ausgabe der Marie Claire auf mich eingeschlagen und mir das Versprechen abgerungen hat, nie wieder etwas derart Dummes zu tun.
Charlie hingegen gibt keine Ruhe. Sie hüpft in ihrem Schlafanzug auf dem Bett auf und ab und bedrängt mich mit Fragen, wie hoch es war, ob ich Angst hatte und ob die Feuerwehrleute ein großes Netz bereithatten, um mich aufzufangen.
»Endlich kann ich mal was Aufregendes erzählen«, sagt sie und boxt mich auf den Arm. Zum Glück hört Julianne sie nicht.
Jeden Morgen wenn ich mich aus dem Bett gekämpft habe, vollführe ich ein kleines Ritual. Wenn ich mich bücke, um die Schuhe zuzubinden, bekomme ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, was für eine Art von Tag vor mir liegt. Anfang der Woche, wenn ich ausgeruht bin, habe ich kaum Probleme, die Finger meiner linken Hand zu bewegen. Knöpfe finden in ihre Löcher, Gürtel ihre Schlaufen, und ich kann sogar einen Windsor-Knoten binden. An schlechten Tagen wie diesem ist es eine andere Geschichte. Der Mann, den ich im Spiegel sehe, braucht zwei Hände, um sich zu rasieren, und erscheint mit kleinen Toilettenpapierfetzen an Kinn und Hals zum Frühstück. An solchen Vormittagen sagt Julianne zu mir: »Du hast einen funkelnagelneuen elektrischen Rasierapparat im Bad.«
»Ich mag keine elektrischen Rasierer.«
»Warum nicht?«
»Weil ich Rasierseife mag.«
»Was gibt es an Rasierseife zu mögen?«
»Das Einseifen. Allein das Wort klingt wunderbar, findest du nicht? Ziemlich sexy – einseifen. Es ist dekadent.«
Sie kichert jetzt, versucht jedoch weiter, verärgert auszusehen.
»Die Leute seifen sich ein; sie seifen ihre Körper mit Duschgel ein. Ich finde, wir sollten unsere Scones mit Sahne und Marmelade einseifen. Und im Sommer könnten wir uns mit Sonnenöl einseifen… wenn es je einen Sommer gibt.«
»Du bist albern, Daddy«, sagt Charlie und blickt von ihren Cornflakes auf.
»Danke, mein Turteltäubchen.«
»Ein komisches Genie«, sagt Julianne und knibbelt das Klopapier aus meinem Gesicht.
Ich setze mich an den Tisch, gebe einen Löffel Zucker in meinen Kaffee und fange an zu rühren. Julianne beobachtet mich. Der Löffel stockt in der Tasse. Ich konzentriere mich und befehle meiner linken Hand, sich zu rühren, doch keine noch so große Willenskraft kann sie bewegen. Elegant wechsele ich den Löffel in die rechte Hand.
»Wann siehst du Jock?«, fragt sie.
»Am Freitag.« Bitte keine weiteren Fragen.
»Hat er dann die Ergebnisse der Tests?«
»Er wird mir sagen, was wir schon wissen.«
»Aber ich dachte – «
»Das hat er mir nicht gesagt!« Ich hasse die Schärfe in meiner Stimme.
Julianne zuckt nicht einmal mit der Wimper. »Jetzt habe ich dich wütend gemacht. Albern gefällst du mir besser.«
»Ich bin albern. Das weiß jeder.«
Ich kann sie durchschauen. Sie denkt, dass ich machomäßig versuche, meine Gefühle zu verbergen oder gnadenlos optimistisch zu sein, während ich in Wirklichkeit zusammenbreche. Meine Mutter ist genauso – sie ist eine verdammte Hobbypsychologin geworden. Warum überlassen sie es nicht den Experten, sich zu irren?
Julianne hat mir den Rücken zugewandt und zerkrümelt trockenes Brot, um es draußen für die Vögel auszustreuen. Mitgefühl ist ihre Lieblingsbeschäftigung.
In ihrem grauen Jogginganzug, den Turnschuhen und der Baseballkappe über dem kurzen dunklen Haar sieht sie aus wie siebenundzwanzig, nicht wie siebenunddreißig. Anstatt dass wir in Würde gemeinsam alt werden, hat sie das Geheimnis ewiger Jugend entdeckt, während ich zwei Anläufe brauche, um vom Sofa aufzustehen. Bei ihr hat sogar das Gebären leicht ausgesehen, obwohl ich ihr das nie sagen würde, es sei denn, ich entwickelte eine Todessehnsucht.
Wir sind seit sechzehn Jahren verheiratet, und wenn die Leute mich fragen, warum ich Psychologe geworden bin, sage ich: »Wegen Julianne. Ich wollte wissen, was sie wirklich denkt.«
Es hat nicht funktioniert. Ich habe noch immer keine Ahnung. Normalerweise ist Sonntagmorgen meine Zeit. Ich vergrabe mich unter dem vereinten Gewicht von vier Zeitungen und trinke Kaffee, bis meine Zunge sich pelzig anfühlt. Nach den gestrigen Ereignissen werde ich die Titelzeilen überschlagen, obwohl Charlie darauf besteht, dass wir die Artikel ausschneiden und in ein Notizbuch kleben. Vermutlich ist es ziemlich cool, ausnahmsweise mal »cool« zu sein. Bis gestern fand sie meinen Job langweiliger als Kricket.
Charlie ist ausgehfertig in Jeans, Pulli und Skijacke, weil ich versprochen habe, dass sie heute mitkommen darf. Seit sie ihr Frühstück heruntergeschlungen hat, beobachtet sie mich ungeduldig – und findet, dass ich meinen Kaffee zu langsam trinke.
Als es Zeit ist, den Wagen voll zu packen, tragen wir die Pappkartons aus dem Gartenschuppen und stellen sie neben meinen alten Metro. Julianne sitzt mit einer Tasse Kaffee auf den Knien auf der Treppe vor dem Haus. »Ihr seid beide verrückt, wisst ihr das?«
»Wahrscheinlich.«
»Man wird euch verhaften.«
»Und du bist schuld.«
»Wieso bin ich schuld?«
»Weil du nicht mitkommen willst. Wir brauchen einen Fluchtfahrer. «
Charlie stimmt mit ein. »Komm, Mum. Dad hat gesagt, dass du früher auch mitgekommen bist.«
»Da war ich noch jung und dumm und keine Elternvertreterin an deiner Schule.«
»Wusstest du, Charlie, dass deine Mutter bei meiner zweiten Verabredung mit ihr verhaftet worden ist, weil sie auf einen Fahnenmast geklettert ist und die südafrikanische Flagge heruntergeholt hat?«
Julianne wirft mir einen wütenden Blick zu. »Erzähl ihr das nicht!«
»Bist du wirklich verhaftet worden?«
»Ich wurde verwarnt. Das ist nicht das Gleiche.«
Zwei Kartons stehen auf dem Dachgepäckträger, zwei im Kofferraum und zwei auf dem Rücksitz. Feine Schweißperlen wie poliertes Glas zieren Charlies Oberlippe. Sie zieht ihre Skijacke aus und stopft sie zwischen die Sitze.
Ich wende mich noch einmal zu Julianne um. »Bist du sicher, dass du nicht mitkommen willst? Ich weiß, dass du eigentlich willst.«
»Und wer stellt die Kaution für uns?«
»Das macht deine Mutter.«
Sie kneift die Augen zusammen und stellt ihre Kaffeetasse hinter der Tür ab. »Aber ich tue es nur unter Protest.«
»Wird vermerkt.«
Sie streckt die Hand aus, damit ich ihr die Wagenschlüssel gebe. »Und ich fahre.«
Sie schnappt sich eine Jacke von der Garderobe im Flur und zieht die Tür zu. Charlie zwängt sich zwischen die Kartons auf dem Rücksitz und beugt sich aufgeregt vor. »Erzähl mir noch mal die Geschichte«, sagt sie, als wir uns in den leichten Verkehr auf der Prince Albert Road am Regent’s Park einfädeln. »Und lass nichts aus, bloß weil Mum dabei ist.«
Ich kann ihr nicht die ganze Geschichte erzählen. Ich kann mich nicht einmal selbst an alle Einzelheiten erinnern. In ihrem Mittelpunkt steht meine Großtante Gracie – der wirkliche Grund, warum ich Psychologe geworden bin. Sie war die jüngste Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits und ist im Alter von achtzig Jahren gestorben, nachdem sie beinahe sechzig Jahre lang keinen Fuß mehr vor ihre Haustür gesetzt hatte.
Sie lebte eine Meile von meinem Elternhaus entfernt in West London, in einem großen, alten, frei stehenden viktorianischen Haus mit kleinen Türmchen auf dem Dach, eisernen Balkonen und einem Kohlenkeller. Die Haustür hatte zwei rechteckige Bleiglasfenster. Wenn ich meine Nase dagegen drückte, sah ich Dutzende gebrochener Bilder von Tante Gracie, die den Flur hinuntereilte, weil sie mein Klopfen gehört hatte. Sie öffnete die Tür gerade weit genug, um mich hereinzulassen, und schloss sie dann eilig wieder.
Sie war groß und knochig mit klaren blauen Augen und hellem Haar, das mit den Jahren von weißen Strähnen durchzogen wurde. Sie trug immer ein langes schwarzes Samtkleid mit einer Perlenkette, die vor dem dunklen Stoff zu leuchten schien.
»Finnegan, komm! KOMM! Joseph ist hier!«
Finnegan war ein Jack Russell, der nicht bellen konnte. Sein Kehlkopf war bei einem Kampf mit einem Schäferhund aus der Nachbarschaft zertrümmert worden. Anstatt zu bellen, schnaufte und keuchte er, als ob er bei einem Pantomimentheater für die Rolle des großen bösen Wolfs vorsprechen würde.
Gracie sprach mit Finnegan, als ob er ein Mensch wäre. Sie las ihm Geschichten aus der Zeitung vor oder stellte ihm Fragen zu lokalen Angelegenheiten. Sie nickte, wenn er mit einem Schnauben, Keuchen oder einem Furz antwortete. Finnegan hatte sogar seinen eigenen Stuhl am Tisch, und Gracie steckte ihm heimlich Kuchenstückchen zu, während sie sich gleichzeitig dafür schalt, »das Tier von Hand zu füttern«.
Wenn Gracie Tee ausschenkte, goss sie meine Tasse immer halb voll Milch, weil ich zu jung war, das unverdünnte starke Gebräu zu trinken. Wenn ich auf den Stühlen am Esstisch saß, reichten meine Füße kaum auf den Boden, und wenn ich mich zurücklehnte, ragten meine Beine unter dem weißen Spitzentischtuch hervor.
Als ich Jahre später längst mit den Füßen auf den Boden kam und mich bücken musste, um Gracie auf die Wange zu küssen, goss sie meine Tasse immer noch halb voll Milch. Vielleicht wollte sie nicht, dass ich erwachsen wurde.
Wenn ich direkt von der Schule zu ihr ging, ließ sie mich neben sich auf der Chaiselongue Platz nehmen und fasste meine Hand. Sie wollte alles über meinen Tag wissen. Welche Spiele ich gespielt hatte. Womit meine Butterbrote belegt waren. Sie saugte die Details auf, als würde sie sich jeden meiner Schritte vorstellen.
Gracie war eine klassische Agoraphobikerin – sie hatte Angst vor offenen Plätzen. Nachdem sie es leid war, meine Fragen abzuwimmeln, hat sie einmal versucht, es mir zu erklären.
»Hattest du schon einmal Angst vor der Dunkelheit?«, fragte sie.
»Ja.«
»Was hast du geglaubt, was passieren würde, wenn das Licht ausgeht?«
»Dass mich ein Monster kriegen würde.«
»Hast du dieses Monster je gesehen?«
»Nein. Mum sagt, es gibt keine Monster.«
»Sie hat Recht. Es gibt wirklich keine Monster. Woher ist dein Monster also gekommen?«
»Von hier oben.« Ich tippte mir an die Stirn.
»Genau. Ich habe auch ein Monster. Ich weiß, dass es dieses Monster angeblich gar nicht gibt, aber es geht nicht weg.«
»Wie sieht dein Monster aus?«
»Es ist über drei Meter groß und hat ein Schwert. Wenn ich versuche, das Haus zu verlassen, schlägt es mir den Kopf ab.«
»Denkst du dir das aus?«
Sie lachte und versuchte, mich zu kitzeln, doch ich schob ihre Hände weg. Ich wollte eine ehrliche Antwort.
Sie wurde der Unterhaltung überdrüssig, kniff die Augen fest zu und steckte ein paar lose weiße Strähnen in ihren festen Dutt. »Hast du je einen dieser Horrorfilme gesehen, in denen der Held fliehen will und der Wagen springt nicht an? Er dreht den Zündschlüssel und tritt aufs Gaspedal, doch der Motor hustet nur und säuft ab. Und man sieht den Schurken schon kommen. Er hat eine Pistole oder ein Messer. Und man will schreien: ›Mach, dass du weg kommst! Los! Er kommt immer näher!‹«
Ich nickte mit großen Augen. »Na, stell dir diese Angst vor«, sagte sie, »multipliziere sie mit hundert, und dann weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich nur daran denke, rauszugehen.«
Sie stand auf und verließ das Zimmer. Die Diskussion war beendet. Ich habe das Thema nie wieder zur Sprache gebracht. Ich wollte sie nicht traurig machen.
Ich weiß nicht, wovon sie gelebt hat. Es trafen regelmäßig Schecks aus einer Anwaltskanzlei ein, doch Gracie stellte sie auf den Kaminsims, wo sie sie täglich anstarren konnte, bis sie abgelaufen waren. Ich vermute, dass sie Teil ihrer Erbschaft waren, doch sie wollte nichts mit dem Geld ihrer Familie zu tun haben. Den Grund kannte ich nicht – noch nicht.
Sie arbeitete als Näherin – sie nähte Brautkleider und Brautjungfernkleider. Häufig war das Wohnzimmer mit Seide und Organza dekoriert und eine zukünftige Braut stand auf einem Hocker vor Gracie, die eine Reihe Stecknadeln im Mund hatte. Es war kein Ort für kleine Jungen – es sei denn, sie wollten als Modell Kleider anprobieren.
Die Zimmer im ersten Stock waren voll gestopft mit dem, was Gracie ihr »Sammelsurium« nannte. Damit meinte sie Bücher, Modezeitschriften, Stoffballen, Garnspulen, Hutschachteln, Säcke voller Wolle, Fotoalben, Stoffspielzeug und eine Fundgrube unerschlossener Schachteln und Truhen.
Die meisten Stücke ihres »Sammelsuriums« waren gebraucht oder per Postversand bestellt. Die Kataloge lagen stets aufgeschlagen auf dem Couchtisch, und jeden Tag brachte der Postbote etwas Neues.
Gracies Weltsicht war verständlicherweise ziemlich begrenzt. Die Fernsehnachrichten und aktuellen Sendungen schienen Konflikte und Leiden mit einem Vergrößerungsglas zu betrachten. Sie sah kämpfende Menschen, sterbende Natur, fallende Bomben und verhungernde Länder. Und auch wenn das nicht die Gründe für ihre Flucht vor der Welt waren, so stellte das alles keinerlei Anreiz dar, dorthin zurückzukehren.
»Es macht mir schon Angst, wenn ich nur sehe, wie klein du noch bist«, erklärte sie mir. »Dies sind keine guten Zeiten, um Kind zu sein.« Sie blickte aus dem Erkerfenster und schüttelte sich, als könnte sie ein schreckliches Schicksal sehen, das dort draußen auf mich wartete. Ich sah bloß einen überwucherten und ungepflegten Garten, in dem weiße Schmetterlinge zwischen den knorrigen Ästen der Apfelbäume hin und her flatterten.
»Willst du nie rausgehen?«, fragte ich sie. »Willst du nie die Sterne betrachten oder am Flussufer entlanggehen und die Gärten bewundern?«
»Ich habe vor langer Zeit aufgehört, darüber nachzudenken. «
»Was vermisst du am meisten?«
»Nichts.«
»Irgendwas muss es doch geben.«
Sie überlegte einen Moment. »Ich habe den Herbst geliebt, wenn die Blätter sich verfärben und abfallen. Wir sind immer in die Kew Gardens gegangen, und ich bin über die Wege gerannt, habe mit den Füßen die Blätter aufgewirbelt und versucht, sie zu fangen. Die zusammengerollten Blätter segelten von einer Seite zur anderen wie winzige Boote in der Luft, bis sie in meinen Händen gelandet sind.«
»Ich könnte dir die Augen verbinden«, schlug ich vor.
» Nein.«
»Und wenn ich einen Karton über deinen Kopf stülpe. Du könntest so tun, als wärst du drinnen.«
»Lieber nicht.«
»Ich könnte warten, bis du schläfst und dann dein Bett aus dem Haus schieben.«
»Die Treppe runter?«
»Hmm. Könnte schwierig werden.«
Sie legte einen Arm um meine Schulter. »Mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin hier drinnen recht glücklich.«
Von da an war es eine Art Dauerwitz zwischen uns beiden. Ich dachte mir ständig neue Methoden aus, sie aus dem Haus zu locken, und schlug ihr neue Hobbys wie Drachenfliegen oder Flugakrobatik vor. Gracie reagierte mit gespieltem Entsetzen und erklärte mir, dass ich der eigentlich Verrückte wäre.
»Und was ist mit ihrem Geburtstag?«, fragt Charlie ungeduldig. Wir fahren durch St. John’s Wood und kommen gerade am Lord’s Kricketplatz vorbei. Vor den öden Mauern strahlen die Lichter der Verkehrsampeln besonders hell.
»Ich dachte, du wolltest die ganze Geschichte hören?«
»Ja, aber ich werde auch nicht jünger.«
Julianne kriegt einen Kicheranfall. »Den Sarkasmus hat sie von dir.«
»Okay«, sage ich seufzend, »ich erzähle dir von Tante Gracies Geburtstag. Sie hat ihr Alter nie zugegeben, aber ich wusste, dass sie fünfundsiebzig wurde, weil ich beim Ansehen ihrer Fotoalben auf ein paar Daten gestoßen war.«
»Du hast gesagt, sie wäre schön gewesen.«
»Ja. Auf den alten Fotos kann man das nur schwer erkennen, weil niemand je gelächelt hat und die Frauen schlicht Furcht einflößend aussahen. Gracie war anders. Sie hatte funkelnde Augen und sah immer so aus, als würde sie jeden Moment anfangen zu kichern. Und sie hat ihren Gürtel stets ein wenig enger gezogen und sich absichtlich so hingestellt, dass das Licht durch ihre Unterröcke fiel.«
»Sie war eine Kokette«, sagt Julianne.
»Was ist eine Kokette?«
»Vergiss es.«
Charlie runzelt die Stirn, schlingt die Arme um die Beine und legt ihr Kinn auf die Flicken auf den Knien ihrer Jeans.
»Es war ziemlich schwierig, eine Überraschung für Gracie zu planen, weil sie das Haus natürlich nie verlassen hat«, erkläre ich. »Ich musste alles machen, während sie schlief – «
»Wie alt warst du?«
»Sechzehn. Ich war noch in Charterhouse.«
Charlie nickt und fängt an, ihr Haar hochzustecken. Wenn sie das macht, sieht sie genau aus wie Julianne.
»Gracie hat ihre Garage nicht benutzt. Sie brauchte kein Auto. Die Garage hatte große Holztüren zur Einfahrt sowie einen Durchgang zur Waschküche. Zuerst habe ich aufgeräumt, den ganzen Müll weggeschafft und die Wände getüncht.«
»Da musst du aber ganz leise gewesen sein.«
»War ich.«
»Und dann hast du Lichterketten besorgt?«
»Hunderte. Sie sahen aus wie funkelnde Sterne.«
»Und dann hast du den großen Sack geholt.«
»Genau. Ich habe vier Tage gebraucht. Ich habe ihn auf der Schulter auf meinem Fahrrad transportiert. Die Leute haben wahrscheinlich gedacht, ich wäre ein Straßenkehrer oder Parkwächter. «
»Sie haben wahrscheinlich gedacht, du bist verrückt.«
»Unbedingt.«
»Genau so wie wir verrückt sind?«
»Ja.« Ich riskiere einen Seitenblick zu Julianne, die aber nicht anbeißt.
»Was ist als Nächstes passiert?«, fragt Charlie.
»Nun, am Morgen ihres Geburtstags kam Gracie nach unten, ich habe ihr erklärt, dass sie die Augen zumachen müsse. Sie hat meinen Arm gefasst, und ich habe sie durch die Küche in die Waschküche und dann in die Garage geführt. Als sie die Tür öffnete, rollte ihr eine hüfthohe Laublawine entgegen. Ich sagte: ›Herzlichen Glückwunsch.‹ Du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Sie sah von den Blättern wieder zu mir. Einen Moment lang dachte ich, sie wäre wütend, doch dann hat sie mich angestrahlt. «
»Ich weiß, was als Nächstes passiert ist«, sagt Charlie.
»Ja, weil ich es dir erzählt habe.«
»Sie ist durch die ganzen Blätter gerannt.«
»Ja, wir alle beide. Wir haben sie hoch geworfen und mit den Füßen aufgewirbelt. Wir haben uns mit Laub beschmissen und die Blätter zu Haufen aufgetürmt. Irgendwann waren wir beide so erschöpft, dass wir in ein Bett aus Laub gesunken sind und zu den Sternen aufgeschaut haben.«
»Aber es waren keine echten Sterne, oder?«
»Nein, aber wir konnten so tun als ob.«
Der Eingang zum Kensal Green Cementary liegt in der Harrow Road und ist leicht zu übersehen. Julianne fährt die schmale Straße hinunter und parkt möglichst weit entfernt vom Häuschen des Friedhofswärters unter einer Gruppe von Bäumen. Ich schaue aus dem Fenster und sehe ordentliche Reihen von Grabsteinen, unterbrochen von Wegen und Blumenbeeten.
»Ist es verboten?«, flüstert Charlie.
»Ja«, sagt Julianne.
»Nicht direkt«, widerspreche ich und fange an, die Kartons auszuladen und Charlie zu reichen.
»Ich kann zwei nehmen«, erklärt sie.
»Okay, ich nehme drei, und dann kommen wir zurück und holen den Rest. Es sei denn, Mum – «
»Oh, ich bin hier ganz zufrieden.« Sie hat sich seit unserer Ankunft nicht von der Stelle gerührt.
Wir marschieren los und bleiben anfangs in der Nähe der Bäume. Zwischen den Gräbern erstrecken sich lange Rasenflächen. Ich gehe vorsichtig, um keine Blumen niederzutrampeln und mir an niedrigen Grabsteinen nicht die Schienbeine zu stoßen. Die Geräusche der Harrow Road verklingen und werden von Vogelgezwitscher und dem regelmäßigen Dröhnen der Schnellzüge ersetzt.
»Kennst du den Weg?«, fragt Charlie hinter mir leicht keuchend.
»Es ist da drüben, Richtung Kanal. Sollen wir eine Pause machen? «
»Schon gut.« Ihre Stimme klingt unvermittelt zweifelnd. »Dad?«
»Ja?«
»Diese Blätter kann sie nicht wirklich aufwirbeln, weil sie tot ist, oder?«
»Nein.«
»Ich meine, sie kann nicht wieder lebendig werden. Das machen Tote nicht, oder? Ich habe nämlich Zeichentrickfilme über Zombies und Mumien gesehen, die von den Toten zurückkehren, aber in Wirklichkeit passiert so was nicht, oder?«
»Nein.«
»Und Gracie ist jetzt im Himmel, oder? Dorthin ist sie doch gegangen.«
»Ja.«
»Und was machen wir dann mit all den Blättern hier?«
In solchen Augenblicken verweise ich Charlie normalerweise direkt an Julianne, die sie postwendend mit der Bemerkung zu mir zurückschickt: »Dein Vater ist Psychologe. Er kennt sich mit so was aus.«
Charlie wartet.
»Was wir machen, ist sozusagen symbolisch«, sage ich.
»Was bedeutet das?«
»Hast du die Leute schon mal sagen hören: ›Es ist der Gedanke, der zählt.‹?«
»Das sagst du immer, wenn mir jemand etwas schenkt, das mir nicht gefällt. Du sagst, ich soll dankbar sein, auch wenn das Geschenk blöd ist.«
»Das ist nicht genau das, was ich meine.« Ich probiere es mit einem neuen Ansatz. »In Wirklichkeit kann Tante Gracie diese Blätter natürlich nicht aufwirbeln. Aber egal wo sie ist, ich glaube, wenn sie uns jetzt zuguckt, dann lacht sie. Und es gefällt ihr bestimmt. Darauf kommt es an.«
»Und sie wirbelt im Himmel Blätter auf?«, will Charlie wissen.
»Auf jeden Fall.«
»Glaubst du, dass sie draußen ist, oder gibt es im Himmel auch irgendwas, wo man drinnen sein kann?«
»Ich weiß es nicht.«
Ich stelle meine Kartons ab und nehme Charlie ihre ab. Gracies Grabstein ist ein schlichter quadratischer Granitblock. Jemand hat eine schlammverschmierte Schaufel an die Messingplakette gelehnt und vergessen. Ich stelle mir Grabräuber vor, die eine Teepause machen, aber heutzutage arbeiten sie bestimmt mit Maschinen und nicht mehr mit Muskelkraft. Ich werfe die Schaufel zur Seite, und Charlie wischt die Plakette mit dem Ärmel ihrer Skijacke blank. Ich schleiche mich von hinten an und kippe einen Karton Laub über ihr aus.
»Hey, das ist nicht fair!« Charlie sammelt eine Hand voll Blätter ein und stopft sie mir in den Nacken meines Pullovers. Kurz darauf ist alles mit Blättern übersät. Gracies Grabstein ist komplett unter unserem Herbstopfer begraben.
Plötzlich räuspert sich hinter mir jemand laut, und Charlie stößt einen überraschten Schrei aus.
Vor dem Hintergrund des blassen Himmels zeichnet sich die Silhouette des Friedhofswärters ab, die Beine gespreizt und die Hände in die Hüften gestemmt. Er trägt eine grüne Jacke und schlammige Gummistiefel, die aussehen, als wären sie ihm zu groß.
»Könnten Sie mir vielleicht erklären, was Sie hier machen?«, fragt er mit monotoner Stimme und kommt einen Schritt näher. Er hat ein flaches rundes Gesicht, eine breite Stirn und eine Glatze und erinnert an Thomas, die kleine Lokomotive.
»Das ist eine lange Geschichte«, sage ich zaghaft.
»Sie entweihen ein Grab.«
Das klingt so albern, dass ich lachen muss. »Das glaube ich kaum.«
»Sie finden das komisch? Das ist Vandalismus. Es ist ein Verbrechen. Das ist Verschmutzung – «
»Trockenes Laub fällt nicht im engeren Sinne unter Verschmutzung. «
»Kommen Sie mir nicht mit Spitzfindigkeiten«, stottert er.
Charlie entscheidet sich, dazwischenzugehen. Mit atemloser Eloquenz erklärt sie: »Heute ist Gracies Geburtstag, aber wir können keine Party für sie geben, weil sie schon tot ist. Sie geht nicht gern raus. Wir haben ihr ein paar Blätter mitgebracht. Sie wirbelt gern mit den Füßen Blätter auf. Keine Angst, sie ist kein Zombie oder eine Mumie. Sie kommt nicht von den Toten zurück. Sie ist im Himmel. Glauben Sie, dass es im Himmel Bäume gibt?«
Der Friedhofswärter sieht sie vollkommen verdutzt an und braucht einen Moment, bis er begreift, dass die letzte Frage an ihn gerichtet ist. Es scheint, als hätte es ihm die Sprache verschlagen, er unternimmt einige erfolglose Anläufe zu sprechen, bevor seine Stimme ihn ganz im Stich lässt. Nunmehr vollkommen entwaffnet, geht er in die Hocke und sieht ihr direkt in die Augen.
»Wie heißt du denn, Fräuleinchen?«
»Charlie Louise O’Loughlin. Und Sie?«
»Mr. Gravesend.«
»Das ist ziemlich komisch.«
»Ja, mag sein.« Er lächelt.
Ungleich weniger warmherzig sieht er nun mich an. »Wissen Sie, wie viele Jahre ich schon versuche, den Mistkerl zu schnappen, der immer Blätter auf dieses Grab schüttet?«
»Ungefähr fünfzehn?«, schätze ich.
»Ich wollte sagen, dreizehn, aber ich glaube Ihnen gerne. Ich habe beobachtet, wann Sie kommen. Ich habe mir das Datum notiert. Vor zwei Jahren hätte ich Sie beinahe erwischt, aber da müssen Sie mit einem anderen Auto gekommen sein.«
»Mit dem Wagen meiner Frau.«
»Und im letzten Jahr hatte ich frei – ein Samstag. Ich habe dem jungen Whitney gesagt, er soll Ausschau nach Ihnen halten, aber der hält mich für zwanghaft und meint, ich soll mich über einen Haufen Blätter nicht so aufregen.«
Er stößt mit der Stiefelspitze gegen den anstößigen Haufen. »Aber ich nehme meinen Job sehr ernst. Die Leute kommen hierher und probieren alles Mögliche, sie pflanzen Eichen auf Gräber oder deponieren Spielzeug. Wo soll das enden, wenn wir so etwas durchgehen lassen?«
»Muss ein harter Job sein«, sage ich.
»Da haben Sie verdammt Recht!« Er sieht Charlie an. »Verzeihung, mein Fräulein.«
Sie kichert.
Mir fällt ein flackerndes Blaulicht am anderen Ufer des Kanals auf, und über seine Schulter hinweg sehe ich zwei Polizeiwagen, die neben einem dritten, bereits wartenden halten. Ihre Lichter spiegeln sich im Wasser und beleuchten stroboskopartig die Stämme der winterlichen Bäume, die wie Wächter zwischen den Gräbern stehen.
Mehrere Polizisten starren in eine Mulde neben dem Kanal. Ihre Gesichter wirken erfroren, bis einer beginnt, die Stelle mit blau-weißem Polizeiband abzusperren, das er um Bäume und Zaunpfähle wickelt.
Mr. Gravesend ist verstummt und weiß nicht, was er als Nächstes tun soll. Sein Plan reichte nur bis zu meiner Ergreifung, weiter ging er nicht. Außerdem hat er nicht erwartet, dass Charlie hier sein würde.
Ich ziehe eine Thermoskanne aus meiner Manteltasche. In der anderen Tasche habe ich zwei Becher. »Wir wollten gerade einen heißen Kakao trinken. Möchten Sie auch einen?«
»Sie können meinen Becher benutzen«, sagt Charlie. »Ich teile ihn mit Ihnen.«
Er denkt darüber nach und fragt sich, ob man ihm das als Bestechlichkeit auslegen könnte. »So weit ist es also gekommen«, sagt er mit klarer sanfter Stimme. »Entweder ich lasse Sie verhaften oder ich trinke einen heißen Kakao.«
»Mum hat gesagt, wir würden verhaftet«, meldet sich Charlie wieder zu Wort. »Sie hat gesagt, wir wären verrückt.«
»Du hättest auf deine Mama hören sollen.«
Ich reiche dem Friedhofswärter den einen, Charlie den anderen Becher an.
»Herzlichen Glückwunsch, Tante Gracie«, sagt sie. Mr. Gravesend murmelt eine angemessen klingende Antwort, während er immer noch darüber staunt, wie schnell er kapituliert hat.
In diesem Moment sehe ich zwei Kartons nahen, die über schwarzen Leggins und Turnschuhen durch das Halbdunkel schwanken.
»Das ist meine Mum. Sie ist unser Wachposten«, stellt Charlie fest.
»Nicht unbedingt ihre Stärke«, gibt Mr. Gravesend zurück.
»Nein.«
Julianne lässt die Kartons fallen und stößt einen überraschten Schrei aus, der ähnlich klingt wie Charlies.
»Keine Sorge, Mum, du wirst nicht wieder verhaftet.«
Der Friedhofswärter zieht die Augenbrauen hoch und Julianne lächelt matt. Wir teilen uns den heißen Kakao und plaudern. Mr. Gravesend erzählt von den Schriftstellern, Malern und Staatsmännern, die auf diesem Friedhof begraben liegen, und bei den meisten klingt es so, als wären sie seine persönlichen Freunde gewesen, obwohl sie schon seit einhundert Jahren tot sind.
Charlie tobt durch die Blätter, bis sie unvermittelt erstarrt. Sie blickt den Hang zum Kanal hinunter. Bogenlampen sind eingeschaltet worden, und am Wasser wird ein Zelt aufgebaut. Aus einer Leuchtpistole werden mehrere Schüsse abgegeben.
»Was ist da los?«, fragt sie neugierig und will hinuntergehen. Julianne zieht sie sanft an sich und legt den Arm um Charlies Schultern.
Charlie sieht erst mich und dann den Friedhofswärter an. »Was machen die da?«
Niemand antwortet. Stattdessen beobachten wir schweigend das Geschehen, von einem Gefühl niedergedrückt, das über Trauer hinausgeht. Die Luft ist kälter geworden und riecht nach Feuchtigkeit und Verwesung. Das markerschütternde Kreischen von Stahl in einem entfernten Lagerhof klingt wie ein Schmerzensschrei.
Auf dem Kanal ist ein Boot. Männer in fluoreszierenden gelben Westen beugen sich über den Rand und leuchten mit Taschenlampen ins Wasser. Andere gehen in einer Reihe langsam mit gesenkten Köpfen an den Ufern entlang und suchen jeden Zentimeter ab. Hin und wieder bleibt einer stehen und bückt sich. Die anderen warten, um die Reihe nicht aufzulösen.
»Haben die was verloren?«, fragt Charlie.
»Psst«, flüstere ich.
Juliannes Gesicht wirkt nackt und verletzlich. Sie sieht mich an. Zeit zu gehen.
In diesem Moment hält ein Leichenwagen neben dem Zelt. Die Hecktüren gehen auf, und zwei Männer in Overalls ziehen eine Bahre auf einen zusammenklappbaren Rollwagen.
Rechts hinter mir taucht ein Polizeiwagen auf, der, gefolgt von einem weiteren Wagen, mit flackerndem Licht, aber ohne Sirene durch das Friedhofstor fährt.
Mr. Gravesend ist bereits unterwegs zum Parkplatz und seinem Wärterhäuschen.
»Los, komm, wir gehen jetzt besser«, sage ich und kippe den letzten Schluck Kakao aus. Charlie begreift immer noch nichts, spürt jedoch, dass sie lieber den Mund halten sollte.
Ich öffne die Wagentür, und sie rutscht auf die Rückbank, um der Kälte zu entkommen. Über die Kühlerhaube hinweg sehe ich, dass der Friedhofswärter sich achtzig Meter entfernt mit den Polizisten unterhält und in Richtung Kanal weist. Ein Block wird gezückt, Einzelheiten werden notiert.
Julianne sitzt auf dem Beifahrersitz. Sie möchte, dass ich fahre. Mein linker Arm zittert. Ich packe den Schaltknüppel, damit es aufhört. Als wir an den Polizeiwagen vorbeifahren, blickt einer der Beamten auf. Er ist ein Mann mittleren Alters mit pockennarbigen Wangen und kampferprobter Nase. Er trägt einen zerknitterten grauen Mantel und einen zynischen Ausdruck im Gesicht, als wäre dies nicht das erste Mal und würde trotzdem nie leichter werden.
Unsere Blicke treffen sich, und er sieht direkt durch mich hindurch. In seinen Augen liegt kein Licht, keine Geschichte, kein Lächeln. Er zieht eine Augenbraue hoch und dreht den Kopf zur Seite. Aber da bin ich schon an ihm vorbei. Ich halte noch immer den Schaltknüppel gepackt und suche verzweifelt den zweiten Gang.
Als wir das Tor erreichen, blickt Charlie durch das Heckfenster zurück und fragt, ob wir nächstes Jahr wiederkommen.
3
Ich gehe jeden Morgen durch den Regent’s Park zur Arbeit. Zu dieser Jahreszeit, wenn es kühler wird, trage ich rutschfeste Schuhe, einen Wollschal und ein Dauerstirnrunzeln im Gesicht. Von wegen globale Erwärmung. Man wird älter und die Welt kälter. Das ist eine Tatsache.
Die Sonne schwebt wie ein blassgelber Ball am grauen Himmel, Jogger gleiten mit gesenkten Köpfen an mir vorbei und hinterlassen mit ihren Laufschuhen Abdrücke auf dem nassen Asphalt. Die Gärtner sollten eigentlich Knollen für den Frühling pflanzen, aber ich sehe sie im Geräteschuppen rauchen und Karten spielen, während ihre Schubkarren voll Wasser laufen.
Auf der Primrose Hill Bridge blicke ich über das Geländer auf den Kanal. An dem Treidelpfad liegt ein einsames schmales Boot vor Anker, und vom Wasser steigt kräuselnd Dunst auf wie Rauchschwaden.
Was haben die Polizisten gesucht? Wen haben sie gefunden?
Ich habe gestern Abend Fernsehen geguckt und heute Morgen Radio gehört. Nichts. Ich weiß, dass es bloß morbide Neugier ist, doch irgendwie habe ich das Gefühl, Zeuge gewesen zu sein – wenn schon nicht des Verbrechens, so doch des anschließenden Grauens. Es ist wie in der Doku-Sendung über ungelöste Kapitalverbrechen, in der die Zuschauer aufgefordert werden, sich zu melden, wenn sie irgendwelche Informationen haben. Immer ist es jemand anderes, nie jemand, den wir kennen.
Es nieselt, und als ich mich wieder in Bewegung setze, klebt die Feuchtigkeit an meiner Jacke. Der Post Office Tower sticht vor dem dunklen Himmel ab. Er ist einer der Punkte, an denen sich die Leute in einer Stadt orientieren können. Straßen verlieren sich in Sackgassen oder winden und wenden sich grundlos, doch der Turm erhebt sich über alle Schrulligkeiten der Stadtplanung.
Ich mag diese Aussicht auf London. Die Stadt sieht immer noch ziemlich majestätisch aus. Erst wenn man näher kommt, erkennt man den Verfall. Andererseits könnte man das Gleiche vermutlich auch über mich sagen.
Meine Praxis liegt in einer Pyramide aus weißen Kästen an der Great Portland Street, entworfen von einem Architekten, der sich von seiner Kindheit hat inspirieren lassen. Vom Erdgeschoss aus betrachtet, wirkt das Gebäude irgendwie unfertig, sodass ich ständig einen Kran erwarte, der noch ein paar Klötze in die Lücken hievt.
Auf der Treppe vor dem Gebäude höre ich ein Auto hupen und drehe mich um. Ein knallroter Ferrari hält halb auf dem Bürgersteig. Der Fahrer, Dr. Fenwick Spindler, hebt eine behandschuhte Hand und winkt mir zu. Fenwick sieht aus wie ein Anwalt, ist jedoch Leiter der psychopharmakologischen Abteilung der Londoner Universitätsklinik. Nebenbei unterhält er eine Privatpraxis mit einem Behandlungszimmer direkt neben meinem.
»Morgen, alter Junge«, ruft er mir zu, ohne sich daran zu stören, dass die Menschen die Straße betreten müssen, um seinen Wagen zu umgehen.
»Keine Angst vor einem Knöllchen?«
»Dafür hab ich ja das da«, meint er und zeigt auf die Arztplakette an der Windschutzscheibe. »Perfekt in medizinischen Notfällen.«
Er eilt die Treppe hinauf und stößt die Glastür auf. »Hab dich neulich abends im Fernsehen gesehen. Ziemlich gute Show. Mich hätte da bestimmt keiner hochgekriegt.«
»Ich bin sicher, du hättest genauso – «
»Ich muss dir von meinem Wochenende erzählen. Ich war zur Jagd in Schottland. Ich hab ein Reh zur Strecke gebracht.«
»Bringt man Rehe zur Strecke?«
»Egal.« Er winkt ab. »Hab dem Viech direkt ins linke Auge geschossen.«
Die Empfangssekretärin öffnet mit einem Knopfdruck die Sicherheitstür und wir rufen den Fahrstuhl. Fenwick betrachtet sich in den Spiegeln und streicht ein paar Schuppen von den knubbeligen Schultern seines teuren Anzugs. Die Tatsache, dass ihm nicht mal ein maßgeschneiderter Anzug passt, sagt einiges über Fenwicks Statur.
»Verkehrst du immer noch mit Prostituierten?«, fragt er.
»Ich halte Vorträge.«
»So nennt man das heutzutage?« Er stößt ein dröhnendes Lachen aus. »Und wie wirst du bezahlt?«
Wenn ich ihm erzähle, dass ich es umsonst mache, wird er mir nicht glauben. »Ich bekomme Gutscheine, die ich später gegen Blowjobs eintauschen kann. Ich habe schon eine ganze Schublade voll.«
Er verschluckt sich beinahe und wird knallrot. Ich muss ein Lachen unterdrücken.
Bei all seinem Erfolg als Arzt ist Fenwick einer jener Menschen, die verzweifelt versuchen, jemand anderes zu sein. Deswegen wirkt er am Steuer eines Sportwagens auch irgendwie lächerlich. So als würde man Bill Gates in einer Badehose oder George W. Bush im Weißen Haus sehen. Es sieht einfach verkehrt aus.
»Wie geht’s mit der Du-weißt-schon?«
»Gut.«
»Mir ist es noch kein bisschen aufgefallen, alter Junge. Ich glaube, Pfizer arbeitet an einem neuen Medikamenten-Cocktail. Schau irgendwann mal vorbei, dann gebe ich dir die Forschungsberichte …«
Fenwicks Kontakte zur Pharmaindustrie sind bekannt. Seine Praxis ist eine Gedenkstätte für Pfizer, Novatis und Hoffmann-La Roche; praktisch jedes Detail ein Geschenk, von den Füllfederhaltern bis zur Espressomaschine. Das Gleiche gilt für sein gesellschaftliches Leben – Segeln in Cowes, Lachsfischen in Schottland und Gänsejagd in Northcumberland.
Wir biegen um die Ecke, und Fenwick wirft einen Blick in meine Praxis. Im Wartezimmer sitzt eine Frau mittleren Alters, die sich an eine orangefarbene, torpedoförmige Rettungsboje klammert.
»Ich weiß nicht, wie du das schaffst, alter Junge«, murmelt Fenwick.
»Was?«
»Ihnen zuzuhören.«
»So finde ich heraus, was ihr Problem ist.«
»Wozu die Mühe? Spendier ihr ein paar Anti-Depressiva und schick sie nach Hause.«
Fenwick glaubt nicht, dass Geisteskrankheiten psychologische oder gesellschaftliche Aspekte haben. Er behauptet, es wäre ein rein biologisches Problem und daher per definitionem medikamentös behandelbar. Alles nur eine Frage der richtigen Mischung.
Jeden Morgen (nachmittags arbeitet er nicht) marschiert ein Patient nach dem anderen in seine Praxis und beantwortet ein paar oberflächliche Fragen, bevor Fenwick ihm ein Rezept ausschreibt und 140 Pfund berechnet. Wenn sie über Symptome sprechen wollen, will er über Medikamente reden. Und wenn sie über Nebenwirkungen klagen, setzt er die Dosis herunter.
Das Seltsame ist, dass seine Patienten ihn lieben. Sie kommen, weil sie Medikamente wollen, welche, ist ihnen egal. Je mehr Tabletten, desto besser. Vielleicht denken sie, dass sie so einen Gegenwert für ihr Geld kriegen.
Menschen zuzuhören, gilt heutzutage als altmodisch. Auch meine Patienten erwarten, dass ich eine Zauberpille zücke, die alles heilt. Wenn ich ihnen erkläre, dass ich bloß reden will, wirken sie enttäuscht.
»Morgen, Margaret. Freut mich, dass Sie es schaffen konnten. «
Sie hebt die Boje hoch.
»Über welche Brücke sind sie gekommen?«
»Über die Putney Bridge.«
»Das ist eine gute solide Brücke. Steht schon seit Jahren.«
Sie leidet an Gephyrophobie – der Angst, Brücken zu überqueren. Zu allem Überfluss wohnt sie am Südufer des Flusses und muss jeden Tag die Themse überqueren, um ihre Kinder zur Schule zu bringen. Sie trägt eine Rettungsboje für den Fall, dass die Brücke einstürzt oder von einer Flutwelle weggerissen wird. Ich weiß, dass das irrational klingt, aber so funktionieren einfache Phobien.
ENDE DER LESEPROBE
1. Auflage
Taschenbuchausgabe Juli 2011
Copyright © der Originalausgabe 2004 by Michael Robotham
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
NG · Herstellung: sc
eISBN 978-3-641-06305-4
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de