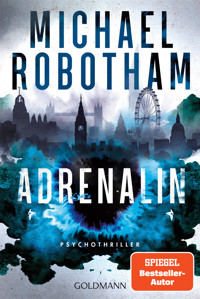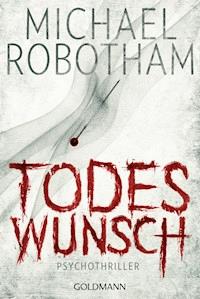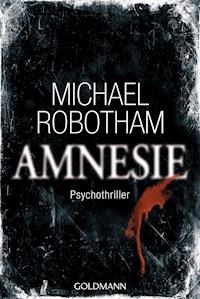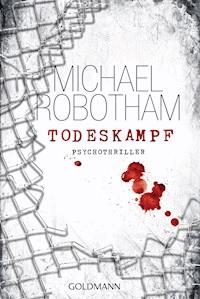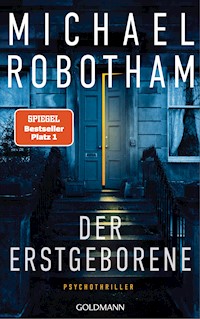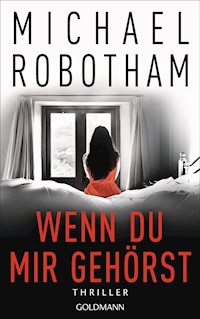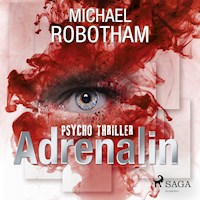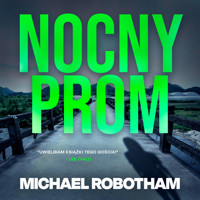9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Joe O'Loughlin und Vincent Ruiz
- Sprache: Deutsch
Der SPIEGEL-Bestseller jetzt im Taschenbuch!
Als Piper Hadley und ihre Freundin Tash McBain spurlos verschwinden, ahnt niemand, dass sie entführt wurden. Erst nach drei Jahren gelingt Tash die Flucht. Doch sie kommt nie zu Hause an. Dann wird eine Leiche in einem zugefrorenen See entdeckt. Handelt es sich um eines der Mädchen? Der Psychologe Joe O’Loughlin soll helfen, den Täter zu finden. Was er nicht weiß: Piper kauert währenddessen in ihrem Verlies und hofft verzweifelt auf Rettung. Denn der Mann, der sie in seiner Gewalt hat, ist in seinem Wahn zu allem fähig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Joe O’Loughlin freut sich auf ein ruhiges vorweihnachtliches Wochenende mit seiner Tochter Charlie in Oxford. Auf dem Weg dorthin kommt es allerdings zu einer Verzögerung. Der Zug hält kurz vor dem Ziel an, weil die Polizei gerade versucht, das Gebiet um einen See abzuriegeln, um einen Sichtschutz errichten zu können. Doch bevor ihnen das gelingt, ist für einen kurzen Augenblick die Leiche eines Mädchens zu sehen, die unter der Eisfläche gefangen ist.
In Oxford angekommen wird Joe gleich von der dortigen Polizei abgefangen. Er soll einen psychisch labilen Verdächtigen befragen. Ein Ehepaar wurde brutal ermordet in seinem Haus aufgefunden. Joe vermutet schon bald eine Verbindung dieses Falls zu der Leiche, die im See entdeckt wurde. Er hat im Haus der Opfer nämlich Spuren ausmachen können, die auf die Anwesenheit einer dritten Person schließen lassen. Besteht vielleicht sogar eine Verbindung zu dem so lang ungeklärten Fall der sogenannten Bingham-Mädchen? Vor drei Jahren sind zwei Mädchen aus dem Ort spurlos verschwunden. Zuerst dachte man, sie seien weggelaufen, doch sie konnten nie aufgespürt werden. Joe macht sich auf die Suche und merkt schon bald, dass er es diesmal mit einem äußerst grausamen Täter und einem extrem schwierigen Fall zu tun hat …
Weitere Informationen zu Michael Robotham sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Sag, es tut dir leid
Psychothriller
Ins Deutsche übertragen von Kristian Lutze
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Say You’re Sorry« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
1. AuflageCopyright © Bookwrite Pty 2012Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: Reilika Landen / Arcangel Images; FinePic®, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-09343-3 www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Alex
»Ich bin mir des Augenblicks bewusst, in dem ich mich gerade befinde. Dies ist der Moment davor. Dies ist das Luftholen.«
Jon Bauer, Rocks in the Belly
Ich heiße Piper Hadley und
ich werde seit dem letzten Samstag der Sommerferien vor drei Jahren vermisst. Ich habe mich nicht in Luft aufgelöst, und ich bin auch nicht weggelaufen, wie damals viele Leute geglaubt haben (sofern sie nicht dachten, ich sei sowieso schon tot). Und trotz allem, was man vielleicht gehört oder gelesen hat, bin ich auch nicht in ein fremdes Auto eingestiegen oder mit einem perversen Pädo durchgebrannt, den ich im Internet kennengelernt habe. Ich wurde weder an ägyptische Sklavenhändler verkauft noch von einer Bande Albaner zur Prostitution gezwungen. Und dass ich auf einer Luxusjacht nach Asien verschleppt wurde, stimmt auch nicht.
Ich war die ganze Zeit hier – weder im Himmel noch in der Hölle noch an dem Ort dazwischen, dessen Name mir nie einfällt, weil ich im Kindergottesdienst nicht aufgepasst habe. (Ich bin bloß wegen dem Kuchen und dem Saft danach hingegangen.)
Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Tage, Wochen oder Monate ich schon hier bin. Ich habe versucht mitzuhalten, aber mit Zahlen hab ich es nicht so. Im Rechnen bin ich ehrlich gesagt eine absolute Niete. Fragt Mr Monroe, meinen alten Mathelehrer. Der behauptet, ihm seien die Haare ausgefallen, als er mir das Lösen von Gleichungen beibringen wollte. Das ist übrigens totaler Blödsinn. Er war schon kahler als eine Schildkröte auf Chemo, bevor er mich je unterrichtet hat.
Jeder, der damals die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass ich nicht allein verschwunden bin. Meine beste Freundin Tash war bei mir. Ich wünschte, sie wäre jetzt hier. Ich wünschte, sie hätte sich nicht durch das Fenster gezwängt. Ich wünschte, ich wäre an ihrer Stelle entkommen.
In Geschichten über vermisste Kinder heißt es immer, sie würden von Herzen geliebt, und ihre Eltern wünschten sie sich sehnlichst zurück, egal ob das stimmt oder nicht. Damit will ich nicht sagen, dass sie nicht geliebt und vermisst werden, doch das ist nicht die ganze Wahrheit.
Schüler, die bei Prüfungen glänzen, laufen nicht weg. Mädchen, die bei Schönheitswettbewerben gewinnen, laufen nicht weg. Und auch nicht solche, die mit heißen Typen zusammen sind. Sie haben einen Grund zu bleiben. Aber was ist mit denen, die gemobbt werden? Die magersüchtig sind oder wegen ihres Aussehens Komplexe haben? Oder die die Streitereien ihrer Eltern leid sind? Es gibt eine Menge Gründe, die Jugendliche dazu bringen, und keiner hat etwas damit zu tun, ob man von seinen Eltern geliebt wird oder gewollt ist.
Ich will nicht an Tash denken, weil ich weiß, dass mich das aufregen wird. Meine Sauklaue ist auch so schon schwer zu entziffern, was eigentlich seltsam ist, weil ich mit neun sogar mal einen Schönschriftwettbewerb gewonnen habe. Als Preis gab es einen Füller in einer schicken Schachtel, an der ich mir beim Zumachen immer die Finger geklemmt habe.
Wir sind zusammen verschwunden, Tash und ich. Es war ein Sommer mit heißen Winden und heftigen Gewittern, die kamen und gingen wie, nun ja, Gewitter eben. Es war ein klarer Abend Ende August, der letzte Tag des Bingham Summer Festivals. Die Karussells liefen nicht mehr, und die bunten Lichter waren gelöscht.
Unser Verschwinden wurde erst am nächsten Morgen bemerkt. Am Anfang haben nur unsere Familien nach uns gesucht, dann riefen auch Nachbarn und Freunde unsere Namen auf Spielplätzen und Straßen, über Hecken und Felder. Als die Stunden sich anhäuften, alarmierten sie die Polizei, die eine richtige Suche einleitete. Hunderte von Menschen versammelten sich auf einem Kricketplatz und wurden in Trupps unterteilt, die die Bauernhöfe und Wälder entlang des Flusses durchsuchten.
Am zweiten Tag waren fünfhundert Leute im Einsatz, Polizeihubschrauber, Spürhunde und Soldaten von der Royal Air Force. Dann kamen die Journalisten mit ihren Satellitenschüsseln und Übertragungswagen, die auf dem Bingham Green parkten und die Einheimischen für die Benutzung der Toiletten bezahlten. Vor der Stadtuhr stehend berichteten Reporter den Leuten, dass es nichts zu berichten gebe, doch sie taten es trotzdem. Tagelang ging das so, auf allen Sendern rund um die Uhr, weil die Öffentlichkeit auf den neusten Stand des Nichts gebracht werden wollte.
Sie nannten uns die »Bingham Girls«, und die Leute häuften Blumen zu Gedenkstätten und banden gelbe Bänder um Laternenpfähle. Sie kamen mit Luftballons, Stofftieren und Kerzen an, genau wie damals bei Prinzessin Dianas Tod. Vollkommen Fremde beteten für uns, weinten, als seien wir ihre Kinder, als würden wir die Tragödien ihres eigenen Lebens auf den Punkt bringen.
Wir waren wie die beiden Geschwister aus dem Märchen, wie Hänsel und Gretel, oder wie die verschwundenen Mädchen aus Soham in ihren identischen Man-United-Trikots. Ich erinnere mich an die Mädchen aus Soham, weil unsere Schule ihren Familien Karten geschickt hat, auf denen stand, wir würden für sie beten.
Ich mag diese alten Märchen nicht – die, in denen Kinder von Wölfen gefressen oder von Hexen eingesperrt werden. In unserer Grundschule hat man Hänsel und Gretel aus dem Bücherregal genommen, weil einige Eltern sich beschwert hatten, dass es zu unheimlich für Kinder sei. Mein Dad nannte solche Leute politisch korrekte Korinthenkacker und meinte, als Nächstes würden sie wahrscheinlich Humpty Dumpty als eine Verherrlichung von Gewalt gegen ungeborene Küken verbieten.
Mein Dad ist nicht gerade berühmt für seinen Humor, doch manchmal kann er echt komisch sein. Einmal hat er mich so zum Lachen gebracht, dass mir der Tee aus der Nase gekommen ist.
Die Tage vergingen, und der Ansturm der Reporter nahm kein Ende. Kameras schwenkten durch unsere Häuser, die Treppe hinauf in unsere Zimmer. An der Türklinke hing mein BH, und auf dem Nachttisch stand eine leere Tamponschachtel. Sie nannten es ein typisches Teenagerzimmer wegen der Poster, der kleinen, bunten Steinsammlung und den Schnappschüssen aus dem Fotoautomat, auf denen ich mit meinen Freundinnen drauf bin.
Meine Mum hätte normalerweise einen Anfall bekommen, weil das Haus so chaotisch war, aber ihr war offenbar nicht nach Aufräumen. So wie sie aussah, war ihr wohl jeder Atemzug zu viel. Meistens hat Dad geredet, trotzdem kam er rüber wie ein Mann weniger Worte, der starke stille Typ.
Unsere Eltern rekonstruierten unsere letzten Tage, setzten sie aus Fetzen von Informationen zusammen, wie bei den Alben, die Leute von ihren neugeborenen Babys machen. Jedes Detail war wichtig. Welches Buch habe ich gelesen: Supergute Tage – zum sechsten Mal. Welche DVD ich mir zuletzt ausgeliehen habe: Shaun of the Dead. Ob ich einen Freund habe: Ja, klar!
Jeder hatte eine Geschichte über uns zu erzählen – sogar die Leute, die uns nie leiden konnten. Wir waren aufgeweckt, fröhlich, beliebt und fleißig; glatte Einserschülerinnen. Ich hab mich kaputtgelacht.
Die Leute haben uns einen unechten Heiligenschein verpasst, uns zu den Engeln gemacht, die sie sich gewünscht hätten. Unsere Mütter waren anständig, unsere Väter schuldlos. Perfekte Eltern, die es nicht verdient hatten, so gequält zu werden.
Tash war die Intelligente und Hübsche. Und sie wusste es. Trug immer kurze Röcke und enge Tops. Selbst in ihrer Schuluniform sah sie umwerfend aus, mit Brüsten, die ihre Ankunft wie eine Kühlerfigur ankündigten. Es waren die Brüste einer erwachsenen Frau, einer Frau, die Glück gehabt hatte, einer Frau, die BHs vorführen oder bei einer Automesse die Motorhaube eines Sportwagens zieren könnte. Und sie fachte die Aufmerksamkeit noch weiter an, krempelte den Bund ihres Rockes um, um ihn noch kürzer zu machen, oder ließ den obersten Knopf ihrer Bluse offen.
Mit fünfzehn ist das Aussehen eines Mädchens ziemlich unberechenbar. Manche blühen auf, andere spielen Klarinette. Ich war dünn und hatte Sommersprossen, einen großen Mob wirrer schwarzer Haare, ein spitzes Kinn und Wimpern wie ein Lama. Meine körperlichen Vorzüge waren noch nicht bei mir angekommen oder einer anderen zugestellt worden, die vermutlich inniger oder überhaupt darum gebetet hatte.
Ich war eher für Tempo als für tief ausgeschnittene Kleider und kurze Röcke gebaut. Spindeldürr, eine Läuferin, Zweite der Landesmeisterschaften in meiner Altersgruppe. Mein Vater meinte, ich wäre ein halber Windhund, bis ich ihn darauf hinwies, dass der Vergleich mit einem Hund meinem Selbstbewusstsein nicht förderlich sei. Unscheinbar, lautete die Beschreibung meiner Großmutter. Ein Bücherwurm, sagte meine Mutter. Sie hätten mich auch ein Mauerblümchen nennen können, allerdings weiß ich gar nicht, wie Mauerblümchen aussehen. Verglichen mit mir wahrscheinlich gut.
Tash war ein hässliches Entlein, das zu einem Schwan erblühte, während ich ein hässliches Entlein war, das zu einer Ente heranwuchs – ein weniger glückliches Ende, ich weiß, aber so was kommt weit häufiger vor. Anders ausgedrückt, wenn ich eine Schauspielerin in einem Horrorfilm wäre, würde man einen Blick auf mich werfen und sagen: »Die muss dran glauben.« Während Tash das Mädchen wäre, das sich in der Dusche auszieht, im letzten Moment gerettet wird und bis an sein Lebensende mit dem Helden und seinen perfekten Zähnen glücklich ist.
Vielleicht hat sie dieses Happy End verdient, weil ihr echtes Leben nicht sonderlich lustig war. Tash ist in einem alten Bauernhaus eine halbe Meile außerhalb von Bingham aufgewachsen, an einem schmalen Weg, gerade breit genug für ein Auto oder einen Traktor. Mr McBain hatte den Hof in der Hoffnung gemietet, ihn eines Tages zu kaufen, doch er brachte das Geld nie auf.
Ich erinnere mich, wie meine Mutter sagte, die McBains wären weiße Unterschicht, was ich nie wirklich verstanden habe. Eine Menge Leute wohnen zur Miete und schicken ihre Kinder auf öffentliche Schulen, ohne dass sie deswegen verkorkster wären als die Reichen, die in Priory Corner leben.
Dort habe ich gewohnt, in einem Haus namens »The Old Vicarage«. Dort hat früher der Pfarrer gewohnt, bis die Kirche beschloss, dass sie noch mehr Geld brauchte, und das Haus samt Grundstück verkauft hat. Die Straßen von Priory Corner sind nicht mit Gold gepflastert, aber unsere Nachbarn benehmen sich so, als sollten sie es sein.
Wie alle anderen in der Stadt hängten sie nach unserem Verschwinden Plakate in ihre Fenster und pappten Aufkleber auf ihre Autos. Es gab Mahnwachen mit Kerzen, Sondergottesdienste in St. Mark’s und Gebete in der Schule. So viele Gebete, dass ich nicht weiß, wie Gott sie alle überhören konnte.
Wahrscheinlich fragt ihr euch, woher ich den Kram mit der polizeilichen Suche und der Mahnwache weiß. In den ersten paar Wochen ließ George uns fernsehen und Zeitung lesen. Wir waren in einem Speicher angekettet mit schrägen Decken und einem mit Vogelscheiße verdreckten Dachfenster. Der Raum unter den Dachziegeln war heiß und stickig, aber viel netter als hier. Es gab ein richtiges Bett und einen alten Fernseher mit einem Kleiderbügel als Antenne und rauschendem Schneesturm auf den meisten Sendern.
Am dritten Tag sah ich Mum und Dad auf dem Bildschirm. Sie sahen aus wie Kaninchen, die in einem grellen Lichtstrahl erstarrt waren. Mum trug ihr enges, schwarzes Kleid von Alexander McQueen und dunkle Pumps. Tash kannte die Marke. Ich bin nicht so gut in Designerklamotten. Mum hielt ein Foto in der Hand. Sie hatte ihre Stimme wiedergefunden und war nicht mehr zu bremsen.
Sie listete alle Kleider auf, die ich möglicherweise getragen hatte, als hätte ich sie wie Brotkrumen fallen lassen, um eine Spur zu legen, der die Leute folgen konnten. Dann hielt sie inne und starrte in die Kamera. Eine Träne hing an ihrer Wange, und weil alle warteten, wann sie fallen würde, hörte niemand auf das, was sie sagte.
Mr und Mrs McBain waren ebenfalls auf der Pressekonferenz. Mrs McBain hatte sich nicht die Mühe gemacht, sich zu schminken … oder zu schlafen. Sie hatte dicke Tränensäcke unter den Augen und trug ein T-Shirt und eine alte Jeans.
»Wie eine Vogelscheuche«, meinte Tash.
»Sie macht sich Sorgen um dich.«
»So sieht sie immer aus.«
Mein Dad holte zittrig Luft, doch seine Worte waren klar.
»Irgendjemand muss Piper und Tash gesehen haben. Vielleicht sind Sie sich nicht sicher oder wollen jemanden schützen. Bitte rufen Sie trotzdem die Polizei an. Sie können sich nicht vorstellen, was Piper uns bedeutet. Wir können nicht ohne unsere Tochter sein.«
Er blickte direkt in die Kameras. »Wenn Sie unsere Kinder entführt haben, geben Sie sie bitte zurück. Setzen Sie sie an der nächsten Straßenecke ab. Die beiden können einen Bus oder den Zug nehmen. Lassen Sie sie laufen.«
Dann wandte er sich an Tash und mich.
»Piper, wenn ihr beide, du und Tash, das seht. Wir finden euch. Haltet einfach durch. Wir kommen.«
Mit all der verwischten Mascara hatte Mum Augen wie ein Panda, doch sie sah immer noch aus wie ein Filmstar. Niemand kann für ein Foto posieren wie sie.
»Wo immer Sie sein mögen – wir verzeihen Ihnen. Schicken Sie Piper und Tash einfach nach Hause.«
Meine Schwester Phoebe wurde in ihrem hübschesten Kleid ins Bild gezerrt und stand mit einwärtsgerichteten Füßen und an den Fingern lutschend vor den Kameras. Mum musste ihr soufflieren.
»Komm nach Hause, Piper«, sagte Phoebe. »Wir vermissen dich alle.«
Tashs Vater sah sich den ganzen Zirkus mit verschränkten Armen an. Er sagte bis zum Schluss kein einziges Wort, bis ihn ein Reporter fragte: »Haben Sie nichts zu sagen, Mr McBain?«
Er bedachte den Reporter mit einem tödlichen Blick und ließ die Arme sinken. Dann sagte er: »Wenn Sie sie noch haben, lassen Sie sie laufen. Wenn sie tot sind, sagen Sie uns, wo wir sie finden können.«
Danach verschränkte er die Arme wieder. Das war alles. Zwei Sätze.
Irgendetwas zerbrach in Tashs Mum, und sie stieß einen leisen tierischen Laut aus wie ein wimmerndes Kätzchen in einer Kiste.
Hinterher gab es Gerüchte über Mr McBain. Die Leute fragten: »Wo waren seine Gefühle? Warum hat er angedeutet, dass sie tot sein könnten?«
Offenbar soll man bei Pressekonferenzen zittern und stammeln. Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz, ansonsten denken die Leute, man hätte die eigene Tochter und ihre beste Freundin vergewaltigt und ermordet.
Zum Schluss hielt meine Mum ein Foto von Tash und mir hoch. Es ist das Bild, das berühmt wurde, aufgenommen von Mr Quick, dem Schulfotografen (berühmt für seinen Pfefferminzatem und seine wandernden Hände, die Kragen richten, Röcke glatt streichen und Brüste betatschen).
Auf dem Foto sitzen Tash und ich in der ersten Reihe unserer Klasse. Tashs Rock ist so kurz, dass sie die Knie zusammenpressen und beide Hände im Schoß halten muss, um keine Einblicke zu gewähren. Ich hocke neben ihr mit meinen widerspenstigen Haaren und einem falschen Lächeln, das Victoria Beckham alle Ehre gemacht hätte.
Das ist das Foto, an das sich jeder erinnert: zwei Mädchen in einer Schuluniform, Piper und Tash, die Bingham Girls.
Egal welchen Sender man eingeschaltet hatte, überall waren wir und unsere Eltern zu sehen, die um Informationen flehten. Millionen von Wörtern wurden in den Zeitungen geschrieben, Seite auf Seite über neue Entwicklungen, die eigentlich nicht neu waren und zu nichts führten.
Bei der Mahnwache mit Kerzen sprach Reverend Trevor das gemeinsame Gebet, während seine Frau Felicity den örtlichen Klatsch anführte. Sie ist wie ein menschliches Megafon mit einem fetten Arsch und erinnert mich an diese Wippvögel, die ihren Schnabel in ein Glas tunken.
Sie und der Reverend haben einen Sohn namens Damian, der ein Kreuz auf der Stirn tragen sollte, weil er ins Reich des Bösen gehört. Der kleine Scheißer schleicht sich gern von hinten an und lässt die BH-Träger der Mädchen flitschen. Bei mir hat er das nie gemacht, weil ich schneller bin als er und ihm einmal seinen Asthma-Inhalator in die Nase gerammt habe.
Bei der Mahnwache in St. Mark’s gab es nur Stehplätze. Lautsprecher wurden aufgebaut, damit auch die Leute vor der Kirche die Gebete und Lieder hören konnten. Das Einzige, was fehlte, waren Kinder. Eltern hatten solche Angst vor weiteren Entführungen, dass sie ihre Kleinen sicher zu Hause hinter verschlossenen Türen hielten.
Das war das Wochenende, an dem die ersten Trauertouristen eintrafen. Leute kamen aus Oxford und von noch weiter, liefen durch die Straßen, besichtigten die Kirche und gafften unser Haus an.
Sie beobachteten die Reporter, die atemlos in Kameras sprachen und eine Menge heiße Luft abließen, vergangene Unglücksfälle ausweideten, Namen wie Holly Wells, Jessica Chapman und Sarah Payne fallen ließen und ein paar weitere Stunden mit Gerüchten und Spekulationen füllten.
Wenn die Touristen wieder abfuhren, wirkten sie leicht enttäuscht. Sie hatten sich Bingham düsterer gewünscht – als einen Ort, an dem Teenager verschwanden und nicht wieder nach Hause kamen.
1
Draußen ist es eiskalt – an manchen Orten minus sechsundzwanzig Grad –, was außergewöhnlich ist für diese Jahreszeit. Ich kam mir vor wie Scott auf seiner Antarktis-Expedition, als ich heute Morgen durch den Hyde Park zur Arbeit gelaufen bin, obwohl ich wahrscheinlich eher aussehe wie ein dick eingepackter Kandidat bei Dancing on Ice.
Vor vier Tagen hat es angefangen zu schneien. Dicke feuchte Flocken, die geschmolzen, wieder gefroren und von neuem Schnee zugedeckt worden sind, der den Verkehr zum Erliegen gebracht hat. Es gibt nicht genug Schneepflüge, um die Autobahnen zu räumen, und nicht genug städtische Fahrzeuge, um die Straßen zu streuen. Alle müssen die Zähne zusammenbeißen, buchstäblich und im übertragenen Sinn.
Flughäfen sind geschlossen worden, Flüge gestrichen, Flugzeuge sitzen am Boden fest. Zehntausende Menschen sind in Terminals und Autobahnraststätten gestrandet, die aussehen wie Flüchtlingslager voller Vertriebener, die sich in einem Meer aus Silberfolie unter Wärmedecken zusammendrängen.
Laut Wetterbericht im Fernsehen sitzt ein Keil kalter Luft über Grönland und Island fest und blockiert den Jetstream vom Atlantik. Gleichzeitig haben arktische und sibirische Winde die Kälte »turbo-gefrostet«, was an der sogenannten Arktischen Oszillation liegt.
Normalerweise habe ich nichts gegen Schnee. Er kann eine Menge Sünden verbergen. Unter den weißen Laken sieht London wunderschön aus, wie eine Stadt aus einem Märchen oder eine Filmkulisse. Aber heute ist es wichtig, dass die Züge pünktlich fahren. Charlie kommt nach London, wir wollen vier Tage zusammen nach Oxford fahren, ein Wochenende fürs Vater-Tochter-Bonding, obwohl sie es wahrscheinlich anders nennen würde.
Es geht um einen Jungen. Er heißt Jacob.
»Hättest du keinen Edward finden können?«, habe ich Charlie gefragt. Sie hat mir nur einen vernichtenden Blick zugeworfen – den, den sie von ihrer Mutter gelernt hat.
Ich weiß nicht viel über Jacob außer der Marke seiner Unterhose, die man knapp unterhalb der Arschspalte lesen kann. Er könnte sehr nett sein. Er könnte einen Wortschatz haben. Ich weiß, dass er fünf Jahre älter als Charlie und zusammen mit ihr bei geschlossener Tür in ihrem Zimmer erwischt worden ist. Sie hätten sich nur geküsst, sagen sie, aber Charlies Bluse war aufgeknöpft.
»Du musst mit ihr reden«, hat Julianne mir erklärt, »aber sei behutsam. Wir wollen nicht, dass sie Komplexe kriegt.«
»Was für Komplexe denn?«
»Wir könnten ihr den Sex verleiden.«
»Wär doch ein Pluspunkt.«
Das fand Julianne nicht witzig. Sie befürchtet, Charlie könnte unter einem zu geringen Selbstbewusstsein leiden, was offenbar der erste Schritt auf dem rutschigen Hang zu Essstörungen, kaputten Zähnen, unreiner Haut, schlechten Noten, Drogensucht und Prostitution ist. Ich übertreibe natürlich, doch immerhin fragt Julianne mich um Rat.
Wir leben getrennt, sind jedoch nicht geschieden. Das Thema wird gelegentlich aufgebracht (nie von mir), doch wir sind noch nicht dazu gekommen, die Papiere zu unterschreiben. Derweil ziehen wir gemeinsam zwei Töchter groß, eine intelligente, entzückende Siebenjährige und einen Teenager mit einem frechen Mundwerk und ständig wechselnden Launen.
Ich bin vor acht Monaten zurück nach London gezogen. Deshalb sehe ich die Mädchen nicht mehr so oft, was bedauerlich ist. Ich habe den Kreis beinahe geschlossen – ich habe eine neue psychologische Praxis eröffnet und lebe im Norden Londons. Wie vor fünf Jahren, als Julianne und ich ein Haus an der Grenze von Camden Town und Primrose Hill hatten. Im Sommer konnte man bei offenem Fenster die Löwen und Hyänen im Londoner Zoo hören. Als ob man auf Safari wäre, nur ohne Jeeps.
Jetzt wohne ich in einem Einzimmer-Apartment, das mich an meine Studentenzeit erinnert – billig, vorübergehend, voller nicht zueinanderpassender Möbel und einem Vorrat von indischen Pickles und Chutneys im Kühlschrank.
Ich versuche, nicht über die Vergangenheit zu grübeln. Ich berühre sie nur behutsam mit den äußersten Gedankenspitzen, als wären sie ein besorgniserregender Knoten in meinen Hoden, wahrscheinlich gutartig, aber vernichtend bis zum Beweis des Gegenteils.
Ich praktiziere wieder. An der Tür prangt ein Messingschild mit der Aufschrift JOSEPH O’LOUGHLIN, PSYCHOLOGE sowie verschiedenen Abkürzungen vor meinem Namen. Die meisten meiner Patienten werden mir vom Gericht geschickt, obwohl ich zwei Tage in der Woche auch für den National Health Service arbeite.
Heute habe ich schon einen Autohändler mit Hang zum Cross-Dressing, einen zwangsgestörten Floristen und einen Nachtclub-Türsteher mit Aggressionsbewältigungsproblemen empfangen. Keiner von ihnen ist besonders gefährlich, sie versuchen bloß, irgendwie klarzukommen.
Meine Sekretärin Bronwyn klopft an meine Tür. Sie ist eine Aushilfskraft von einer Zeitagentur und kaut schneller Kaugummi, als sie tippt.
»Ihr Zwei-Uhr-Termin ist da«, sagt sie. »Und ich wollte fragen, ob ich heute früher gehen kann.«
»Sie sind doch schon gestern früher gegangen.«
»Ja.«
Sie verzieht sich ohne weitere Diskussion.
Mandy kommt herein, neunundzwanzig, blond und übergewichtig, mit schrecklicher Haut und Augen, die zu einer älteren Frau gehören sollten. Man hat sie zu mir geschickt, weil man ihre beiden Kinder allein in einer abgeschlossenen Wohnung gefunden hatte. Mandy war mit ihrem Freund in einen Club gegangen und hatte bei ihm übernachtet. Der Polizei erklärte sie, dass sie den Eindruck gehabt hätte, ihre sechsjährige Tochter sei alt genug, um auf ihren vierjährigen Bruder aufzupassen. Beiden Kindern geht es übrigens gut. Eine Nachbarin fand sie wie flatternde Hühner zwischen Kekskrümeln und Fäkalien auf dem Teppich.
Mandy sieht mich aggressiv an, als ob ich persönlich dafür verantwortlich wäre, dass ihre Kinder in Pflege gekommen sind. In den nächsten fünfzig Minuten sprechen wir über ihre Geschichte, und ich höre mir ihre Ausflüchte an. Wir vereinbaren, uns in der nächsten Woche wiederzusehen, und ich übertrage meine Notizen.
Es ist kurz nach drei. In einer halben Stunde kommt Charlies Zug an, und ich soll sie am Bahnhof treffen. Ich weiß nicht, was wir am Wochenende in Oxford machen wollen. Ich soll einen Vortrag bei einem psychologischen Symposium halten, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass bei dem Wetter irgendjemand kommt, doch sie haben Zugfahrkarten geschickt (Erste Klasse) und mir ein schickes Hotelzimmer gebucht.
Ich packe meinen Aktenkoffer, nehme die Reisetasche aus dem Schrank und schließe die Praxis ab. Bronwyn ist schon weg und hat nur einen Hauch ihres Parfüms und einen Kaugummi zurückgelassen, der an ihrem Becher klebt.
An der Paddington Station suche ich unter den Massen, die aus den Waggons des First-Great-Western-Zuges strömen, nach Charlie. Sie gehört zu den Letzten, die aus dem Zug steigen. Sie redet mit einem Jungen, der mit der ganzen Nonchalance eines Ferrari-Fahrers ein Mountainbike neben sich herschiebt. Er trägt einen Duffelcoat und lässt sich Koteletten wachsen.
Der Junge radelt davon. Charlie steckt sich zwei weiße Ohrhörer in die Ohren. Sie trägt Jeans, einen weiten Pullover und einen Mantel, der von der deutschen Luftwaffe übrig geblieben ist.
Sie hält mir eine Wange zum Küssen hin und beugt sich vor, um sich umarmen zu lassen.
»Wer war das?«
»Bloß ein Junge.«
»Wo hast du ihn kennengelernt?«
»Im Zug.«
»Wie heißt er?«
»Soll das ein Verhör werden oder was, Dad?«, unterbricht sie mich. »Ich hab mir nämlich keine Notizen gemacht. Hätte ich das tun sollen? Du hättest mich vorwarnen müssen. Ich hätte dir einen kompletten Bericht schreiben können.«
Den Sarkasmus hat sie von ihrer Mutter geerbt oder vielleicht auch auf der Privatschule gelernt, die mich so viel Geld kostet.
»Ich wollte bloß Konversation machen.«
Charlie zuckt die Achseln. »Er heißt Christian, ist achtzehn Jahre alt, kommt aus Bristol und will Arzt werden – Kinderarzt, um genau zu sein –, und er denkt, dass er vielleicht eine Zeitlang in der Dritten Welt arbeiten will, aber er ist nicht mein Typ.«
»Du hast einen Typ.«
»Jep.«
»Darf ich fragen, was dein Typ ist?«
Sie seufzt, der vielen Erklärungen schon müde. »Kein Mädchen in meinem Alter sollte einen Freund haben, mit dem ihre Eltern einverstanden sind.«
»Ist das eine Regel?«
»Jep.«
Ich nehme ihre Tasche und studiere die Anzeigetafel mit den abfahrenden Zügen. Der Zug nach Oxford geht in vierzig Minuten.
»Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, von denen ich wissen sollte? Irgendwelche jüngsten Entwicklungen?«
»Nö.«
»Wie läuft’s in der Schule?«
»Gut.«
»Emma?«
»Geht’s prima.«
Ich verhöre sie schon wieder. Charlie ist nicht der redselige Typ. Ihre Grundhaltung ist zu-cool-für-alles.
Wir kaufen uns Sandwiches in dreieckigen Plastikverpackungen und Getränke in Plastikflaschen. Charlie steckt wieder ihre Ohrhörer in die Ohren. Als wir in den Zug gestiegen sind und uns auf gegenüberliegende Plätze gesetzt haben, kann ich das komprimierte Umba-Umba-Zang hören.
Sie hat sich die Haare gefärbt, seit ich sie zum letzten Mal gesehen habe, und sich einen ärgerlichen Pony wachsen lassen, der bis über ihre Augen fällt. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie runzelt zu oft die Stirn. Offenbar fühlt sie sich aus irgendeinem Grund gedrängt, das Leben zu früh zu verstehen, lange bevor sie die nötigen Voraussetzungen dafür hat.
Der Zug fährt pünktlich, wir verlassen London, die Räder unter meinen Füßen spielen einen jazzigen Rhythmus. Häuser weichen Feldern, die Landschaft ist zu einem Stillleben gefroren, in der die Rauchfahnen der Schornsteine und die Scheinwerfer der an den Bahnübergängen wartenden Autos die einzigen Lebenszeichen sind.
Ein Pärchen auf den Plätzen auf der anderen Seite des Mittelgangs küsst sich eng umschlungen. Sie hat ein Bein zwischen seine Schenkel geschoben.
»Das ist eklig«, sagt Charlie.
»Sie küssen sich doch nur.«
»Ich kann das Schmatzen bis hierher hören.«
»Es ist ein öffentlicher Ort.«
»Sie sollten sich ein Zimmer nehmen.«
Ich blicke erneut zu dem Paar und spüre ein Pawlow’sches Zucken der Erregung oder Nostalgie. Das Mädchen ist jung und hübsch. Sie erinnert mich an Julianne in dem Alter. Daran, verliebt sein. Zu irgendjemandem zu gehören.
Kurz vor Oxford bremst der Zug. Die Räder quietschen in Abständen und kommen dann rüttelnd zum Stehen.
Charlie presst ihre Hand ans Fenster und beobachtet eine lange Reihe von Männern, die sich gebückt über ein verschneites Feld bewegen, als würden sie unsichtbare Pflüge ziehen.
»Haben die irgendwas verloren?«
»Keine Ahnung.«
Der Zug setzt sich im Schritttempo wieder in Bewegung. Durch das vom Schneeregen verschmierte Fenster sehe ich einen Polizeiwagen, der in einem Feldweg feststeckt. In der Nähe parkt ein schlammbespritzter Landrover an der Böschung. Ein Kreis von Männern, Gestalten in Weiß, errichten ein Zelt am Rand eines Sees. Sie breiten eine Stoffkuppel über das Gestänge, doch der Wind lässt die Zeltplane immer wieder aufflattern, bis Pflöcke in den gefrorenen Boden geschlagen und die Seile gespannt sind.
Als der Zug vorbeirollt, sehe ich, was sie abschirmen wollen. Erst sieht es aus wie ein weggeworfenes Kleidungsstück oder ein totes Tier, doch dann erkenne ich die menschliche Gestalt, eine Leiche, die unter dem Eis gefangen ist wie ein Insekt in durchsichtigem Bernstein.
Charlie sieht es auch.
»War das ein Unfall?«
»Sieht so aus.«
»Ist jemand aus dem Zug gefallen?«
»Ich weiß nicht.«
Charlie presst ihre Stirn an das Glas.
»Vielleicht guckst du besser nicht hin«, sagte ich. »Sonst kriegst du noch Albträume.«
»Ich bin keine sechs mehr.«
Der Zug nimmt ruckelnd Fahrt auf. Schnee wirbelt wie Konfetti vom Dach. Einen kurzen Augenblick lang ist etwas aus dem Lot geraten, und ich spüre ein wachsendes Unbehagen. Eine Leere ist in der Welt … jemand kommt nicht nach Hause.
Ich bin hier.
Ich möchte es rufen.
Schreien
Ich bin hier.
ICH BIN HIER.
ICH BIN HIER!
Drei Tage. Irgendwas ist schiefgelaufen. Tash sollte längst zurück sein. Vielleicht hat George sie erwischt. Vielleicht hat er sie mit einer Schaufel erschlagen und im Wald vergraben. Damit hat er immer gedroht, falls wir fliehen sollten.
Vielleicht hat sie sich verirrt. Tash hatte nie einen besonders guten Orientierungssinn. Einmal hat sie es geschafft, sich im Westgate Shopping Centre in Oxford zu verlaufen, wo wir uns bei Apricot treffen wollten, um mein Weihnachtsgeld für einen mit Perlen verzierten Gürtel und eine schwarze pre-washed Jeans auszugeben.
Das war der Tag, an dem Tash sich mit Bianca Dwyer gestritten und gedroht hat, sie mit einem spitzen Stift zu stechen, weil sie mit Aiden Foster geflirtet hatte. Und sie hätte es auch getan. Tash hat mich einmal mit einem Stift durch meine Strumpfhose gestochen. Ich hab das kleinste Tattoo der Welt als Beweis. Sie war wütend, weil ich den Freundschaftsring verloren hatte, den sie mir zu meinem zwölften Geburtstag geschenkt hat.
Jedenfalls ist ihr Orientierungssinn eine Katastrophe – beinahe so schlecht wie ihr Geschmack bei Jungs.
Mir ist unvorstellbar kalt. Ich trage alle meine Kleider – und noch ein paar von Tashs Sachen. Sie hat bestimmt nichts dagegen.
Ich ziehe die Decke über den Kopf, rieche meinen schalen Atem. Schweiß. Hin und wieder stecke ich den Kopf heraus und schnappe ein paar Atemzüge frische Luft, bevor ich wieder unter die Decke tauche.
Vielleicht erfriere ich, bevor man mich findet.
In den ersten paar Wochen war es anders. Da war Sommer, und auf dem Speicher unter den Dachziegeln war es heiß. Wir hatten ein richtiges Bett, anständiges Essen und konnten fernsehen. George hat gesagt, wir dürften bald nach Hause zurückkehren. Er wirkte nicht wie ein Monster. Er hat uns Zeitschriften und Riesentafeln Schokolade gekauft.
Ich weiß nicht, ob George sein richtiger Name ist. Tash hat damit angefangen. Sie meinte, es würde zu ihm passen, weil er aussehen würde wie eine jüngere, dickere Ausgabe von George Clooney, doch ich finde, wir hätten ihn Freddy nennen sollen wie den Typen aus Nightmare on Elm Street oder diesen anderen Irren mit der Hockeymaske und der Kettensäge.
Am Anfang sprach George viel von einem Lösegeld.
»Deine Eltern sind reich«, sagte er zu mir, »aber sie wollen nicht zahlen.«
»Das ist nicht wahr.«
»Sie wollen dich nicht zurückhaben.«
»Doch, das wollen sie.«
Es war eine weitere Lüge. Es würde nie eine Lösegeldforderung geben. Wie kann man etwas bezahlen, wenn keiner den Preis kennt?
Wir lagen aneinandergekettet auf dem Bett, sahen fern und warteten auf Neuigkeiten. Derweil guckte auch der Rest des Landes in die Glotze und wartete auf Neuigkeiten. Jeder gab seinen Senf dazu. Jedes Gerücht wurde analysiert. Laut einer Geschichte waren wir von einem Internet-Pädophilen entführt worden. Er hatte uns online in einem Chatroom kennengelernt und uns dazu gebracht, uns auszuziehen. Von wegen!
Eine Hellseherin aus Bristol sagte, wir seien tot, und unsere Leichen seien ins Wasser geworfen worden.
Die Polizei setzte im Fluss bei Abingdon Schleppnetze ein und durchsuchte Dutzende von Brunnen und Abwasserkanälen.
Mrs Jarvis, unsere Nachbarin, erzählte der Polizei, dass sie einen Mann gesehen hätte, der durch ihr Schlafzimmerfenster gespäht hatte, als sie sich auszog. Darüber musste Tash lachen. »Die Jarvis lässt jeden Abend die Vorhänge auf und hofft, dass irgendjemand guckt.«
Ein Londoner Taxifahrer behauptete, uns vor einem Kino in Finchley gesehen zu haben. Und ein Autofahrer in High Barnet berichtete, er habe zwei Mädchen hinten in einem weißen Transporter gesehen, die ihre Hände an die Rückscheibe gepresst hätten.
Warum ist es immer ein weißer Transporter? Nie sieht jemand, dass Kinder von Leuten in violetten oder gelben Transportern verschleppt werden.
Tashs Bruder Hayden wurde ständig interviewt und erzählte den Reportern, dass er auf einem Feld in der Nähe von Bingham einen Mann gesehen hätte, der sich verdächtig benommen hatte. Er führte sie an die genaue Stelle. Als er von Tash sprach, hätte er fast geweint, er wischte sich immer wieder die Augen und drohte, jeden umzubringen, der ihr etwas antun würde.
Es ist erstaunlich, wie dünn man die Wahrheit auswalzen kann, so dünn, dass sie wahrscheinlich verschwinden würde, wenn man sie zur Seite kippen würde. Es war, als hätte man eine Fantasieversion unseres Lebens erfunden und so getan, als wäre sie real.
Die Sun setzte eine Belohnung von 200 000 Pfund für Hinweise aus, die zu unserer Entdeckung führen würden. Wir wurden plötzlich in Bristol, Manchester, Aberdeen, Lockerbie und Dover gesichtet – kurzfristig machte sich Hoffnung breit und dann wieder Verzweiflung.
Die Oxford Mail enthüllte, dass es 984 registrierte Sexualstraftäter in Oxfordshire gebe. Mehr als dreihundert davon lebten im Umkreis von fünfundzwanzig Kilometern um Bingham. Wer hätte gedacht, dass so viele Perverse in der Nähe wohnen?
Einer von ihnen war der alte Mr Purvis, der ein Haus gegenüber vom Stadtpark hat. Er ist so ein unheimlicher alter Typ, der am Bahnhof rumhängt und den Mädchen erzählt, sie würden ihn an seine Tochter erinnern.
Die Polizei hat Mr Purvis’ Garten umgegraben, jedoch nur das Skelett seines Hunds Buster gefunden. Aber bis dahin demonstrierten die Leute vor seinem Haus und nannten ihn einen Pädo und Kindermörder.
Die Polizei musste ihn retten. Sie brachten ihn mit einer Decke über dem Kopf weg. Man konnte nur seine weite Hose und seine braunen Schuhe sehen. Eine Socke war heruntergerutscht. Irgendjemand zog die Decke weg, und Mr Purvis sah aus wie ein verängstigter alter Mann.
Danach wurde es nur noch schlimmer. Tashs Onkel Victor erstellte eine Liste von Leuten, die neu in Bingham waren – vor allem Ausländer. Außenseiter. Zusammen mit einem Kumpel, einem Klempner, trommelte er einen Trupp »besorgter Einheimischer« zusammen. Dann fuhren sie von Haus zu Haus, sagten, jemand hätte ein Gasleck gemeldet, und sie hätten das Recht, sich Zutritt zu verschaffen.
Die Polizei nahm Victor fest, allerdings erst nach einem Handgemenge. Er erklärte den Fernsehkameras, die Polizei würde nicht genug unternehmen. Die Polizeiwache in Bingham hätte niemals geschlossen werden dürfen, sagte er. Ich wusste gar nicht, dass hier früher einmal eine Polizeiwache gewesen war.
Dieselben Leute, die schnell Tränen vergossen, waren auch fix mit Hass … und mit Kritik. Der Polizei wurden Fehler vorgeworfen. Sie reagiere zu langsam oder überstürzt, verfolge Spuren, die in Sackgassen endeten, während sie das Offensichtliche übersehe, und lasse obendrein die Familien im Ungewissen.
Als der Chor laut genug geworden war, schoss die Polizei zurück. Gerüchte machten die Runde. Wir waren nicht die Engel, als die man uns dargestellt hatte. Wir waren frühreif mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern. Wild. Straffällig. Tash ein schwer erziehbares Kind, das von der Schule verwiesen worden war. Ihr Vater hatte im Gefängnis gesessen. Mein Dad hatte obszön hohe Boni kassiert, während die Steuerzahler seine Bank retten mussten.
Beinahe über Nacht verwandelte Bingham sich von einem verschlafenen idyllischen Städtchen in das Herz der Finsternis – voller Teenagersex, Drogen und Komasaufen. Dieselben Gutmenschen, die bei der Suche geholfen, Beileidskarten geschrieben und Geld gespendet hatten, schnalzten mit der Zunge und schüttelten den Kopf. Die ganze Stadt ließ ihre Missbilligung heraus, und das Land stimmte in den Chor mit ein.
Blumen verwelkten in ihrer Zellophanverpackung, Luftballons lagen schlaff auf dem Boden, Stofftiere wurden feucht, die handgeschriebenen Wünsche verwischten. Der Glanz blätterte ab von Bingham wie billiger Nagellack, unter dem etwas Hässliches und Schmutziges zum Vorschein kommt.
2
Oxford liegt unter einer Schneedecke und ist überrascht von seiner eigenen Stille. Haufen schmutzigen Eises sind an die Straßenränder gepflügt oder von Bürgersteigen und Einfahrten geschaufelt worden. Die verträumten Türme wirken besonders nachdenklich, eingehüllt von Dunst und bewacht von Wasserspeiern mit Eisbärten.
Ich habe den Vormittag damit zugebracht, in einem breiten Sessel in der Halle des Randolph Hotels meine Rede auf der Konferenz vorzubereiten. Es gibt eine Morse Bar – benannt nach dem Chefermittler aus Colin Dexters Kriminalromanen –, an den Wänden hängen Fotos der Hauptfiguren.
Charlie war den ganzen Morgen in der Cornmarket Street shoppen. Sie wärmt sich vor dem offenen Kamin.
»Hast du Hunger?«
»Ich sterbe vor Hunger.«
»Wie wär’s mit Sushi?«
»Ich mag kein japanisches Essen.«
»Es ist sehr gesund.«
»Nicht für Wale und Delphine.«
»Wir essen keinen Wal oder Delphin.«
»Und was ist mit Thunfisch?«
»Das heißt, du boykottierst alles aus Japan?«
»Bis sie den Walfang für angeblich wissenschaftliche Zwecke einstellen.«
Mein linker Arm zittert. Die Wirkung meiner Medikamente lässt nach, und eine unsichtbare Kraft zupft an unsichtbaren Fäden wie ein Fisch, der an einem Köder knabbert.
Ich weiß alles über meinen Zustand, habe jede Abhandlung, medizinische Fachzeitschrift, Promi-Autobiografie und jeden Online-Blog über Parkinson gelesen. Ich kenne die Theorien, die Symptome, die Prognose und die möglichen Therapien – die den Fortschritt der Krankheit alle hinauszögern, meinen Zustand jedoch nicht heilen können. Ich habe die Suche noch nicht aufgegeben. Ich habe es nur aufgegeben, zwanghaft darüber zu grübeln.
Ich blicke über Charlies Schulter und sehe zwei Männer in der Halle, die ihre Mäntel abstreifen. Feuchtigkeit perlt auf die Marmorfliesen. Sie haben Schlamm an den Schuhen und riechen nach Bauernhof.
Der Ältere ist Mitte vierzig mit einem beunruhigend niedrigen Haaransatz, der seine Stirn hinunterzukriechen scheint, um die Augenbrauen zu treffen. Sein Kollege ist jünger und größer mit der Figur eines ehemaligen Boxers, der sein Training hat schleifen lassen.
Eine Polizeimarke wird präsentiert.
»Wir suchen Professor O’Loughlin.«
Die junge Frau am Empfang ruft auf meinem Zimmer an. Charlie stößt mich an. »Die fragen nach dir.«
»Ich weiß.«
»Willst du nichts sagen?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Wir wollen doch zusammen Mittag essen.«
Die Spannung bringt sie um. »Suchen Sie meinen Vater?«, fragt sie laut.
Die Männer drehen sich um.
»Er ist hier«, sagt sie.
»Professor O’Loughlin?«, fragt der ältere Mann.
Ich werfe Charlie einen enttäuschten Blick zu.
»Ja«, antworte ich.
»Wir kommen, um Sie abzuholen, Sir. Ich bin Detective Sergeant Casey. Das ist mein Kollege Brindle Hughes, Detective Constable in der Ausbildung.«
»Die Leute nennen mich Grievous«, sagt der jüngere Mann mit einem verlegenen Lächeln.
»Wir wollten gerade gehen«, sage ich und zeige auf die Drehtür.
»Unser Chef will Sie sehen«, antwortet Casey. »Er sagt, es ist wichtig.«
»Wer ist Ihr Chef?«
»Detective Chief Inspector Drury.«
»Ich kenne ihn nicht.«
»Er kennt Sie aber.«
Es entsteht eine Pause. Mit Polizisten geht es mir wie mit Priestern – sie erledigen wichtige Jobs, aber sie machen mich nervös. Nicht, weil ihr Beruf etwas mit Beichten und Geständnissen zu tun hat – ich habe ein reines Gewissen –, es ist mehr das Gefühl, meinen Anteil geleistet zu haben. Ich möchte ein Schild hochhalten, auf dem steht: »Ich habe schon gespendet.«
»Sagen Sie Ihrem Boss, es tut mir sehr leid, aber ich bin unabkömmlich. Ich muss auf meine Tochter aufpassen.«
»Ich hab nichts dagegen«, sagt Charlie mit erwachtem Interesse.
Casey senkt die Stimme. »Ein Mann und seine Frau sind tot.«
»Ich kann Ihnen die Namen von Profilern nennen …«
»Der Chef will keinen anderen.«
Charlie zupft an meinem Ärmel. »Komm schon, Dad, du solltest ihnen helfen.«
»Ich hab dir ein Mittagessen versprochen.«
»Ich hab keinen Hunger.«
»Und was ist mit dem Shoppen?«
»Ich hab kein Geld, das heißt, ich müsste dir erst ein schlechtes Gewissen machen, damit du mir was kaufst. Ich würde meine Schuldpunkte lieber für etwas aufsparen, was ich wirklich will.«
»Deine Schuldpunkte?«
»Du hast mich gehört.«
Die Detectives finden diese Unterhaltung offenbar amüsant. Charlie grinst ihnen zu. Sie langweilt sich. Sie möchte ein bisschen Aufregung. Aber das ist nicht die Art Abenteuer, die sich irgendjemand wünscht. Zwei Menschen sind tot. Es ist tragisch. Es ist sinnlos. Es ist die Sorte Arbeit, der ich lieber aus dem Weg gehe.
Doch Charlie lässt nicht locker. »Ich sag Mum auch nichts«, drängt sie. »Bitte, können wir hinfahren?«
»Du musst hierbleiben.«
»Das ist nicht fair. Lass mich mitkommen.«
»Wir fahren nur aufs Revier«, unterbricht Casey uns.
Vor dem Hotel parkt ein Polizeiwagen. Charlie rutscht neben mich auf die Rückbank.
Wir fahren schweigend durch fast leere Straßen. Oxford sieht aus wie eine Geisterstadt unter einer Schneekuppel. Charlies Sicherheitsgurt spannt, als sie sich vorbeugt.
»Geht es um die Leiche im Eis?«
»Woher weißt du davon?«, fragt Casey.
»Wir haben es vom Zug aus gesehen.«
»Das ist ein anderer Fall, Miss«, sagt Grievous. »Keiner für uns.«
»Wie meinen Sie das?«
»In dem Schneesturm sind viele Autos liegen geblieben. Wahrscheinlich ist sie aus ihrem Fahrzeug gestiegen und in den See gefallen.«
Die Vorstellung lässt Charlie erschaudern. »Wissen Sie, wer sie war?«
»Noch nicht.«
»Hat niemand sie vermisst gemeldet?«
»Bestimmt wird sich bald jemand melden.«
Die St. Aldates Police Station hat ein Vordach aus Stahl und Glas über dem Haupteingang, auf dem sich ein halber Meter Schnee gesammelt hat. Ein Mitarbeiter der Stadt steht auf einer Leiter und bricht die gefrorene weiße Welle mit einer Schaufel, sodass sie in tausend Splittern auf die Pflastersteine kracht.
Anstatt vor dem Revier zu parken, fahren die Detectives noch hundert Meter weiter und halten vor einem chinesischen Restaurant mit gerupften Enten im Fenster.
»Was sollen wir hier?«
»Der Chef hat Sie zum Mittagessen eingeladen.«
In einem separaten Raum im ersten Stock sitzt ein Dutzend Detectives um einen großen runden Tisch. Der Drehteller ist mit dampfenden Schüsseln mit Schweinefleisch, Meeresfrüchten, Nudeln und Gemüse beladen.
Der Vorgesetzte der Runde hat eine Serviette in sein Hemd gesteckt und öffnet mit einer silbernen Zange einen Hummer. Er saugt das Fleisch heraus und macht sich dann an die nächste Schere. Selbst im Sitzen wirkt er groß. Er ist Mitte vierzig, im Eiltempo aufgestiegen, hat schwarzes Haar und Rasurbrand. Er trägt einen Ehering und ein ungebügeltes Hemd. Er war ein paar Tage nicht mehr zu Hause, doch er hat es geschafft, sich zu duschen und zu rasieren.
Hinter dem runden Tisch sind mehrere Weißwandtafeln aufgestellt, auf denen Fotos und die Chronologie der Ereignisse präsentiert werden. Die Namen der Opfer stehen ganz oben. Das Restaurant ist in ein Einsatzzentrum umgewandelt worden.
DCI Drury zieht die Serviette aus dem Kragen und wirft sie auf den Tisch. Das ist ein Zeichen. Kellner strömen herbei, um die Reste abzutragen. Drury rückt vom Tisch ab und erhebt sich schwerfällig und ungelenk.
»Professor O’Loughlin, danke, dass Sie gekommen sind.«
»Man hat mir nicht groß eine Wahl gelassen.«
»Gut.«
Mit einem Rülpsen schiebt er die Arme in die Ärmel seines Jacketts.
»Kann ich Ihnen etwas zu essen bestellen?«
Ich sehe Charlie an. Sie ist kurz vorm Verhungern.
»Ausgezeichnet«, sagte Drury. »Grievous, besorg ihr eine Speisekarte.« Er beugt sich näher. »Das ist nicht sein richtiger Name, Miss. Seine Initialen sind GBH. Wissen Sie, wofür diese Abkürzung steht?«
Charlie schüttelt den Kopf.
»Grievous Bodily Harm. Schwere Körperverletzung.« Der DCI lacht. »Aber keine Sorge, er ist noch zu feucht hinter den Ohren, um gefährlich zu sein.« Er wendet sich mir zu. »Wie gefällt Ihnen mein Einsatzzentrum, Professor?«
»Es ist unkonventionell.«
»Ich ermutige meine Leute, sich als Teil eines Teams zu begreifen. Wir trinken zusammen. Wir essen zusammen. Jeder kann frei seine Meinung sagen. Fehler eingestehen. Zweifel äußern. Mein Dezernat hat die beste Aufklärungsrate im Land.«
Eure Mütter sind bestimmt stolz auf euch, denke ich. Das großspurige und anmaßende Gehabe des DCI ist mir spontan unsympathisch.
Er zieht einen Zahnstocher aus einem Glas und säubert sich die Zähne.
»Sie wurden mir empfohlen.«
»Von wem?«
»Einer gemeinsamen Bekannten. Man hat mir gesagt, Sie würden vielleicht nicht kommen.«
»Da hat man Sie gut informiert.«
Er lächelt. »Ich bitte um Entschuldigung, falls wir einen schlechten Start erwischt haben. Also noch mal ganz von vorn. Ich bin Stephen Drury.«
Er schüttelt meine Hand und hält sie eine Sekunde länger als nötig fest.
»Ich habe es mit einem Doppelmord zu tun, sieht aus wie gewaltsames Eindringen. Dem Ehemann wurde der Schädel eingeschlagen, die Frau wurde ans Bett gefesselt, möglicherweise vergewaltigt und dann angezündet.«
Die letzten Worte hat er geflüstert. Ich werfe einen Blick auf Charlie, die gebratenen Reis auf einen Teller löffelt.
»Wann?«
»Vor drei Nächten.«
Ich gucke zu der Tafel, an der ein Foto von einem weiß gestrichenen Bauernhaus mit leichten Brandspuren hängt. Als die Bilder gemacht wurden, hat es geschneit, was ihnen einen Sepiaton verleiht. Vor dem weißen Himmel über dem Dachfirst steigen klar umrissene Rauchfetzen auf.
»Was wollen Sie von mir?«
»Ich habe einen Verdächtigen festgenommen. Er hat für die Familie gearbeitet. Wir haben seine Fingerabdrücke im Haus gefunden, und er hat Verbrennungen an beiden Händen. Er leugnet, das Ehepaar getötet zu haben, und behauptet, er hätte nur versucht, sie zu retten.«
»Sie glauben ihm nicht?«
»Der Verdächtige hat eine Vorgeschichte psychischer Erkrankungen. Er nimmt Neuroleptika. Im Augenblick klettert er die Wände hoch, führt Selbstgespräche und kratzt sich die Arme blutig. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Vielleicht lügt er. Ich kann ihn nur noch zweiundzwanzig Stunden festhalten. So viel Zeit habe ich, einen dringenden Tatverdacht zu belegen.«
»Ich verstehe immer noch nicht …«
»Wie soll ich ihn behandeln? Wie hart kann ich ihn anfassen? Ich will nicht, dass irgendein Schlaumeieranwalt behauptet, ich hätte dem Burschen die Worte in den Mund gelegt oder ein Geständnis aus ihm herausgeprügelt.«
»Ein psychologisches Gutachten würde Tage in Anspruch nehmen.«
»Ich will von Ihnen auch nicht seine Lebensgeschichte hören, sondern nur einen Eindruck.«
»Wo sind seine Krankenakten?«
»Wir können nicht darauf zugreifen.«
»Bei wem ist er in Behandlung?«
»Dr. Victoria Naparstek.«
Der Groschen fällt. Ich habe Dr. Naparstek vor anderthalb Jahren bei der Anhörung einer Kommission kennengelernt, bei der es um einen ihrer Patienten ging. Sie nannte mich einen arroganten, herablassenden Frauenhasser, weil ich ihren Patienten so unter Druck gesetzt hatte, dass er seine wahre Persönlichkeit offenbarte. Ich brachte ihn dazu zuzugeben, dass er Fantasien habe, Dr. Naparstek nach Hause zu folgen und sie zu vergewaltigen.
Habe ich ihn unter Druck gesetzt? Ja. Habe ich Grenzen überschritten? Unbedingt, aber die Kollegin hätte mir dankbar sein sollen. Stattdessen drohte sie, mich bei der British Psychological Society anzuzeigen, die Disziplinarmaßnahmen wegen standeswidrigen Verhaltens einleiten sollte.
Warum sollte sie mich für diesen Fall empfehlen? Irgendwas ist unlogisch.
Drury wartet auf meine Entscheidung. Ich gucke zu Charlie und wünschte, sie wäre zu Hause.
»Okay, ich rede mit Ihrem Verdächtigen, aber vorher will ich mir den Tatort ansehen.«
»Wozu?«
»Für den größeren Zusammenhang.«
3
Der Landrover schlittert und schlingert durch den Schneematsch über einen Feldweg auf ein Wäldchen aus skelettartigen Bäumen zu, die die Hügelkuppe bewachen. Die gepflügten Felder sind in einen eigenartigen gelblichen Glanz getaucht, als ob der Schnee die matten Sonnenstrahlen aufgesogen hätte wie ein fluoreszierendes Zifferblatt, um sie bei gespenstischem Zwielicht zurückzuspiegeln.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!