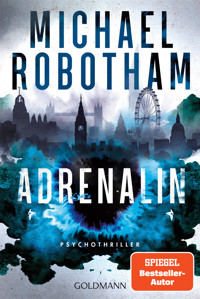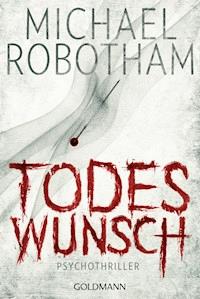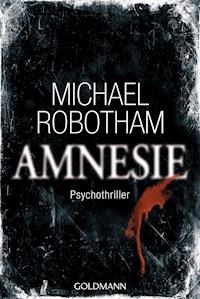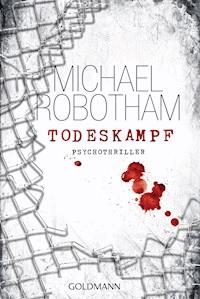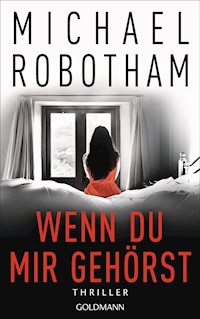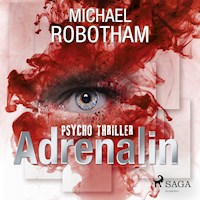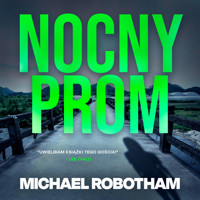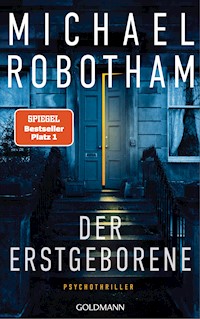
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cyrus Haven
- Sprache: Deutsch
Der Psychologe Cyrus Haven berät die Polizei in Nottingham bei der Aufklärung von Straftaten. Dabei wurde er als Jugendlicher selbst Opfer eines Verbrechens: Sein geistig verwirrter Bruder Elias ermordete die gesamte Familie, nur Cyrus überlebte das Massaker. Nun, 20 Jahre später, soll der angeblich geheilte Elias in Cyrus' Obhut entlassen werden – und konfrontiert diesen auf brutale Art mit seiner Vergangenheit.
Zudem muss der Psychologe sich noch um sein Mündel Evie Cormac kümmern: eine aufsässige Teenagerin mit der Gabe, jede Lüge zu enttarnen. Als Cyrus in einem Mordfall ermittelt und Evie dem Täter allzu nahe kommt, geraten sie beide in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Wenn ich nur eins über meinen Bruder erzählen könnte, wäre es dies: Zwei Tage nach seinem neunzehnten Geburtstag ermordete er unsere Eltern und unsere Zwillingsschwestern, weil er Stimmen in seinem Kopf hörte. Als einzelnes prägendes Ereignis ist das unübertroffen für Elias und für mich.
Nachdem Cyrus Haven als Jugendlicher die grausame Bluttat seines Bruder Elias durch einen glücklichen Zufall überlebte, setzte er sein Leben mühsam wieder zusammen. Mittlerweile ist er ein erfolgreicher Psychologe und arbeitet nebenbei für die Polizei. Als Elias nach zwanzig Jahren als geheilt aus der Psychiatrie entlassen werden soll, scheint Cyrus also perfekt vorbereitet, ihm zu verzeihen und ihn bei sich aufzunehmen.
Doch sind die Stimmen in Elias’ Kopf wirklich verstummt? Und kann man eine solche Tat wirklich jemals vergeben? Zudem Cyrus’ Leben nicht so wohlgeordnet ist, wie es nach außen hin den Eindruck hat: Sein Mündel Evie Cormac, eine ebenso schwierige wie brillante Teenagerin, steht dem neuen Mitbewohner mehr als skeptisch gegenüber. Und sein Job bei der Polizei wird gefährlich persönlich. Denn während Cyrus in einem Fall mehrerer verschwundener Frauen vom Berater zum Verdächtigen zu werden droht, glaubt Evie bei einem nächtlichen Aushilfsjob den wahren Täter erkannt zu haben. Doch nur zwei Menschen glauben ihr. Einer davon ist Cyrus. Der andere der Mörder …
Weitere Informationen zu Michael Robotham sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Michael Robotham
Der Erstgeborene
Psychothriller
Aus dem Englischen von Kristian Lutze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel „Lying beside you« bei Sphere, einem Imprint der Little, Brown Book Group, London.
Das nachfolgende Zitat stammt aus:Julie Buntin, Marlena. Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Bonné. Für die deutsche Ausgabe: © 2017 bei Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln, S. 9. Mit freundlicher Genehmigung des Eichborn Verlags.
Deutsche Erstveröffentlichung Dezember 2022
Copyright © 2022 by Bookwrite Pty.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ann-Catherine Geuder
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: @ Arcangel/John Cooper
Innenklappen: FinePic®, München
Th · Herstellung: ast
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27157-2V009
www.goldmann-verlag.de
»Sage mir, was du nicht vergessen kannst, und ich sage dir, wer du bist.«
Julie Buntin, Marlena
1Cyrus
Wenn ich nur eins über meinen Bruder erzählen könnte, wäre es dies: Zwei Tage nach seinem neunzehnten Geburtstag ermordete er unsere Eltern und unsere Zwillingsschwestern, weil er Stimmen in seinem Kopf hörte. Als einzelnes prägendes Ereignis ist das unübertroffen für Elias und für mich.
Ich habe oft versucht, mir vorzustellen, was ihm an jenem kühlen Herbstabend durch den Kopf gegangen ist, als unsere Nachbarn allmählich die Vorhänge vor der heranziehenden Nacht zuzogen und die Straßenlaternen einen dunstigen Schein bekamen. Was haben diese Stimmen gesagt? Welche denkbaren Worte könnten ihn bewegt haben, die Dinge zu tun, die er getan hat?
Ich habe mich mit dem Hätte und Wäre gemartert. Was, wenn ich auf dem Heimweg vom Fußballtraining nicht noch angehalten und Pommes frites gekauft hätte? Was, wenn ich mein Rad nicht kurz vor Alisa Pipers Haus abgestellt hätte, in der Hoffnung, sie im Garten oder beim Nachhausekommen von ihrem Korbball-Training zu erwischen? Was, wenn ich schneller gestrampelt hätte und früher zu Hause angekommen wäre? Hätte ich ihn aufhalten können, oder wäre ich jetzt auch tot?
Ich bin der Junge, der überlebt hat, im Gartenschuppen versteckt, zusammengekauert zwischen Gartengeräten, den Geruch von Kerosin, Farbe und frischem Grasschnitt in der Nase, während Sirenen durch die Straßen von Nottingham heulten.
In meinen Albträumen wache ich immer in dem Moment auf, in dem ich auf schlammverdreckten Fußballsocken in die Küche komme. Meine Mutter liegt zwischen gefrorenen Erbsen auf dem Boden, die sich auf den weißen Fliesen verteilt haben. Auf dem Herd kocht Hühnerbrühe über, und ihre berühmte Paella klebt an dem schweren Pfannenboden.
Meine Mum vermisse ich am meisten. Ich habe ein schlechtes Gewissen, jemanden am liebsten zu mögen, aber niemand ist da, der meine Wahl kritisieren könnte, außer Elias, und der hat dazu nichts zu sagen. Weder jetzt noch in Zukunft.
Dad starb im Wohnzimmer, vor dem DVD-Spieler hockend, weil eine der Zwillinge es geschafft hatte, eine DVD in dem Schlitz zu verklemmen. Er hob eine Hand, um sich zu schützen, und verlor zwei Finger und einen Daumen, bevor das Messer sein Rückgrat durchtrennte.
Esme und April waren oben in ihrem Zimmer mit den Hausaufgaben beschäftigt oder spielten. Normalerweise machte immer April alles als Erste, weil sie zwanzig Minuten älter war und deswegen den Ton angab, doch es war April, bekleidet in einem Einhorn-Jumpsuit, die auf das Messer zurannte, um ihre Schwester zu beschützen. Esme musste unter dem Bett hervorgezerrt werden und starb mit einem zusammengebauschten Teppich unter ihrem Körper und einer Ukulele in der Hand.
Viele dieser Details können mir den Hals zuschnüren oder mich schreiend aufwachen lassen, aber die Schnappschüsse verblassen. Meine Erinnerungen sind nicht mehr so lebhaft wie früher. Die Farben. Die Gerüche. Die Angst.
Ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, welche Farbe das Kleid hatte, das meine Mutter trug, und welche der Zwillinge ihr Haar in der Woche geflochten hatte. (Esme und April wechselten sich mit ihren Frisuren ab, damit die Lehrerinnen sie leichter voneinander unterscheiden konnten, vielleicht aber auch, um sie noch mehr zu verwirren.)
Und ich kann mich nicht erinnern, ob Dad schon eine Flasche Home Brew aufgemacht hatte – ein Sechs-Uhr-abends-Ritual in unserem Haus, bei dem er ein Bier aus seiner letzten Lieferung mit einem Winston-Churchill–Flaschenöffner aus Messing öffnete. Feierlich goss er den »bernsteinfarbenen Nektar« in ein Pint-Glas und hielt es ins Licht, um Farbe und Trübheit zu begutachten. Wenn er trank, spülte er den ersten Schluck im Mund hin und her wie ein Weinkenner und sagte Sachen wie: »Ein wenig malzig … ein bisschen wolkig … einen Tick zu früh … einigermaßen trinkbar … buttrig … süffig … noch eine Woche, dann ist es perfekt.«
Es sind kleine Details, die mir entfallen sind. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Schlamm von meinen Fußballschuhen abgetreten, mein Fahrrad abgeschlossen und das Seitentor geschlossen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich stehen geblieben bin, um mir das Salz von den Händen zu waschen und Wasser zu trinken, weil Mum es nicht ausstehen konnte, wenn ich mir den Appetit verdarb, indem ich so kurz vor dem Abendessen Junkfood aß. Im selben Atemzug beschwerte sie sich darüber, dass ich »ein Loch im Bauch« hätte und »ihr die Haare vom Kopf fressen« würde.
Ich vermisse ihre Kochkünste. Ich vermisse ihre peinlichen Umarmungen in der Öffentlichkeit. Ich vermisse es, dass sie auf Servietten spuckt und mir Essensreste aus dem Gesicht wischt. Ich vermisse es, wie sie versucht, meinen Haarwirbel zu glätten. Ich vermisse ihr Gemecker, weil ich den Zwillingen Geistergeschichten erzählt, den Klodeckel hochgeklappt gelassen oder die Zahnpasta nicht wieder zugeschraubt habe.
Nach den Morden hat niemand mehr mit mir gemeckert. Meine Großeltern brachten es nicht übers Herz. Sie trauerten auch. Ich wurde der Junge, mit dem man Mitleid hatte, auf den man mit dem Finger zeigte, über den man tuschelte. Den man unterstützte. Mobbte. Verwöhnte. Therapierte. Der Junge, der Drogen nahm, sich ritzte und betrunken zur Schule kam. Ein schwer zu liebendes Kind. Eigentlich überhaupt kein Kind mehr, nicht nach allem, was ich gesehen hatte.
Es ist Montagmorgen Viertel vor zehn, und ich sitze im Empfangsbereich des Rampton Secure Hospital, eine Autostunde nördlich von Nottingham. In fünfzehn Minuten wird eine Kommission von drei Personen – ein Richter, ein beratender Psychologe und ein Laie – über den Antrag meines Bruders beraten, entlassen zu werden. Es ist zwanzig Jahre her, seit meine Eltern und meine Schwestern gestorben sind. Ich bin jetzt dreiunddreißig, Elias ist neununddreißig. Der Junge ist ein Mann. Der Bruder möchte nach Hause kommen.
Jahrelang habe ich den Leuten erklärt, dass ich das Beste für Elias will, ohne genau zu wissen, was das bedeutete und ob das auch seine Freilassung mit einschloss. Als forensischer Psychologe verstehe ich psychische Krankheiten. Ich sollte in der Lage sein, die Person von der Tat zu trennen – die Sünde zu hassen, aber dem Sünder vergeben.
Ich habe Geschichten von Vergebung gelesen. Von Menschen, die Mörder im Gefängnis besucht und ihnen Mitgefühl und Absolution angeboten haben. Sie sagen Sachen wie: »Du hast mir einen Teil meines Herzens genommen, der niemals ersetzt werden kann, aber ich verzeihe dir.«
Eine Frau, eine Mutter Mitte sechzig, hatte ihren einzigen Sohn verloren, der vor einer Partylocation erstochen worden war. Nachdem die Geschworenen den Mörder, einen sechzehnjährigen Jungen, verurteilt hatten, vergab sie dem Teenager. Noch gekrümmt vor Entsetzen, wiederholte sie immer wieder: »Ich habe gerade den Mann umarmt, der meinen Sohn getötet hat.« Im nächsten Atemzug fügte sie hinzu: »Ich habe gespürt, wie etwas meinen Körper verlassen hat. Und ich wusste sofort, dass all der Hass, die Bitterkeit und die Feindseligkeit weg waren.«
Ein besseres Ich, eine gütigere Seele, ein Empath oder gläubiger Mensch würde Gnade zeigen und Elias die Vergebung anbieten, die er ersehnt. Bedingungslos. Ohne Frage oder Zögern. So ein Mensch bin ich nicht.
Dr. Baillie zieht seine Sicherheitskarte durch den Schlitz und kommt, um mich im Warteraum abzuholen. Er ist der für Elias zuständige Psychiater, Anfang fünfzig, gedrungen und ernst, mit einem gestutzten Bart und einem ergrauten Pferdeschwanz, der seinen Haaransatz höher in die Stirn zu ziehen scheint.
»Wie läuft es?«, frage ich.
»Es sieht vielversprechend aus.«
Für wen, will ich fragen, aber ich weiß, auf wessen Seite Dr. Baillie steht. Er geht davon aus, dass ich in seinem Team bin. Vielleicht bin ich das auch.
Er winkt einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hinter einer Plexiglasscheibe zu. Eine Tür wird geöffnet, und wir werden durch breite Flure geführt, die nach Phenol und Bodenreiniger mit Kiefernaroma riechen.
Rampton ist eine von drei hoch gesicherten forensischen psychiatrischen Kliniken in England. Laut der Daily Mail beherbergt sie die »Schlimmsten der Schlimmsten«, aber Journalisten neigen dazu, sich auf die prominenten Patienten zu konzentrieren, die »Ripper«, »Schlächter« und »Schlitzer«, die mehr Klicks generieren als der Großteil der Insassen, die wegen Persönlichkeitsstörungen oder Stimmungsschwankungen behandelt werden, Erkrankungen, bei denen keine Leichen gezählt werden.
Wir sind in einem großen Raum angekommen, wo zwei Dutzend Stühle vor einem langen polierten Tisch aufgestellt sind. Eine Schwingtür geht auf. Elias kommt herein. Er wird ein letztes Mal abgetastet, bevor man ihn auffordert, Platz zu nehmen. Er winkt mir zu. In seinem Blick liegt Erleichterung.
Wir sehen nicht aus wie Brüder. Er hat im Laufe der Jahre zugenommen – wegen der Medikamente und der Inaktivität –, und sein Haar ist um die Ohren mittlerweile grau meliert. Er hat ein rundes, fleckiges Gesicht, schmale Lippen und braune intelligente Augen, die trotzdem sonderbar leer wirken.
Heute trägt er seine beste Kleidung, beigefarbene Chinos zu einem ordentlich gebügelten weißen Hemd, und ich erkenne Kammspuren in seinem leicht pomadisierten Haar. Gerade Linien von vorne nach hinten.
Ich schlurfe an der Reihe der Stühle entlang, bis ich nah genug bin, um seine feuchte Hand zu schütteln.
»Du bist gekommen.«
»Selbstverständlich. Wie geht es dir?«
»Ich bin nervös.«
»Dr. Baillie sagt, du hast dich bisher gut geschlagen.«
»Hoffentlich.«
Elias blickt nervös zu dem Haupttisch und den drei leeren Stühlen.
Eine weitere Tür geht auf, und drei Leute kommen herein. Die Kommission, zwei Männer und eine Frau. Sie nehmen Platz. Alle haben ein Namensschild, doch sie stellen sich trotzdem vor. Der Vertreter der Justiz, Richter Aimes, ist ein kleiner, ziemlich rundlicher Mann in einem Nadelstreifenanzug. Sein graues Haar ist in einer Welle nach hinten gekämmt, die eine kahle Stelle verdeckt. Der Psychiater, Dr. Steger, trägt ein Hemd mit bis zu den Ellbogen hochgekrempelten Ärmeln und eine Krawatte des Marylebone Cricket Club. Seine Haare sind streng nach hinten gegelt, und statt einer Armbanduhr trägt er ein schweres silbernes Armband. Das Laienmitglied der Kommission, Mrs Sheila Haines, erinnert mich an meine alte Vorschullehrerin, und ich kann mir vorstellen, wie sie das Verfahren aufmuntert und im Laufe des Vormittags ein »Obstfrühstück« vorschlägt.
Jede neue Person im Raum muss vorgestellt werden. Ihre Blicke wenden sich mir zu.
»Ich bin Cyrus Haven. Elias’ Bruder.«
»Sind Sie sein engster Familienangehöriger?«, fragt der Richter.
Ich bin sein einziger Familienangehöriger, will ich antworten, doch das stimmt nicht ganz. Er hat nach wie vor Großeltern, Tanten, Onkel und eine Handvoll Cousins und Cousinen, die in den letzten zwei Jahrzehnten bemerkenswert still waren. Ich bezweifle, dass die Verwandtschaft mit Elias zu ihren Anekdoten für Abendesseneinladungen gehört.
»Ich bin sein engster lebender Verwandter«, sage ich und bereue meine Wortwahl noch im selben Moment.
»Sind Sie Doktor der Medizin?«, fragt Mrs Haines.
»Ich bin forensischer Psychologe.«
»Wie faszinierend.«
Richter Aimes möchte vorankommen. Er wendet sich an Elias.
»Haben Sie Medikamente eingenommen, die Ihre Fähigkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen, beeinträchtigen könnten?«
»Nur meine üblichen Medikamente«, antwortet Elias lauter als erforderlich.
»Was nehmen Sie?«, fragt der Psychiater.
»Clozapin.«
»Wissen Sie, was passieren würde, wenn Sie aufhören, Ihre Medikamente zu nehmen?«
»Ich würde wieder krank werden. Aber jetzt geht es mir besser«, fügt er eilig hinzu.
Richter Aimes blickt von seinen Notizen auf. »Uns liegen Berichte von zwei gutachtenden Psychiatern vor, außerdem haben wir mündliche Vorträge von Dr. Baillie, dem Stationspfleger sowie zwei ansässigen Psychiatern gehört. Hat man Ihnen diese Aussagen gezeigt?«
Elias nickt.
»Haben Sie irgendwelche Fragen?«
»Nein, Sir.«
»Dies ist Ihre Gelegenheit zu einem Plädoyer, Elias. Erklären Sie uns, was Ihrem Wunsch nach jetzt geschehen soll.«
Elias schiebt den Stuhl zurück und will aufstehen, doch der Richter erklärt, er solle sitzen bleiben. Elias zieht einen Zettel aus der Tasche.
»Ich möchte mich bei der Kommission für diese Gelegenheit bedanken«, sagt er und blinzelt auf den Zettel, als hätte er seine Brille vergessen. Trägt er sie noch? Es ist Jahre her, seit ich ihn etwas anderes habe lesen sehen als die Comicalben und Graphic Novels, die ich ihm bei Besuchen mitbringe. Dad brauchte ab vierzig eine Lesebrille, vermutlich wird es mir auch so gehen.
Elias fährt fort: »Ich weiß, was ich getan habe, und ich weiß, warum es geschehen ist. Ich bin schizophren. Was ich an jenem Tag erlebt habe – was ich gesehen und gehört habe, die Stimmen, die Halluzinationen –, nichts von all dem war real. Aber ich habe meiner Familie unaussprechliche Dinge angetan. Unverzeihliche Dinge.«
Er wendet den Blick kurz zu mir und wieder ab.
»Mit diesem Makel auf meiner Seele muss ich leben. Ich habe viele Herzen gebrochen – inklusive meines eigenen –, und ich bitte Gott jeden Tag um Vergebung.«
Das ist ebenfalls eine neue Information, obwohl er bei meinen vierzehntägigen Besuchen in Rampton schon seit einiger Zeit Bibelzitate in die Unterhaltung streut. Er wischt sich Schweißtropfen von der Oberlippe.
»Ich bin seit mehr als siebentausend Tagen an diesem Ort, und in all der Zeit habe ich das Gelände nie verlassen, um ein Geschäft zu betreten, einen Film zu sehen, allein am Strand spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Ich möchte einen Weihnachtsbaum schmücken, Geschenke einpacken und verreisen. Ich möchte ein normales Leben führen, Freundschaften schließen, einen Job finden und eine Frau treffen.«
Ich stelle mir vor, wie er diese Rede wochenlang vor seinem bruchsicheren Spiegel geübt hat.
»Was für einen Beruf möchten Sie denn ausüben?«, fragt der Richter.
»Ich möchte mein Jurastudium fortsetzen. Ich hoffe, eines Tages dort zu sitzen, wo Sie jetzt sitzen, und den Menschen zu helfen.«
»Das ist sehr ehrenwert«, sagt Mrs Haines.
Dr. Steger wirkt weniger beeindruckt. »Fast die Hälfte der Patienten scheitern, weil sie ihre Medikamente nicht nehmen. Achtzig Prozent von ihnen erleiden binnen zwei Jahren einen Rückfall.«
»Das würde mir nicht passieren«, sagt Elias.
»Wie können wir sicher sein?«
»Ich habe an einem Genesungsplan gearbeitet. Ich habe Bewältigungsmechanismen gelernt.«
»Wo würden Sie wohnen?«
»Bei meinem Bruder Cyrus.«
Die Kommissionsmitglieder blicken zu mir. Ich nicke. Mit trockenem Mund.
»Haben Sie Fragen an Elias, Dr. Haven?«, erkundigt sich der Richter.
Elias wirkt mit einem Mal nervös. Er hat nicht erwartet, dass ich das Wort ergreife.
»Wie haben sie angefangen?«, frage ich. »Die Stimmen?«
Er blinzelt mich an, als würde er die Frage nicht recht verstehen. Die Stille füllt jede Nische des Raumes und steigt wie Wasser, das meine Ohren knacken lässt.
Schließlich spricht er. »Es war nur eine. Am Anfang dachte ich, ich bilde sie mir nur ein.«
»Was hat sie gesagt?«
»Sie … sie … hat über einen anderen gesprochen. ›Kann er die ganze Nacht wach bleiben?‹ ›Kann er die Schule schwänzen?‹ ›Kann er Geld aus Dads Brieftasche stehlen?‹«
»Hat die Stimme dir gesagt, dass du diese Dinge machen sollst?«
»Den Eindruck hatte ich nicht … jedenfalls am Anfang nicht.«
»Warum hast du auf sie gehört?«
Wieder blinzelt er mich an.
»Mum und Dad. Esme und April. Denkst du je an sie?«
Er zuckt die Schultern.
»Warum nicht?«
»Es regt mich auf.«
»Hast du sie geliebt?«
»Ich war krank. Ich habe etwas Böses getan.«
»Ja, aber hast du sie geliebt?«
»Natürlich.«
»Liebst du mich?«
»Ich kenne dich kaum«, flüstert er.
»Ich bin dir dankbar für deine Ehrlichkeit.«
In seinen Augen stehen Tränen. »Es tut mir leid.«
»Was tut dir leid?«
»Was ich getan habe.«
»Und jetzt hast du dich geändert?«
Er nickt.
Ich blicke zu dem Richter und erkläre ihm, dass ich fertig bin.
»Nun, machen wir eine Pause«, sagt er und wendet sich an Elias. »Wir werden Ihnen unsere Entscheidung in Kürze mitteilen.«
2Evie
Der Geschäftsführer hat einen Schnurrbart mit gewachsten Spitzen, die sich aufrollen wie verängstigte Tausendfüßler. Es ist die Art Gesichtsbehaarung, die man sonst nur bei altmodischen Schurken in schwarzen Capes sieht, die Frauen an Eisenbahngleise fesseln und gackernd lachen.
Er heißt Brando, was ein Spitzname oder einfach nur sein Nachname sein könnte. Vielleicht ist es auch sein einziger Name wie Beyoncé oder Prince. Brando poliert mit einem weichen Tuch eine Wodkaflasche. Er hält inne und zwirbelt die Spitzen seines Schnurrbarts auf, als würde er eine sehr lange Zigarette drehen.
»Wie heißt du?«
»Evie Cormac.«
»Wie alt bist du?«
»Einundzwanzig.«
»Du siehst jünger aus.«
Ich halte meinen frisch erworbenen Führerschein hoch und hoffe, dass er sich das Bild nicht allzu genau anschaut, weil es aussieht wie ein Verbrecherfoto. Ich weiß nicht, wie man lächelt, wenn Leute einen fotografieren.
»Hast du schon mal in einer Bar gearbeitet?«
»Ja, massenhaft.«
»Referenzen?«
»Nein.«
»Kannst du eine Bloody Mary mixen?«
»Ich kann ein Bier zapfen.«
»Ich brauche jemanden, der Cocktails mixen kann.«
»Sie könnten es mir beibringen.«
»In der Anzeige stand, dass wir jemanden mit Erfahrung suchen.«
»Na ja, es ist wie mit der Henne und dem Ei, oder?«
»Hä?«
»Was war zuerst da – die Henne oder das Ei? Ich kann keine Erfahrung sammeln, wenn Sie mir keinen Job geben.«
Brando kräuselt die Nase. Er trägt Jeans, ein Baumwollhemd und eine zu enge Weste. An einem kleinen goldenen Ring in seinem linken Ohr baumelt eine winzige Gitarre. Meiner Erfahrung nach kompensieren Menschen, die sich extravagant kleiden, einen Mangel an Persönlichkeit. Ich bin das Gegenteil. Ich habe keine Persönlichkeit, doch das kommt mir gelegen, weil ich unsichtbar sein will.
Die Bar heißt Little Drummer, eins dieser kleinen Rattenlöcher am Lace Market, teuer und völlig selbstüberzogen. Ehrlich gesagt verstehe ich den Sinn von Bars und Alkohol nicht. Die Leute haben schon wenig genug Kontrolle über ihr Leben, auch ohne sich volllaufen zu lassen.
Ich brauche einen Job, weil Cyrus sagt, mein Beitrag müsste sich mit seinem »die Waage halten«. Was soll das überhaupt heißen? Ich wiege nicht mal fünfundvierzig Kilo. Bei einem dieser Wettbewerbe, bei denen man seine Ehefrau tragen muss, könnte er mich über eine Schulter werfen, und wir würden locker gewinnen. Nicht, dass ich seine Frau oder seine Freundin wäre; meistens behandelt er mich wie ein Kind, und das nervt mich.
Seit September gehe ich wieder zur Schule – ein paar Stunden die Woche –, um am Nottingham College mein Abitur nachzuholen, weil Cyrus sagt, ich soll etwas aus meinem Leben machen. Das ist noch etwas, was ich nicht verstehe. Warum kann es nicht meine Mission sein, mich irgendwie durchzuwurschteln?
Auf YouTube habe ich ein Video von einem japanischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen, der auf einer philippinischen Insel stationiert war, um nach feindlichen Flugzeugen Ausschau zu halten. Er hatte den Befehl, unter keinen Umständen aufzugeben. Er bekam nicht mit, dass der Krieg endete, deshalb versteckte er sich neunundzwanzig Jahre in den Bergen und weigerte sich zu kapitulieren. Das ist mein Ideal eines gut gelebten Lebens: versteckt auf einer tropischen Insel, abgeschnitten von der Welt. Unerreichbar. Unberührbar.
Mein neuer Plan ist es, so zu tun, als würde ich etwas aus meinem Leben machen. Ich werde den Leuten erzählen, dass ich ein Buch schreibe, und wenn sie mich fragen, worüber, klaue ich die Handlung irgendeines Netflix-Dramas und nenne das Ganze »eine Hommage«. Das Wort habe ich von Mr Joubert, einem meiner Lehrer.
Wenn das nicht funktioniert, erkläre ich den Leuten, dass ich reisen möchte, und rede verträumt über Berge, die ich besteigen, und Meere, die ich besegeln will. Eine große Leidenschaft stellt nie jemand infrage.
Meine dritte Option ist ehrenamtliche Arbeit. Ich melde mich freiwillig für ein oder zwei Wochen – damit ich die nächsten zehn Jahre damit angeben kann, wie sehr es mich erfüllt, »anderen zu helfen und etwas zurückzugeben«. Das sollte mein Leben lohnend genug erscheinen lassen.
»Hast du schon mit Gästen zu tun gehabt?«, fragt Brando.
»Ja.«
»Als was?«
»Ich war Kellnerin.«
Das Lokal lasse ich unerwähnt – Langford Hall, eine geschlossene Einrichtung für Kinder und Jugendliche –, genau wie die Tatsache, dass ich nicht im eigentlichen Sinn angestellt war. Er braucht auch nicht zu wissen, dass ich aus der Küche verbannt wurde, weil ich einen Monatsvorrat Kakao geklaut habe. Das war die alte Evie. Die wütende Evie. Mündel des Gerichts. Das Mädchen in der Kiste. Angel Face. Das Kind, das sich in einer Geheimkammer versteckt hat, während ein Mann zu Tode gefoltert wurde.
Brando wendet das Blatt mit meinem einseitigen Lebenslauf, als würde er erwarten, dass auf der Rückseite noch etwas steht.
»Hattest du je Ärger mit der Polizei?«
»Nein.«
Eine weitere Lüge.
»Wieso willst du im Little Drummer arbeiten?«
»Ich brauche einen Job.«
Brando wartet und will mehr hören.
»Ich kann gut mit Menschen«, lüge ich unverhohlen. In Wahrheit komme ich vor allem gut mit Hunden aus.
»Was ist deine beste Eigenschaft?«, fragt er.
»Ich bin unglaublich bescheiden.«
Er kapiert den Witz nicht. Idiot!
Brando zwirbelt seinen Schnurrbart auf. »Ich kann dir den Job geben, die leeren Gläser einzusammeln. Donnerstag, Freitag und Samstag. Du fängst um acht an und hast um zwei Feierabend. Neun Pfund die Stunde. Das Trinkgeld wird mit dem Küchenpersonal geteilt.«
»Und das ist alles, was ich machen muss – Gläser einsammeln?«
»Du lächelst. Du machst sauber, wenn jemand etwas verschüttet. Du wischst die Damentoilette. Du bist der Handlanger.«
»Was?«
»Der Hiwi.« Er gibt mir ein Formular. »Füll das aus.«
Es ist eine Art Arbeitsvertrag.
»Wieso brauchen Sie meine Adresse und meine Telefonnummer?«
»Für die Steuer.«
»Aber ich hab noch gar nichts verdient.«
»So läuft das.«
Ich leihe mir einen Stift aus, setze mich an den Tresen und beobachte mit einem Auge, wie er den Kühlschrank nachfüllt. Es gefällt mir, seine Schultern zu betrachten, die sich unter dem Baumwollhemd bewegen. Ich wünschte, ich wüsste mehr über Männer. Nicht die bösen, sondern die guten.
Zehn Minuten später liest Brando das ausgefüllte Formular durch. Beim Umblättern leckt er an seinem Daumen.
»Du fängst am Freitag an. Komm nicht zu spät. Und zieh dir was Anständiges an.«
Ich trage Jeans und einen weiten Pullover, den ich vor Wochen aus Cyrus’ Kleiderschrank geklaut habe, ohne dass er ihn seitdem vermisst hat.
»Ich sammele bloß Gläser ein.«
»Wir sind eine Cocktail-Bar, keine Säufer-Kneipe an der Ecke. Unsere Gäste erwarten ein wenig Glamour. Zeig ein bisschen Bein.« Er mustert mich von oben bis unten. »Du hast doch Beine, nehme ich an.«
Damit ich dich besser treten kann. Er dreht sich um und stellt ein Sixpack Cidre in den Kühlschrank. Als er sich aufrichtet, stehe ich immer noch am Tresen.
»Kann ich einen Vorschuss bekommen – um mir ein Kleid zu kaufen?«
»Ja, klar«, sagt er lachend. »Hau ab, bevor ich es mir anders überlege.«
Draußen ziehe ich den Reißverschluss meines Parkas hoch und vermeide es, von einer Busladung japanischer Touristen niedergetrampelt zu werden, die Fotos vom Adams Building machen, einem alten Lagerhaus für Stoffe aus Spitze, das jetzt zum Nottingham College gehört. Die Fremdenführerin schwenkt einen gelben Regenschirm und zählt die Köpfe, um sich zu vergewissern, dass sie keins ihrer Schäfchen verloren hat.
Ich gehe über die Carlton Street und die Long Row Richtung Old Market Square. Ein Spendensammler mit einem Klemmbrett sucht Blickkontakt, doch ich gehe weiter. Ich rede nicht gern mit Fremden.
Ich checke die letzten Antworten in meiner Dating-App. Jemand hat mich gematched. Ich schaue mir das Profil an. Attraktiv, sportlich, ein bisschen klein, aber es geht nicht um mich. Zu Hause werde ich die Profile bei anderen sozialen Medien überprüfen. Derweil schicke ich, bemüht um einen lockeren Ton, eine erste Nachricht.
Hey, wir haben gematched.
Die Antwort erscheint mit einem Ping:
Offensichtlich!
Ein bisschen sarkastischer, als ich gehofft hatte. Ich versuche es noch einmal.
Schicke Bilder. Du siehst toll aus.
Sag das nicht, sonst finde ich dich langweilig.
Sorry.
Und entschuldige dich nicht. Das hasse ich noch mehr.
Können wir noch mal von vorne anfangen?
Was möchtest du gern wissen?
Hunde oder Katzen?
Hunde.
Was hältst du von Ananas als Pizzabelag?
Ein Sakrileg.
Kaffee oder Tee?
Weder noch.
Dann kann ich dich nicht zu einem Kaffee einladen?
Wir könnten Bubble Tea trinken.
Keck. Vielversprechend. Mir fallen keine Fragen mehr ein.
Wovor hast du mehr Angst – Spinat oder Spinnen?
Spinnen. Ich bin Veganer.
Ist das nicht eine Sekte?
Ich versuche, den Planeten zu retten.
Oder in Restaurants besonders nervig zu sein.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das mit uns funktioniert.
Schönes Leben noch.
Eine weitere gescheiterte Romanze. Vielleicht bin ich zu wählerisch – aber wer hätte gedacht, dass Nottingham ein so flacher Teich ist? Ich suche nicht nach Perfektion, habe jedoch gewisse Standards. Keine Mützen oder Hüte. Keine Emo-Frisuren. Keine überdimensionierten Sonnenbrillen. Und behaltet die Kleider an. Mit einem Lächeln kommt man viel weiter.
Mein Freund Morty macht Straßenmusik auf den Stufen des Rathauses. Er passt auf Poppy auf, meine Labrador-Hündin. Als sie hört, wie ich ihren Namen rufe, geht sie in Habtachtstellung und spitzt die Ohren. Sie wedelt mit dem ganzen Körper, als sie ihren Kopf in meine Hände drückt. Ich empfinde eine Welle von Glück.
»Hat sie sich benommen?«
»Absolut«, sagt Morty. »Sie hat mehr verdient als ich.«
Eine umgedrehte Anglermütze liegt zwischen seinen Füßen. Darin liegt eine Handvoll Münzen.
»Die bargeldlose Wirtschaft bringt mich um«, sagt er.
Morty, der eigentlich Mortimer heißt, spielt Mundharmonika und kennt nur vier Lieder, alle Shantys. Er gibt sich als obdachlos aus, schläft aber auf einer Couch im Haus seiner Schwester. Und er erzählt ständig Geschichten von Leuten, die »entdeckt« worden sind, als sie auf der Straße Musik gemacht haben, wie Ed Sheeran und Passenger.
Ich lege einen Fünf-Pfund-Schein in seine Mütze.
»Wofür ist der denn?«
»Dafür, dass du auf Poppy aufgepasst hast.«
»Du musst mich nicht bezahlen.«
»Ich weiß.«
Er steckt das Geld ein. »Hast du den Job bekommen?«
»Ich bin jetzt offiziell Cocktail-Kellnerin.«
»Ist das ein Euphemismus?«
»Leck mich.«
Ich spüre einen Regentropfen auf der Stirn und blicke in den hässlichen Himmel. Ich sollte mich lieber beeilen. Heute hat Cyrus den Wagen, sodass ich den Bus nach Hause nehmen muss.
Morty steckt die Münzen in seine Tasche und setzt die Mütze auf. Der Regen wird stärker.
»Soll ich dich fahren?«, fragt er.
»Du musst doch gar nicht in meine Richtung.«
»Ich mache einen Umweg.«
Sein Wagen parkt in der Nähe, ein betagter Mini mit blauen Türen und brauner Motorhaube. Auf dem Armaturenbrett liegt ein handgeschriebenes »Zu verkaufen«-Schild.
»Willst du ihn wirklich verkaufen?«
»Meine Schwester schenkt mir ihren alten Wagen. Sie hält diesen hier für eine Todesfalle.«
»Stimmt das?«
»Nein.«
»Wie viel willst du dafür haben?«
»Dreihundert. Aber für dich mach ich ihn fünfzig Pfund billiger.«
»Ich habe zweiundneunzig Pfund.«
»Ich bin nicht die Wohlfahrt.«
»Schade.«
Morty setzt mich vor dem National Ice Center ab, und ich renne durch den Regen, weil ich zu spät für meine Therapie-Sitzung bin. Poppy übernimmt die Führung. Wir weichen Fußgängern aus, die sich unter Markisen und in Ladeneingängen drängen oder hektisch Schutz suchen. Ein Mann mit Hut und Aktenkoffer rennt mich beinahe um, weil er den Kopf wegen des Regens gesenkt hält.
An einem Fußgängerübergang bleibe ich stehen und warte auf Grün. Dann mache ich einen Schritt von der Bordsteinkante. Bremsen kreischen, Stahl trifft auf Stahl. Der direkt an dem Übergang stehende Wagen wird von hinten angestoßen und ein Stück nach vorn geschoben. Ich weiche mit einem Satz aus, die Fahrerin blickt mich entsetzt an, steigt aus.
»Alles in Ordnung? Habe ich dich erwischt?«
Sie ist Mitte fünfzig, vielleicht auch älter, hat sich jedoch gut gehalten. Bis auf ein buntes Tuch um ihren Hals ist sie ganz in Schwarz gekleidet.
»Ich kann dich ins Krankenhaus fahren.«
»Mir geht es gut.«
Poppy schiebt ihren Körper zwischen uns, entweder um sich vorzustellen oder um mich zu beschützen.
Ein zweiter Fahrer steigt aus seinem Transporter. Ein großer, kräftiger Typ mit erschlafften Muskelpaketen. Er betrachtet die Front seines Transporters und fängt an, die Frau anzuschreien und als »dumme Kuh« zu beschimpfen.
»Sie sind einfach stehen geblieben. Ohne Warnung. Total abrupt!«
»Das stimmt nicht«, erwidert sie empört. »Ich habe ganz langsam abgebremst.«
Er begutachtet den Schaden an seinem Transporter und flucht leise.
»Werden Sie für den Schaden aufkommen?«
»Es war doch nicht meine Schuld! Sie sind mir von hinten reingefahren.«
Er äfft ihren Akzent nach, wiederholt ihren Satz, wippt auf den Füßen und macht einen Schritt auf sie zu. Ich sehe, wie sie zurückweicht.
Fußgänger sind stehen geblieben, der Verkehr staut sich. Ungeduldiges Hupen wird laut.
»Er lügt«, sage ich und trete einen Schritt näher zu der Frau. »Lassen Sie sich von ihm nicht einschüchtern.«
Der Mann starrt mich wütend an, aber ich sehe den Zweifel, der über sein Gesicht huscht. Die Lüge. Ich kann nicht erklären, woran ich das erkenne. Ich wünschte, ich könnte es einem nervösen Zucken oder einer an der Stirn pulsierenden Ader zuschreiben oder behaupten, seine Stimme hätte sich verändert, er hätte zweimal geblinzelt oder nach links oben geguckt. Ich weiß einfach, dass er lügt. Ich weiß es immer.
»Du nennst mich einen Lügner?«, fragt er und wendet seine Aufmerksamkeit mir zu.
Poppy knurrt.
»Ja. Vielleicht hat Ihr Handy geklingelt, oder Sie haben den Radiosender gewechselt oder einer Frau nachgeschaut, die über die Straße gegangen ist. Es war Ihre Schuld.«
Der Fahrer des Transporters ist es nicht gewohnt, dass man ihm die Stirn bietet. Er will mich einschüchtern, schlagen oder mir eine Socke in den Mund stopfen. Das könnte er vermutlich auch, aber ich würde zweimal so hart zurückschlagen. Ich würde beißen und kratzen. Ich würde kämpfen wie ein Mädchen.
Ich mache ein Foto von seinem Transporter und dem Kombi.
»Sie sollten die Polizei rufen«, sage ich zu der Frau. »Ich stehe als Zeugin bereit.«
In Wahrheit will ich nicht in die Sache verwickelt werden. Ich kann es nicht ausstehen, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Der Fahrer des Transporters fängt an, Ausflüchte zu machen, und erklärt, es sei nicht nötig, die Polizei einzuschalten, wir könnten die Sache unter uns klären.
»Wir wär’s, wenn wir kurz an den Rand fahren und unsere Kontaktdaten austauschen«, schlägt er vor.
Die Frau wirkt erleichtert.
»Kannst du mitkommen?«, fragt sie mich.
»Ich fahre mit ihm«, sage ich und weise mit dem Kopf auf den Transporter.
Ich folge dem Fahrer.
»Wollten Sie abhauen?«
»Nein.«
Das ist die Wahrheit. Er legt den Kopf zur Seite. »Wer bist du?«
»Eine Augenzeugin.«
3Cyrus
Wenn man sich den doppelten Stahlzaun, den Stacheldraht und die Überwachungskameras wegdenkt, könnte man Rampton für ein Gesundheits- und Wellness-Resort oder ein Adventure-Sports-Zentrum halten, mit angelegten Gärten und Außenflächen, einem Swimming-Pool, Aufenthaltsräumen und einem Fitness-Studio.
Bei all meinen Besuchen habe ich nur sehr wenige Patienten gesehen. Sie sind getrennt untergebracht, separiert nach Geschlecht und dem Grad ihrer Erkrankung. Als Elias zuerst hierherkam, war er in The Peaks, einer Station für Männer mit schweren Persönlichkeitsstörungen, und verbrachte wegen seines gewalttätigen Verhaltens elf Monate in Einzelunterbringung. Jahrelang musste er auf seinen Wegen durch die Klinik von vier Personen begleitet werden. Seitdem hat sich viel verändert. Er ist medikamentös eingestellt. Klar. Still wie ein Teich im Winter.
Er ist zugegebenermaßen nicht mehr der Bruder, den ich einst verehrt und dessen weitergereichte Klamotten ich gerne getragen habe, weil ich das Gefühl hatte, ihm dadurch näher zu sein. Ich hatte nichts dagegen, wenn Lehrer oder Verwandte mich versehentlich mit seinem Namen ansprachen, weil sie sich eher an ihn erinnerten. Das erstgeborene Kind wird immer am meisten verhätschelt und fotografiert. Ich kam als Zweiter. Und die Zwillinge hatten einen genetischen Vorteil. Denn wer ist nicht von einem Embryo fasziniert, der sich in zwei vollkommene, aber unterschiedliche Hälften teilt?
Elias ging in die zehnte Klasse, als die Probleme begannen. Er trieb davon wie ein Puh-Stock, der von einer Brücke geworfen wurde. Mum schob es auf die Pubertät, die Hormone, doch ich wusste, dass es etwas Ernsteres war. Er verkroch sich stundenlang in seinem Zimmer, wo er auf der Fensterbank Hasch rauchte und jeden vollen Lungenzug in die Abendluft blies, während er auf seinem iPod »Headbanger-Musik« hörte.
Er kam nur heraus, um zu essen, zu streiten oder im Garten seine selbst gebastelten Gewichte zu heben. Er verlor seinen Wochenend-Job, in der Nachbarschaft Rasen zu mähen, kaufte sich jedoch einen Schleifstein und einen Schleifblock und begann, Messer, Äxte und Rasenmäherklingen zu schleifen. Die Nachbarn standen Schlange für seine Dienste, und Elias schwärmte davon, wie scharf er jedes Werkzeug machen konnte.
Sosehr ich mich bemühte, ich konnte das Mysterium seiner Veränderung nicht ergründen oder Worte dafür finden. Für den langsamen Verfall. Die geflüsterten Streitgespräche, die durch seine Zimmertür drangen. »Lass mich in Ruhe«, sagte er zu niemandem außer sich selbst. »Ich hör dir nicht zu.«
Einmal erklärte er mir, er könne die Planeten kontrollieren, ohne ihn würde der Mond auf die Erde fallen und die Menschheit auslöschen, genau wie die Dinosaurier. Ich wollte ihm glauben. Klang es lächerlicher als das, was man mir im Kindergottesdienst beibrachte?
Die Diagnose machte es eine Zeit lang leichter. Die Medikamente. Elias nannte sie seine »Zombie-Pillen«. Seine Schulnoten befanden sich in freiem Fall. Abitur kam nicht mehr infrage. Wochen vergingen. Seine Schweigephasen wurden länger. Seine Isolation. Dad erwischte ihn dabei, wie er sich abends aus dem Haus schlich und erst am Morgen zurückkehrte. Zweimal brachte ihn die Polizei nach Hause, blutig und mit zerrissenem Hemd.
So lebten wir zwei Jahre lang – mit Höhen und Tiefen, mit guten und schlechten Wochen, ohne jemals zu wissen, was uns erwartete. Später erzählte ich einem Therapeuten, dass es war, wie mit einer Zeitbombe zu leben, die ich mal schneller, mal langsamer, aber unaufhörlich ticken hörte. Bis sie eines Tages stehen blieb.
Dr. Baillie findet mich im Garten, wo ich in der Sonne Wärme suche, die jedoch nur durch hohe Wolken gefiltertes, bleiches gelbes Licht spendet.
»Manchmal wünschte ich, ich würde rauchen«, sage ich. »Dann hätte ich etwas zu tun.«
Er setzt sich neben mich. »Sie kommen zurück.«
»Irgendein Hinweis?«
»Nein.«
Wir gehen wieder in den Konferenzraum, in dem Elias geduldig mit zwischen den Oberschenkeln zusammengepressten Händen gewartet hat. Die drei Mitglieder des Komitees treten nacheinander ein, gehen zwischen der Wand und dem Tisch entlang und nehmen auf ihren Stühlen Platz wie Geschworene, die mit einem Urteil zurückkehren.
Elias wurde seinerzeit nicht angeklagt. Ein Richter befand ihn für unschuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit und ordnete eine »Verwahrung nach Ermessen Ihrer Majestät« an, mit anderen Worten: für immer. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob die Königin sich Gedanken über die »Verwahrung« von Menschen machte. Kannte sie überhaupt Elias’ Namen und wusste, was er getan hatte?
Das Handy in meiner Manteltasche vibriert. Ich werfe einen Blick auf das Display. Detective Superintendent Lenny Parvel hat eine Nachricht geschickt:
Du wirst gebraucht! Ruf mich an!
Ich ignoriere sie. Ein Handy bei mir zu tragen fühlt sich immer noch fremd an. Bis Evie bei mir eingezogen ist, habe ich einen altmodischen Pager benutzt, was bedeutete, dass Menschen mich nicht einfach anrufen und mit mir sprechen konnten. Ich wollte keinen Computer in der Tasche haben, über den ich permanent erreichbar war. Mein Beruf gründet sich auf menschliche Interaktion, auf Gespräche von Angesicht zu Angesicht, auf das Beobachten und Interpretieren von Mimik und Gestik, und das geht am Telefon oder per SMS nicht.
Jetzt habe ich ein Telefon, das smarter ist als ich. Es kann schneller rechnen und weiß, wo ich bin, wohin ich gehe und wann ich auf das Display blicke. Es hält meine Vorlieben und Abneigungen und meine Internet-Historie fest und kann Worte vorhersagen, die ich tippen will, was entweder ein Fortschritt oder eine Kapitulation ist.
Richter Aimes gießt sich ein Glas Wasser ein, führt es zum Mund, nippt, schmeckt, nippt erneut und spricht.
»Wir sind hier, um einen Antrag von Elias David Haven zu beraten, der wegen seiner Rolle beim Tod von vier Personen, namentlich seiner Eltern und seiner Zwillingsschwestern, seit 2001 nach dem Mental Health Act in Verwahrung ist.
Bei seiner Ankunft im Rampton Special Hospital wurden bei ihm eine paranoide Schizophrenie sowie eine antisoziale und narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Erst in den letzten fünf Jahren hat Elias seine Taten in jener Nacht allmählich verarbeitet. Dank psychotroper Medikamente hat sich sein Zustand laut Aussagen seines zuständigen Psychiaters und des psychiatrischen Gutachters beträchtlich verbessert. Außerdem hat Elias Bewältigungsstrategien und Verhaltensmuster gelernt, die zu einer Milderung seiner Psychose geführt haben, sodass seine Kontrolle kein oder nur ein geringes Problem darstellt.«
Er hebt den Kopf und sieht Elias an.
»In den Augen der Justiz sind Sie keines Verbrechens schuldig, Elias, weshalb Sie nur so lange in Verwahrung bleiben sollten, solange die Fachleute Sie für eine Gefahr für die Allgemeinheit halten. Heute müssen wir deshalb die Frage beantworten, ob Sie bereit sind, Ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Die öffentliche Sicherheit steht an oberster Stelle, und unsere Entscheidung muss auch die Gefühle und Ängste der Menschen berücksichtigen, die direkt von Ihren Taten betroffen waren.
Wir Mitglieder dieses Komitees sind uns durchaus bewusst, dass jede Entscheidung, die wir heute treffen, subjektiv ist. Wir versuchen, das zukünftige Verhalten eines latent gefährlichen Psychiatriepatienten vorherzusagen, und verlassen uns dabei auf Empfehlungen von Psychiatern und Psychologen, die einräumen, dass ihre Wissenschaft nicht exakt ist. Nicht alle Personen, die mit Ihrem Fall zu tun hatten, waren einer Meinung. Dr. Reid, ein Psychiater an dieser Klinik, hat die Ansicht geäußert, dass Sie kalt, distanziert und gefühllos sein können und über eine perverse Arroganz verfügen, die die Grundlage Ihres paranoiden Denkens ist.
Des Weiteren haben wir die mündlichen Aussagen von zwei gutachtenden Psychiatern sowie von Ihrem zuständigen Psychiater Dr. Baillie gehört, die sich einig sind, dass Ihre psychopathische Störung durch Medikamente und Therapie unter Kontrolle gebracht werden konnte.«
Es entsteht eine Pause. Richter Aimes blickt den Tisch hinunter zu seinen Kollegen. Niemand möchte etwas hinzufügen, doch die Atmosphäre im Raum vibriert, als stünde alles unmittelbar vor einer Veränderung. Ich bin nervös seinetwegen. Und meinetwegen.
Der Richter fährt fort.
»Ein langfristiger Hafturlaub nach Artikel 17 des Mental Health Act muss vom Innenminister genehmigt werden. Wir werden dem Minister empfehlen, dass es Ihnen erlaubt wird, das Klinikgelände tageweise unbegleitet zu verlassen.«
»Wann kann ich nach Hause?«, fragt Elias.
»Freigang über Nacht ist der nächste Schritt«, sagt Richter Aimes. »Wochenenden. Feiertage. Jede Stufe wird ein Test sein.«
»Aber es geht mir besser. Ich bin keine Gefahr mehr.«
Dr. Baillie beugt sich vor und legte eine Hand auf Elias’ Unterarm.
Er schüttelt ihn ab. »Man hat mich einen Musterpatienten genannt. Sie haben sie gehört. Ich bin geheilt.«
Ich lege einen Finger auf die Lippen, um ihm zu signalisieren, dass er still sein soll. Im nächsten Atemzug legt er den Kopf zur Seite wie ein Vogel und beobachtet irgendetwas in der oberen Ecke des Raumes.
Richter Aimes beendet seine Erklärung.
»Der Minister wird unsere Empfehlung im Laufe des Tages erhalten. Das ist normalerweise eine Formalität, und wenn er nicht anders entscheidet, sind Sie zu einer tageweisen Entlassung berechtigt, sobald er die nötigen Papiere unterschrieben hat.«
Stühle werden zurückgeschoben. Die Mitglieder des Komitees stehen gleichzeitig auf und gehen hintereinander durch die Seitentür hinaus.
Elias reagiert nicht. Zwei Wärter kommen. Große Männer in kurzärmeligen T-Shirts und dunklen Hosen. Sie gehen vorsichtig auf Elias zu und erklären ihm, dass es Zeit ist zu gehen. Ich erwarte, dass er ungehalten reagiert, aber Stille hat sich über seinen gesamten Körper gesenkt. Er sammelt seine Papiere zusammen, richtet sie am Rand gerade aus und klemmt sie unter den Arm, bevor er sich vor einem imaginären Publikum verbeugt.
»Vielen Dank für Ihr Kommen«, sagt er und klingt durch und durch wie ein Anwalt. »Ich weiß Ihre Geduld und Ihre Sorgfalt zu schätzen.«
4Evie
Meine Therapeutin Veera Jaffrey wird gern mit ihren Initialen angeredet. VJ – worüber ich kichern muss, weil es mich an Vayjayjay erinnert, ein englisches Slang-Wort für Vagina. Ich hab ihr das gesagt, aber sie hat den Witz nicht verstanden.
Veejay ist Anfang vierzig, hat eine wundervoll tiefe Stimme und dichtes dunkles Haar. Sie spricht mit dem Hauch eines pakistanischen Akzents, weil ihre Eltern nach England gezogen sind, als sie sieben war. Sie waren sehr streng und wollten, dass sie einen muslimischen Jungen heiratet, aber sie brannte mit einem Saxofonspieler namens Nigel durch und versteckte sich, weil ihre Eltern drohten, sie umzubringen.
Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber es ist eine gute Geschichte. Ich denke mir gern Sachen über das Leben von Menschen aus, weil die Wahrheit so langweilig ist oder ich nicht herausfinden kann, was wirklich passiert ist. Veejay spricht nicht über sich. Ich weiß, dass sie Kinder hat, weil in ihrem Garten Spielsachen liegen. Poppy schnuppert dort gerade am Komposthaufen und trinkt aus dem Fischteich.
Wenn ich Veejay nach ihrer Familie frage, lenkt sie das Gespräch jedes Mal zurück auf mich. Jede Sitzung beginnt gleich. Habe ich gut geschlafen? Albträume? Panikattacken? Wahllose Gedanken? Flashbacks?
Veejay ist einer der wenigen Menschen, die wissen, wer ich bin und woher ich komme. Dass ich eigentlich nicht Evie Cormac heiße, sondern in Albanien geboren und im Rumpf eines Fischerbootes nach Großbritannien gekommen bin, zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester, die beide auf der Überfahrt gestorben sind. Auch andere haben beschissene Kindheiten, aber nicht wie meine.
»Letzte Woche hast du von deiner Schwester gesprochen«, sagt Veejay und blickt auf ihre Notizen. »Agnesa. Wie viel älter als du war sie?«
»Sechs Jahre.«
»Was hast du für Erinnerungen an sie?«
»Sie hatte wunderschönes Haar, so wie Ihres, und sie hat mich dafür bezahlt, dass ich es bürste und flechte, oder versprochen, mir Krapfen zu kaufen.«
Im selben Moment bin ich wieder in meinem Dorf, vor dem Wagen eines Straßenhändlers neben der Kirche, in dem durch eine herabhängende Tülle Teigklumpen in heißes Öl tropfen. Ich kann riechen, wie sie aufquellen und goldgelb werden. Die Verkäuferin wendet sie in Puderzucker, steckt sie in eine weiße Papiertüte und spritzt Schokoladensauce darüber. Agnesa überlässt mir immer die obersten Krapfen, auf denen die meiste Schokolade ist.
»Vermisst du sie?«, fragt Veejay.
»Ja.«
»Wie ist sie gestorben?«
»Sie ist ertrunken.«
»Zusammen mit deiner Mutter?«
»Ja.«
»Wurden ihre Leichen je gefunden?«
»Nein.«
»Erzähl mir von deiner Mutter.«
»Sie war Schneiderin. Doch dann wurde sie krank, Melancholie, wie Papa es nannte. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Sie hat den Großteil der kalten Monate im Bett verbracht, doch wenn es wärmer wurde, war sie fröhlicher.«
Diese Fragen gehen weiter, aber behutsam. Veejay konzentriert sich auf das, was mir passiert ist, nachdem das Boot gesunken war. Jedes Mal, wenn sie das Thema anspricht, finde ich einen Weg, ihre Aufmerksamkeit abzulenken. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, aber ich weiß nicht, wer von uns beiden die Katze ist. Ich habe kein Bedürfnis, das Geschehene noch einmal zu durchleben. Die Leute denken, man sollte traumatische Erlebnisse wie einen Satz Karten ausbreiten und nach Farbe oder Wert sortieren, weil es so hübsch ordentlich aussieht, doch ich will die Karten noch einmal mischen und austeilen. Ich will nicht mit irgendwas »abschließen«. Ich will ein neues Blatt.
Nach fünfzig Minuten ist meine Zeit um.
»Es ist immer gut zu sprechen«, sagt Veejay.
»Wirklich?«, frage ich.
»Reden hat die Kraft zu heilen.«
»Und die Kraft zu verletzen.«
Sie schraubt ihren Füller zu. »Warum kommst du dann weiterhin?«
»Ich möchte ihn nicht enttäuschen.«
»Bedeutet dir Cyrus so viel?«
Ich überlege, wie ich ihr unsere Beziehung erklären soll.
»Früher dachte ich, ich wäre das einzige bewusst empfindende Wesen im Universum. Ich dachte, dass alles nur meinetwegen da ist – die Dinge, andere Menschen, Tiere, Ereignisse –, und wenn ich sterbe, würde alles verschwinden.«
»Solipsismus«, sagt Veejay. »Die Idee, dass nichts jenseits der eigenen Vorstellung existiert.«
»Dann habe ich Cyrus getroffen und erkannt, dass ich nicht allein bin. Ich habe nicht bloß meinen Schmerz gespürt, sondern auch seinen. Seine Gedanken. Seine Gefühle. Seine Erfahrungen. Ich war nicht mehr das einzige bewusst empfindende Wesen im Universum – wir waren zu zweit.«
5Cyrus
Als ich zu meinem Wagen auf dem Parkplatz der Klinik gehe, scheint die Luft von Sauerstoff gesättigt; er lässt die Farben heller leuchten und schärft meine Sinne. Ich lehne mich auf dem Fahrersitz meines Fiats zurück und spüre mein klopfendes Herz. Elias darf die Klinik tageweise verlassen. Er geht davon aus, nach Hause zu kommen. Der nächste Schritt werden Übernachtungsbesuche sein. Das Haus ist groß genug. Es gibt fünf Zimmer. Eins belegt Evie. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie sie darauf reagieren könnte, dass mein Bruder mit uns lebt. Ich habe in einem Zustand der Leugnung gelebt. Ich bin davon ausgegangen, dass Elias’ Antrag abgewiesen wird und bis zum nächsten mindestens zwei Jahre vergehen.
Bei einem flüchtigen Blick in den Rückspiegel sehe ich mein dreizehnjähriges Ich mit Sommersprossen, Locken und einer Zahnspange aus Metall. Meine Wangen brennen. Als ich wieder hinsehe, ist es verschwunden.
Mein Handy vibriert. Zwei weitere Nachrichten von Lenny Parvel.
Beaconsfield Street, Hyson Green. Älterer männlicher Toter. Schädelhirntrauma durch stumpfe Gewalt. Tochter vermisst. Ruf mich an.
Und zwanzig Minuten später: Wo bist du?
Mein Herzschlag beruhigt sich wieder. Das ist inzwischen mein Job – die Untersuchung gewaltsamer und verdächtiger Todesfälle. Ich bin Profiler, ein Fachmann für menschliches Verhalten – in seiner schlimmsten, nicht in seiner besten Ausprägung –, für die Soziopathen und Psychopathen, die Außenseiter und Einzelgänger, die Sonderlinge und Verwirrten.
Zur Lösung der meisten Verbrechen braucht man keinen forensischen Psychologen. Wenn zwei Betrunkene auf einem Parkplatz in eine Prügelei geraten, und einer stößt dem anderen ein zerbrochenes Glas in den Hals, ist kein Universitätsabschluss in Kriminalpsychologie erforderlich, um zu erklären, was passiert ist. Ich werde gerufen, wenn ein Verbrechen das Verständnis der Ermittler übersteigt. Wenn die Polizisten möchten, dass jemand ihnen erklärt, warum ein menschliches Wesen einem anderen etwas so Schreckliches angetan hat.
Ich tippe eine Nachricht: Bin unterwegs.
Lenny antwortet: Wird auch Zeit.
Mein alter Fiat hat kein Navi, deshalb benutze ich mein Handy, das von einer Halterung an das Armaturenbrett gesaugt wird. Die Anweisungen werden von einer Frau gesprochen, deren Stimme mich unheimlich an die einer meiner Patientinnen erinnert. Ursula, eine Verhaltenstherapeutin, die unter Apotemnophobie leidet, der Angst vor Amputation.
Vierzig Minuten später erreiche ich die Außenbezirke von Nottingham, nachdem ich den östlichen Rand des Sherwood Forest gestreift habe, eines uralten Waldes, der kaum groß genug scheint, seine eigene Geschichte zu fassen; die Folklore, nicht die Fakten.
An beiden Enden der Beaconsfield Street parken Polizeiwagen und leiten den Verkehr um. Zwei uniformierte Constables besetzen die Absperrung an der Westseite, durch die Polizeiband gefädelt ist, das im Wind flattert.
»DSU Parvel erwartet mich«, sage ich.
Die Police Constable notiert meinen Namen und weist mich zu einem Parkplatz. Sie ist neu – gerade mit der Ausbildung fertig –, und ihre Miene wirkt aufgeregt und sehr ernst. Eines Tages werden Verbrechen wie diese sie traurig machen und entsetzen; wenn sie zu viele Leichen gesehen hat, die aus demolierten Autos gezerrt, blutbespritzten Schlafzimmern getragen, am Fuß einer Klippe geborgen oder von Dachbalken geschnitten wurden.
Ich betrachte die Umgebung, freistehende Häuser und Doppelhäuser, zweistöckig, aus rotem Backstein, erbaut in den Fünfziger- und Sechzigerjahren. Dies ist ein traditionelles Arbeiterviertel, doch einige der Besitzer streben offensichtlich nach Höherem, haben renoviert und ihre Speicher ausgebaut.
»Sie haben sich ganz schön Zeit gelassen«, sagt Alan Edgar, ein Sergeant aus Lennys Truppe, der aus offensichtlichen Gründen den Spitznamen Poe trägt.
»Wie schlimm ist es?«
»Eine Sauerei.«
Eine gespensterartige Gestalt kommt aus dem Haus. Lenny Parvel in einem weißen Schutzoverall, Latexhandschuhen und Plastikvisier. Sie schlägt die Kapuze zurück und sieht mich aus haselnussbraunen Augen an. Warm. Intelligent. Vorwurfsvoll.
»Wo warst du?«
»Rampton.«
»Lassen sie ihn raus?«
»Ja.«
»Und wie fühlst du dich deswegen?«
»Nervös.«
»Verständlich.«
Meine Beziehung zu Lenny lässt sich schwer einordnen. Sie war die junge Police Constable, die mich in dem Gartenschuppen gefunden hat, wo ich mich, überzeugt, dass Elias auf der Jagd nach mir war, in verdreckten Fußballsocken und mit einer Hacke bewaffnet versteckt hatte. Es war Lenny, die mich herausgelockt, mich in ihren Mantel gewickelt und mit mir auf den Schaukeln gesessen hat, bis Verstärkung eintraf.
Später begleitete sie mich durch polizeiliche Vernehmungen und wachte über mich, wenn ich auf dem Feldbett in der Station einschlief. In den folgenden Monaten war sie auf den Beerdigungen, bei den Anhörungen zur Feststellung der Todesursache und bei Elias’ Erscheinen vor Gericht immer an meiner Seite.
Und noch später, in meinen wüsten Jahren, war es Lenny, die mich fand, wenn ich ritzte, trank, mir irgendwas spritzte oder meinen Körper mit selbst gemachten Tattoos beschädigte.
Sie ist zwar erst Mitte vierzig, aber für mich war sie immer wie eine Mutter und ich vielleicht wie ein Sohn. Lenny hat keine eigenen Kinder bekommen, nachdem sie einen älteren Mann geheiratet und seine beiden Söhne mit großgezogen hat, die nicht viel jünger sind als ich. Der eine ist Arzt, der andere Zahnarzt. Meine Anerkennung an beide.
Lenny reicht mir einen weißen Plastikoverall an, ich schlüpfe hinein und streife Schoner aus Plastik über meine Schuhe.
»Was wissen wir über das Opfer?«
»Rohan Kirk. Siebenundsechzig. Bezieher einer Behindertenrente. Seine Frau ist vor zehn Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Rohan saß am Steuer und erlitt Hirnverletzungen. Sie haben zwei Töchter. Zwillinge. Zweiunddreißig. Maya lebt mit ihrem Dad zusammen und betreibt einen mobilen Hundepflege-Service. Melody ist verheiratet mit Kindern. Sie wohnt zwei Straßen entfernt. Maya wurde seit gestern nicht mehr gesehen.«
Das Geräusch einer Polizeisirene kommt in hohem Tempo näher. Der Wagen hält, und ein Detective steigt aus. Er ist etwa eins achtzig, trägt einen gut geschnittenen grauen Anzug und strahlt eine drahtige Sportlichkeit aus, die dem mittleren Alter standhalten wird, wenn er die Finger vom Alkohol lässt.
Er entdeckt Lenny, und die beiden tauschen kein Lächeln, sondern eher ein feixendes Grinsen aus.
»Ich dachte, das wäre mein Fall«, sagt er und klopft seine Jackentaschen ab, als hätte er die Notiz verlegt, die ihn von der Planänderung in Kenntnis gesetzt hat.
»Ich dachte, es wäre etwas für die Serious Sexual Offence Unit«, erwidert Lenny, die die neue Task Force für schwere Sexualverbrechen in Nottinghamshire seit einiger Zeit leitet.
»Ein Mann wurde ermordet«, sagt der Neuankömmling.
»Und seine Tochter wird vermisst«, entgegnet Lenny.
»Das macht es nicht zu einem Sexualverbrechen.«
»Noch nicht.«
Sie starren sich eine Weile an, bis Lenny nachgibt. Der Detective wendet seine Aufmerksamkeit mir zu.
»Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet.«
»DCI Gary Hoyle, das ist Dr. Cyrus Haven«, sagt Lenny. »Unser forensischer Psychologe.«
»Ja, natürlich, ich habe von Ihnen gehört«, sagt er und drückt kräftig meine Hand. »Sie haben diesen Typen in Schottland erschossen.«
»In Notwehr«, sage ich.
»Natürlich. Sein Magazin war leer, aber das konnten Sie nicht wissen.«
Ich weiß nicht genau, ob er mich kritisieren oder mir aufrichtiges Mitgefühl ausdrücken will. Ich wünschte, Evie wäre hier.
»Ich bin froh, Sie an Bord zu haben«, sagt Hoyle. Sein breites, zuversichtliches Lächeln hat etwas sehr Amerikanisches. Im nächsten Atemzug erklärt er: »Mir wäre es lieber, wenn der Tatort möglichst wenig kontaminiert wird.«
»Ich trage einen Schutzanzug.«
Wir starren uns ein paar Sekunden zu lange in die Augen. Schließlich nickt er. »Ich freue mich auf Ihren Beitrag.« Dann klatscht er in die Hände und reibt die Handflächen aneinander, als wäre er bereit, mit der Arbeit zu beginnen.
Beamte der Spurensicherung tragen Gerätschaft ins Haus. Kameras. Scheinwerfer. Schutzbeutel. Ersatzbatterien. Abstrichtupfer. Material zum Sichern von Fingerabdrücken. Beweisetiketten. Absperrband. Laufbretter. Hoyle signalisiert einem der Leute, dass er ihn sprechen möchte, und überquert die Straße.
»Er macht einen sehr freundlichen Eindruck«, sage ich.
»Stimmt«, erwidert Lenny. »Er ist die Sorte Freund, der ich gerne folge.«
»Weil du ihn nicht in deinem Rücken haben willst.«
»Genau.«
»Ist er neu?«
»Hoyle? Nein. Er hat bei der National Crime Agency gearbeitet. Davor war er im Dezernat für Schwere und Organisierte Kriminalität. Ein Starermittler. Immer auf der Überholspur. Dazu bestimmt, uns alle zu beherrschen.«
»Ein Typ mit seltsamem Händedruck?«, frage ich.
»Das ist bis jetzt noch kein Ding.« Lenny rückt ihr Visier zurecht. »Er ist einer dieser Detectives, die den Job zu sehr mögen. Als würde er sich vom Leiden anderer nähren.«
»Ein Soldat, der den Krieg für glorreich hält.«
»So ungefähr.«
Ich betrachte das Haus. Es liegt an einer ruhigen Straße im Blickfeld von mindestens sechs anderen Grundstücken. Keine Alarmanlage oder Bewegungsmelder.
»Was ist mit den Nachbarn?«
»Die haben nichts gehört, ausnahmsweise.«
»Das heißt?«
»Tochter und Vater waren für ihre Auseinandersetzungen bekannt. Rohan Kirk hat regelmäßig die örtliche Polizeidienststelle angerufen, sich über Misshandlungen beschwert und behauptet, seine Töchter würde ihm seine Pensionszahlungen stehlen.«
In der Auffahrt parkt ein Transporter. Auf der Seite steht Short Bark and Sides. Die Haustür ist durch einen Windfang geschützt, die äußere Tür doppelt verglast.
Ich trete auf die Laufplanken, die im Flur ausgelegt sind. Mäntel hängen an Haken, darunter sind Schuhe aufgereiht. Die Küche liegt direkt vor uns, das Wohnzimmer zur Linken.
Als Erstes sehe ich die blassen Knöchel, die aus einer Flanellschlafanzughose ragen. Seine Schienbeine sind von violetten Adern durchzogen. Er liegt zusammengerollt auf der Seite, einen Arm unter dem Körper verdreht. Eine Hälfte seines Kopfes ist zu einem blutigen Brei zertrümmert. Er ist noch ein oder zwei Meter gekrochen, bevor er vor dem Kamin gestorben ist. Die rechte Hand scheint er nach einem Kissen auszustrecken, das vom Sofa gefallen ist, als hätte er seinen Kopf weich betten wollen.
Neben ihm liegen eine blutbespritzte Bettdecke und eine Tupperware-Schüssel.
Ein Beamter der Spurensicherung kauert neben der Leiche.
»Craig Dyson«, sagt Lenny. »Er leitet den Einsatz der Spurensicherung.«
»Wir sind uns schon begegnet.«
Dyson dreht sich um und nickt. Er hält einen feuchten Abstrichtupfer in der Hand, mit dem er über die Finger, Nägel und Nagelbetten des Opfers gefahren ist. Er schiebt ihn in ein Teströhrchen aus Plastik, das in einem verschließbaren Beweisbeutel verstaut wird.
»Irgendeine Spur von der Tatwaffe?«
Dyson zeigt auf ein dekoratives Kaminbesteck mit Handbesen und Schaufel. »Der Schürhaken fehlt.« Er weist auf die Blutspritzer an der Wand. »Sieht so aus, als wäre er von vorn geschlagen worden, als er den Raum betreten hat. Er ging weiter und wurde erneut getroffen. Hier ist er gefallen und hat versucht, den Kopf mit den Händen zu bedecken, doch die Schläge sind immer weiter auf ihn eingeprasselt.«
»Fingerabdrücke?«
Dyson zeigt auf einen verschmierten Blutfleck am Lichtschalter. »Der wurde nach der Tat hinterlassen, aber keine Schleifen oder Wirbel, was darauf hindeutet, dass unser Täter Handschuhe getragen hat.«
Weitere Blutspuren wurden auf dem Küchenboden und im Waschbecken gefunden. Nummerntafeln markieren die Stellen. Eine Schranktür neben der Waschmaschine ist offen. Auf einem Regal stehen Waschpulver und Weichspüler.
Ich folge Lenny durch das übrige Haus und halte Ausschau nach Spuren von gewaltsamem Eindringen, Streit, Raub oder Flucht. Eine Mitarbeiterin untersucht die Treppe. Wir tragen identische Kleidung, doch sie hat ihr langes Haar unter ihre Kapuze gesteckt, und der Overall steht ihr viel besser als mir.
»Hallo, ich bin Cassie Wright«, stellt sie sich eifrig vor.
»Ich bin Cyrus Haven.«
»Ich weiß. Wir sind uns schon einmal begegnet.«
»Entschuldigen Sie, ich erinnere mich nicht.«
Sie lacht, und ihre Augen funkeln. »Es wird Ihnen schon noch einfallen.«
Sie macht einen Schritt zurück, damit ich an ihr vorbeigehen kann. Als unsere Overalls sich streifen, knistern sie leise von der elektrischen Ladung.
Im ersten Stock gibt es drei Schlafzimmer. In dem größten, das zur Straße hin liegt, hat Rohan Kirk geschlafen. Das Bett ist zerwühlt, die Decke zurückgeschlagen, das Kissen eingedrückt. Auf dem Nachttisch neben dem Bett ein Glas Wasser neben einer Packung Schlaftabletten.
Vor einem großen Fernseher stehen ein verschlissener Sessel und ein Beistelltisch mit Fernbedienung, zwei zusammengedrückten leeren Bierdosen und einem Aschenbecher voller Süßigkeitenverpackungen. Der Kleiderschrank enthält eine Handvoll Pullover, zwei Jeans und karierte Hemden, alle mit dem gleichen Label und in ähnlichen Farben. Funktionelle Kleidung, die nichts ausdrücken will.
Gegenüber liegt Mayas Zimmer, das heller und ordentlicher ist. Es wird von einem Doppelbett, einem Kleiderschrank und einer Kommode dominiert. Die Bettdecke fehlt, wahrscheinlich liegt sie unten. Auf einem Regal neben dem Fenster reihen sich nach Größe sortiert ein Dutzend Stofftiere, darunter ein Paddington-Bär.
Neben einem Ganzkörperspiegel hängen mehrere Kleider über einem Stuhl. Ein Glätteisen ist noch in die Steckdose gestöpselt. Vermutlich hat Maya Sachen anprobiert, sich frisiert und geschminkt.
»Sie war gestern Abend aus«, sage ich.
Ich hebe ihr Kissen hoch. Darunter liegt ihr zusammengeknülltes Nachthemd.
»Haben Sie im ersten Stock ebenfalls Blutspuren gefunden?«
»Noch nicht.«
Ich drehe mich langsam um und stelle mir Maya in diesem Zimmer vor, doch ich bekomme kein richtiges Gefühl für sie. Ich kann mich nicht in ihren Kopf versetzen.
»Erzähl mir von Rohan Kirks Hirnverletzung.«
»Sie hat das Frontalhirn betroffen. Seine Aufmerksamkeit und seine Konzentrationsfähigkeit waren beeinträchtigt. Er hat sich nie lange in einem Job gehalten und zu viel getrunken.«
»War er gewalttätig?«
»Ungeduldig und impulsiv.« Lenny blickt die Treppe hinunter. »Es war bestimmt nicht leicht, sich um ihn zu kümmern.«
»Du glaubst, Maya war es?«
»Sie wäre nicht die erste pflegende Angehörige, die die Beherrschung verliert.«
»Sie hat weder eine Tasche gepackt noch ihren Wagen mitgenommen.«
»Sie ist in Panik geraten.«
»Das heißt, sie taucht wieder auf«, sage ich sarkastisch. Lenny hält es für Geplänkel und ist nicht beleidigt, dass ich anderer Meinung bin als sie.
»Hat Maya einen Hund?«
»Nein. Wieso?«
»Es kommt mir bloß seltsam vor – einen Hundepflege-Service zu betreiben und selbst keinen Hund zu haben.«
Wir gehen die Treppe hinunter und steigen über Nummerntafeln im Flur. An der Haustür bleibe ich stehen. Dyson sucht nach Fingerabdrücken. Ich blicke zu den Mänteln an der Garderobe und der Reihe von Schuhen darunter, die ein wenig durcheinander ist. Rechter und linker Schuh eines Paars sind jeweils vertauscht.
»Haben Sie diese Schuhe schon untersucht?«
»Wir sind sehr gründlich«, erwidert Dyson spöttisch. Ich schiebe die Mäntel beiseite und presse die Wange an die Tapete.
»Was ist?«, fragt Lenny.
»Ich weiß noch nicht genau.«
6Evie
Die Bustür geht zischend auf. Der Fahrer hat einen Bart und trägt einen blauen Turban.
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragt er.
»Nein. Wir kommen sehr gut klar.«
Ich trage eine dunkle Brille, Poppy ihr Hundegeschirr. Sie führt mich die Stufen hinauf, und ich greife nach meinem Handy, um es vor das Lesegerät zu halten.
»Schon gut«, sagt der Fahrer. »Für Sie ist es umsonst.«
»Vielen Dank.«
Ich gehe den Gang hinunter. Zwei ältere Leute auf den nächsten Sitzen stehen sofort auf.
»Der hier ist frei«, sagt die Frau und will meinen Arm greifen. Aber ich werde nicht gern angefasst. Ich ziehe Poppy näher an mich und lasse sie zwischen meinen Beinen Platz nehmen.
Allmählich werde ich ziemlich gut in blind sein. Ich spare Geld und kann unbemerkt die Menschen beobachten. Cyrus wäre wütend, wenn er es wüsste, doch ich nehme keiner ernsthaft beeinträchtigten Person den Platz weg oder zwinge einen Scheintoten zum Stehen.