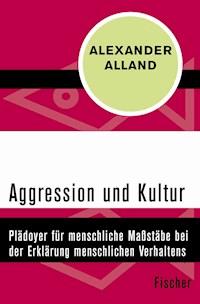
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In der Diskussion um Wesen und Ursprung der Aggression prallen die Meinungen heftig aufeinander. Verhaltensforscher suchen die Quellen menschlicher Angriffslust in ererbten Instinkten. Nach ihren Theorien ist der Mensch Tier unter Tieren, unausweichlich biologisch »programmierten« Gesetzen unterworfen, die sein Tun weitgehend bestimmen. Einen solchen Ansatz hält der Anthropologe Alexander Alland für eindimensional, für wissenschaftlich unhaltbar, ja sogar für gefährlich, weil geeignet, »unser Bewußtsein von der Komplexität der menschlichen Existenz abzustumpfen« und die Aufmerksamkeit von den wirklichen Ursachen abzulenken. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alexander Jr. Alland
Aggression und Kultur
Plädoyer für menschliche Maßstäbe bei der Erklärung menschlichen Verhaltens
Aus dem Amerikanischen von Friedhelm Herborth
FISCHER Digital
Inhalt
Für Sonia
Vorwort
In den letzten Jahren ist eine Flut von Büchern erschienen, in denen nachgewiesen werden soll, daß menschliches Verhalten entweder auf Instinkten oder auf streng geregelten biologischen Prinzipien beruhe. Viele Autoren meinen, sie hätten in Antrieben wie instinktiver Aggression oder Territorialität den Schlüssel zum Verständnis solcher sozialen Phänomene wie Krieg und Besitzverhältnisse gefunden. Andere versuchen, menschliche Geschichte auf genetische Prinzipien oder biologisch festgelegte Geschlechtsunterschiede zu reduzieren, die dafür verantwortlich seien, daß wohl Männer, nicht aber Frauen zu Gruppenverhalten fähig seien. Einige haben auch wieder Rassenargumente in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt. Der Haupteffekt dieser Bücher besteht darin, Nichtfachleute, die selten wissenschaftliche Zeitschriften lesen und wenig Einsicht in die Komplexität der neueren Forschungen auf Gebieten wie Verhaltensgenetik, Ethologie, biologischer Anthropologie, Ethnologie, Soziologie und physiologischer Psychologie haben, irrezuführen oder zu verwirren.
Dieses Buch versteht sich als eine Kritik an derart allzu stark vereinfachenden Auffassungen menschlichen Verhaltens und gleichzeitig als eine Verteidigung darwinistischer Prinzipien in der Biologie wie in den Sozialwissenschaften.
Zwischen der Niederschrift des ersten Entwurfs und des endgültigen Manuskripts ist dieses Buch gewissermaßen zu einer Frucht kollektiver Anstrengung geworden. Ich möchte insbesondere Elman R. Service, Marvin Harris, Abraham Rosman, Mimi Kaprow, Elizabeth Zinyei-Merse, Ralph Holloway und Ben White danken. Besondere Anerkennung gilt meiner Frau Sonia, deren überaus aufmerksame und kritische Lektüre des Manuskripts in seinen verschiedenen Fassungen sehr viel zu dessen Endfassung beigetragen hat. Nicht zuletzt schulde ich meinen Studenten an der Columbia University Dank – den noch nicht Graduierten ebenso wie den Graduierten; die pädagogische Arbeit mit ihnen ist zumindest für mich ein wechselseitiger Prozeß gewesen.
Schließlich danke ich den folgenden Verlagen und Autoren für die Erlaubnis, aus früher veröffentlichtem Material zu zitieren: Holt, Rinehart and Winston Inc.; Doubleday and Company, Inc.; The American Psychological Association, die den American Psychologist herausgibt; The American Geographical Society; Ashley Montagu und Omar C. Stewart.
Oktober 1971
Alexander Alland, Jr.
1. Kapitel Einleitung
Dieses Buch wendet sich gegen Anschauungen, die den Menschen durch die Brille eines streng biologischen Determinismus sehen. Es wendet sich gegen jene, die wie Konrad Lorenz, Robert Ardrey und Desmond Morris den Ort des Menschen in der Natur allzu einfach festlegen und menschliches Verhalten auf eine Funktion von Instinkten reduzieren. Dieses Buch wendet sich ferner gegen die Behauptung, die Anthropologie sei antidarwinistisch und unwissenschaftlich. Lorenz und Ardrey haben einen Pseudokonflikt erzeugt: Wissenschaft contra romantische Metaphysik. Sie vertreten die Ansicht, die Biologen betrachteten den Menschen als ein Verhaltensgesetzen unterworfenes Wesen, während die Sozialwissenschaftler den Menschen als das Produkt einer besonderen Schöpfung und biologischen Gesetzmäßigkeiten deshalb nicht unterworfen ansähen. Nun ist dies niemals der Fall gewesen und auch heute nicht der Fall. Das Problem ist allzu sehr vereinfacht und die Schlachtlinien sind falsch gezogen worden.
Ich bin Darwinist. Die Evolutionstheorie bildet das tragende Gerüst meines Nachdenkens und Forschens über die Abstammung des Menschen und menschliches Verhalten. Ich bin auch Anthropologe. Mein Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft vom Menschen. Diese Wissenschaft hat – zumindest in den Vereinigten Staaten – immer einen doppelten Bezugspunkt gehabt: den der Biologie und den der Sozialwissenschaft. Die Anthropologen haben immer den Standpunkt vertreten, daß der Mensch, obgleich eine einzigartige Spezies, sich nur im Kontext der Natur verstehen läßt. Dazu gehört das Studium der Abstammung des Menschen von älteren Primaten und der Entstehung des Menschen als einer einzigartigen, kulturerzeugenden Art sowie ein Verständnis der vielfältigen Verhaltensmuster, die in den vergangenen hundert Jahren moderner Anthropologie von den Ethnologen (denjenigen, die lebende Gesellschaften auf der ganzen Welt studieren) dokumentiert worden sind.
Das heißt nicht, daß die Anthropologen biologische Deterministen wären oder beim Studium des Menschen einem einheitlichen theoretischen Ansatz folgten. Die voreilige Veröffentlichung relativ rigider sozialevolutionärer Theorien im späten neunzehnten Jahrhundert brachte viele Anthropologen von der Vorstellung ab, menschliches Verhalten ließe sich überzeugend in das darwinistische Schema einfügen. Einige dieser Theorien verdunkelten die nützlichen Aspekte der evolutionstheoretischen Konzepte, weil sie auf dem Boden schwach konstruierter Analogien argumentierten, statt von den Hauptprinzipien des modernen Darwinismus auszugehen.
In den letzten Jahren hat sich das Interesse an der Anwendung der darwinistischen Biologie auf menschliches Verhalten neu belebt. Dieses Interesse hat ein erregendes Feld für Theorie und Forschung eröffnet, insbesondere deshalb, weil es ohne die Annahme arbeitet, daß die Menschen, weil sie Tiere sind, sich auch wie andere Tiere verhalten müßten. Die an diesem theoretischen Ansatz Interessierten suchen vielmehr nach Kontinuitäten und Diskontinuitäten in den Prozessen, die zur Entstehung des Menschen führten und seine Entwicklung weiterhin beeinflussen.
Bücher wie Adam kam aus Afrika, Adam und sein Revier, Das sogenannte Böse, Der nackte Affe (und einige andere) verdunkeln den auf diesem Gebiet tatsächlich erreichten wissenschaftlichen Fortschritt. In diesen Büchern wird der Darwinismus ebenso wie die conditio humana allzu stark vereinfacht. Ihre Konzentration auf hypothetische biologische Determinanten der sozialen Existenz des Menschen führt zu keiner plausiblen Theorie über die Anfänge des Menschen. Darüber hinaus haben sich diese Autoren als außerordentlich unfähig erwiesen, Einsichten in die Ursachen für Verhaltensunterschiede zwischen Gruppen anzubieten oder die Komplexität menschlicher Sozialstrukturen zu erklären.
Es kommt darauf an, diejenigen Aspekte der biologischen Theorie zu retten, die zum Verständnis des Menschen beitragen können. In einer Zeit, in der das komplexe menschliche Verhalten in seinen Tiefenschichten erforscht werden kann und muß, stellen die genannten Bücher eine intellektuelle Sackgasse dar. Die politische und ökologische Situation der Welt hat eine kritische Phase erreicht, die sich der Katastrophe nähert. Überholte Analysen, die Krieg mit angeborener Aggression gleichsetzen, können nur den an der Aufrechterhaltung des status quo Interessierten Trost bieten. Programmatische Erklärungen, die einen sofortigen Stopp des Bevölkerungswachstums oder eine abgestufte Verminderung der Bevölkerung verlangen, sind nur Versuche, die ernsten Probleme ungleicher Produktion, Distribution und Konsumtion wegzudeuten. Statische Darstellungen menschlichen Verhaltens, die auf falschen oder allzu schematischen Analogien zu niederen Tieren beruhen und historische Veränderung und Entwicklung leugnen, können nur die Funktion haben, uns den wahren Problemen der Menschheit gegenüber blind zu machen.
Evolution und Genetik
Darwins Evolutionstheorie ist eine elegante Theorie. Mit nur wenigen Grundannahmen erklärt sie die Entwicklung und Mannigfaltigkeit des Lebens und ist somit eines der bedeutsamsten einheitstiftenden Konzepte in der Biologie.
Darwin ging von der Annahme aus, daß alles Leben miteinander zusammenhängt und die Zahl der auf der Erde lebenden Arten sich im Verlauf der Zeit als Folge einer kontinuierlichen Verzweigung und Entwicklung von Urformen aus erhöht. Beweise für diese Annahme sind von den Paläontologen zusammengetragen worden, deren Erforschung fossiler Zeugnisse eine beträchtliche Menge an Information über die historische Entwicklung des Lebens auf der Erde erbracht hat.
Die Theorie erklärt weiter den Veränderungsprozeß der lebenden Formen. Darwin (und mit ihm Alfred Russel Wallace, der Mitentdecker der Theorie) nahm an, daß die Variation, die sich in der Natur innerhalb der und zwischen den Arten findet, zumindest in einem metaphorischen Sinne von Variationen in der natürlichen Umwelt ausgenutzt wird. Einfach gesagt: wo um solche Dinge wie Raum oder Nahrung gekämpft wird, werden die für das Überleben und die Fortpflanzung in einer bestimmten Umwelt am besten geeigneten Organismen in größerer Zahl überleben und sich in größerer Zahl fortpflanzen als weniger gut angepaßte Formen. Wenn dieser Prozeß eine gewisse Zeit lang andauert, werden weniger gut angepaßte Formen auf eine unbedeutende Zahl innerhalb der Population reduziert oder sterben ganz aus. Darwin bezeichnete diesen Prozeß als natürliche Auslese. Die moderne Evolutionstheorie legt das Hauptgewicht nicht mehr auf das Aussterben, sondern auf die relative Fortpflanzung, weil der Ausleseerfolg auf dem genetischen Beitrag eines Organismus zur nächsten Generation beruht.
Die Evolutionstheorie unterscheidet zwei Klassen von biologischen Phänomenen. Die eine Klasse sorgt für eine relative Stabilität der Pflanzen- und Tierarten im Wechsel der Generationen. Die andere bildet eine der Ursachen für Variationen. Zur ersten Klasse gehören die Mechanismen der Kontinuität, zur zweiten die Mechanismen der Variation. Obwohl beide Klassen für die Evolution notwendig sind, ist es eines der Paradoxe der Biologie, daß die eine – die Mechanismen der Kontinuität – die Vollkommenheit biologischer Systeme widerspiegelt, und die andere – die Mechanismen der Variation – aus nichts anderem besteht als aus Fehlern oder Irrtümern in einem Reproduktionsprozeß. Ohne diese Fehler gäbe es keine Evolution; Evolution ist deshalb in einem sehr realen Sinne ein zufälliger Prozeß. Das bedeutet, daß evolutionäre Veränderung nicht eine Reaktion auf Mangelsituationen ist. Die Natur hat die Arten nicht mit der angeborenen Fähigkeit ausgestattet, sich an Umweltvariationen anzupassen. Eine evolutionäre Veränderung kann nur dann eintreten, wenn eine in der Population bereits vorhandene Variation hinsichtlich der Anpassung an neue Bedingungen einen gewissen Wert hat. Ist ein adaptiver Trend jedoch erst einmal in Gang gekommen – d.h. hat bei einer Gruppe von Organismen eine Verschiebung in Richtung auf eine bestimmte Form adaptiver Veränderungen einmal eingesetzt –, dann wird diese Veränderung sich in derselben relativen Richtung fortsetzen, solange die entsprechende Variation vorhanden ist und solange die Umweltbedingungen relativ konstant bleiben. Wenn z.B. die Entwicklung eines gegenständigen Daumens (eines den Fingern gegenüberstehenden Daumens wie bei der menschlichen Hand) eine Gruppe von Baumbewohnern mit einem deutlichen Vorteil für das Festhalten – im Gegensatz zum Herabfallen – ausstattet, wird jede Variation in Richtung einer besseren Greifhand ein selektiver Vorteil sein. So kann eine Reihe ungerichteter oder zufälliger Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu einer vorhersagbaren oder gerichteten Reihe von Veränderungen führen. Wenn die Umwelt nur die den vorherrschenden Bedingungen am besten entsprechenden Formen auswählt, werden die Veränderungsmöglichkeiten alsbald eingeschränkt, und im weiteren Fortgang der Anpassung an eine besondere Umwelt verringern sich die Chancen, daß weit auseinandergehende Variationen überleben können. Eine große Überlebenschance haben nur diejenigen Variationen, die eine Verbesserung auf der Linie eines bereits vorhandenen Trends darstellen. Anpassung bedeutet, daß die Form einer Tier- oder Pflanzenart und die Umwelt, in der sie leben muß, einander entsprechen. Mit anderen Worten: eine Gruppe von Tieren tritt niemals voll angepaßt in eine neue Umwelt ein; denn zur Anpassung gehört das Wechselspiel zwischen der Umwelt und bestimmten biologischen Merkmalen des Organismus.
Die Mechanismen der Variation und Kontinuität können allein mit Hilfe der Genetik – einer zu Darwins Zeiten noch unbekannten Wissenschaft – voll verstanden werden. Die spezifische Leistung der Genetik für die Evolutionstheorie liegt in der genauen Erklärung der Ursprünge von Variation und Kontinuität, die bei allen lebenden Formen anzutreffen sind. Zusammen mit dem Studium der Umwelt und den fossilen Überresten hilft uns die Genetik nicht nur verstehen, was in der Evolution vorgegangen ist, sondern auch, wie und warum es geschehen ist. Sehen wir uns die Beziehungen zwischen Genetik und Evolutionstheorie näher an.
Zunächst wollen wir einige Beispiele von Kontinuität und Variation betrachten, wie sie in vertrauten Situationen auftreten.
Man muß kein Experte sein, um vorherzusagen, daß aus der Paarung zwischen reinrassigen Hunden Nachkommen hervorgehen werden, die ihren Eltern sehr ähnlich sind, ihnen aber nicht genau gleichen. Andererseits werden Kreuzungen zwischen zwei verschiedenen Hunderassen Nachwuchs von größerer Variation erzeugen, und zwei Bastarde unbekannter Abstammung werden eine ziemlich unvorhersagbare Reihe von Jungen hervorbringen. Alle Hunde bringen Hunde hervor und nicht Katzen, und dänische Doggen bringen Hunde hervor, die ebenfalls dänische Doggen sind. Rassen oder Unterarten können sich kreuzen und Bastarde hervorbringen; Arten hingegen können im allgemeinen nicht gekreuzt werden, um Zwischenarten zu erzeugen. In den wenigen Fällen, in denen diese Regel gebrochen wird (Tiger können mit Löwen und Pferde mit Eseln Nachwuchs zeugen), sind die Nachkommen unfruchtbar. Die Art ist also eine geschlossene Einheit. Mitglieder einer Art können sich erfolgreich kreuzen; wenn sie sich mit Mitgliedern einer anderen Art paaren, können sie keinen fruchtbaren Nachwuchs hervorbringen.
Die Ursache eines Großteils der beobachteten Kontinuität ist Erblichkeit; d.h. der Fortpflanzungsprozeß impliziert die Übertragung invarianten genetischen Materials von den Eltern auf die Jungen. Nun besitzt z.B. jede Hunderasse Tausende von Einheiten genetischen Materials, die Merkmale wie Größe, Gestalt, Farbe des Fells, Länge des Schwanzes usw. bestimmen. In manchen Fällen ist ein Merkmal durch eine einzige Einheit determiniert; in anderen Fällen müssen sich viele Einheiten verbinden, um ein bestimmtes Merkmal hervorzubringen. Innerhalb jeder Art gibt es einige genetische Einheiten, die allen Mitgliedern der Art gemeinsam sind, während andere für bestimmte Rassen spezifisch sind. Die Unterscheidungsmerkmale von Hunden resultieren aus der Verteilung der genetischen Einheiten innerhalb der Art. Das Unterscheidende an dänischen Doggen resultiert aus der Verteilung innerhalb dieser Rasse. Wieder andere genetische Einheiten sind in ihrer Verteilung noch weiter begrenzt und bedingen die individuellen Unterschiede innerhalb einer Rasse. Diese Einheiten oder Gene werden in der Regel unverändert von den Eltern an den Nachwuchs weitergegeben, wobei ein Nachkomme von jedem Elternteil jeweils eine Hälfte seiner Gene erhält. Wenn sich zwei reinrassige Hunde aus derselben Zucht paaren, ist ein Großteil des von jedem Elternteil an die Nachkommen weitergegebenen Materials ähnlich und die sich ergebende Variation gering. Wenn Bastarde sich paaren, ist die Situation etwas anders. Die Gene werden unverändert an die Nachkommen weitergegeben, aber diese Gene repräsentieren selbst eine größere Mannigfaltigkeit von Merkmalen, weil einige eine Rasse repräsentieren, einige eine andere, einige wieder eine andere. Die Verbindung dieser Einheiten in der Nachkommenschaft ist zufällig – und eine größere Variation ist die Folge. Es ist wichtig hervorzuheben, daß die genetischen Einheiten selbst sich auf dem Wege von einer Generation zur nächsten nicht verändern. Was sich ändert, ist allein die Kombination dieser Einheiten. Die Variation, die wir beobachten, beruht auf neuen Kombinationen der invarianten genetischen Einheiten.
Wenn wir die Variation genauer untersuchen, stoßen wir auf eine weitere Komplikation. Man kann bei den Exemplaren eines Wurfes beträchtliche Unterschiede erzeugen, indem man bestimmte nicht erbliche Bedingungen variiert, z.B. Menge und Art der Nahrung, die die verschiedenen Hunde erhalten, oder das Maß an Bewegung, das man ihnen gestattet. Eine Veränderung dieser Bedingungen bedeutet eine Veränderung der Umwelt. Wenn einige Tiere in der einen, einige in einer anderen Umwelt aufgezogen werden, ist jede sich aus einer derartigen Manipulation ergebende Variation ein Resultat von Umweltfaktoren. Es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, welche Unterschiede auf die Umwelt und welche auf Vererbung zurückgehen. Eine Möglichkeit, diese beiden Faktoren zu trennen, beruht auf der Beobachtung, daß umweltbedingte Unterschiede (im Leben des Tieres erworbene Variationen) nicht an die nächste Generation weitergegeben werden. Das heißt: erworbene Merkmale werden nicht vererbt. Zuchtexperimente können zeigen, welche Merkmale erblich sind.
Jede auf Umweltveränderung zurückgehende Variation liegt innerhalb festgelegter Grenzen, denn die Umwelt kann die Entwicklung eines einzelnen Tieres zwar erheblich beeinflussen, sie kann es aber niemals in etwas transformieren, das jenseits der Grenzen seiner ererbten Anlagen liegt.
Entwicklung ist also durch eine Verbindung von relativ konstanten Faktoren, die zur Anlage des Organismus gehören, und äußeren Bedingungen, die die Lebenserfahrung des Organismus bestimmen, charakterisiert. Jedes Lebewesen ist ein Produkt seiner besonderen Umweltgeschichte und ein Teil der genetischen Geschichte seiner Vorfahren.
Genotypus und Phänotypus
Nach dieser Formel könnte man vermuten, daß ein hohes Maß an phänotypischer Variation in einer Population das Resultat hoher genetischer Variation, hoher Umweltvariation oder einer Verbindung aus beiden ist.
Dies ist tatsächlich oft der Fall, aber wir müssen festhalten, daß es vom genetischen Hintergrund abhängt, welches Maß und welche Art von Umweltvariation der Phänotypus absorbieren kann. Manche Arten sind Umweltveränderungen gegenüber hoch empfindlich; andere können unter mannigfaltigen Bedingungen stabil bleiben. Stabilität kann auf zwei verschiedenen genetischen Prozessen beruhen. Einige Arten können selbst geringfügige Veränderungen der Umwelt nicht gut ertragen. Wird eine Population einer solchen Art veränderten Bedingungen ausgesetzt, so wird sie aussterben. Viele Mikroorganismen (Bakterien z.B.) sind gegenüber Bedingungen wie Säurespiegel oder Temperatur so empfindlich, daß sie nur minimale Veränderungen tolerieren können. Solche Arten werden sich nur dort finden, wo die Umweltvariation gering ist, und die phänotypische Variation wird ebenfalls immer gering sein. Der genotypische Hintergrund anderer Arten kann demgegenüber darauf eingestellt sein, eine Vielfalt von Umweltveränderungen zu absorbieren, ohne deshalb Veränderungen im Phänotypus zu entwickeln. Der Mensch gehört – relativ gesehen – zu dieser Art von Organismen.
Aus der Evolutionstheorie folgt, daß auf alle Populationen Umweltzwänge einwirken, die die am besten angepaßten Phänotypen auswählen. Wenn die genotypische Variation sich in einem einzigen Phänotypus konzentriert, kann die Variation im Anpassungsprozeß bewahrt werden. Wenn hingegen der Großteil der genetischen Variation sich in verschiedenen Phänotypen ausdrückt, wird die genotypische Variation verringert. Man muß ganz klar sehen: in beiden Fällen wirkt die Umwelt direkt auf den Phänotypus ein, auf das, was sichtbar ausgedrückt ist. Jede Wirkung auf den Genotypus ist indirekt. Dies ist in der Evolution von großer Bedeutung, da der Genotypus ein Reservoir ungenutzter Variation enthalten kann, das unter kritischen Bedingungen für das Überleben ausschlaggebend sein kann.
Worüber ich in diesen letzten Abschnitten gesprochen habe, ist die natürliche Auslese; die natürliche Auslese repräsentiert die Wirkung der Umwelt auf die Phänotypen einer spezifischen Gruppe von Organismen, d.h. auf eine Population. Im gegebenen Variationsbereich haben die der Umwelt phänotypisch am besten entsprechenden Organismen den anderen gegenüber einen selektiven Vorteil.
Obwohl alle Organismen qua Individuen Produkte der evolutionären Entwicklung sind, liefert die Evolutionstheorie Vorhersagen über Populationen und nicht über Individuen. Aussagen über die natürliche Auslese werden statistische Vorhersagen genannt, weil Wahrscheinlichkeitsfaktoren in sie eingehen und sie niemals absolut sind. Sie können einem Forscher niemals die Gewißheit geben, daß ein besonderes Individuum überleben wird. Vorhersagen in diesem Zusammenhang stellen eine Prozentzahl dar, die auf dem für ein spezifisches Merkmal oder für einen Phänotypus erwarteten Selektionswert beruhen. Es gibt natürlich Fälle, in denen ein Merkmal mit absoluter Sicherheit bei oder kurz nach der Geburt zum Tode führt. In diesen Spezialfällen kann man mit Gewißheit sagen, daß jeder mit einem solchen Merkmal geborene Organismus weder lebens- noch fortpflanzungsfähig ist. Man sagt, sein Fortpflanzungspotential sei gleich Null. Diese Tatsache setzt indes nicht die Regel außer Kraft, daß sich nicht vorhersagen läßt, welche Organismen sich fortpflanzen werden. Aus dem bisher Gesagten dürfte deutlich geworden sein, daß selektiver Vorteil immer ein relativer Wert ist. So etwas wie einen absoluten Selektionsvorteil gibt es nicht, weil der Maßstab der Selektion sich aus dem Vergleich des Fortpflanzungspotentials des einen Genotypus mit dem eines anderen ergibt.
Statistische Aussagen über den Überlebenswert beziehen sich immer auf eine spezifische Umwelt. Das Gesamtbild der von Paläontologen und Genetikern so gründlich analysierten evolutionären Entwicklung ist aus kleinen Stücken zusammengesetzt, deren jedes eine Population repräsentiert, die sich im Laufe der Zeit verändert und ein wenig zum Gesamtprozeß der Entwicklung beiträgt. Dieser Prozeß schreitet extrem langsam voran und ist deshalb schwer im Ablauf zu beobachten. Genetische Veränderungen sind sehr klein, und es bedarf gewöhnlich einer langen Zeit, ehe sich ihre additive Wirkung nachweisen läßt. Gleichwohl hat man einige kleine, aber bedeutsame adaptive Veränderungen dokumentieren können, insbesondere bei Arten, die sich sehr schnell fortpflanzen und sich deshalb durch mehrere Generationen hindurch von einem einzigen Forscher studieren lassen.
Artbildung
Alle bisher erwähnten Beispiele für Variation fallen in einen bestimmten Kontinuitätsbereich, nämlich den der Art. Ich habe auf Vererbung beruhende und umweltbedingte Variationen und den Prozeß der natürlichen Auslese, von dem diese Variationen ausgenutzt werden, diskutiert, und habe außerdem nachdrücklich betont, daß Hunde Hunde, Katzen Katzen und Hasen Hasen bleiben. Der genetischen Variation scheint eine durch die Geschlossenheit der Art bestimmte Grenze gesetzt zu sein. Aus Kreuzungen zwischen Arten geht in der Regel kein fruchtbarer Nachwuchs hervor; Gene können sich daher nicht durch Vermischung von einer Art in eine andere ausbreiten. Wie kann dann aber der Darwinismus – selbst mit Hilfe der Genetik – die Veränderungen erklären, die sich an der Scheidelinie zwischen zwei Arten vollzogen haben müssen? Wie läßt sich der Ursprung der Arten aus den bisher diskutierten Prinzipien erklären? Dies ist eine der wichtigsten Fragen der Evolutionstheorie und gleichzeitig die von den Kritikern Darwins – von denen die meisten den Vorgang der Anpassung nicht bestreiten – am häufigsten gestellte. Solange die Artbildung, die Umwandlung einer Art in eine andere, nicht erklärt und solange dieser Prozeß nicht experimentell bewiesen ist, weigern sie sich, irgendeine Verbindung zwischen dem, was sie über die Fortpflanzung von Lebewesen wissen, und der darwinistischen Theorie anzuerkennen. Unterschiede innerhalb einer Art (z.B. verschiedene Rassen) fassen sie als graduelle Unterschiede auf, Unterschiede zwischen Arten als qualitative Unterschiede. Ihrer Definition zufolge sind Arten im Hinblick auf ihre Fortpflanzungsmöglichkeiten isolierte Gruppen oder geschlossene Einheiten, während Rassen oder Unterarten einer Art offene Einheiten sind, die sich miteinander fortpflanzen können. Fortpflanzungsisolierung kann von genetischen oder von Verhaltensfaktoren abhängen; wir werden unser Interesse hauptsächlich auf die genetischen Faktoren richten.[1] Die Forderung, die Artbildung zu erklären und sie stützende Evidenzen beizubringen, ist gerechtfertigt. Denn die Evolutionstheorie wäre nutzlos, wenn sie nicht die Entstehung von Arten erklären könnte; dies ist ihre Hauptaufgabe. Glücklicherweise gibt es zwei Antworten auf diese Frage; auf zwei getrennten Wegen läßt sich verfolgen, daß Artbildung tatsächlich stattfindet. Einmal auf historischem Wege, indem man von fossilen Überresten ausgeht; zum andern auf dem genetischen, der durch das Studium zeitgenössischer Populationen zum Ziel führt.
Fossilien und Artbildung
Die Fossilüberlieferung erlaubt uns zunächst, die allmähliche Umwandlung einzelner Arten zu erforschen. Außerdem liefert sie Vergleichsmaterial, das die evolutionäre Verzweigung von Elternformen aus veranschaulicht. Sowohl allmähliche Umwandlung als auch Verzweigung lassen sich am besten als evolutionäre Anpassung an die Umwelt verstehen. Im ersten Falle (auch Anagenese genannt) entwickelt ein einziger Typus in Gebieten, in denen die Umwelt relativ konstant bleibt, im Laufe der Zeit eine immer größere genetische Spezialisation. Wir können hier von der allmählichen Entwicklung einer guten Anpassung sprechen. Im zweiten Falle (auch Kladogenese genannt) entwickeln sich verwandte isolierte Populationen in Reaktion auf unterschiedliche Auslesezwänge in verschiedenen Mikroumwelten auseinander. Wenn diese Gruppen sich auch fortpflanzungsmäßig isoliert haben – d.h. wenn sie sich nicht mehr kreuzen können –, sind die genetischen Unterschiede zwischen ihnen groß genug geworden, daß sie die allgemein akzeptierte Definition der Art erfüllen.
In der Ordnung der Primaten, die Menschen, Affen und Menschenaffen umfaßt, ist die Verzweigung von gemeinsamen Vorfahren aus (Kladogenese) ebenso dokumentiert wie die allmähliche Umbildung (Anagenese). Die gemeinsamen Vorfahren dieser Formen haben sich vor mehr als fünfundsiebzig Millionen Jahren an das Leben in Bäumen angepaßt, für das stereoskopisches Sehen und ein Paar guter Greifhände vorteilhaft sind. Dies sind zwei Hauptmerkmale aller Mitglieder der Primatenordnung, mit Ausnahme der ältesten und primitivsten. In ihrer Entwicklung breiteten sich die Primaten in verschiedenen Umweltzonen aus. Einige wurden wieder zu Erdbewohnern und modifizierten ihre früheren Anpassungen, darunter Pavian und Mensch, zwei Arten, die sich in verschiedenartiger Weise an das Leben auf der Erde angepaßt haben. Die Entwicklung des Menschen ist durch zunehmende Hirngröße, aufrechte Haltung und den Verlust der Hände an den unteren Extremitäten gekennzeichnet.
In den letzten zwanzig Jahren ist eine beeindruckend große Zahl von Fossilien gefunden worden, die die Einzelheiten in der Evolution des Menschen von älteren Primatenformen ausfüllen hilft. Darwin wäre über solches Beweismaterial hocherfreut gewesen. In seinem Buch Die Abstammung des Menschen hat er die menschliche Art in eine Reihe mit den übrigen Mitgliedern des Tierreichs gestellt und die These vertreten, daß auch die Evolution des Menschen den Regeln folgt, die er in seinem früheren Werk über Die Entstehung der Arten aufgestellt hatte.
Die Fossilüberlieferung ist nicht nur deshalb hilfreich, weil sie es ermöglicht, einen wesentlichen Teil eines Stammbaumes zu erforschen, sondern auch deshalb, weil sie sowohl eine gute Repräsentation der zeitlichen Folge von Formen darstellt als auch eine gewisse Vorstellung von ihrer räumlichen Ausbreitung verschafft. Die Geologen haben viel Mühe darauf verwandt, Maßstäbe für die geologische Zeitmessung zu konstruieren, und sind dabei recht erfolgreich gewesen. Diese geologischen Uhren helfen dem Paläontologen, seine Fossilfunde zu datieren und richtig einzuordnen.
Hinsichtlich aller verwandten Fossilreihen nimmt man an, daß genetische Unterschiede die Basis für Veränderungen gebildet haben. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, daß genetische Veränderungen zufällige Ereignisse und im allgemeinen von geringer quantitativer Bedeutung sind. Aus eben diesem Grund dauert es so außerordentlich lange, bis in der Evolution eine Veränderung sichtbar wird. Nun besteht die Erde seit mehr als vier Milliarden Jahren, und Leben gibt es seit mehr als der Hälfte dieser Zeit. Vergegenwärtigt man sich, daß der Mensch eine neue Art ist (etwas über zwei Millionen Jahre alt), sind zwei Milliarden Jahre zweifellos ein Zeitraum, der groß genug ist, um die bisherige Evolution stattfinden zu lassen.
Die Fossilüberlieferung enthält des weiteren eine Stütze für die Behauptung, daß auf genetischer Veränderung beruhende Evolution ein zufälliger und ungerichteter Prozeß ist. Diese Stütze besteht in der Tatsache, daß in der Zeit seit der Entstehung des Lebens eine gewaltige Zahl von Pflanzen und Tieren ausgestorben ist. Viele Arten haben im Irrgarten des Lebens den ›falschen Weg‹ eingeschlagen und sind an einen Punkt gekommen, von dem aus kein Weg weiterführte. Umweltveränderungen, die im unabhängigen Prozeß der genetischen Veränderung keine Entsprechung fanden, haben zum Aussterben vieler Arten geführt. Dem Argument, Evolution sei ein von höherer Weisheit geleiteter Prozeß, widersprechen die vielen ›Fehler‹ in der Entwicklungsgeschichte der Pflanzen und Tiere. Vollkommenheit kann nur entdecken, wer seinen Blick ausschließlich auf das richtet, was übrigbleibt, nachdem ein mitunter verheerender Prozeß der Ausmerzung eine beinahe unvorstellbare Zeitspanne lang angedauert hat. Von der gegebenen biologischen Welt läßt sich nur in dem Sinne sagen, sie sei die beste aller möglichen, daß das, was ist, möglich ist – als Resultat einer langen Wechselwirkung zwischen inneren genetischen Faktoren und äußeren Umweltbedingungen. Nur ein gutes Zusammenpassen dieser Faktoren kann das Überleben ermöglichen, und Überleben ist immer etwas Vorläufiges, das von wechselnden Bedingungen abhängt. Leichte Verschiebungen in der Umwelt wie etwa das Vordringen einer neuen oder fremden Art können das Gleichgewicht der Natur derart durcheinanderbringen, daß ein Teil der natürlichen Umwelt zerstört wird.
Genetik und Artbildung
Einige Gegner der Darwinschen Theorie bestreiten die Evidenz der Fossilüberlieferung. Neben mancher ärmlicher Kritik bringen sie die bedenkenswertere vor, daß es unmöglich sei, genetische Daten aus Knochen abzuleiten. Das ist richtig, wenngleich die Darwinsche Theorie nicht unmittelbar von der Genetik abhängt. Darwin hat seine Werke ja geschrieben, ehe es eine Wissenschaft der Genetik gab. Seine Theorie ermöglicht es – mit oder ohne genetische Evidenz –, die Funde der Paläontologen befriedigend zu erklären. Seine Evolutionstheorie erfüllt ihre wissenschaftliche Aufgabe: sie liefert logisch und empirisch zu rechtfertigende Erklärungen beobachtbarer Erscheinungen. Für die Artbildung gibt es darüber hinaus aber auch genetische Evidenz, die das Gewicht der Fossilüberlieferung stark erhöht. Diese genetische Evidenz läßt sich am besten anhand der Untersuchung eines abstrakten Falles zeigen.
Nehmen wir an, eine sich geschlechtlich fortpflanzende, relativ homogene Art lebe in einer kleinen, begrenzten Umweltzone. Nehmen wir weiter an, diese Art bilde eine einzige Fortpflanzungspopulation. Dies bedeutet: jedes Mitglied der Population hat eine gleich gute Chance, sich mit jedem anderen reifen gegengeschlechtlichen Mitglied dieser Art zu paaren. Eine solche Situation würde eine weite und ungerichtete Verteilung der Gene in der Population zur Folge haben. Die beliebige Paarung dieses Typus nennt man Panmixie. Wenn sie vorkommt, sagt man, die Population verfüge über einen gemeinsamen Genpool (Genbestand). Jede in einer derartigen Population vorhandene Variation wird sich innerhalb der Grenzen der Gesamtgruppe ziemlich gleichmäßig verteilen. Wenn es sich nun um eine besonders erfolgreiche Art handelt und sie sich geographisch ausbreitet, dann ist es wahrscheinlich, daß sich Subpopulationen als Einheiten der größeren Gruppe entwickeln. Dies ist im Kern ein mechanischer Vorgang: Tiere, die enger zusammen leben, paaren sich mit höherer Wahrscheinlichkeit als weit auseinander lebende Tiere. Entwickeln sich zwischen Einheiten irgendwelche Schranken, so führt dies zu einer zumindest teilweisen Isolation dieser Einheiten. Und wenn eine solche Situation eingetreten ist, werden sich neue genetische Variationen in der Art im ganzen ungleichmäßig verteilen. Das heißt, jede Untergruppe wird anfangen, ihren eigenen Genbestand zu entwickeln, der sich in einigen Hinsichten von allen anderen Genbeständen unterscheidet. Wenn der geographische Raum, in dem die Art sich ausgebreitet hat, ungleichmäßig ist – d.h. wenn es in der Umwelt Variationen gibt, für die die Art empfindlich ist –, werden unterschiedliche Selektionszwänge die Genbestände der Untergruppen weiter differenzieren. Solange noch Kreuzungen zwischen diesen Subpopulationen vorkommen, wird sich keine Differenzierung herausbilden, die die Grenzen der Art überschreitet. Jede einzelne Einheit wird eine besondere Rasse oder Linie der Art darstellen. Wenn jedoch einige Populationen aus irgendeinem Grunde völlig isoliert werden, so werden sie sich weiter verändern, bis die genetischen Unterschiede groß genug sind, um neue Arten hervorzubringen. Ich habe oben schon ausgeführt, daß die meisten Arten sich nicht erfolgreich kreuzen können, weil sie distinkte Einheiten sind, Einheiten, zwischen denen es eine beträchtliche genetische Differenz gibt. Solange der Genfluß andauert, bleibt genug genetische Ähnlichkeit erhalten, um den Prozeß der Artbildung kein endgültiges Stadium erreichen zu lassen. Unter natürlichen Bedingungen wirken zentrifugale Prozesse wie unterschiedliche genetische Variation, unterschiedliche Selektionszwänge und Semi-Isolation auf die Isolation von Subpopulationen hin; häufig werden sie aber auch durch den zentripetalen Prozeß des Genflusses zusammengehalten. Artbildung vollzieht sich, wenn die zentripetalen Kräfte ihre Wirkung verlieren.
Hinsichtlich der Artbildung enthält die Fossilüberlieferung Evidenz für Anpassung durch Entwicklung (Anagenese) ebenso wie für Anpassung durch Verzweigung (Kladogenese). Genetische Untersuchungen lebender Populationen liefern weitere, die Verzweigungshypothese der Artbildung stützende Evidenz. Die Argumente gegen Darwins Entstehung der Arten fallen unter die Kritik zweier unabhängiger Quellen wissenschaftlicher Evidenz. Beide Quellen weisen auf dieselben Phänomene hin, Anpassung und Differenzierung durch genetische Mechanismen, die in Verbindung mit Umweltzwängen wirksam sind. Artbildung ist ein Resultat der Evolution, die Variation ausnutzt, um Anpassung zu bewirken. Wenn solche Variation sich in verwandten, aber voneinander isolierten Populationen entwickelt, werden diese zu distinkten Einheiten. Solange es noch einen gewissen Genfluß zwischen diesen Einheiten gibt, wird eine spezifische Kontinuität aufrechterhalten, und solange die Umwelt stabil ist, wird diese Kontinuität durch die Tatsache verstärkt, daß sich unter spezifischen Bedingungen nur bestimmte genetische Kombinationen als anpassungsfähig erweisen. Wenn die Umwelt sich über bestimmte Grenzen hinaus verändert, wird sich die bis zu einem gewissen Grad in allen Populationen vorhandene phänotypische Variation entweder an die neuen Bedingungen anpassen oder aussterben. Aussterben ist eine unvermeidliche Folge, wenn in der inneren genetischen Variation nichts den neuen Umwelterfordernissen entspricht.





























