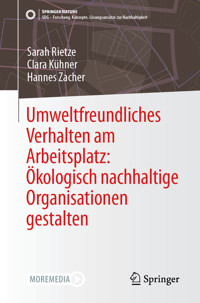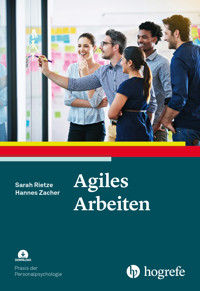
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Agiles Arbeiten ist in all seinen Facetten von entscheidender Bedeutung, um Unternehmen in einer sich ständig wandelnden (Arbeits-)Welt gegenwärtig und in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Hierbei ist es jedoch wichtig, genau zu verstehen, warum und unter welchen Umständen agiles Arbeiten funktioniert, welche Chancen und Risiken es mit sich bringt, und wie eine erfolgreiche Einführung agiler Arbeitsweisen gelingen kann. Dieser Band stellt auf Grundlage von psychologischen Modellen und empirischen Forschungsergebnissen die Wirkungsweisen und Konsequenzen agilen Arbeitens dar und übersetzt diese Erkenntnisse in praktische Handlungsempfehlungen und Leitfäden. Dabei werden u. a. die folgenden Fragen beantwortet: Wie sollte agile Teamarbeit gestaltet sein, welche Bedeutung kommt dabei der Selbstorganisation des agilen Teams zu, und wie kann ein agiler Sprint als Schutzraum für fokussierte Teamarbeit optimal gestaltet sein? Welche Rolle spielen Führungskräfte und HR Professionals in der agilen Transformation? Konkrete Leitfäden und Tools, die von der Moderation agiler Meetingformate, über die Neueinführung von Scrum im Team ("Sprint Zero") bis hin zu agilen Transformationsprozessen auf Unternehmensebene reichen, erleichtern die Umsetzung in der Praxis. Fallbeispiele, die unter dem Aspekt der Chancen und Risiken, die agiles Arbeiten mit sich bringt, diskutiert werden, runden den Band ab. Die im Anhang des Buches zur Verfügung gestellten praktischen Hilfen können nach erfolgter Registrierung zusätzlich von der Hogrefe Webseite heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sarah Rietze
Hannes Zacher
Agiles Arbeiten
Praxis der Personalpsychologie
Human Resource Management kompakt
Band 45
Agiles Arbeiten
M. Sc. Sarah Rietze, Prof. Dr. Hannes Zacher
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Jörg Felfe, Prof. Dr. Benedikt Hell, Dr. Rüdiger Hossiep, Prof. Dr. Martin Kleinmann, Prof. Dr. Bettina Kubicek
Die Reihe wurde begründet von:
Prof. Dr. Heinz Schuler, Dr. Rüdiger Hossiep, Prof. Dr. Martin Kleinmann, Prof. Dr. Werner Sarges
M. Sc. Sarah Rietze, geb. 1988. Studium der Psychologie in Leipzig, Konstanz und Bordeaux. 2015–2017 Beraterin im Management Consulting in Zürich. 2017–2019 Projektmanagerin im Bereich Personalentwicklung in Freienbach. 2019–2020 Agile Coach in Leipzig. Seit 2020 Selbstständige Beraterin und Trainerin im Bereich Führungskräfte- und Teamentwicklung sowie Agile Coaching und Promovierende an der Universität Leipzig. Forschungsschwerpunkt: Psychisches Wohlbefinden in agilen Entwicklungsteams.
Prof. Dr. Hannes Zacher, geb. 1979. Studium der Psychologie in Braunschweig und Minneapolis. 2006–2009 Promotionsstipendiat an der Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen. 2009 Promotion. 2009–2010 Postdoktorand an der Jacobs University Bremen. 2010–2013 Lecturer an der University of Queensland. 2014–2015 Associate Professor an der Rijksuniversiteit Groningen. 2016 Professor an der Queensland University of Technology. Seit 2016 Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig. Arbeitsschwerpunkte: Alter im Arbeitskontext und Laufbahnentwicklung, berufliche Gesundheit, proaktives und adaptives Arbeitsverhalten, nachhaltige Organisationen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / Yuri_Arcurs
Satz: Franziska Stolz, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3240-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3240-4)
ISBN 978-3-8017-3240-0
https://doi.org/10.1026/03240-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Anhang
VInhaltsverzeichnis
Agiles Arbeiten
1
Was ist agiles Arbeiten?
1.1
Einordnung
1.2
Definition
1.2.1
Agilität am Arbeitsplatz
1.2.2
Agiles Projektmanagement
1.2.3
Weitere agile Methoden und Ansätze
1.3
Abgrenzung und Einordnung in den Kontext von New Work
1.4
Abgrenzung und Einordnung in bestehende Konzepte von Gruppenarbeit
1.5
Bedeutung agilen Arbeitens für das Personalmanagement
1.6
Betrieblicher Nutzen
2
Modelle und Theorien: Auswirkungen und Einflussfaktoren agilen Arbeitens
2.1
Theorien im Kontext agilen Arbeitens
2.1.1
Erwartungstheorie
2.1.2
Job-Characteristics-Modell
2.1.3
Selbstbestimmungstheorie
2.2
Auswirkungen agilen Arbeitens
2.2.1
Kognitive Auswirkungen
2.2.2
Verhaltensbezogene Auswirkungen
2.2.3
Emotionale Auswirkungen
2.3
Einflussfaktoren auf die Auswirkungen agilen Arbeitens
2.3.1
Individuelle Merkmale
2.3.2
Teambezogene Merkmale
2.3.3
Führungs- und kontextbezogene Merkmale
2.4
Zusammenhang von agilem Arbeiten und beruflichem Wohlbefinden
2.4.1
Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen im agilen Arbeiten
2.4.2
Chancen und Risiken agilen Arbeitens für berufliches Wohlbefinden
3
Analyse und Handlungsempfehlungen für agiles Arbeiten
3.1
Wann macht agiles Arbeiten Sinn?
3.2
Das Agile Team-Radar: Analyse und Handlungsempfehlungen
3.2.1
Geteilte Führung
3.2.2
Teamorientierung
3.2.3
Redundanz
3.2.4
Lernen
3.2.5
Autonomie
3.3
Führungsansätze für agiles Arbeiten
3.3.1
Befähigende Führung
3.3.2
Dienende Führung
3.3.3
Beidhändige Führung
3.3.4
Transformationale Führung
4
Vorgehen: Die agile Transformation
4.1
Umsetzung agilen Arbeitens auf der Ebene Projektteam
4.1.1
Ablauf eines typischen Sprints
4.1.2
Einführung von Scrum im Team: Sprint Zero
4.2
Transformation auf Organisationsebene
4.2.1
Agile Skalierungsansätze
4.2.2
Prozess der agilen Transformation
4.2.3
Rolle des Personalmanagements in der agilen Transformation
4.2.4
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der agilen Transformation
5
Fallbeispiele aus der Unternehmens- und Beratungspraxis
5.1
Agile Veränderung top-down vs. bottom-up – zwei Erfahrungsberichte
5.2
Psychisches Wohlbefinden in agilen Scrum-Teams – im Interview mit einem Scrum Master
5.3
Team-Empowerment mittels Scrum-Methodik im Personalbereich
5.4
Teamentwicklung als Instrument zur agilen Kulturtransformation im Unternehmen
5.5
Per Anhalter durch die Agilität – eine agile Lernreise jenseits statischer Trainings
5.6
Komm, wir gründen ein Labor! Förderung einer Experimentierkultur als Beitrag zur Unternehmenstransformation
5.7
Der Weg einer Bank zu einem agilen Zusammenarbeitsmodell – im Interview mit einer Transformationsbegleiterin
6
Literaturempfehlungen
7
Literatur
8
Anhang
Hinweise zu den Online-Materialien
„Agile Health Check“ zur Standortbestimmung der mentalen Gesundheit im agilen Team
Retrospektive zur mentalen Gesundheit im Team
9
Sachregister
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die vier Elemente der VUCA-Welt
Abbildung 2: Vergleich eines traditionellen, linearen Projektvorgehens mit einem agilen, iterativen Projektvorgehen
Abbildung 3: Organisationsstruktur klassischer Projektteams vs. agiler Scrum-Teams
Abbildung 4: Darstellung des Sprint Backlog in Form eines Scrum-Boards
Abbildung 5: Die fünf Prinzipien der New Work Charta (Väth et al., 2019)
Abbildung 6: Zustimmungswerte, inwiefern bestimmte Praktiken New Work repräsentieren (Schermuly & Meifert, 2022)
Abbildung 7: Prozentuale Verbreitung unterschiedlicher Zielsetzungen agiler Methoden (Schermuly & Meifert, 2022)
Abbildung 8: Prozentuale Verteilung der Bereiche, auf welche sich die Einführung agilen Arbeitens positiv im Unternehmen ausgewirkt hat (digital.ai, 2021)
Abbildung 9: Beispielhafte Darstellung von Velocity-Chart und Burndown-Chart
Abbildung 10: Kognitive, verhaltensbezogene und emotionale Auswirkungen agilen Projektmanagements (Koch et al., 2023)
Abbildung 11: Zusammenhänge zwischen agilen Arbeitspraktiken, Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen sowie emotionaler Ermüdung und Engagement (Rietze & Zacher, 2023)
Abbildung 12: Das Cynefin-Modell als Entscheidungshilfe für die Sinnhaftigkeit agilen Arbeitens (Snowden & Boone, 2007)
Abbildung 13: Die Schritte des Integrativen Entscheidens nach Robertson (2015)
Abbildung 14: Prozessschritte beim Rollenwechsel vom Scrum Master zu den Teammitgliedern (Spiegler et al., 2021)
Abbildung 15: Illustration zur Veranschaulichung der Verlagerung der Ergebnisverantwortung von der Führungskraft hin zum Team (in Anlehnung an Manz, 1992)
Abbildung 16: Beispiele für organisatorische Merkmale, die mit dem Übergang von selbstverwaltenden Teams zu selbstführenden Teams in Einklang stehen (Manz, 1992)
Abbildung 17: Darstellung des Ablaufs eines Sprints
Abbildung 18: Zeitliche Kapazität des Teams im Sprint (Rubin, 2012)
Abbildung 19: Die fünf Schritte eines Retrospektive-Meetings
Abbildung 20: Die vorgeschlagene Struktur zur Umsetzung von Scrum of Scrums
Abbildung 21: Strukturelle Veränderungen in der agilen Transformation: von der hierarchischen Organisationsstruktur über die Einführung einzelner agiler Pilotteams hin zu einer agilen Organisationsstruktur
Abbildung 22: Darstellung der vier Phasen der agilen Transformation
Abbildung 23: Aufbau des OKR-Frameworks
Abbildung 24: Vier Meta-Prinzipien des agilen Lernens (Augner et al., 2024)
Abbildung 25: Auszug aus dem Kanban-Board in der Funktion „Personalentwicklung“
Abbildung 26: Beispiel-Agenda für Woche 9 des agilen Lernformates
Abbildung 27: Standardisiertes Experimente-Template
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Definition und Messung der zehn Dimensionen von Agilität am Arbeitsplatz (Petermann & Zacher, 2022)
Tabelle 2: Gegenüberstellung von traditionellem und agilem Projektmanagement (Bishop & Deokar, 2014; Breidenbach & Rollow, 2019; Koch & Schermuly, 2021b)
Tabelle 3: Aufteilung der Ergebnisverantwortung nach den Rollen im Scrum-Team
Tabelle 4: Scrum-Events (Meeting-Formate) im Überblick
Tabelle 5: Agile Work Practices Instrument (AWPI) (Junker, Bakker, Derks & Molenaar, 2022)
Tabelle 6: Beschreibung verschiedener, häufig eingesetzter agiler Methoden
Tabelle 7: Konzepte der Gruppenarbeit als Form der Arbeitsorganisation (Antoni, 2004; Kauffeld, 2019)
Tabelle 8: Auswahl an Techniken zur Visualisierung des Arbeitsfortschrittes in der agilen Projektarbeit
Tabelle 9: Die Merkmale der fünf kreativitätsfördernden Räume agiler Projektteams (Olszewski, 2023)
Tabelle 10: Überblick über mögliche Einflussvariablen (Moderatoren) auf die Beziehung zwischen agilem Arbeiten und den Ergebnissen
Tabelle 11: Gegenüberstellung von Chancen und Risiken agilen Arbeitens (Rietze & Zacher, 2023)
Tabelle 12: Die fünf agilen Faktoren des Agilen Team-Radars: Definition, Messung und Handlungsempfehlungen je Faktor (aus Christoph J. Stettina & Werner Heijstek, Five Agile Factors: Helping Self-management to Self-reflect, 2011, S. 87, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autoren und von Springer Nature, Übers. d. Verf.)
Tabelle 13: Überblick über Führungsansätze im Kontext agilen Arbeitens
Tabelle 14: Die sechs Eigenschaften von dienenden Führungskräften (van Dierendonck, 2011)
Tabelle 15: Scrum Master als dienende Führungskraft gegenüber dem Product Owner, dem Entwicklungsteam und der Organisation (Srivastava & Jain, 2017)
Tabelle 16: Verhaltenseigenschaften für öffnende und schließende Führung (Rosing et al., 2011)
Tabelle 17: Ablauf eines Review-Meetings in vier Phasen (Rubin, 2012)
Tabelle 18: Leitfaden für die Durchführung von effektiven Retrospektive-Meetings anhand von fünf Schritten (in Anlehnung an Rubin, 2012)
Tabelle 19: Aktivitäten im Sprint Zero inklusive eines konkreten Beispiels
Tabelle 20: Vergleich der am häufigsten genutzten agilen Skalierungs-Frameworks (Kalenda et al., 2018)
Tabelle 21: Phasen und Aktivitäten in der agilen Transformation (Brosseau et al., 2019; Bullock & Button, 1985; Denning, 2019)
Tabelle 22: Herausforderungen agiler Transformationen (Dikert et al., 2016; Kalenda et al., 2018)
Tabelle 23: Erfolgsfaktoren für gelingende agile Transformationsprozesse (diGAP, 2021; Dikert et al., 2016; Kalenda et al., 2018; Misra et al., 2009)
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
160
161
162
163
164
165
11 Was ist agiles Arbeiten?
1.1 Einordnung
Agile Arbeitsweisen sind ein Weg im Umgang mit der Komplexität moderner Arbeitswelten. Die Auseinandersetzung mit agilem Arbeiten hat daher im letzten Jahrzehnt einen großen Teil der Unternehmen weltweit erreicht. In Deutschland setzt über die Hälfte aller Unternehmen agile Methoden ein, in Ländern wie China, USA und Indien sogar über 80 % (Kinkel et al., 2020). Die Einführung agilen Arbeitens, auch als agile Transformation bezeichnet, kann sich auf einzelne Projektteams, einzelne Bereiche innerhalb des Unternehmens, aber auch auf das gesamte Unternehmen beziehen. Agil zu arbeiten, ist eine Reaktion auf die moderne VUCA-Welt, die geprägt ist von Unsicherheit, Unbeständigkeit, Komplexität und Mehrdeutigkeit (siehe Abbildung 1). Agiles Arbeiten zeigt einen Weg auf, der effektives Agieren in der VUCA-Welt ermöglicht. Es steht für einen neuen Ansatz, an unternehmerische Problemstellungen heranzugehen, und schlägt vor, eine traditionell lineare Projektplanung und Umsetzung durch ein schrittweises, inkrementelles Vorgehen zu ersetzen.
Abbildung 1: Die vier Elemente der VUCA-Welt
Die meisten Unternehmen stellen sich heute nicht die Frage, ob es Sinn macht, agiles Arbeiten einzuführen. Stattdessen fragen sie, für welche Aufgaben und Projekte agiles Arbeiten eingesetzt werden sollte und v. a. wie es umgesetzt werden kann, um eine größtmögliche Wirkung für die Zusammenarbeit und das Gesamtergebnis zu erzielen. Agiles Arbeiten verändert eine Organisation auf allen Ebenen – stärker dezentralisierte Strukturen und Prozesse, flachere Hierarchien, Delegation von Verantwortung auf Teamebene, kooperative und enge Zusammenarbeit mit Kunden1 sowie Veränderungen der Unternehmenskultur. Der Wandel zu agi2lem Arbeiten wird nicht selten durch den technischen Fachbereich, insbesondere durch die Softwareentwicklung, angestoßen. Noch viel wichtiger sind für diesen komplexen Veränderungsprozess jedoch andere Akteure im Unternehmen: die Geschäftsführung für die Sinnstiftung, die Führungskräfte als Vorbilder und vor allem auch der Personalbereich für die Begleitung organisationaler und kultureller Veränderungsprozesse. Insbesondere Human Resources (HR)-Fachkräfte haben hier die zentrale Aufgabe, mitzugestalten und Veränderungen zu ermöglichen. Häufig sind sie allerdings nicht Teil von agilen Transformationsprozessen oder stehen nur als Unterstützer am Rande des Geschehens, was aus unserer Sicht ein Fehler ist.
Ziele der agilen Organisationsentwicklung
Agile Organisationsentwicklung verfolgt zwei zentrale Ziele, die miteinander in Wechselwirkung stehen:
Wirtschaftlichkeit: Wie kann ein Unternehmen bessere und schnellere Ergebnisse in der herausfordernden VUCA-Welt liefern? Wie können Kundenbedürfnisse erfüllt werden, die sich ebenfalls schnell ändern?
Menschengerechte Arbeitsgestaltung: Wie können Arbeitsbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten für einzelne Mitarbeitende verbessert werden? Wie entsteht eine optimale Zusammenarbeit im Team?
Mit Blick auf die Aufgaben der Personalpsychologie soll in diesem Buch insbesondere auf die zweite Fragestellung eingegangen werden: Wie verändert agiles Arbeiten die Arbeitsgestaltung und Zusammenarbeit? Wie verändert agiles Arbeiten das Verständnis von Führung? Welche Konsequenzen für Leistung, Motivation und Wohlbefinden am Arbeitsplatz hat agiles Arbeiten? Wie gelingt die Einführung agilen Arbeitens und welche Herausforderungen müssen dabei überwunden werden?
1.2 Definition
1.2.1 Agilität am Arbeitsplatz
Agilität am Arbeitsplatz kann als die Fähigkeit von Beschäftigten, angemessen auf Veränderungen reagieren zu können und Veränderungen als Chancen zu nutzen, definiert werden (Petermann & Zacher, 2020). Petermann und Zacher (2021) entwickelten eine Verhaltenstaxonomie, in der sie zehn spezifische Verhaltensweisen der Agilität von Beschäftigten („Workforce Agility“) identifizierten. Diese können als voneinander abgrenzbare Dimensionen von Agilität betrachtet werden, welche bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen. Aufbauend auf diesem Modell entwickelten Petermann und Zacher (2022) ein Messinstrument, welches arbeitsbezo3gene Ergebnisse valide vorhersagt. So konnte gezeigt werden, dass Agilität der Beschäftigten positiv mit innovativer Leistung, sozialem Verhalten in der Organisation („Organizational Citizenship Behavior“), Aufgabenleistung, Arbeitszufriedenheit und negativ mit psychischer Beanspruchung bei der Arbeit zusammenhängt. Die zehn Dimensionen von Agilität am Arbeitsplatz sind in Tabelle 1 definiert und die jeweils drei Items zur Messung einer jeden Dimension aufgeführt.
Tabelle 1: Definition und Messung der zehn Dimensionen von Agilität am Arbeitsplatz (Petermann & Zacher, 2022)
Dimension
Definition
Messung
Annehmen von Veränderung
Beinhaltet die Überprüfung früherer Entscheidungen aufgrund neuer Informationen und die Akzeptanz unterschiedlicher Rollen und Situationen
Umfasst die Fähigkeit, sich flexibel, schnell und erfolgreich an veränderte Umstände anzupassen
Bei der Arbeit kann ich mich schnell auf verschiedene Situationen einstellen.
Ich bin in der Lage, verschiedene Rollen in meiner Arbeit anzunehmen.
Wenn nötig, fällt es mir leicht, auf Veränderungen zu reagieren.
Treffen von Entscheidungen
Bezieht sich auf die Fähigkeit, Risiken zu tolerieren, Prioritäten zu setzen, schnell und proaktiv zu reagieren und zu entscheiden
Umfasst die Fähigkeit, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen
Ich zögere wichtige Entscheidungen oft länger hinaus. (invertiert)
Ich treffe jetzt schon Entscheidungen, die zu Lösungen der Probleme der Zukunft führen.
Ich übernehme gern Verantwortung für Themen bei der Arbeit.
Gestaltung von Transparenz
Beinhaltet einen schnellen Austausch von Informationen, das Eingestehen von Fehlern, das Bitten um Hilfe oder Informationen sowie die direkte Kommunikation
Ich teile aktiv alle Informationen, die ich habe.
Wenn ich eine Frage habe, gehe ich oft direkt zu der betreffenden Person.
Ich frage Kollegen außerhalb meines direkten Umfelds nach neuen Informationen.
Kollaboration
Umfasst, dass Teammitglieder vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten und sich wertschätzend und empathisch gegenüber anderen verhalten
Bezieht sich auf eine Zusammenarbeit, die funktionsübergreifend, offen und dynamisch ist
Ich zeige meine Wertschätzung für andere regelmäßig.
Ich kann gut auf Gefühle und Emotionen von anderen eingehen.
Ich arbeite gern mit anderen zusammen.
4Reflexion
Betrifft das Infragestellen aktueller Verhaltensweisen, das Reflektieren der Zusammenarbeit und die ständige Suche nach Verbesserungen in der Arbeit
Bei der Arbeit denke ich darüber nach, wie man Dinge anders machen könnte.
Ich hinterfrage, wie wir unsere Zusammenarbeit verbessern könnten.
Ich suche nach neuen Möglichkeiten und Werkzeugen, meine Abläufe und Prozesse zu verbessern.
Kunde im Mittelpunkt
Betrifft die ständige Einbindung des Kunden in das Projekt und das Einholen und Einbeziehen von Feedback des Kunden
Der Wert für den Kunden wird in den Mittelpunkt gestellt und in den Entwicklungsprozess integriert
Feedback vom Kunden ist eines der wichtigsten Dinge, um unser Produkt zu verbessern.
Der Kunde ist ein wichtiger Teil unseres Projektes.
Die Kundensicht wird aktiv in unsere Entscheidungsprozesse einbezogen.
Iteration
Umfasst, ein Projekt schrittweise zu entwickeln, kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen und in kurzen Anpassungszyklen zu handeln
Wir hinterfragen unser Produkt immer wieder, um es zu verbessern.
Wir versuchen, das Produkt schrittweise zu entwickeln, um immer wieder abschätzen zu können, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind.
In unserem Entwicklungsprozess wechseln sich kurzzyklisch Entwicklung und Evaluation ab.
Testen
Betrifft das regelmäßige Testen eines Produkts, die Erstellung eines Prototyps sowie das Experimentieren und Ausprobieren neuer Dinge
Wir testen jedes Produkt, bevor wir es öffentlich machen.
Ohne ein Produkt zu testen, lassen wir es nicht auf den Markt.
Produkttests sind ein fester Bestandteil unseres Entwicklungsprozesses.
Selbstorganisation
Betrifft das Engagement der Teammitglieder und die Bereitschaft, sich selbst zu verwalten, zu strukturieren und zu organisieren
Ich überwache die Ergebnisse meiner Arbeit.
Ich suche nach besseren Möglichkeiten, meine Arbeit zu machen.
Ich führe neue Methoden ein, um meine Arbeit zu machen.
5Lernen
Beinhaltet die Notwendigkeit ständiger Weiterbildung sowie ein gutes Wissensmanagement und die Möglichkeit, von anderen zu lernen
Ich lege großen Wert darauf, immer neue Dinge zu lernen.
Ich erweitere ständig meine Fähigkeiten.
Mir ist es wichtig, mein Wissen zu erweitern.
Anmerkungen: 5-Punkte-Skala von „1 = nie/sehr selten“ bis „5 = sehr oft/immer“. Das Messinstrument ist öffentlich zugänglich („Open Access“) und kann unter Angabe der Originalquelle frei genutzt werden. Der Abdruck der Items erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Autoren. Die Dimensionen und Items sind in englischer Sprache verfügbar unter https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.841862/full
1.2.2 Agiles Projektmanagement
Agiles Projektmanagement umfasst verschiedene Praktiken und Methoden, die auf einem gemeinsamen globalen Wertesystem basieren – dem agilen Manifest (Beck et al., 2001). Dieses wurde 2001 bei einer Zusammenkunft von 17 Softwarenentwicklern in Utah, USA, aufgestellt, um eine Alternative zu traditionellen Formen der Zusammenarbeit vorzuschlagen.
Werte und Prinzipien des agilen Manifests
Die zentralen Werte und Prinzipien, die im agilen Manifest definiert wurden, sind:
Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
Agile Ansätze wurden entwickelt, um die Probleme des schnellen Wandels der Arbeitswelt direkt anzugehen und Teams zu befähigen, durch schlanke Informations- und Entscheidungsprozesse effektiv auf Veränderungen zu reagieren. Agiles Projektmanagement ist mittlerweile insbesondere in der Softwareentwicklung und IT gängige Praxis. Doch auch in anderen Bereichen, wie z. B. im Personal oder Marketing, finden agile Ansätze immer mehr Verbreitung (Conforto et al., 2014). Dabei wird agiles Arbeiten in der Praxis nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Ansatz umgesetzt, sondern häufig in hybriden Lösungen eingeführt. Das bedeutet, dass einzelne agile Praktiken, die für den jeweiligen Kontext sinnvoll erscheinen, umgesetzt und mit bestehenden Prozessen kombiniert werden (Gemino et al., 2021).
6Agile Projektarbeit kann als eine Weiterentwicklung und Spezifizierung von Konzepten der Gruppenarbeit, die bereits eine lange Tradition haben (z. B. Lean Management oder teilautonome Teams), angesehen werden (siehe Abschnitt 1.4). In der agilen Arbeit liegt ein starker Fokus auf dem Team und den Individuen, die im Team arbeiten. Anstatt eines hierarchischen „Command-and-Control“-Führungsstils wird auf kollaborative und selbstorganisierte Teamführung gesetzt (Cockburn & Highsmith, 2001). Teammitglieder arbeiten autonom zusammen, um ihre Arbeit zu planen und zu koordinieren, gemeinsame Ziele zu erreichen und ihre eigenen Rahmenbedingungen festzulegen. Die Teammitglieder teilen sich die Führungs- und Entscheidungsverantwortung. Damit wird die Entscheidungsbefugnis direkt auf die Ebene der operativen Prozesse gebracht, was zu einer erhöhten Geschwindigkeit und Genauigkeit der Problemlösung führt. Die Rolle des Managements in der agilen Organisation besteht darin, ein Umfeld der Unterstützung, des Lernens und des Vertrauens zu schaffen, welches die Teammitglieder benötigen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Weitere Kernelemente der agilen Arbeit sind das iterative Planen und inkrementelle Vorgehen. Das Team arbeitet in kurzen wiederkehrenden Iterationen (auch Sprints genannt; siehe Abschnitt 4.1.1). Zu Beginn jeder Iteration einigen sich die Teammitglieder mit den Stakeholdern, d. h. den Projektbeteiligten außerhalb des Teams wie z. B. Geschäftsbereich-Verantwortlichen oder Projektmanagern des Kunden darauf, was in der kommenden Iteration geliefert werden soll. Zudem erfolgt die Bereitstellung von Projektergebnissen inkrementell. Das bedeutet, dass am Ende jeder Iteration ein fertiges Teilergebnis dem Kunden vorgestellt und, wenn gewünscht, ausgeliefert werden kann. Der Entwicklungsprozess richtet sich nach den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden, welche direkt und regelmäßig über Feedbackprozesse eingebunden werden (Rietze & Zacher, 2023).
Mit den beschriebenen Vorgehensweisen sollen Herausforderungen und Risiken, die häufig im traditionellen Projektgeschäft entstehen, minimiert werden. Eines der größten Risiken ist, dass in traditionellen „Wasserfall-Vorgehensweisen“ der flexible Umgang mit sich ändernden Marktbedingungen und Kundenanforderungen kaum steuerbar ist. Der „Wasserfall“ steht hier als Metapher für ein Vorgehen, welches einen linearen Prozess befolgt, der aus Anforderungsdefinition, Planung, Umsetzung und Testen besteht. Dieser Ansatz ignoriert, dass sich Anforderungen und Kontexte ändern können, was zu langen Projektzeiten, überholten Projektergebnissen und unzufriedenen Kunden führen kann. In Tabelle 2 werden die beiden Projektmanagement-Ansätze anhand verschiedener Dimensionen verglichen und voneinander abgegrenzt, Abbildung 2 veranschaulicht den Projektablauf beider Ansätze.
7Tabelle 2: Gegenüberstellung von traditionellem und agilem Projektmanagement (Bishop & Deokar, 2014; Breidenbach & Rollow, 2019; Koch & Schermuly, 2021b)
Dimension
Traditionelles Projektmanagement
Agiles Projektmanagement
Organisationsstruktur und Zusammenarbeit
Zusammenarbeit in homogenen Teams mit klar definierten Rollen
Teammitglieder werden hierarchisch geführt
Zusammenarbeit in heterogenen, crossfunktionalen Teams
Team organisiert sich selbst
Projektverantwortung und Rollen
Top-down, d. h. die Projektleitung leitet die Projektarbeit an
Wichtige Entscheidungen werden durch die Projektleitung getroffen und Aufgaben durch diese verteilt
Geteilte Führung nach Rollen und Verantwortungsbereichen im Team (keine Projektleitungs- oder Teamleitungsrolle)
Wichtige Entscheidungen und Aufgabenverteilung erfolgen durch das Projektteam selbst
Prozessabläufe und Planung
Wasserfallprinzip, d. h. Projektphasen sind langfristig angelegt und es wird strikt ein linearer Projektplan befolgt
Lange Planungsphase zu Projektbeginn: alle Anforderungen und Annahmen werden detalliert beschrieben
Testen erfolgt erst nach der Fertigstellung
Iteratives Vorgehen: Projekt wird in kurze Projektphasen (Sprints) unterteilt
Projektarbeit wird im Regelfall durch das Reagieren auf Veränderung bestimmt
Zu Projektbeginn wird die Planungsphase so kurz wie möglich gehalten: Annahmen werden kontinuierlich getestet und die Projektplanung erfolgt schrittweise und passt sich an sich ändernde Anforderungen an
Zusammenarbeit mit dem Kunden
Kunde ist reiner Auftraggeber: enge Zusammenarbeit zu Projektbeginn, um die Anforderungen zu definieren
Kunde erhält die Projektergebnisse am Ende des Projektes und wird nicht in Zwischenschritte eingebunden
Projektteam hat keinen direkten Kontakt zum Kunden
Kunde erhält Projektergebnisse kontinuierlich über den gesamten Projektzeitraum
Regelmäßiges Kundenfeedback wird immer wieder für die nächsten Projektschritte genutzt
Enge Zusammenarbeit zwischen Projektteam und Kunden
Transparenz und Sichtbarkeit von Fortschritt
Verwendung von Gantt-Diagrammen und Projektstatus-Updates, um Fortschritt aufzuzeigen
Fortschritt wird durch die monatliche Bereitstellung von Teilergebnissen sichtbar (inkrementeller Ansatz)
Einsatz von Visualisierungstechniken, z. B. Scrum-Board oder Burndown-Chart (siehe Abbildung 9 auf Seite 30)
8
Abbildung 2: Vergleich eines traditionellen, linearen Projektvorgehens mit einem agilen, iterativen Projektvorgehen
9Insbesondere die Softwareindustrie verwendet eine Vielzahl von verschiedenen agilen Arbeitspraktiken und Entwicklungsmethoden (siehe Abschnitt 1.2.3). Der Scrum-Ansatz hat sich für das agile Projektmanagement sowohl in der Softwareentwicklung als auch in vielen anderen projektbezogenen Unternehmensbereichen durchgesetzt und wird weltweit am häufigsten verwendet (Schwaber & Sutherland, 2020; digital.ai, 2022). Auch in der Forschung zu agilem Arbeiten wird vor allem Scrum und damit zusammenhängende Praktiken als konzeptueller Rahmen für agiles Projektmanagement untersucht. Daher liegt auch hier im Buch der Fokus auf den agilen Praktiken in Anlehnung an Scrum, weshalb im Folgenden die verschiedenen Elemente von Scrum zum grundlegenden Verständnis für die weiteren Kapitel vorgestellt werden sollen.
Grundlagen von Scrum
Scrum wurde in den 1990er Jahren entwickelt und ist im sogenannten Scrum Guide definiert. Dieses Rahmenwerk ist weltweit verbreitet und offiziell in über 30 Sprachen übersetzt (www.scrumguides.org). Der Leitfaden definiert Scrum und beschreibt die Elemente und Regeln sehr kurz und präzise. Die Autoren definieren Scrum als „ein leichtgewichtiges Rahmenwerk, welches Menschen, Teams und Organisationen hilft, Wert durch adaptive Lösungen für komplexe Probleme zu generieren“ (Schwaber & Sutherland, 2020, S. 3). Die erfolgreiche Anwendung von Scrum baut dabei auf den fünf Werten Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut auf. Zudem werden im Scrum-Leitfaden die wichtigsten Elemente und deren Zusammenspiel definiert, die auch hier kurz skizziert werden sollen:
Scrum-Team und -Rollen,
Scrum-Events (Meeting-Formate),
Scrum-Artefakte.
Scrum-Team und -Rollen. Das Scrum-Team ist ein kleines Team von etwa 5 bis 9 Leuten und besteht aus den Rollen Scrum Master, Product Owner und Entwicklungsteam. Die Teams sind interdisziplinär zusammengesetzt und es gibt keine Hierarchien innerhalb eines Teams. Hierbei ist zu beachten, dass die Rollenbezeichnung „Entwickler“ nicht nur auf Software-Entwickler und -Entwicklerinnen beschränkt ist, sondern die Rolle aller Teammitglieder aus unterschiedlichen Funktionen beschreibt, die Teil der Umsetzung im Projekt sind. Nach der Theorie sollten alle Teammitglieder zu 100 % Teil des Projektteams sein, damit sie sich auf ein gemeinsames Produktziel fokussieren können. Das Team organisiert sich selbst und entscheidet, wer was wann und wie macht. Es organisiert sich in sogenannten Sprints – kurze, fest definierte Zeiträume von ein bis vier Wochen, in denen ein bestimmtes Arbeitskontigent geplant und erledigt wird (siehe Abschnitt 4.1.1). Das Team ist umsetzungsverantwortlich für alle projektspezifischen Tätigkeiten und ist so aufgebaut und befähigt, dass es die Arbeit selbst steuern kann. Das gesamte Scrum-Team ist auch ergebnisverantwortlich, wobei die 10Verantwortung konkret auf die drei Rollen aufgeteilt wird, d. h. dass ein Ansatz der geteilten Führung verfolgt wird. Tabelle 3 stellt die Aufteilung der Verantwortung auf die Rollen im Detail dar.
Tabelle 3: Aufteilung der Ergebnisverantwortung nach den Rollen im Scrum-Team
Entwicklungsteam
Product Owner
Scrum Master
Schaffung eines Teilergebnisses (Inkrement) in jeder Arbeitsiteration
Festlegung des Sprintziels sowie Planung des Sprints
Umsetzung der Anforderungen im Sprint
Einhaltung von Qualität
Nutzung der Expertise des gesamten Teams
Entwicklung und Kommunikation von Produktziel und -strategie
Maximierung des Produktwertes durch ein effektives Management der Produktanforderungen (Erstellung, Priorisierung und Kommunikation) über das sogenannte Product Backlog
Einführung von Scrum und Sicherstellung, dass sowohl das Scrum-Team als auch die Organisation die Scrum-Theorie und -Praxis verstanden haben
Maximierung des Teamwertes, d. h. Sicherstellung der Effektivität des Scrum-Teams (u. a. Beseitigung von Hindernissen, Moderation der Zusammenarbeit)
Im Vergleich zu dem hier beschriebenen Vorgehen liegt im klassischen Projektmanagement die Ergebnisverantwortung häufig bei einer Person: der Projektleitung (zentralisierte Führung). Zudem hat eine klassische Projektleitung die Verantwortung, Arbeit an das Team zu delegieren und dem Team zu sagen, wie es am besten die Arbeit umsetzen kann. Im selbstorganisierten Team kümmert sich das Team selbst darum, Aufgaben an Einzelne zu delegieren und zu entscheiden, wie die Arbeit umgesetzt werden kann. Diese strukturelle Unterscheidung zwischen zentralisierter und geteilter Führung im Projektteam ist in Abbildung 3 skizziert.
In Anlehnung an Scrum wird auch in diesem Buch von Product Owner und Scrum Master als Rollen gesprochen. Die Empfehlung ist, diese jeweils einem Teammitglied eindeutig zuzuordnen. Die Rollen Scrum Master und Product Owner sind mittlerweile auch als Stellenbeschreibungen auf dem Arbeitsmarkt fest etabliert und es gibt verschiedene Zertifizierungsangebote, die als Voraussetzung zur Erfüllung der Rollen angesehen werden (z. B. Professional Scrum Master über www.scrum.org).
Scrum-Events (Meeting-Formate). Scrum-Events sind spezifische Ereignisse oder Meetings in Scrum, um die Zusammenarbeit, Kommunikation und Transparenz im Team in Form einer definierten Regelmäßigkeit zu fördern. Es gibt vier wichtige Meetings, die zu definierten Zeitpunkten innerhalb eines Sprints stattfinden. Ein Sprint startet mit dem Planning-Meeting (auch Sprint Planning), in welchem der Aufwand einzelner Aufgaben geschätzt und die Arbeit für den kommenden Sprint geplant wird. Während eines Sprints trifft sich das Scrum-Team täglich zu 11einem kurzen Daily Stand-up-Meeting, um den Fortschritt zu besprechen, für Transparenz zu sorgen und sich zu koordinieren. Der Sprint endet mit einem Review-Meeting und einem Retrospektive-Meeting. Im Review-Meeting demonstriert das Team die Ergebnisse des Sprints vor den Stakeholdern und erhält Feedback von außen. Die Teilnehmenden diskutieren gemeinsam, was als nächstes zu tun ist. Im Retrospektive-Meeting reflektiert das Scrum-Team seine Prozesse und Zusammenarbeit im letzten Sprint und identifiziert daraus Verbesserungsmaßnahmen. Alle Meetings folgen einer empfohlenen „Timebox“, d. h. einem festgelegten Zeitrahmen für das Meeting, welcher nicht überschritten werden sollte. Dieses Vorgehen soll Effizienz und Fokus im Meeting sicherstellen. Um die Ziele und den Ablauf der einzelnen Meetings genauer zu verstehen, sind diese in Tabelle 4 anhand verschiedener Dimensionen beschrieben. Konkrete Ablaufpläne für die Umsetzung und Moderation der Meetings finden sich in Abschnitt 4.1.1.
Abbildung 3: Organisationsstruktur klassischer Projektteams vs. agiler Scrum-Teams
Scrum-Artefakte. Artefakte sind Mittel und Werkzeuge, die eingesetzt werden, um agiles Arbeiten zu organisieren und transparent zu machen. Sie beinhalten die Planungs- und Arbeitsergebnisse. Die drei Hauptartefakte sind das Product Backlog, Sprint Backlog und Produktinkrement.
Das Product Backlog ist eine Liste, die alle erforderlichen Arbeiten an einem Produkt beinhaltet. Diese ist dynamisch und wird stetig weiterentwickelt. Auch die Einträge werden weiterentwickelt, präzisiert, ggf. in einzelne Einträge zerteilt und in der Größe geschätzt. In ihr sind u. a. Anforderungen, Funktionalitäten, Verbesserungen oder Fehlerbehebungen aufgeführt. Der Product Owner ist dafür verantwortlich, diese Liste zu erstellen, zu pflegen und zu priorisieren. Die Liste ist die Quelle, in der alle Arbeiten, die das Scrum-Team erledigen soll, aufgeführt sind. Sie dient als Input für das Planning-Meeting.
12Tabelle 4: Scrum-Events (Meeting-Formate) im Überblick
Planning-Meeting
Daily Stand-up-Meeting
Review-Meeting
Retrospektive-Meeting
Zeitpunkt
Beginn eines Sprints
Täglich während des Sprints
Ende eines Sprints
Ende eines Sprints, nach dem Review-Meeting
Ziel und Inhalte
Definition des Sprintziels
Planung, was im Sprint erledigt werden kann
Planung, wie die ausgewählte Arbeit erledigt wird
Überprüfung des Fortschritts und der Erreichung des Sprintziels
Austausch zu Aufgaben und Hindernissen
Schnelle Entscheidungsfindung
Demonstration und Prüfung der Sprintergebnisse
Festlegung zukünftiger Anpassungen und nächster Schritte
Reflexion und Feedback zur Zusammenarbeit im Team
Maßnahmen zur Steigerung von Qualität und Effektivität
Teilnehmende
Team, Scrum Master, Product Owner
Team, Scrum Master (Product Owner optional)
Team, Scrum Master, Product Owner, Stakeholder
Team, Scrum Master (Product Owner optional)
Input
Definierte und priorisierte Anforderungen (Product Backlog-Einträge)
Team-Kapazitäten
Aktueller Arbeitsstand und ggf. Hindernisse zur Zielerreichung
Erledigte Product Backlog-Einträge
Fertige Teilergebnisse
Feedback der einzelnen Teammitglieder
Output
Sprintziel
Umsetzungsplan für den Sprint (als Sprint Backlog)
Team-Commitment
Plan für die nächsten 24 Stunden
Anpassungen im Product Backlog (neue Einträge, Priorisierung)
Maßnahmen zur Verbesserung
Timebox