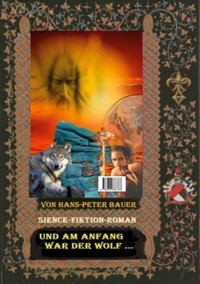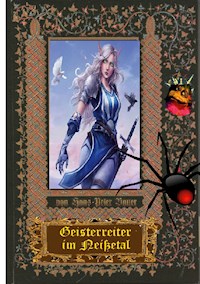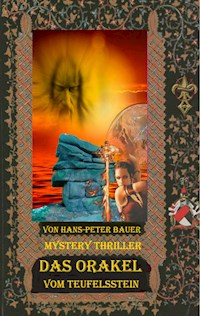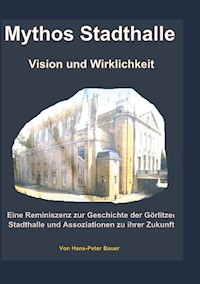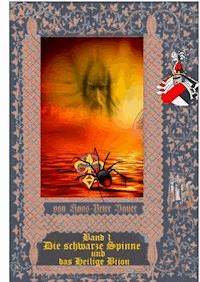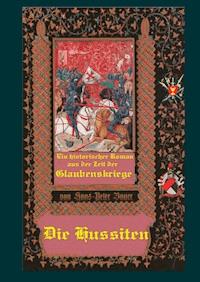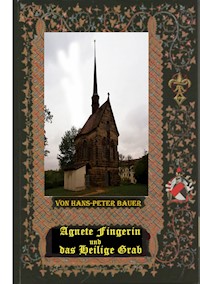
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historischer Roman um das Heilige Grab zu Görlitz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet
950 Jahre Görlitz
517 Jahre Heiliges Grab
Inhaltsverzeichnis
Prolog «Das Jahr 1771,
Kapitel 1 «Die Karawanserei El Mahmud»
Kapitel 2 «Der Kampf mit der Gum»
Kapitel 3 «An Bord der Karavelle Genoveva»
Kapitel 4 «In Candia»
Kapitel 5 «Der schwarze Kosar»
Kapitel 6 «Omar Ibn Halef Ilderim»
Kapitel 7 «In der Lagune von Venedig»
Kapitel 8 «Marie-Luisa»
Kapitel 9 «Auf dem Weg nach Hause»
Kapitel 10 «Bonifacius und die Inquisition»
Kapitel 11 «Endlich zu Hause»
Kapitel 12 «Die Reliquie des Täufers»
«Epilog»
Prolog
Das Jahr 1771
In der Brüdergasse 9 saßen zwei Männer, Carl Gotthelf Freiherr von Hundt, der die Freimaurerloge nach Görlitz geholt hat und Johann Ernst von Gersdorff, seines Zeichens der amtierende Meister vom Stuhle der Freimaurerloge «Zur gekrönten Schlange».
Johann Ernst von Gersdorff ist gerade aus Bautzen zurückgekommen und legte eine antik aussehende Lederrolle auf das kleine Tischchen vor ihm. Das Leder der Rolle ist sehr alt und war an einigen Stellen schon brüchig.
Carl Gotthelf von Hundt sah ihn fragend an.
»Meine große Verwandtschaft hat seinerzeit 1681 in Bautzen auf dem Burglehn eine Stiftungsbibliothek eingerichtet, in der sich auch unser Familienarchiv befindet. Ich war gerade dort und habe mich noch einmal umgesehen. Die Stiftung soll demnächst nach Göttingen ausgelagert werden.
Die Familie sammelt seit jahrhunderten ununterbrochen Kupferstiche, Handschriften, Globen und Bücher – also alles, was von historischem Wert ist. Aus diesem Grunde habe ich eigentlich das Familienarchiv besucht und bin zufällig auf diese Dinge gestoßen!« Gersdorff zeigte auf die Lederrolle. »Ich weiß aus der Ahnengalerie, dass der hier in den Dokumenten benannte Gabriel von Gersdorff aus Schlesien stammt und lange Zeit in Tetschen gelebt hat. Wie sein Reisebericht und dieses «Pergament» in unser Archiv gekommen sind und warum er es überhaupt geschrieben hat – keine Ahnung!
Diese Lederrolle, in der diese Schriftstücke aufbewahrt wurden, ist aus Schafsleder und eindeutig arabischen Ursprungs. So etwas wurde bei uns auch in früheren Zeiten nicht genutzt!«
Carl Gotthelf nahm die Lederrolle zur Hand und betrachtete sie aufmerksam. Am Verschlussband waren Reste von Siegellack zu erkennen, brüchig und von ganz anderer Art, wie er jetzt gebraucht wird. »Du hast recht, Johann!« Er nahm das brüchige Pergament in die Hand, das Gersdorff der Rolle entnommen hatte.
»Die Schrift ist auch mit einer Tinte geschrieben, die heute nicht mehr üblich ist – sie verblasst unter dem Einfluss von Licht!«, sagte er.
Carl Gotthelf las das Fragment und zuckte mit den Schultern. »Der Text passt überall hin – man müsste nur die fehlenden Teile haben, um sich einen Vers darauf zu machen!
Das lateinische «Sigillum Militum Chris …» deutet auf den Templerorden hin. Siegel der Streiter Christi lautet die korrekte Übersetzung«
Gersdorff entschloss sich, die Karten auf den Tisch zu legen.
»Carl, der Kustos unserer Stiftungsbibliothek hat mich informiert, dass sich in letzter Zeit Personen nach Unterlagen im Gersdorffschen Nachlass aus dem Jahre 1476 erkundigt und in Handschriften aus dieser Zeit gelesen haben. Sie wiesen ein bischöfliches Empfehlungsschreiben vor, im dem sie zur Nutzung der Gersdorffschen Stiftung berechtigt wären. Das allein ist schon ein Unding und entbehrt jeglicher Grundlage! Wenn jemand in Unterlagen unseres Nachlasses Einblick haben möchte, dann bitte nur mit Gersdorffscher Genehmigung. Was sie gesucht haben, konnte er mir nicht sagen. Aber er hatte bemerkt, dass diese Personen eindeutig Fremde waren und sich, wenn er sich näherte, in einer fremden Sprache unterhielten. Er ist der Meinung es klang wie italienisch oder lateinisch! Könnte es sein, sie haben das hier gesucht?«
Er deutete auf die Lederrolle auf dem Tisch.
»Welcher Bischof hat denn das Empfehlungsschreiben verfasst?«, fragte Carl.
»Der Kustus sagte, es wäre vom Meißener Bischof unterzeichnet!«, antwortete Gersdorff.
Nachdenkliche Stille.
Carl Gotthelf fragte nach einigen Minuten.
»Hast du schon darin gelesen?«, fragte Carl.
»Nein, ich habe nur die ersten Seiten überflogen!«, antwortete Johann. »Immerhin wäre hier ein logischer Zusammenhang zu ihrer Suche zu erkennen. Der Bericht über die Pilgerreise beinhaltet auch ein Zusammentreffen der Pilger mit einem Inquisitor aus dem Vatikan, der sich nach dem Stammbaum, derer von Gersdorff erkundigte. Gabriel von Gersdorff konnte die Frage damals nicht beantworten - aber ich kann es.
Er suchte damals schon nach Verwandten des Bodo von Gersdorff, Großmarschall des Ordens der Templer und ein Geheimnisträger der höchsten Stufe. Das Fragment hier stammt unzweifelhaft aus seiner Feder! Ich bin froh, dass ich die Rolle vor ihnen bemerkt und mitgenommen habe«.
Carl Gotthelf von Hundt nahm das Fragment zur Hand und betrachtete es erneut und diesmal aus einem anderen Blickwinkel. »Wo war das aufbewahrt?«, fragte er mit Blick auf die Rolle.
Gersdorff trank einen Schluck Wasser und antwortete.
»Eigentlich für jedermann zugänglich in einem Bücherregal für Handschriften im Obergeschoß, verborgen unter alten Schriftrollen, allerdings ist es nicht in der Registratur der Stiftung verzeichnet. Ich wundere mich nur, dass niemand dieser Rolle Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ich habe es aus purem Zufall gefunden und geöffnet, als ich in den verstaubten Handschriften in der letzten Etage des Regals gesucht habe. Die Rolle muss schon eine Ewigkeit dort oben gelegen haben, so eingestaubt war sie. Da sie nicht im Register nachgewiesen ist, habe ich sie mitgenommen, anscheinend rechtzeitig! Der Kustus hat das brüchige Pergament auf Leinwand geklebt, sodass es nicht mehr brechen kann. Die beschriftete Rückseite kann man lesen.
Carl legte das Pergament vorsichtig auf das Tischchen.
»Bei aller Freundschaft Carl, womit haben sich die flüchtigen Templer beschäftigt, als ihr Orden verboten wurde – immerhin habe ich gelesen, von der Anklage bis zur Auflösung des Ordens dauerte es fast fünf Jahre. Das Eigentum der Templer verblieb ja sehr zum Ärger des Königs Philipp in den Händen der Kirche oder die Johanniter haben es sich unter den Nagel gerissen. Das, was danach übrig blieb, hat der neu gegründete Orden der Ritter Christi bekommen!«
Von Gersdorff räusperte sich und stellte eine weitere Frage in den Raum.
»Was aber ist mit den Heiligtümern und Schätzen der Templer passiert? Wo sind diese geblieben? Zum Beispiel hatten die Templer zumindest Kenntnis über den Verbleib der Bundeslade und des Heiligen Grals, für deren Schutz sie schon vor der Kreuzigung Jesu verantwortlich zeichneten. Ebenso fehlen alle Hinweise auf den Verbleib des Kelches von Johannes dem Täufer, mit dem er am Jordan die Sakramente der christlichen Taufe vollzog. Darüber gibt es keine offiziellen Erkenntnisse – nur Spekulationen! Wenn man der Überlieferung Glauben schenken kann, dann haben die Templer einige dieser wertvollen christlichen Reliquien vor dem Zugriff der Kurie und deren Inquisition in Sicherheit gebracht und versteckt!
Warum auch immer und wo, das werden wir nie erfahren. Es sollte mich aber nicht wundern, wenn die Apostolische Kammer der Kurie im Vatikan immer noch auf der Suche ist!«
Carl Gotthelf von Hundt nahm das Fragment noch einmal zur Hand und betrachtete es etwas genauer.
»Hast du die erste Zeile genauer betrachtet, Johann?
Hier schau hin! … heilige thaufreli des Johann ege …
Das ist doch ein Hinweis – Taufreli... kann man das nicht auch mit Taufbecher übersetzen, oder? Und das hier, das ist viel viel später auf die Rückseite hinzugefügt worden. Eine völlig andere Schreibweise.
«Ich habe den heiligen Eid, den ich gegenüber Diethardt von Borsow und Omar Ibn Halef Ilderim abgelegt habe, erfüllt. GvG».
Die Initialien deuten doch auf Gabriel von Gersdorff hin. Also hat er die Rolle in Bautzen deponiert, oder?«
Johann von Gersdorff runzelte die Stirn.
»Du kannst doch wohl ermessen, was das jetzt bedeutet, Carl. Wir stehen im Verdacht der Inquisition aufgrund der verwandtschaftlichen Verquickung derer von Gersdorffs, etwas von dem zu wissen, was die Kurie seit Hunderten von Jahren sucht! Jetzt verstehe ich auch unseren Kustos«. Von Gersdorff rollte das Pergament vorsichtig zusammen und verstaute es wieder in der Lederrolle, dann stand er auf.
»Auf uns, oder besser gesagt auf der Freimaurerei, liegt seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren der doppelte Bannfluch des Pontifex. Sie werden alles daransetzen, uns zu schaden, Carl. Einen Teil Schuld haben wir, wir die Gersdorffs, die mit der alten Verbindung zum Templerorden belastet sind. Jetzt haben sie erneut Grund zu forschen, weil sie Gersdorff und Freimaurer in Verbindung bringen können«.
Von Hundt räusperte sich und fragte Gersdorff.
»Wie hieß der Inquisitor, sagtest du?«
Gersdorff schaute irritiert auf seinen Logenbruder nieder.
»Wie kommst du jetzt darauf, den Namen habe ich überhaupt nicht genannt. Warte, da muss ich nachlesen …« Er setzte sich und entnahm der Rolle den Reisebericht Gabriels. Dabei rutschte das Jerusalemkreuz heraus und fiel auf den Boden. Gersdorff rollte die Blätter auf.
Auf dem dritten und vierten Blatt wurde er fündig.
»Bonifazius, mit weltlichen Namen Heinrich Kramer steht hier!« Von Hundt grunzte. »Setz dich Johann! Bonifazius war 1476 in Görlitz zu einem Blitzbesuch und ist dann weitergezogen in die damalige Neumark. Ich habe es in den Tagebuchotizen von Frauenburg gelesen, als ich im Stadtarchiv war. Heinrich Kramer ist niemand anders als der spätere Verfasser des Hexenhammers. Kennst du das üble Machwerk? Ein ganz schlechter Mensch. Ich habe so ein Exemplar des Hexenhammers ln unserer Bibliothek deponiert, kannst es gerne mal lesen!«
Carl Gotthelf von Hundt ging zu einem der vielen Bücherregale suchte eine Weile und holte ein abgegriffenes Buch hervor auf dessen Deckel die lateinischen Worte in abgegriffenen goldenen Buchstaben zu lesen waren, «Malleus Maleficarum» zu Deutsch, der Hexenhammer.
Er legte den Folianten vor Gersdorff auf den Tisch.
»Frauenburg verwies in seinen Notizen darauf, dass Georg Emmerich bereits bei seiner Pilgerreise in Venedig mit Bonifacius aneinandergeraten ist. Eigentlich ist das gar nicht seine Domäne. Aber er musste nach 1465 seine Integrität unter Beweis stellen, weil er öffentlich den Kaiser Friedrich III. angegriffen hatte und dafür ins Gefängnis sollte. Das haben das Generalkapitel des Dominikanerordens und die Kurie verhindert. Im Gegenteil, sie haben ihm die Befugnis zur Inquisition erteilt.
Möglich, dass er in diesem Rahmen seiner Integritätsfindung besondere Aufgaben hier in der Region zu erfüllen hatte.
Er hatte ja auch das Recht, sich seinen eignen Konvent und seinen eignen Beichtvater zu suchen, dazu konnte er noch alle Vorrechte eines Magisters der Theologie in Anspruch nehmen. Damit weißt du, welche Macht die Inquisition zur damaligen Zeit verkörperte. Das erklärte doch auch, warum er unter dem Namen Bonifazius reiste, sein lateinischer Name lautete nämlich «Henricus Institoris». Das bedeutet nichts anderes, er war in einer geheimen Mission unterwegs!«
»Und was bedeutet das für uns?«, fragte Gersdorff.
„Ich weiß es nicht, noch nicht! Aber zum Zeitpunkt seines Kurzbesuches in Görlitz waren Gabriel von Gersdorff und die Fingerin gerade von ihrer Pilgerreise zurück. Na, dämmert es bei dir? Und jetzt dein Hinweis, dass immer noch in eurer Bibliothek nach etwas gesucht wird, was man mit der Vergangenheit in Verbindung bringen könnte!
Also was suchen sie? Hast du dir diese Frage einmal gestellt?«
Gersdorff sah staunend auf seinen Logenbruder und bemerkte, dass sich dieser sehr umfangreich informiert hatte. »Woher weißt du das alles, Carl. Wieso hast du dich damit so intensiv beschäftigt?«, fragte Gersdorff und sah seinen Logenbruder erwartungsvoll an.
Von Hundt stand auf und lief im Zimmer auf und ab. Die Frage Johanns blieb unbeantwortet. Abrupt blieb Carl vor von Gersdorff stehen und stellte sehr sachlich fest.
»Die moderne Inquisition der Glaubenskongregation im Vatikan sucht noch immer, wenn auch erfolglos, nach verschwundenen Reliquien aus der Zeit der Tempelritter und die sind ihnen für immer verborgen!
Das ist, meiner Meinung nach, die einzig richtige Schlussfolgerung, die man aus der Mitteilung eures Kustos und aus dem vorliegenden Pergament ziehen kann! Sie werden auch zu uns kommen, zumal sie wissen, dass du ein rechtmäßiger Nachkomme in fast gerader Linie des Gabriels von Gersdorff bist! Aber sie werden nichts mehr finden!«
Gersdorff stand auf und lief unruhig hin und her. »Carl, das ist fast dreihundert Jahre her. Glaubst du wirklich …?«
Er wurde von Hundt unterbrochen.
»Auch wenn das schon Jahrhunderte zurückliegt – die Inquisition vergisst nichts, Bruder, lass dir das gesagt sein.
Was sind schon dreihundert Jahre für die Inquisition – nichts, einfach nur nichts. Die Archive des Vatikans verfügen über so viel gutes und genaues Material, das sie die Recherchen der Suche nach Reliquien, auf einen Punkt zusammenballen können … aber dann mit aller Kraft und ohne Rücksicht auf die Menschen, die davon betroffen werden! Sie verfügen seit über zweihundert Jahren über ein effizientes Machtmittel, mein lieber Johann - die Kompanie Jesu. Wo immer die Interessen der römischen Kirche es erfordern, tauchen sie auf, die unverdrossenen, fanatischen Jesuitenpadres der Kompanie Jesu. Jetzt sind es nicht mehr die Dominikaner, sondern jetzt sind es die Jesuiten, die, obwohl seit drei Jahren vom Papst Clemens XIV. verboten, immer noch die schwarzen Fäden ziehen. Sie kommen inkognito, soviel steht fest. Sie müssen es, denn offiziell gibt es sie nicht mehr. Diese Padres waren bestimmt die Besucher in eurer Stiftung.
Hast du noch nie von ihnen gehört? Das wundert mich sehr!«
Gersdorff schüttelte entsetzt den Kopf.
Ihm war nicht wohl, als er das hörte.
»Wieso sind die Jesuiten verboten, Carl. Sie sind dann doch …«
Carl Gotthelf von Hundt unterbrach seinen Gegenüber mit einer Handbewegung und fügte hinzu.
»Die Gründe des Verbotes werden vom Vatikan streng geheim gehalten, warum auch immer, ich weiß es nicht! Ich kann mir nur denken, wenn sie etwas ausbaldowern und dabei erwischt werden, weist der Heilige Stuhl alle Schuld von sich, denn sie sind nicht gerade fein in der Wahl ihrer Mittel, Johann. Sie schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor einem Mord!«
Carl Gotthelf von Hundt hatte das herausgefallene Kreuz aufgenommen und betrachtete es von allen Seiten und warf einen Blick auf die Rückseite.
»Und was bedeutet das, Johann?«, fragte mit Blick auf das
Schmuckstück und legte es auf den Tisch zurück. Gersdorff nahm das Kreuz an sich und steckte es in seine Rocktasche.
»Das Jerusalemkreuz ist der Beweis, dass Gabriel von Gersdorff ein «Ritter des Heiligen Grabes» war. Wie du vielleicht bemerkt hast, sind auf der Rückseite seine Initialen eingraviert Aufgrund dieser Tatsache, dass er zum «Ritter des Heiligen Grabes» geschlagen wurde, konnte er mithilfe des Guardians der Grabeskirche an die Bauabrisse des Heiligen Grabes gelangen, die die Fingerin mitgebracht hat!«.
»Carl«, sagte er, »ich habe die Befürchtung, dass das unserer Loge Schaden zufügen könnte. Wenn sich Rom für unser Archiv interessiert, haben die Jesuiten einen handfesten Grund, etwas zu suchen, wovon wir noch keine Ahnung haben!«
Carl Gotthelf von Hundt sah ihn zweifelnd an.
»Meinst du wirklich, dass sie Hinweise haben?«
In der Stiftungsbibliothek befindet sich doch auch unser Familienarchiv. Das ist jetzt wohl in Gefahr, oder? Da sind Interna darunter, die niemandem etwas angehen, schon garnicht der Kurie!« Johann trank einen großen Schluck Wasser.
»Und nun sammelt die Familie ununterbrochen Kupferstiche, Handschriften, Geräte, Globen und Bücher – also alles, was von historischem Wert ist. Aus diesem Grunde habe ich eigentlich unser Familienarchiv besucht und bin zufällig auf diese Dinge gestoßen! Ich weiß nur, dass der hier genannte Gabriel von Gersdorff aus Schlesien stammt und in Tetschen gelebt hat. Wie sein Reisebericht und das «Pergament» in unser Archiv gekommen sind und warum er es überhaupt geschrieben hat – keine Ahnung! Diese Lederrolle, in der diese Schriftstücke aufbewahrt wurden, ist aber eindeutig arabischen Ursprungs. So etwas wurde bei uns auch in früheren Zeiten nicht benutzt!“
Carl von Anton nahm die Lederrolle zur Hand und betrachtete sie aufmerksam. Sie war brüchig und von ganz anderer Art, wie die, die jetzt im Gebrauch sind.
»Du hast recht, Johann!« Er nahm erneut das brüchige Pergament zu Hand.
Carl Gotthelf von Hundt las das Fragment und zuckte mit den Schultern. »Der Text passt überall hin – man müsste nur die fehlenden Teile haben, resümierte er.
»Carl, der Kustos unserer Stiftungsbibliothek hat mich informiert, dass sich in letzter Zeit Personen nach Unterlagen im Gersdorffschen Nachlass aus dem Jahre 1476 erkundigt und in Handschriften aus dieser Zeit gelesen haben. Was sie gesucht haben, konnte er mir nicht sagen. Aber er hatte bemerkt, dass diese Personen eindeutig Fremde waren und sich, wenn er sich näherte, in einer fremden Sprache unterhielten. Er ist der Meinung es klang wie italienisch oder lateinisch! Könnte es sein, sie haben das hier gesucht?«
Er deutete auf die Lederrolle auf dem Tisch.
»Immerhin wäre hier ein logischer Zusammenhang zu ihrer Suche zu erkennen. Der Bericht über die Pilgerreise beinhaltet auch ein Zusammentreffen der Pilger in Bamberg mit einem Inquisitor aus dem Vatikan, der sich nach dem Stammbaum, derer von Gersdorff erkundigte. Gabriel von Gersdorff konnte die Frage damals nicht beantworten - aber ich kann es.
Der Inquisitor suchte damals nach Verwandten des Bodo von Gersdorff, Großmarschall des Ordens der Templer und ein Geheimnisträger der höchsten Stufe und dieses Fragment hier stammt unzweifelhaft von ihm!«
Carl Gotthelf von Hundt nahm das Fragment zur Hand und betrachtete es erneut und diesmal aus einem anderen Blickwinkel. »Wo war das aufbewahrt?«, fragte Carl noch einmal.
»Ich sagte es schon, eigentlich für jedermann zugänglich in einem Bücherregal für die alten Handschriften, allerdings ist sie nicht in der Registratur der Stiftung verzeichnet. Ich wunderte mich nur, dass niemand diese Rolle bemerkt hat. Es war purer Zufall, dass ich die Rolle gefunden und geöffnet habe. Die Rolle muss schon eine Ewigkeit unberührt dort oben gelegen haben, so eingestaubt wie sie war. Und weil sie nicht im Register nachgewiesen ist, habe ich sie mitgenommen, anscheinend rechtzeitig!
Ich wiederhole meine Frage, Carl, womit haben sich die flüchtigen Templer beschäftigt, als ihr Orden verboten wurde? Von der Anklage bis zur Auflösung des Ordens dauerte es fast fünf Jahre, das ist eine relativ große Zeitspanne. Was ist in dieser Zeit passiert? Das physische und monetäre Eigentum der Templer verblieb ja in den Händen der Kirche oder die Johanniter haben es sich unter den Nagel gerissen. Das, was danach übrig blieb, hat der neu gegründete Orden der Ritter Christi bekommen!«
Von Gersdorff räusperte sich, als er eine weitere Frage erneut in den Raum stellte. »Was aber ist mit ihren Heiligtümern und Schätzen passiert? Wo sind diese geblieben? Zum Beispiel hatten die Templer zumindest Kenntnis über den Verbleib der Bundeslade und des Heiligen Grals, für deren Schutz sie schon vor der Kreuzigung Jesu verantwortlich zeichneten. Ebenso fehlen alle Hinweise auf den Verbleib des Kelches von Johannes dem Täufer, mit dem er am Jordan die Sakramente der christlichen Taufe vollzog. In keiner der mir bekannten Unterlagen findet man ansatzweise Spuren, alles nur Spekulationen! Haben die Templer einige dieser wertvollen christlichen Reliquien vor dem Zugriff der Kurie und deren Inquisition in Sicherheit gebracht und versteckt?
Warum auch immer und wo, das werden wir nie erfahren.
Es sollte mich aber nicht wundern, wenn die Apostolische Kammer der Kurie im Vatikan immer noch auf der Suche ist!«
Carl Gotthelf von Hundt nahm das Fragment noch einmal zur Hand und betrachtete es etwas genauer.
»Hast du die erste Zeile genauer betrachtet, Johann?
Hier schau hin!
… heilige thaufreli des Johann ege …
Das ist doch ein Hinweis – Taufreli... kann man das nicht auch mit Taufbecher übersetzen, oder?«
Johann von Gersdorff runzelte die Stirn.
»Du kannst doch wohl ermessen, was das bedeutet, Carl. Wir stehen im Verdacht der Inquisition aufgrund der verwandtschaftlichen Verquickung derer von Gersdorffs, etwas von dem zu wissen, was die Kurie seit Hunderten von Jahren sucht! Jetzt verstehe ich auch unseren Kustos«.
Von Gersdorff rollte das Pergament vorsichtig zusammen, verstaute es wieder in der Lederrolle und stand auf.
»Auf uns, oder besser gesagt, auf der Freimaurerei, liegt seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren der Bannfluch des Pontifex. Sie werden alles daransetzen, uns zu schaden, Carl. Einen Teil Schuld haben wir, wir die Gersdorffs, die mit der alten Verbindung zum Templerorden belastet sind. Jetzt haben sie erneut Grund zu forschen, weil sie Gersdorff und Freimaurer in Verbindung bringen können«.
Von Hundt räusperte sich und fragte Gersdorff.
»Wie hieß der Inquisitor, sagtest du?«
Gersdorff schaute irritiert auf seinen Logenbruder nieder.
»Wie kommst du jetzt darauf, den Namen habe ich überhaupt nicht genannt. Warte, da muss ich nachlesen …« Er setzte sich und entnahm der Rolle den Reisebericht. Dabei rutschte das Jerusalemkreuz heraus und fiel auf den Boden. Gersdorff rollte die Blätter auf. Auf dem dritten und vierten Blatt wurde er fündig.
»Bonifazius, mit weltlichen Namen Heinrich Kramer steht hier!«
Von Hundt grunzte.
»Setz dich Johann! Bonifazius war 1477 in Görlitz zu einem Blitzbesuch und ist dann weitergezogen in die damalige Neumark. Ich habe es in den Notizen von Frauenburg gelesen, als ich im Stadtarchiv war. Heinrich Kramer ist niemand anders als der spätere Verfasser des Hexenhammers. Kennst du das üble Machwerk? Ein ganz schlechter Mensch. Ich habe so ein Exemplar des Hexenhammers in unserer Bibliothek abgelegt, kannst es gerne mal lesen!«
Carl Gotthelf von Hundt ging zu einem der vielen Bücherregale suchte eine Weile und holte ein abgegriffenes Buch hervor auf dessen Deckel die lateinischen Worte in abgegriffenen goldenen Buchstaben zu lesen waren.
«Malleus Maleficarum» die Deutschen nannten das Werk den »Hexenhammer«. Er legte den Folianten vor Gersdorff auf den Tisch.
»Frauenburg verwies in seinen Notizen darauf, dass Georg Emmerich bereits bei seiner Pilgerreise in Venedig mit ihm aneinandergeraten ist. Eigentlich ist das hier gar nicht seine Domäne. Aber er musste nach 1474 seine Integrität unter Beweis stellen, weil er öffentlich den Kaiser Friedrich III. angegriffen hatte und dafür ins Gefängnis sollte. Das haben das Generalkapitel des Dominikanerordens und die Kurie verhindert. Im Gegenteil, sie haben ihm die Befugnis zur Inquisition erteilt. Möglich, dass er in diesem Rahmen seiner Integritätsfindung besondere Aufgaben hier in der Region zu erfüllen hatte.
Er hatte ja auch das Recht, sich seinen eignen Konvent und seinen eignen Beichtvater zu suchen, dazu konnte er noch alle Vorrechte eines Magisters der Theologie in Anspruch nehmen. Damit weißt du, welche Macht die Inquisition zur damaligen Zeit verkörperte. Das erklärte doch auch, warum er unter dem Namen Bonifazius reiste, sein lateinischer Name lautete nämlich «Henricus Institoris». Das bedeutet nichts anderes, er war in einer geheimen Mission unterwegs!«
»Und was bedeutet das für uns?«, fragte Gersdorff.
»Ich weiß es nicht, noch nicht! Aber zum Zeitpunkt seines Kurzbesuches in Görlitz waren Gabriel von Gersdorff und die Fingerin gerade von ihrer Pilgerreise zurück. Na, dämmert es bei dir? Und jetzt dein Hinweis, dass immer noch in eurer Bibliothek nach etwas gesucht wird, was man mit der Vergangenheit in Verbindung bringen könnte! Aber was suchen sie? Hast du dir diese Frage einmal gestellt?«
Gersdorff sah staunend auf seinen Logenbruder und bemerkte, dass sich dieser sehr umfangreich informiert hatte. »Woher weißt du das alles, Carl. Wieso hast du dich damit so intensiv beschäftigt?«, fragte Gersdorff und sah seinen Logenbruder erwartungsvoll an. Von Hundt stand auf und lief im Zimmer auf und ab. Die Frage blieb unbeantwortet.
Abrupt blieb er vor von Gersdorff stehen und stellte sehr sachlich fest.
»Die moderne Inquisition der Glaubenskongregation im Vatikan sucht noch immer, wenn auch erfolglos, nach verschwundenen Reliquien aus der Zeit der Tempelritter! Das ist, meiner Meinung nach, die einzig richtige Schlussfolgerung, die man aus der Mitteilung eures Kustos ziehen kann! Sie werden auch zu uns kommen, zumal sie wissen, dass du ein rechtmäßiger Nachkomme in fast gerader Linie des Gabriels von Gersdorff bist!«
Gersdorff stand auf und lief unruhig hin und her.
»Oh, Carl, das ist mehr als dreihundert Jahre her. Glaubst du …?«
Er wurde von Carl unterbrochen.
»Auch wenn das schon Jahrhunderte zurückliegt – die Inquisition vergisst nichts, Bruder, lass dir das gesagt sein.
Was sind schon dreihundert Jahre für die Inquisition – nichts, einfach nur nichts. Die Archive des Vatikans verfügen über so viel gutes und genaues Material, das sie die Recherchen der Suche nach Reliquien, auf einen Punkt zusammenballen können … aber dann mit aller Kraft und ohne Rücksicht auf die Menschen, die davon betroffen werden! Sie verfügen seit über zweihundert Jahren über ein Machtmittel, mein lieber Johann - die «Kompanie Jesu». Wo immer die Interessen der römischen Kirche es erfordern, tauchen sie auf, die unverdrossenen, fanatischen Jesuitenpadres der Kompanie Jesu. Jetzt sind es nicht mehr die Dominikaner, mit ihren «Hunden des Herrn», sondern jetzt die Jesuiten, die, obwohl seit drei Jahren vom Papst Clemens XIV. verboten, immer noch ihre schwarzen Fäden ziehen und das seit 1540.
Sie kommen inkognito, soviel steht fest, sie müssen es, denn offiziell gibt es sie nicht mehr. Diese Padres waren bestimmt die Besucher in eurer Stiftung. Hast du noch nichts von ihnen gehört?
Das wundert mich sehr!«
Gersdorff schüttelte entsetzt den Kopf.
Ihm war nicht wohl, als er das hörte.
»Wieso sind die Jesuiten verboten, Carl. Sie sind dann doch …«
Carl Gotthelf unterbrach seinen Gegenüber mit einer Handbewegung und fügte hinzu. »Die Gründe des Verbotes werden vom Vatikan streng geheim gehalten, warum auch immer, ich weiß es nicht! Ich kann mir nur denken, wenn sie etwas ausbaldowern und dabei erwischt werden, weist der Heilige Stuhl alle Schuld von sich, denn sie sind nicht gerade fein in der Wahl ihrer Mittel, Johann. Sie schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor einem Mord!«
Carl Gotthelf von Hundt hatte das herausgefallene Kreuz aufgenommen und betrachtete es von allen Seiten und warf einen Blick auf die Rückseite. »Und was bedeutet das, Johann?«, fragte mit Blick auf das Schmuckstück und legte es auf den Tisch zurück.
Gersdorff nahm das Kreuz an sich und steckte es in seine Rocktasche.
»Das ist der Beweis, dass Gabriel von Gersdorff ein Ritter des Heiligen Grabes war. Wie du vielleicht bemerkt hast, sind auf der Rückseite seine Initialen eingraviert«.
»Carl«, sagte er, »ich habe die Befürchtung, dass das unserer Loge Schaden zufügen könnte. Wenn sich Rom für unser Archiv interessiert, haben die Jesuiten einen handfesten Grund, etwas zu suchen, wovon wir noch keine Ahnung haben!«
Carl Gotthelf von Hundt sah ihn zweifelnd an.
»Meinst du wirklich, dass sie Hinweise auf eine verschwundene Reliquie suchen, ausgerechnet bei denen derer von Gersdorff?
Hast du den Reisebericht Gabriels von Gersdorff schon gelesen?«
Johann schüttelte den Kopf. »Du hast selbst geschlussfolgert, dass die Kurie nichts vergisst, Carl.
Was sonst sollten sie wohl in unserem Archiv sonst suchen?«
»Johann, Gabriel und die Fingerin waren in Palästina, am Heiligen Grab! Schon allein das macht sie eventuell als Geheimnisträger verdächtig!«
Er deutete auf die Rolle.
»Hier liegt der Schlüssel - ich fühle es!
Wir sollten den Reisebericht studieren und nicht nur lesen!«
»Eine verschwundene Reliquie suchen, ausgerechnet bei denen derer von Gersdorff?«, fragte von Hundt.
Gersdorff nickte.
Er deutete auf die Rolle.
»Hier in der Rolle liegt der Schlüssel!«
Gersdorf holte den Reisebericht aus der Rolle. Das waren mehrere hundert Seiten auf Pergament geschrieben. Sie vertiefen sich in die einzelnen Kapitel der Niederschrift des Gabriel von Gersdorff. Carl sah noch einmal in die Rolle.
»Johann, da ist noch etwas in der Rolle, da schau mal!«
Gersdorff kippte die Rolle und noch eine einzelne Handschrift rutschte aus der Rolle, unterschrieben von einem Peter von Gersdorff. Darin teilte er mit, dass der Großvater ihm die Rolle übergeben hat mit dem Hinweis, sie dem Wundarzt, Hans von Gerdorff, in Wittichenau zu übergeben, der vom Familienkonvent die Aufgabe hatte, in Bautzen eine wissenschaftliche Bibliothek und das Familienarchiv derer von Gersdorff zu errichten.
»Carl, Peter und Diethardt sind die Enkel von Gabriel und Luisa von Gersdorff. Sie befanden sich zu dieser Zeit in Wien, sie waren dem Ruf des Königs Ferdinand gefolgt, um Wien gegen die Osmanen zu verteidigen und das war 1529 herum.
Als sie auf dem Weg nach Wien waren wurden der Großvater und die Großmutter von drei bewaffneten Mönchen erdrosselt, das waren Handlanger der Dominikaner die sogenannten «Hunde des Herrn». Die Haushälterin Margarete und ihr Mann haben die Leichen gefunden. Sie haben auch die Mörder gesehen und beschrieben. Dem Sohn Wolf von Gersdorff und der Tochter Agnete haben sie auch die bittere Nachricht vom Tode der Eltern überbracht. »Kannst du dir nicht vorstellen, aus welchem Grund Luisa und Gabriel sterben mussten? Die Dominikaner wollten ihnen ein Geheimnis entreißen, was offensichtlich nicht geklappt hat. Die beiden Alten starben getreu ihres Eides standhaft!
Damit ist nun auch geklärt, wie die Rolle ins Archiv der Gersdorff gekommen ist!«, stellte Carl Gotthelf von Hund fest.
»Sie stammt aus dem Nachlass des Wundarztes Hans von Gersdorff aus Wittichenau. Irgendwie ist seine Erbmasse ins Archiv gelangt«, bemerkte Johann.
Sie vertieften sich in den Bericht des Gabriel von Gersdorf und lasen Kapitel um Kapitel über die Pilgerreise Agnetes und Gabriels ins Heilige Land.
Kapitel 1
Die Karawanserei El Mahmud
Die Sonne brannte Mitte Oktober des Jahres 1476 noch unerbittlich vom wolkenlosen Himmel Palästinas auf den Sahn der zweigeschossigen Karawanserei. Diese Karawanserei war ein sicherer Hort für Pilger und sie war einigermaßen gepflegt. Unweit von Ramalah, an der Karawanenstraße nach Jaffa gelegen, wurde sie Rastziel vieler Pilgergruppen, die sich auf dem Weg von und nach Jerusalem befanden.
Im Schatten der Gewölbe des Sahn, so nennt man den Innenhof der Karawanserei, hatte sich eine größere Schar Pilger, aus Jerusalem kommend, niedergelassen und diese Schar genoss die angenehme Kühle, die das dicke Gemäuer der Gebäude ausstrahlte. Es gab nur ein einziges Tor als Zugang zu dieser Herberge. Dieses bestand aus dickem, sehr hartem Zedernholz und ist mit sehr starken Eisenbeschlägen versehen. Das Tor konnte bei einem eventuellen Überfall auf die Karawanserei, schnell geschlossen und leicht verteidigt werden. In der Mitte des Innenhofes fiel ein großer Brunnen ins Auge, ein Bir, der wie jeder Brunnen in der arabischen Welt, einen Namen hatte. Dieser hier hieß «Bir El Mahmud», also Brunnen des Mahmud. Der Legende nach hieß der Brunnenbauer Mahmud, der in dieser Gegend einst Wasser fand und den Brunnen teufte.
Um diesen Brunnen herum baute man später die Karawanserei. So bekam dann auch die Karawanserei ihren Namen nach dem Brunnen. Gutes Wasser war lebensnotwendig für Mensch und Tier und dieser Brunnen hatte es im Überfluss.
Zu dieser Zeit waren Überfälle auf waffenlose, christliche Pilgergruppen an der Tagesordnung. Viele zwielichtige Gestalten wurden durch die Pilger angelockt, die ja größten Teils nicht unvermögend ihre Pilgerreise ins Heilige Land antraten. Diese unbewaffneten Pilgergruppen wurden dann zur leichten Beute für Räuber und Sklavenhändler, die meist den Glaubenskampf zwischen Muslimen und Christen als Vorwand nahmen, ihre Raubzüge zu maskieren.
Der Handschi jedenfalls, so nannte man in Palestina den Herbergswirt einer Karawanserei, gab sich alle Mühe, seine Gäste zufriedenzustellen und sorgte auch für deren Sicherheit während ihres Aufenthaltes in seiner Herberge.
El Mahmud
Die meisten Pilgergruppen fanden sich vor ihrer Ankunft im Heiligen Land zusammen. In Jaffa leisteten sie sich gemeinsam einen Chabir, einen Reiseführer, der sie sicher nach Jerusalem brachte, der vielleicht, wenn sie Glück hatten, sogar ihre Heimatsprache verstand und der vielleicht auch wenig kostete, und … der sie vor allen Dingen wieder sicher zurückbringen konnte. Und fast jeder gute Chabir kannte diese Karawanserei und macht hier Station mit Pilgergruppen von und nach Jerusalem. Der Chabir, der an der Balustrade der Terrasse lehnte, gehörte offensichtlich zu einer größeren Pilgergruppe, die sich in der Obhut der Karawanserei befand.
Der hochgewachsene Sarazene betätigte sich nicht nur als Reiseführer, sondern auch als Dolmetscher.
So einen Chabir konnte sich nicht jede Pilgergruppe leisten.
Der Sarazene ist sich offensichtlich seines Wertes bewusst, seine Haltung drückte das aus - zumindest gegenüber seinen Landsleuten ließ er durchblicken, dass er ein guter Chabir sei.
Übrigens - die Gäste der Karawanserei sind allesamt Pilger, die aus dem Heiligen Land kommend, die Heimreise antreten wollen. Und als Pilger sind sie weithin durch ihre Pilgerkutten kenntlich.
Nur wenige arabische Karawanen machten hier Station.
Meist kamen sie nur frisches Wasser aufzunehmen und ihre Tiere zu tränken, um dann weiterzuziehen. Karawanen die Handelsgüter transportierten, blieben auch nur kurze Zeit hier.
Sie hatten es eilig, auf die Märkte zu kommen. Das wurde dann kein gutes Geschäft für den Handschi.
Normalerweise sind die Dienstleistungen einer Karawanserei kostenfrei, nur für Essen und Trinken mussten die Pilger einen relativ kleinen Preis entrichten.
Das Oberhaupt der deutschen Pilger, war der Herzog Albrecht von Sachsen, der mit einer Anzahl von Edelleuten und Bediensteten gen Jerusalem gezogen ist. Jetzt befand sie die Gruppe auf dem Nachhauseweg. Mergenthal, sein Landrentmeister hatte dem Wirt in seinem Auftrage einen größeren Betrag in die Hand drücken lassen, mehr als dieser üblicherweise gefordert hätte. Dafür erhielt die Gruppe die besten Gästekammern im ersten Geschoss der Karawanserei.
Die Pferde der Pilger wurden vorzüglich versorgt und in den unteren Ställen eingestellt, sodass sie der brennenden Sonne nicht ausgesetzt wurden. Aber die Pferde, es waren edle Tiere und ihrer Herkunft nach deutlich arabischen Ursprungs. Das verrieten die innwendig rötlich gefärbten Nüstern und die feinen, dichten Stirnlocken, die von den kleinen zierlichen Ohren begrenzt wurden. Die schwarzen Schweife waren lang und dicht. Die rotbraunen, edlen Tiere erregten Aufsehen, auch bei den anderen Gästen der Herberge. Aber die Gruppe war anfangs nicht beritten, denn normalerweise sind Pilger Fußgänger, aber angesichts der späten Rückreise, gestattete sich der Herzog Albrecht von Sachsen den Luxus, etwas schneller zu reisen, weil er den harten Winter des Gebirges nicht unbedingt erleiden wollte. Immerhin mussten sie, nach der noch bevorstehenden Seereise, die Alpen überqueren.
Bevor sie dort ankamen, konnte es schon November und in den Bergen empfindlich kalt werden.
Der Herbergsbesitzer, der Handschi, nahm den Chabir der Pilgergruppe beiseite und fragte ihn etwas unüberlegt - und vor allen Dingen laut: »Maschallah, Selim, wie kommen die Giaurs zu solch edlen Tieren? Die sind doch ein Vermögen wert!« Da er ihn laut beim Namen nannte, wurde deutlich, dass er den Sarazenen kannte, weil dieser schon oft Pilgergruppen nach Jaffa führte und immer hier seine Rast einlegte.
»Allah schlage dein Maul mit der Pest!«, antwortete ebenfalls laut der mit Selim angesprochene Sarazene.
Er drehte sich um und schaute erschrocken zu der Pilgergruppe, und raunzte den Handschi an: »An der Spitze der Pilger steht ein Herzog, bei uns etwa mit einem Emir zu vergleichen.
Also überlege dir gut, welche Worte dein ungewaschenes Maul verlassen!« Leise fügte er hinzu:
»Außerdem verstehen einige von ihnen unsere Sprache, du Dummkopf!«
Der Gescholtene zog sich, nach dieser schroffen Zurechtweisung, betroffen in die offene Küche zurück und begann den üblichen Mokka zuzubereiten, den er den Gästen, gemeinsam mit seinen Sufragis, auf dem Dach der Herberge servierte. Kleine, glühende Kohlebecken, auf denen in zierlichen Kupferkasserollen der Mokka zubereitet wird, standen an jedem Tisch, sodass das Getränk immer heiß und frisch in die kleinen Schalen kam.
Die offenen und flachen Dächer, von einer zierlichen Balustrade begrenzt, dienten der Karawanserei als Terrasse.
Von hier aus hatte man einen herrlichen Blick über die steppenartige Region bis weit zu den Bergen, die die Sicht aufs Heilige Jerusalem versperrten.
Hier saß nun ein Herzog mit einer Gruppe von Pilgern.
Und genau diesen Herzog, nämlich Herzog Albrecht von Sachsen und seine Pilgergruppe, die aus sieben Grafen und etwa fünfzig Edelleuten, sowie deren Bediensteten bestand, hatte der Handschi als Giaurs, als Ungläubige bezeichnet.
Nicht auszudenken, wenn sie die Beleidigung und das Gespräch mit dem Chabir verstanden hätten.
Der Handschi sah aufmerksam zur Pilgergruppe hin.
Aber niemand sagte etwas, sie redeten miteinander in ihrer Muttersprache, die er sowieso nicht verstand.
Aber jedes Mal, wenn der Handschi am Chabir vorüber musste, grinste dieser ihn anzüglich an.
Irgendwie war das Verhalten des Chabir heute merkwürdig, das spürte auch Hamid der Handschi. So hatte sich dieser Selim noch nie benommen. Er ist schon des Öfteren mit Pilgergruppen zu Gast in der Karawanserei gewesen und eigentlich war immer alles in Ordnung. Dieses Mal jedoch … irgendetwas hatte den Chabir in seinem Benehmen verändert … irgendetwas, das dem Handschi missfiel und dass dessen Unbehagen hervorrief.
Die Pferde, über die der Handschi mit dem Chabir sprach, hatte der Herzog in einem Gestüt in der Nähe von Ramalah gesehen und ausgeliehen. Und das waren allerhand Tiere, die dem Herzog und seinen Leutern das schnelle Weiterkommen ermöglichen sollten. Der Scheikh Hassan Ben Gur, der Besitzer des Gestüts, verlangte, nach langem Feilschen, ein nicht geringes Entgelt für die Leihgabe. Die Pferde nahmen seine Stammesleute natürlich in Jaffa wieder zurück.
Besagter Herzog, selbst erst dreiunddreißig Jahre alt, stand an der Balustrade, abgesondert von seinen Edelleuten und den Bediensteten. Neben ihm lehnte eine schöne junge Frau, vielleicht Ende der Zwanzig oder Anfang der Dreißig - schwer zu schätzen. Sie war ebenfalls mit einer Pilgerkutte bekleidet und sie ließen den Blick in Richtung Jerusalem schweifen.
Selbst die einfache graue Pilgerkutte konnte die Schönheit der Frau nicht verbergen. Sie erregte allgemeine Bewunderung, vor allem der Chabir machte keinen Hehl daraus und starrte sie, bei jeder passenden Gelegenheit, herausfordernd und lüstern an.
Die junge Frau hieß Agnes Finger oder landläufig gesprochen, Agnete Fingerin. Sie hatte sich mit ihrem Begleiter, einem jungen Adligen, der Pilgergruppe des Herzogs Albrecht von Sachsen angeschlossen. Sie genoss natürlich die Annehmlichkeiten und die Vorteile einer solchen Pilgerreise, die eine solch hochgestellte Persönlichkeit mit sich brachte.
Über ihrer Schulter hing eine schwere lederne Rolle an einem Riemen. Eine Dokumentenrolle, so wie sie im Orient zum Transport von Schriftstücken üblich ist.
Sie unterhielt sich lebhaft mit dem Herzog.
Die intensive Unterhaltung schien sich um die Lederrolle zu drehen, die die Frau über der Schulter hängen hatte - und sie hatte in dem Herzog einen aufmerksamen Zuhörer gefunden.
Ihre Unterhaltung bezog sich auch auf die Pilgerfahrt und natürlich auf das «Heilige Grab» von Jerusalem.
Unweit von ihnen lehnte der Chabir an der Balustrade und schaute gelangweilt in die Ferne – so schien es zumindest.
In Wirklichkeit war er bemüht, jedes Wort zu erfassen, das zwischen der jungen Frau und dem Herzog gewechselt wurde.
Dabei kamen ihm seine wirklich guten Kenntnisse der deutschen Sprache zugute, die er bereits als Kind in der deutschen Gemeinde von Jerusalem erlernt hatte.
Selims Vater war dort vor längerer Zeit als «khadimat almanzil», also als «Hausdiener» bei einer christlichen deutschen Familie angestellt. Seine Familie wohnte dort und zwangsläufig hatte auch Selim dadurch Kontakt zu anderen Mitgliedern dieser Gemeinde, die ihm ihre Sprache beibrachten. Der Vater war eine ehrliche Haut und sehr beliebt bei den Deutschen. Dann erkrankte er plötzlich an einem schlimmen Fieber. Kein Heilkundiger und kein Arzt konnte dem Vater helfen. Die Deutschen bemühten sich redlich, dem Erkrankten zu helfen, aber das Fieber war unerbittlich.
Der Vater starb und Selim kehrte der deutschen Gemeinde den Rücken. Er wandte sich wieder der Familie des Vaters zu, die in Ramalah lebte. Hier geriet er unter den Einfluss des Onkels.
Der Onkel, ein Imam in der Moschee von Ramalah, lehrte ihm die Schriften des Korans als das unverfälschte, ewige Wort Gottes. Er lehrte ihm aber auch den Hass gegen die Andersgläubigen, was Selim aber nicht hinderte, für sie als Chabir, als Führer tätig zu sein. Diesen Haß hatte ihm der Onkel eingepflanzt, in dessen Familie er fortan lebte. All die humanistische Ausbildung, die er in Jerusalem erhielt, hatte er von nun an gründlich verdrängt. Die Folge des Einflusses seines Onkels war, dass Selim alle Christen regelrecht hasste.
La ilaha ill’ Allah! Es gibt keinen Gott außer Allah! … und Selim lebte danach, zumindest tat er so. Er musste alle Suren des Korans und die dazugehörigen Hadithe auswendig lernen, der Onkel war mit seinen Forderungen unerbittlich.
Das Gespräch der Fingerin mit dem Herzog war für ihn von besonderem Interesse. Wenn er nur näher herangekonnt hätte, ohne Misstrauen zu erwecken. Er verstand immer nur Bruchstückenhaft Worte der Unterhaltung, die sich seiner Meinung nach um einen «Schatz» drehte. Schon diese wenigen Worte erweckten die Gier in ihm, mehr Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. Aber die Unterhaltung der beiden Pilger wurde sehr leise und gedämpft geführt. Näher konnte Selim nicht heran, ohne in Verdacht zu geraten, dass er sie belauschen könnte. Vielleicht hätte er von seinem frevelhaften Vorhaben abgelassen und sich mit der fürstlichen Entlohnung zufriedengegeben, wenn er den wahren Inhalt der Unterhaltung gekannt hätte.
»Durchlaucht«, sagte die Fingerin an den Herzog gewandt, »das hier ist mein größter Schatz. Hier drinnen befinden sich Kopien der Baurisse und Ansichten des heiligen Grabes von Jerusalem! Sie sind wirklich ein Schatz!« Sie klopfte bestätigend auf die Lederrolle.
»Der künftige Bürgermeister von Görlitz, Emmerich, war bereits vor elf Jahren in Jerusalem. Seit dieser ist Zeit ist er auch Ritter des Heiligen Grabes. Von ihm stammt eigentlich die Idee, die Bauabrisse aus Jerusalem nach Görlitz zu holen!
Er braucht sie, um eine Kopie des Heiligen Grabes in Görlitz zu errichten. Das sind wohl noch Teile der Sühne mit seiner Stadt und ein Ergebnis seiner Pilgerreise ins Heilige Land! Aber so genau weiß ich das nicht, ich vermute es nur!«
Der Herzog zog die Nase kraus.
»Frau Agnete, ist das der Georg Emmerich«, warf er dazwischen, »der die Tochter und somit die Familie des Kaufmanns Horschel entehrt hat?«
Als Agnete bejahend nickte, stellte er bestimmend fest:
»Aber, der ist doch gar kein Bürgermeister, er ist doch Kämmerer! Meinem Wissen nach ist doch der Frauenburg der Bürgermeister von Görlitz! Wie mir zu Ohren gekommen ist, soll ja dieser Georg Emmerich ein tüchtiger Windhund und Intrigant sein! Meine Leute haben mir damals berichtet, dass er zu dem blutigen Femegericht, das der Frauenburg damals in Görlitz abhielt, die Fäden im Hintergrund gesponnen hat, um damit auch seinen persönlichen Zwist zu bereinigen. Damit hat er schon vor seiner Pilgerreise begonnen – ein geschickter Zug von ihm! Immerhin!«, der Herzog senkte seine Stimme.
»Er hat sich damit seine persönlichen Widersacher, vor allen Dingen den Nickel Horschel, vom Halse geschaffen. Soviel mir bekannt ist - Nickel Horschel war ein rechtschaffener Mann und … aber, das ist nur meine Vermutung und ich kann sie auch nicht beweisen, aber es ist wohl so geschehen!«
Dann brach er den Satz mit der Feststellung ab:
»In Dresden hat man schon aufmerksam nach Görlitz geschaut, was sich dort in dieser Zeit der sogenannten «Pulververschwörung» abspielte!«
Der Herzog machte eine kleine Pause und fuhr dann, mit einem Seitenblick auf die Frau fort:
»Ihr seid nicht nur schön, sondern auch klug, Frau Agnete, der Herrgott hat bei euch mit seinen Gaben nicht gespart, aber ich hoffe sehr, ihr macht von den Interna unserer Unterhaltung keinen unzulässigen Gebrauch, wenn ihr wieder in Görlitz seid!« Über dieses Kompliment errötete die Fingerin und wurde verlegen. »Danke Durchlaucht, danke für das Kompliment«, sagte sie, um gleich darauf weiter zu reden, »aber warum urteilt ihr so hart über Georg Emmerich? Ich finde, es sind immer zwei Seiten, die man bei der Beurteilung von Menschen in Erwägung ziehen sollte! Außerdem, er ist der künftige Bürgermeister, ich habe das auch so erzählt!« Sie beschwichtigte den Herzog mit einer Handbewegung, als dieser antworten wollte, und redete weiter:
»Als diese Ereignisse in Görlitz stattfanden, war ich noch ein junges Ding und mit anderen Sachen beschäftigt, um das zu begreifen, was da vor sich ging. In diese Zeit fiel auch der Tod meines Mannes, den ich zu verkraften hatte.
Mit Politik habe ich mich in dieser Zeit kaum beschäftigt.
Aber in unserer Familie sprachen wir schon darüber.
Ich kann mich nur erinnern, dass vor allem mein Vater als Tuchmachermeister, sehr betroffen reagierte über die Grausamkeit und die Gewalt, mit der Frauenburg die Sache der Tuchmacher niederschlug!«
Sie machte eine kleine Pause.
»Aber das ist lange her! Und ihr braucht wirklich keine Bedenken zu haben, dass ich in Görlitz von unserer Unterhaltung Gebrauch mache.
Aber zurück zu eurer anfänglichen Bemerkung, Durchlaucht!
Georg Emmerich wird bei den Geschlechtern der Stadt schon lange als der künftige Bürgermeister gehandelt, er ist doch mit Frauenburg dick befreundet.
Und … nach seiner Pilgerreise hat man ihm seine Vergehen nachgesehen, er hat Absolution erhalten.
Vor immerhin sechs Jahren hat ihn Frauenburg als Nachfolger seines Vaters Urban in den Rat geholt und seither ist er dort ohne Unterbrechung tätig.
Seit dem Tode des Böhmerkönigs macht ihm keiner das Amt mehr streitig - und Frauenburg … der ist schon längere Zeit sehr krank, ist euch das nicht bekannt?«
Der Herzog sah sie merkwürdig an, als sie den Tod des Königs erwähnte, nickte dann aber zustimmend und winkte ab. Erneut stellte er eine Frage an die schöne Frau. »Euer Vater, war das der Tuchmachermeister Jakob Lange?«, fragte er.
Als die Fingerin das erstaunt bejahte, fuhr er fort:
»Lassen wir das Unerquickliche ruhen, Frau Agnete! Die Görlitzer Politik und die Zugehörigkeit der Stadt, zu wem auch immer, ist schon allezeit ein Kapitel für sich gewesen!
Wechseln wir das Thema!«
Er drehte sich um und sah ihr voll ins Gesicht.
»Interessanter für mich ist, wie seid ihr an diese Bauunterlagen herangekommen und, verzeiht diese Frage, welche Rolle spielt dieser Georg Emmerich in eurem Leben, dass ihr euch an solche Dinge wagt, Frau Agnete?«
Der Herzog bemerkte wohl den unwilligen Schatten in ihrem Gesicht, den seine Frage bei ihr auslöste.
»Meines Wissens sind diese unzugänglich für die Allgemeinheit aufbewahrt! Eigentlich hätte die doch euer Emmerich schon mitbringen können, wenn er schon Ritter des Heiligen Grabes ist!«
Das klang etwas spöttisch, vor allem das «euer Emmerich» stach ihr gewaltig in die Nase, aber Agnete überhörte absichtlich diesen stichelnden Unterton in der Frage.
Für sie war es überhaupt schon ein Wunder, das ein Herzog mit einer Patrizierin aus dem Handwerkerstand, Konversation betrieb. Sie wollte die Harmonie dieses Gespräches nicht mit einer forschen Gegenrede zerstören.
Deshalb redete sie weiter. »Dass ihr meinen Vater kennt, ist schon verwunderlich, Durchlaucht. Er hat sich eigentlich nie an der Politik der Stadt beteiligt, zumindest ist es mir nicht bekannt«.
Der Herzog schmunzelte.
»Ich kenne ihn nicht persönlich Frau Agnete. Mein Vater hat mir erzählt, euer Vater hat vor dreißig Jahren ziemlich viel Staub aufgewirbelt in einem Streit mit dem Nürnberger Handelsmann Reuthener. Dieser hatte das Freirecht von Westfalen angerufen, um zu seinem Recht zu kommen. Der Görlitzer Rat hat das aber klug beigelegt, in dem er auf das Privileg verwies, dass Görlitz kein fremdes Gericht zur Rechtsprechung über seine Bürger duldet.
Nur dadurch kenne ich den Namen Jakob Lange.
Wisst ihr überhaupt, was das ist? Das Freirecht von Westfalen?«
Agnete schüttelte den Kopf und sah den Herzog fragend an.
»Soll ich euch das wirklich erzählen?« Agnete nickte zustimmend. »Aber ja Durchlaucht. Schließlich betrifft es ja meinen Vater«.
»Nun gut Frau Agnete«, antwortete der Herzog.
»Eigentlich ist das kein erquickendes Thema. Aber der Streit eures Vaters mit dem Nürnberger hat tatsächlich viel Staub aufgewirbelt - über die Landesgrenze hinweg, genauer gesagt.
Das Freigericht von Westfalen wurde durch die Feme – so nannte man das Gericht – zum Land der «roten Erde». Dies wegen der geheimen Blutgerichte, die hier stattfanden. Die Feme entstammt einem uralten sächsischen Freigericht und Karl der Große hat das ausdrücklich bestätigt. Die Feme erhielt dadurch den Königsbann, seine Befugnisse über ganz Deutschland auszubreiten. Damit sind die Richtersprüche der Feme nach wie vor geltendes Recht.
Euer Vater hatte unsägliches Glück, das er Görlitzer Bürger war. Ich will es euch verdeutlichen, Frau Agnete, wie es dabei zu geht!«
Der Herzog räusperte sich und trank einen Schluck von dem Wasser, welches auf der Terrasse bereitstand und fuhr fort.
»Der anklagende Wissende trägt die Klage vor. Vor ihm auf dem Tisch liegen immer Schwert, Strick und Weidenrute. Nach kurzer Beratung fällt man ein Urteil und das vollzieht man auch sofort. Normalerweise endet die Klage vor der Feme immer mit einem Schuldspruch und der lautet fast immer «Hängen» oder «Halsgericht». Selten, dass ein Freispruch erwirkt wurde.
Wenn der Schuldige aber nicht vor Gericht erscheint, macht es das Gericht im Lande bekannt.
Wisst ihr nun, woher ich den Namen eures Vaters kenne?«
Agnete sah den Herzog betroffen an.
»Das war mir nicht bekannt, Durchlaucht. Ich erinnere mich nur, dass er damals oft nach Nürnberg gefahren ist, um über Waid zu verhandeln. Das ist ja schrecklich. Ist das nun aus der Welt geschaffen oder muss ich dafür büßen?«
Der Herzog sah sie sehr ernst an.
»Ihr habt Glück, dass euer Vater nicht mehr lebt. Ansonsten hätte ihn die Feme für vogelfrei erklärt. Außerhalb von Görlitz hätte jeder mit ihm tun können, was ihm beliebte. Die Femeacht ist gefürchtet«.
Eine geraume Zeit herrschte Schweigen zwischen den Beiden.
Agnete musste das erst verdauen, was der Herzog ihr über ihren Vater berichtete.
»Vogelfrei, recht- und ehrlos«, ging es ihr durch den Kopf, »wer hätte das vom eignen Vater gedacht«.
Der Herzog betrachtete sie von der Seite und begann erneut das Gespräch, indem er ihr die Hand auf die Schultern legte.
»Ihr müsst keine Furcht haben. Die Buße, die ihr mit der Pilgerreise auf euch genommen habt, erteilt euch in Personae die Absolution. Ihr seid schuldfrei von dem, was man eurem Vater anlastete. Auch das ist geltendes Recht«.
Agnete sah den Herzog an. Die Erleichterung drückte sich auf ihrem Gesicht deutlich aus. Damit musste sie sich befassen, wenn sie wieder in Görlitz war – unbedingt.
»Ich werde das ergründen, wenn ich wieder zu Hause bin, Durchlaucht. Ich brauche Gewissheit, dass das alles sauber geklärt ist«, sagte sie resolut.
Eine Weile herrschte Schweigen zwischen ihnen, bis Agnete, wie aus einer Lethargie erwachte und den Herzog ansprach.
»Zurück zu eurer Frage, Durchlaucht. Mein junger Begleiter, der Gabriel von Gersdorff, den euer Landrentmeister irrtümlich für meinen Ehemann hielt, hat Verbindungen zu den Tempelherren von Jerusalem … die hatte Emmerich nicht!«
Der Herzog zog erstaunt die Augenbrauen in die Höhe und bemerkte fast spöttisch: »Die Tempelherren, Frau Agnete?
Meint ihr wirklich den Templerorden?«
Als er sah, dass Agnete dazu nur nickte, fuhr er entschieden fort: »Aber, aber, Frau Agnete! Der Orden ist doch offiziell schon seit 1312 vom Konzil in Vienne aufgelöst und alle Großmeister des Ordens sind exemplarisch bestraft! Das sind … Moment mal, einhundertvierundsechzig Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe. Wieso dann Tempelherren? Ihr nehmt mich auf den Arm!«
»Das würde mir nie einfallen, Durchlaucht!“, lachte sie, „außerdem seid ihr mir viel zu schwer!« Sie lachten beide.
Der Herzog sah sie gespannt an, als sie weitererzählte:
»Anfangs ging es mir genauso!
Aber im Verborgenen gibt es sie doch noch, hier im Heiligen Land! Sie sind damals allesamt im Orden der «Ritter Christi» aufgegangen. Sie zeigen sich selten in der Allgemeinheit, aber sie sind da! Einige Vorfahren, aus einem weitläufigen Zweig derer von Gersdorff gehörten in dieser Zeit, die ihr anführtet, dem Orden der Templer an, daher stammen auch seine Verbindungen. Und diese sind von Generation zu Generation derer von Gersdorff weitergereicht worden. Anfangs war ich auch sehr skeptisch, dass überhaupt eine Begegnung mit ihnen zustande kommt. Und siehe da! Es hat in Jerusalem funktioniert.
Es war gar nicht so einfach, die Templer zu überzeugen, dass wir die Abrisse kopieren wollten.
Dass dies einem guten Zweck dient, den Glauben zu festigen, wenn man bei uns in Görlitz ein Abbild des Heiligen Grabes aufbaut, überzeugte sie dann doch und sie halfen bei der Erstellung der Kopien sogar mit«.
Herzog Albrecht lachte.
»Die Überzeugung dürfte euch ja nicht schwergefallen sein!«
Er ließ erneut einen bewunderten Blick über die junge Frau gleiten. Agnete überhörte erneut die Bemerkung des Herzogs und redete unverdrossen weiter:
»Der ehemalige Kaplan der Komturei von Jerusalem war rein zufällig in der Stadt«, sie machte dabei mit den Händen die Anführungszeichen oben und unten, »er wollte wohl alle noch vorhandenen Unterlagen des Ordens, die immer noch in Jerusalem lagerten, in die Burg Arun verbringen lassen.
Darunter zählten auch die Bauabrisse des Heiligen Grabes, für dessen Schutz der Templerorden einst zuständig war.
Ich glaube zwar nicht an einen Zufall, aber was soll’s, ich habe jedenfalls die kopierten Bauunterlagen und Ansichten hier«.
Und sie klopfte zur Bestätigung auf die lederne Rolle an ihrer Seite. Wieder herrschte eine Weile Ruhe zwischen ihnen.
»Ihr habt den anderen Teil meiner Frage übergangen, Frau Agnete! Was für eine Rolle spielt Emmerich in euerem Leben!«
Die Fingerin errötete und wandte sich ab.
»Wenn ihr nicht antworten wollt, dann müsst ihr es nicht!«, bemerkte ernsthaft der Herzog. Sie drehte sich um und sah ihm voll ins Gesicht: »Es ist mir unangenehm, auf solche Fragen überhaupt eine Antwort zu geben, Durchlaucht!
Seit ich meinen Mann verlor, stellte mir auch Emmerich nach.
Ich weiß mich gewiss zu wehren gegen solche Nachstellungen und Emmerich weiß das auch … schmerzlich denke ich, wird er sich daran erinnern. Wenn auch der Schein trügt, aber ich habe nichts mit dem Emmerich. Eigentlich ist er mit Mitte fünfzig schon ein alter Mann. Bei dieser Feststellung wollen wir es belassen … bitte!«, sagte sie mit harter Stimme.
»Entschuldigt! Ich wollte euch keinesfalls zu nahetreten!«, erwiderte Herzog Albrecht, »aber die Frage bezog sich mehr auf die Kopien, die ihr bei euch tragt, nicht auf eure persönlichen Verbindungen zu ihm.