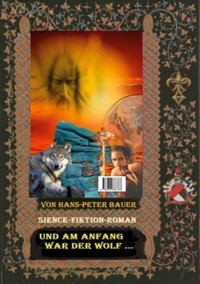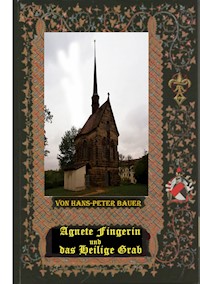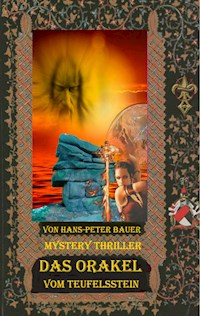Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Hussiten Ein historischer Roman im letzten Drittel der Glaubenskriege Das Konzilgericht in Konstanz verurteilte Jan Hus am 4. Juli 1414 als hartnäckigen und unbelehrbaren Ketzer zum Tode auf den Scheiterhaufen. Sein Tod wird zum Fanal. In Böhmen bricht der Aufstand los, der über 15 Jahre anhalten und Böhmen, Schlesien, Sachsen, Bayern und die Lausitzen überziehen wird. Der Sechsstädtebund bricht im Ereignis dieser Revolution auseinander. Der Landvogt ist nicht in der Lage, in den Lausitzen eine wirksame Verteidigung zu organisieren, die Bischöfe von Breslau und Meißen lassen ihn und die Städte im Stich. Die Stadt Görlitz widersteht als einzige Stadt dem Ansturm der ketzerischen Heermacht und der Rat von Görlitz ist bemüht, die Einigkeit des Sechstädtebundes wiederherzustellen. Im Umland von Görlitz sind es die Adligen, insbesondere die von Gersdorffs, die bemüht sind, im Auftrage der Stadt Görlitz in Königshain das Treffen der Abgesandten des Bundes der Sechsstadt zu organisieren. Im letzten Drittel dieser 15 Jahre währenden fürchterlichen Kämpfe um die Macht des Glaubens handelt dieser Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort zu den Hussiten
Jan Hus
Das Konzil begann am 5. November 1414. In Konstanz waren unter anderem neunundneunzig Kardinäle, siebenundvierzig Erzbischöfe sowie Hunderte Theologen und Rechtsgelehrte zusammengekommen. Als Schutzpatron der Versammlung fungierte König Sigismund persönlich. Um die Einheit der Kirche für jedermann überzeugend wiederherzustellen, galt es auch, die Verbreiter ketzerischer Irrlehren zu bekämpfen. Ihr prominentester Vertreter war der böhmische Theologe Jan Hus. Dieser Mann von ebenso großer Gelehrsamkeit wie Rhetorik predigte seit 1402 in der Prager Bethlehemkapelle. Zentraler Punkt seiner Lehre war die Abschaffung der seit fast 1400 Jahren tradierten Papstwürde. Ihre Autorität sei überflüssig, denn "nicht der Papst kann Sünden vergeben, sondern Gott allein". Das Konzilsgericht verurteilte Hus am 4. Juli 1415 als „hartnäckigen und unbelehrbaren Ketzer" zum Tod auf dem Scheiterhaufen. Der Delinquent sang zunächst mit lauter Stimme den Choral "Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich!" Sein letzter Ausspruch galt der Legende nach einem alten Weiblein, das voller Glaubenseifer ihr Reisigbündel zum Scheiterhaufen herbeitrug. "O, sancta simplicitas!" (heilige Einfalt). Die ganze Asche, die Knochen und alles, was sonst nicht verbrannt war, schüttete man in den Rhein. Angesicht des Scheiterhaufens soll Hus, dessen Name auf Tschechisch "Gans" bedeutet, gesagt haben: "Heute bratet ihr eine magere Gans. Aber über hundert Jahre werdet ihr einen Schwan singen hören, der sich aus meiner Asche erheben wird. Den sollt ihr ungebraten lassen." Sein Tod wird zum Fanal. In Böhmen bricht ein Aufstand los: Fünfzehn Jahre lang widerstehen die sogenannten Hussiten der päpstlichen Übermacht. Gelegentlich begegnet einem das Bild des böhmischen Theologen und Prager Magisters Jan Hus, der auf dem Konstanzer Konzil verhört, zum Tode verurteilt und am 6. Juli 1415 verbrannt wurde, noch heute in lutherischen Kirchenräumen. Die Erinnerung an ihn als einen Vorläufer Luthers ist lebendig geblieben. Sie geht vor allem auf den Wittenberger Reformator zurück. Nach dem Bruch mit der Papstkirche, den Luther infolge der Bannandrohungsbulle Exsurge Domine im Sommer 1520 öffentlich vollzog, bekannte sich der Ketzer Luther freimütig zu dem Ketzer Hus. Er berichtete, dass er schon in der Erfurter Klosterzeit von seinem Novizenmeister gehört habe, dass Hus "on unterricht, on beweisung, on ubirwindung" verurteilt worden sei. Dem Prager Magister war also widerfahren, was dem Wittenberger Doktor nun selbst drohte. In Luthers Orden, bei den Augustinereremiten, erinnerte man sich auch deshalb an die Causa Hus, weil einer der früheren Brüder, der Erfurter Theologieprofessor Johannes Zachariae, eine maßgebliche und sehr fragwürdige Rolle im Prozess gegen den böhmischen Theologen gespielt hatte. Er soll ihn in Konstanz durch ein gefälschtes Bibelwort und eine manipulierte Ausgabe der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Bibel, in Bedrängnis und schließlich zu Fall gebracht haben. Zachariae ist im Kreuzgang von Luthers Erfurter Kloster begraben; der spätere Reformator kannte das Epitaph und erfuhr von der Geschichte durch seinen Lehrer Johannes von Staupitz. Die nach der Verbrennung des „Ketzers“ Jan Hus entstandene hussitische Bewegung hielt über fünfzehn Jahre an und brachte Tod und Verderben über die Menschen in Schlesien, Brandenburg und Sachsen bis hin nach Bayern.
Genau im letzten Teil dieser wechselhaften hussitischen Geschichte, die sich in den Lausitzen und um Görlitz abspielt, da ist dieser Roman angesiedelt.
Görlitz, 17.07.2017
Hans-Peter Bauer
„Da schickten denn die Feinde, die die Höhen rechts der Neiße besetzt hielten und die Stadt im Angesichte hatten, einen Boten hinein mit der Forderung, sich zu ergeben, oder ihnen eine Brandschatzung zu zahlen. Da haben denn die von Görlitz solchen Boten nehmen lassen und auf offener Brücke in einen Sack gesteckt, hinab in die Neiße gestürzt und ertränkt“.
Nach Professor R. Jecht
Inhaltsverzeichnis
Der Görlitzer: Kundschafter
Königshain: Das Rittergut
Rathaus Görlitz: Das Geheimnis der Rolle
Königshain: Das Rittergut
Der Heideberg
Stadt Görlitz: Der Spion
Stadt Görlitz: Im Rathaus
Stadt Görlitz: Der Schläfer
Burg Grafenstein: Prokop der Kahle
Rittergut Königshain: Ein unverhoffter Besuch
Die Schwesterstadt: Sturm auf Zittau
Ludwigsdorf: Der Kretscham
Rittergut Königshain: Der Überfall
Stadt Görlitz: Die Enttarnung
Stadt Görlitz: Der Hussitensturm
Burg Grafenstein: Die Wende
Nach Baruth: Gutshof Preititz
Das Kreuz auf dem Heideberg
Königshain: Das Rittergut
Die Schlacht bei Lipan: Das Ende Tábors
Glossar
Dramatis Personae
Verwendete Literatur
Historie
Begriffe
Zur Geschichte der Vier Prager Artikel
Nachwort: zur Görlitzer Hussitengeschichte
Der Görlitzer Kundschafter
Als der alte Mann vor die Tür des Hauses trat, trieb ihm ein scharfer Nordostwind unverhofft Eispartikel in die Augen. Er musste seine Augen mit der behandschuhten Rechten vor diesem unangenehmen Schneetreiben schützen, bevor er weitergehen konnte. In der Nacht ist auf einmal das Wetter umgeschlagen. Aus dem angenehmen Spätherbst der vergangenen Monate und dem noch warmen Beginn des Dezembers wurde Winter. Er kam plötzlich, der Winter, und zwar heftiger als gewohnt. In Windeseile türmte sich mit dem scharfen Nordostwind der Schnee an den Wegrändern auf. Der Himmel sah aus, als würde es immer weiter schneien.
Ein geheimnisvoll klingender, auf‐ und abschwellender Laut schwebte über dem Waldrand. Jedes Mal, wenn der Wind stärker über das Haus hinwegfegte, wurde dieser Ton schauriger und lauter und er ging den Menschen auf dem Heideberg durch Mark und Bein.
Der alte Mann schaute zum Giebel des Wohnhauses hoch, wischte sich mit dem Handschuh das Eis aus den Augen und stapfte durch den Schnee zum Stall, der mit der Errichtung des Hauses fest angebaut worden ist.
Er öffnete die Tür und schaute hinein. Durch die schmalen vergitterten Fenster fiel fahles Winterlicht in die Stallung. Im Stall war alles wie gewohnt. Die beiden Pferde standen an ihren Plätzen und zupften unlustig Heu aus den Raufen. Der alte Mann goss ihnen frisches Wasser aus einem Holzeimer in die Tröge.
Wieder zog ein markerschütternder Laut über die Dächer des kleinen Hofes.
„Der Wolfsziegel heult“, murmelte der Alte und schüttelte den Kopf und stellte den Eimer an seinen Platz zurück.
»Wenn das so weitergeht, dauert es nicht mehr lange und der Graue ist wieder da!«, ging es ihm durch den Kopf, während er mit einem Scheffel den Hafer aus der Futterkiste einschüttete.
»Der Jahreszeit entsprechend sollten unsere Tiere es schon längst aufgestallt sein! Aber der lange milde Herbst zog sich bis in den Dezember hinein und hat uns veranlasst, die Tiere draußen zu lassen. Aber nun ist wirklich der Moment gekommen ... ich muss die Tiere in den Stall bringen und zwar schnell!«, dachte er.
Ein junger Mann trat vor die Haustür und rief nach dem Alten! Der starke Wind riss ihm die Worte vom Mund und so nahm er seine Hände zu Hilfe, indem er sie zum
Sprachrohr formte. „Großvater, was machst Du da draußen in der Kälte. Komm endlich ins Haus, Du holst Dir noch eine Erkältung an den Hals!“
Der Alte winkte ab.
„Zieh Dir etwas über, Bernárd!“, rief er ihm durch den stürmischen Wind zu und schloss die knarrende Stalltür. „Ich brauche Dich! Wir müssen die Ziegen und Schafe von der Koppel holen. Sie können nicht mehr dortbleiben und … bring den Hund mit!“, schrie er, um
das Geheul des Windes zu übertönen.
Eine Windböe fegte über den Hang und ließ erneut diesen schaurigen und dumpfen Ton über den Waldrand streichen. Der Alte wies mit seiner behandschuhten Rechten auf den Giebel des Wohnhauses, den ein stilisierter Stern aus gebranntem Ton schmückte. Der Stern wies mehrere eigenartig angeordnete Löcher und Schlitze auf, denen der Nordostwind jene schaurigen Töne entlockte.
„Der Wolfsziegel heult, Söhnchen!“, rief er das grausige Heulen übertönend.
„Es dauert nicht mehr lange und der graue Räuber ist da! Er wird dann bald Hunger haben! Die Schafe sind jetzt eine zu leichte Beute für ihn! Lange genug waren sie auch draußen!
Los, beeile Dich!“
Der junge Mann verschwand im Hause und kehrte kurz darauf zurück. Er hatte sich einen dicken Halbpelz übergeworfen und ebenso eine dicke Mütze aufgesetzt. Ihm auf dem Fuße folgte ein riesiger Patou, ein weißer Herdenhund.
Der Alte warf dem jungen Mann ein paar aus Weidenruten geflochtene Schneetreter zu. Als sie diese mithilfe der Riemen an die Füße geschnallt hatten, machten sich die beiden Männer mit dem Hund auf den Weg zu der nicht weit entfernt liegenden Koppel am Hang des Berges.
Am Waldrand, in der Nähe der Koppel, fanden sie bereits die erste Wolfsspur. Der alte Mann hockte sich hin und betrachtete aufmerksam die Trittsiegel im Schnee.
„Siehst Du sie?“, er räusperte sich laut und wischte sich über die Augen. „Er ist also schon da! Das ist die Fährte eines Rüden, eines Einzelgängers. Die Spur ist ganz frisch! Es ist hohe Zeit unsere Tiere in Sicherheit zu bringen!“, rief der Alte seinem Enkel zu richtete sich auf und stapfte weiter durch den Schnee.
„Woher weißt Du, dass es ein Rüde ist?“, schrie Bernárd und betrachtete die Trittsiegel im Schnee. „Ich sehe es an seinen Markierungen, eine Fähe tut so etwas nicht!“
Der alte Mann wies auf die deutlichen Spuren, die der Wolf an den Bäumen hinterlassen hatte.
„Er hat jetzt schon sein Revier abgesteckt! Der Rüde treibt sich hier ganz in der Nähe herum, sonst wäre die Spur bereits zugeweht. Noch hat er vor dem Menschen eine gewisse Scheu … noch! Aber das ändert sich mit
dem Hunger, Söhnchen!“, schrie er dicht am Ohr des jungen Mannes. Der Alte verfolgte mit den Augen die Fährte, die im Wald verschwand und murmelte in
seinen Bart: „Er beobachtet uns, er ist ganz in der Nähe!“
Der Hund wirkte nervös. Er nahm die Spur auf und wollte in den Wald verschwinden.
„Bleib hier Brack, der ist noch harmlos! Lass ihn in Ruhe!“, rief ihn der Alte zurück.
Mit einem beleidigten Schniefen kehrte der riesige Patou um. Er verstand nicht, weshalb ihm der Alte die Verfolgung des Wolfes verboten hat.
Brack ist wirklich beleidigt und kehrte seinem Herrn demonstrativ das Hinterteil zu.
„Komm alter Bursche, lass das!“, fuhr ihn der alte Mann grinsend an und der Hund gehorchte, trotzdem schniefte er beleidigt.
Das Schneetreiben wurde stärker.
Streckenweise sahen sie nicht mehr die Hand vor den Augen. Der Wind blies jetzt recht unangenehm und drang sogar unter die dicken Halbpelze.
Endlich waren sie an der Koppel angelangt. In der Einzäunung drängten sich ein Dutzend Schafe und zwei Ziegen dicht zusammen. Sie trotzten so dem Schneetreiben, in dem sie ihre Hinterteile dem Wind zukehrten. Nur der Schafbock war wachsam und behielt die Gegend im Auge. Er war, im Gegensatz zum Rest der kleinen Herde, unruhig. Anscheinend hatte er den Wolf bereits gewittert.
Doch der Wolfsrüde schien wirklich noch ein Einzelgänger zu sein. Weitere Spuren waren im frischen Schnee nicht zu auszumachen. Zur Rudelbildung war es wohl noch zu früh. Aber der Wind blies immer stärker, er mauserte sich anscheinend zum Schneesturm.
Der Hunger der Wölfe wird es richten! Der Bock spürt das, er trommelt unruhig mit den Hinterläufen gegen das Gatter. Die Wölfe werden sich dann schnell in einem Rudel zur Jagdgemeinschaft zusammenfinden!
„Großvater!“, brach der junge Mann das Schweigen und er musste sich anstrengen, denn der stärker werdende Wind riss ihm fast die Worte vom Munde.
„Wer hatte denn eigentlich die Idee mit dem Wolfsziegel?“, schrie er und schaute hinauf zum Haus, von wo aus noch immer das schaurige Heulen zu vernehmen war.
„Das ist eine lange Geschichte, mein Junge!“, schrie der Alte zurück, öffnete das Gatter und scheuchte die kleine Herde aus der Einzäunung. Der Hund hob seinen mächtigen Schädel und sah aufmerksam zu seinem Herrn auf. Der alte Mann machte nur eine Handbewegung und der Hund wusste, was er zu tun hatte. Er trieb die Tiere bergauf in Richtung des Hauses. Willig lief die kleine Herde auf das Haus zu, als ahnte sie, dass sie dort in Sicherheit ist. Der Patou hatte mit ihnen keine Mühe. Er trottete gemächlich hinter ihnen her. Um nicht so schreien zu müssen trat er dicht an seinem Enkel heran.
„Du weißt ja, unsere Vorfahren stammen aus den Pyrenäen. In den Bergen sind dort diese Arten von Wolfsziegeln fast an jedem Haus angebracht. Sie warnen die Menschen vor dem strengen Frost, den der Nordostwind mitbringt und mit der damit einhergehenden Gefahr durch Wölfe! Daher auch der Name ‚Wolfsziegel’! Unsere Sippe musste das auch erst lernen. Nach ihrer Vertreibung aus der Picardie mussten sie sich anpassen und die Gepflogenheiten der Bergbauern in den Pyrenäen annehmen. Dazu gehörte auch der Umgang mit den Wölfen, vor allen Dingen im Winter. Die Bergbauern kannten deren Lebensgewohnheiten in dieser rauen Zeit und sie richteten sich darauf ein.
Der strenge Frost und der hohe Schnee rauben dort dem Wolf nämlich die Nahrungsquellen. Das Wild ist abgewandert in tiefere und wärmere Regionen und die Wölfe drängten sich jetzt näher an die menschlichen Behausungen in den Bergen, nur um etwas Fressbares zu finden! Sie verlieren dann ihre Scheu vor den Menschen, denn sie wittern deren Tiere, auch wenn sie aufgestallt sind!“
Der Alte schloss seinen Pelz bis oben hin und zog die Klappen der Mütze über die Ohren.
„Hier bei uns ist es nicht ganz so tragisch, aber der Graue ist ein schlaues Tier. Er nimmt sich, was ihm vor die Schnauze gerät! Und wo es ihm keine Mühe macht, wären unsere Tiere in der Koppel ein Festschmaus für ihn!“
Der starke Wind mauserte sich tatsächlich, langsam aber sicher, zum Sturm und peitschte unerbittlich gegen den Waldrand. Die Äste der Bäume bogen sich jetzt schon bedrohlich, aber noch schüttelte der Sturm die feuchte Schneelast immer wieder ab.
Es wurde durchaus höchste Zeit, die Tiere in den Stall zu bringen, denn die Dunkelheit ließ auch nicht mehr lange auf sich warten.
Während sie durch den Schnee stapften, erzählte der alte Mann seinem Enkel die Geschichte vom Wolfsziegel: „Irgendein Mensch hatte vor Hunderten
von Jahren in den Bergen der Pyrenäen die Idee mit dem Ziegel. Bei seinen Beobachtungen ist ihm aufgefallen, immer wenn der Wind aus Nordost kommt, bringt er zu dieser Jahreszeit die Kälte und den Schnee mit … und die Wölfe! So erzählen es die Leute in den Bergdörfern. Dort sind die Wölfe noch heute das Problem für die Menschen“.
Der Alte machte dem Hund wieder eine Handbewegung und leitete ihn so auf die Schneeschuhspur, dann erzählte er weiter:
„Am Türstock seines Hauses hing eine Kalebasse, die er aus einem Flaschenkürbis hergestellt hatte. Als wieder einmal eine starke Windböe über die Öffnung des Flaschenhalses der Kalebasse strich, kroch ein dumpfer Ton aus dem Flaschenkörper. Es war eigentlich reiner Zufall, dass sie genau im richtigen Winkel hing. Aber so entstand in seinem Kopfe die Idee, die gerade gemachte Erfahrung für den Schutz der Menschen zu nutzen. Also formte er aus Lehm etwas Ähnliches nach, brannte das Gebilde und fügte es in seinen Hausgiebel ein. Siehe da ... der scharfe Nordost kam und es funktionierte. Lauter und tragender, als der Ton aus der Kürbiskalebasse, schallte dieser neue Ton von seinem Giebel her über die Häuser des Bergdorfes! Seine Idee verbreitete sich rasch unter den Leuten. Bald darauf war er in den unterschiedlichsten Formen überall an den Häusern der Menschen zu finden! Die abergläubigen Bergbauern hatten die merkwürdigsten Einfälle bei der Gestaltung der Wolfsziegel.
Hauptsache aber sind die Öffnungen. Die geben mit der richtigen Windrichtung die verschiedensten Töne von sich!“
Der alte Mann bemühte sich, mit lauter Stimme das Sturmgeräusch zu übertönen.
„Die Menschen mussten beim Einbau des Ziegels nur den richtigen Winkel und die Himmelsrichtung beachten! Deshalb ist der Stern auf unserem Haus auch in der Himmelsrichtung so ausgerichtet, dass nur der Nordost die Töne in ihm erzeugen kann!“
Die Schneeflocken wurden immer dichter. Vermischt mit Eispartikeln wurden sie regelrecht zur Qual auf der ungeschützten Haut. Sie mussten sich beeilen.
Der Hund trieb die Schafe durch den Schnee auf der verwehten Schneeschuhspur der beiden Männer. Die kleine Herde lief willig und blieb zusammen. Der Bock witterte den sicheren Stall.
Sie erreichten den Hof und der Alte öffnete die Stalltür. Der Patou trieb die Tiere hinein. Die beiden Männer versorgten sie mit frischem Heu und Wasser.
Der Alte zeigte dem jungen Mann noch die Schwelle, die vor der Stalltür den Abschluss bildete. Die Schwelle zum Stall war im Ganzen aus einem Granitblock geschlagen, der tief in den Boden eingelassen und befestigt war.
„Auch so eine Erfahrung unserer Vorfahren! Der Graue kann sich nicht darunter hindurch wühlen!“, sagte er und verschloss die feste Tür mit einem starken Querriegel, den er noch mit einem Splint an einer Kette sicherte.
Bernárd schaute auf den Patou, der sich auf einmal merkwürdig gebärdete. Er gab laut und heftig ein warnendes Knurren von sich.
Dieses Knurren ließ ihn aufmerksam werden. Er starrte durch das Schneetreiben talwärts und bemerkte im dichten Schneegestöber einen Schatten, dessen Silhouette einem Reiter ähnelte und der sich auf dem bereits halbdunklen Karrenwege langsam auf das Haus zu bewegte.
Er stieß den Alten an:
„Großvater! Schau mal! Kommt dort ein Reiter?“ Die beiden Männer hatten Mühe im Schneegestöber den Schatten als Reiter auszumachen. Als er aber den dunklen Waldsaum verließ, erkannten sie, es war tatsächlich ein Reiter.
„Merkwürdig! Großvater, sieh mal, wie der auf seinem Gaul hängt … er scheint verletzt zu sein!“, schrie der junge Mann durch die Sturmgeräusche und streckte den Arm in die Richtung, aus der mühsam ein Pferd durch den Schnee auf sie zu stapfte.
Der Hund an ihrer Seite zog die Lefzen hoch und knurrte lauter. Er witterte etwas Fremdes.
„Ruhig Brack, ruhig!“, brummte der Alte und klopfte dem Hund den Hals. „Es ist gut Brack!“
Der Hund beruhigte sich und schaute zu dem Alten auf. Aus dem Schneetreiben schälte sich, jetzt gut erkennbar, ein Reiter heraus, der merkwürdig verkrümmt auf der Kruppe seines Tieres hing.
„Geh ins Haus, Junge, sag der Großmutter, sie soll Wasser heißmachen. Wenn der Reiter verletzt ist, braucht er anscheinend unsere Hilfe und komm gleich wieder zurück!“, sagte der Alte und schob seinen Enkel sanft zum Eingang des Wohnhauses hin.
Er begab sich in den Windschatten des Hauseinganges, um besser sehen zu können. Das Pferd bewegte sich mühevoll durch den höher werdenden Schnee auf ihn zu.
Der Alte wunderte sich.
»Ein Reiter jetzt und zu dieser Jahreszeit?«
Eigentlich führte nur ein schmaler Karrenweg zu seinem Anwesen auf dem Heideberg, gerade breit genug, dass ein Gespann durch den dicht stehenden Wald hindurchkam. Nur selten verirrte sich ein Mensch in diese einsame Gegend hier, in der sich sein Hof befand und schon gar nicht bei diesem Wetter. Sein Vater, schon damals im gesetzten Alter, hatte diesen Platz, gemeinsam mit einem Freund, lange vor ihrer Flucht aus Prag, bewusst ausgewählt. Fernab der großen Orte und geschützt durch den jahrhundertalten Wald, der sie vor zudringlichen Blicken verbarg.
»Vater wollte für mich und Maria damals schon eine sichere Heimstatt schaffen, bevor er nach Prag zurückkehrte. Die Predigten des Jan Hus schufen eine Menge Zündstoff in der Universität. Es rumorte unter den Studenten! Er wollte uns und unser Kind in Sicherheit wissen!«, erinnerte sich der Alte. »Vater und Großvater hatten angesichts der Familiengeschichte der d´Moreau immer die Gefahr im Auge, die das Geschlecht über die Jahrhunderte begleitete. Und die Wahl mit dem ‚Heideberg‘ war nicht schlecht!« schloss er die Gedanken.
Der nächste Handelsweg, die ‚Via regia’, war einige Meilen entfernt von hier und führte westlich von Görlitz über den Pass der Königshainer Berge. Von unten aus dem Dorf kamen lediglich die von Gersdorffs zu Besuch und einige alte Freunde aus Görlitz, aber auch die kamen nur im Frühjahr oder im Herbst, wenn sie zur Jagd in die nahen Wälder aufbrachen.
Im Winter verirrte sich fast niemand hierher.
Deshalb verwunderte ihn diese Erscheinung auf dem Karrenweg. Gespannt sah er auf den Reiter, der zusammengesunken auf der Kruppe des Pferdes lag. Er schien ohne Bewusstsein zu sein. Das Pferd scheute, als der große Hund zu ihm hinlief. Der alte Mann fiel dem Tier in die Zügel und brachte es zum Stehen.
„Ruhig mein Guter! Der tut dir nichts!“, redete er dem Tier zu. So wie es aussah, hatte sich der Mann mit einigen Riemen selbst festgebunden, um nicht vom Pferd zu fallen.
„Bernárd!“, rief der Alte und drehte sich dem Haus zu. „Bernárd! Komm hilf mir!“
Vorsichtig löste er die Riemen, mit denen sich der Reiter am Sattel angeschnallt hatte. Als dann der alte Mann ihm die Zügel aus den steifen Händen nahm, glitt der Reiter fast von allein aus dem Sattel.
Bernárd sprang herzu und fing den herabgleitenden Mann auf. Jetzt erst sahen die beiden Männer, dass der Reiter wirklich verletzt war. Es schien eine arge Verletzung zu sein. Die linke Schulter war blutverkrustet.
„Dem haben sie einen Schuss beigebracht. Die Wunde ist nicht mehr frisch, aber gewaltig. Die Kugel hat ein großes Loch in seine Schulter gerissen, er hat viel Blut verloren. Anscheinend reitet er damit schon eine ganze Weile herum!“, knurrte der Alte und umfasste vorsichtig den Oberkörper des Reiters. Der Junge nahm die Füße und so trugen sie den Verletzten ins Haus.
Kurz darauf kam der junge Mann zurück und brachte das abgetriebene Tier des Reiters in den Stall. Er versorgte es dort mit Wasser und Futter, löste den Bauchgurt und nahm ihm den Sattel und die Satteltaschen ab. Dabei entdeckte er das Görlitzer Wappen auf der Schabracke.
Mit einem Bündel Stroh rieb er das Tier trocken.
Seine Aufmerksamkeit aber erregte eine Lederrolle, die an der rechten Satteltasche befestigt war. Er musterte die Rolle. Die Kappe der Rolle ist mit einem Band verschlossen, an dem ein großes Siegel hängt. Neugierig untersuchte der junge Mann dieses seltsame Siegel. Fremde Schriftzeichen umgaben einen Kelch, der von einem Dornenkranz umschlossen wurde.
»Das Siegel … die Teile auf dem Siegel kenne ich, die habe ich schon einmal gesehen«, dachte er, »aber schwarzer Siegellack? Der wird hier bei uns gar nicht verwendet!« Immer wieder schaute er auf das Siegel und schüttelte verunsichert den Kopf. Es wollte ihm nicht einfallen, wo er dieses Siegelbild schon einmal gesehen hatte.
Bernárd nahm die Satteltaschen nebst Rolle und trug beides ins Haus.
Im Haus bot sich ihm ein seltsamer Anblick.
Auf der nicht gerade breiten Ofenbank neben dem Kamin lag der Mann, noch immer bewusstlos, aber mit freiem Oberkörper. Über ihm kniete sein Großvater, assistiert von der Großmutter. Er entfernte mit einem spitzen Messer und einer Ahle die platt gedrückten Reste einer Bleikugel aus dessen linker Schulter.
„Es wurde höchste Zeit das Ding herauszuholen!“, sagte der Alte mehr zu sich selbst als zu den anderen.
Es klackte laut, als er das letzte große Bleistück in den neben ihm stehenden Holzbottich warf.
„Dabei hatte er noch Glück im Unglück! Anscheinend haben der dicke Umhang und sein Brustpanzer die Wucht der Kugel abgemindert. Sonst wären die Knochen in der Schulter zerschmettert. Aber so ist ein Teil der platt gedrückte Kugel im Fleisch stecken geblieben und hat natürlich ein großes Loch gerissen“.
Mit einem Stück sauberen Leinen tupfte er das Blut von der Schulter des Verletzten und schaute noch einmal auf die große Wunde und untersuchte die Wundränder.
„Ich glaube, sie hat sich schon entzündet … aber Deine Großmutter bekommt das schon wieder hin!“, brummelte er. Als er das verblüffte Gesicht seines
Enkels sah, schmunzelte der Alte.
Bernárd bekam von der wortkargen Großmutter eine Kanne heißen Wassers in die Hände gedrückt. Ihr Kopfnicken deutet ihm, was er damit tun sollte.
Er goss das Wasser über die Hände seines Großvaters. Mit Seifenkraut wusch der sich gründlich die blutigen Hände über dem Holzbottich, in dem die herausgeschnittene Kugel lag, und trocknete sie mit dem bereitgehaltenen Handtuch ab.
„Sie ist eine Künstlerin Deine Großmutter, eine begnadete Heilerin“, sagte er und wedelte mit dem Handtuch. „Die Großmutter hat schon in jungen Jahren Kranke geheilt, von denen alle glaubten, die würden das Zeitliche segnen! Sie leben heute noch und sind
gesund!“, sagte er grinsend und hängte das Handtuch zum Trocknen an einen Haken neben dem Herd.
„Das unterscheidet Deine Großmutter von den bescheuerten Quacksalbern, die jetzt auf allen Märkten anzutreffen sind, die aus Ziegenscheiße Pillen drehen und die sie den Leuten als Wundermedizin verkaufen.
Ein ernsthafter Heiler ist nicht gleichzusetzen mit einem dieser Wunderheiler vom Markt!“ Der Alte schob seinen Enkel zur Seite und deutete auf den Holzbottich.
„Ihre Kenntnisse in der Heilkunst hat Deine Großmutter von klein auf erworben, mein Junge“, sagte der alte Mann und grinste wieder.
„Schau mal!“
Er zeigte auf den Folianten auf dem Wandbord.
«Causae et curare», las Bernárd mühsam die verwischte Goldschrift auf dem Rücken des Folianten.
„Was heißt das Großvater?“
Der Alte antwortete ihm mit einem Blick auf seine schmunzelnde Frau, der das anscheinend gar nicht so recht war, was ihr Mann von sich gab.
«Ursachen und Heilung», das ist Latein, Söhnchen! Eine Niederschrift der Meisterin vom Ruppertsberg, Hildegard von Bingen, eine Benediktinerin. Darin studiert Deine Großmutter noch immer, wenn sie Rat sucht!“
„Er ist einer von den Görlitzern!“, murmelte der junge Mann unvermittelt und nickte mit dem Kopf zu dem Verwundeten hin. Der Alte sah ihn fragend an.
„Auf seiner Schabracke führt er das Görlitzer Wappen und außerdem hatte er das hier bei sich!“
Der junge Mann legte die Rolle auf den Tisch, an dessen Ende das Siegel zu sehen war. Der alte Mann nahm die Rolle auf und betrachtete das Siegel. Er war ein wenig misstrauisch und drehte die Rolle in den Händen.
„Das ist ein Ketzersiegel!“, stellte der alte d´Moreau erschrocken fest.
„Was? Woher weißt du das, Großvater?“
Der alte Mann legte die Rolle ab, drehte sich um und holte mehrere Papiere aus der Kommode und legte sie vor dem Enkel auf den Tisch.
„Das sind die sogenannten vier Prager Artikel der Ketzer. In Deutsch … es gibt sie noch in lateinischer und tschechischer Sprache. Siehst du dort den Kelch mit dem Dornenkranz? Er ist ihr Symbol! Mein Vater hat das Papier damals aus Prag mitgenommen!“
Bernárd warf einen flüchtigen Blick auf das Traktat und sah das Wappen am oberen Rand.
Dann traf es ihn wie ein Blitz! Jetzt erkannte er es deutlich. Jetzt erinnerte er sich wieder. Das war das Wappen auf dem Brustharnisch des Ritters in Ebersbach.
Das Wappen der Ketzer!
Bernárd wurde leichenblass.
„Großvater! Das Wappen auf dem Siegel … ich habe es schon einmal gesehen … damals in Ebersbach!“, stotterte er.
Da war es wieder!
Der Alte d´Moreau erwartete eine weitere Antwort seines Enkels, aber Bernárd brach diese Seite des Gesprächs rigoros ab. Die Blässe verschwand aus dem Gesicht und wich einem kräftigen Rot. Nach einer Weile begann er unvermittelt.
„Er scheint aber ein Görlitzer zu sein!“, sagte Bernárd sehr bestimmt, „seine gesamte Ausrüstung deutet daraufhin, nur eben diese Rolle nicht!“
Erleichtert, weil das Gespräch eine andere Richtung nahm, nickte der Alte und sagte:
„Dann ist er Gott sei Dank keiner von den Schnapphähnen der Hussiten, die sich hier wieder seit einiger Zeit wieder in der Gegend herumtreiben!“
Er besah sich das Siegel noch einmal genauer. Er hatte keine Zweifel mehr und legte die Rolle auf den Tisch zurück.
„Das allerdings ist tatsächlich das Siegel der Ketzer! Aber wie kommt ein Görlitzer Reiter zu dieser Rolle ... und wohin wollte er damit?“, fragte er und deutete auf den Kelch im Siegellack.
„Nur Hussiten, von ihnen nur die Táboriten verwenden derartige Symbole, Junge! Kelch und Dornenkranz sind hier deutlich auf dem Siegel zu sehen!“
Der Alte legte die Hände auf den Rücken und wanderte ruhelos vor der Liegestatt des Verwundeten hin und her, immer wieder einen Blick auf dessen bleiches Gesicht werfend.
Auch der Junge schwieg nachdenklich.
„Hättest du denen auch geholfen?“, fragte Bernárd unvermittelt, nahm die Rolle auf und und drehte sie in den Händen. Die Frage traf den alten Mann völlig unvorbereitet. Der Alte schaute Bernárd merkwürdig an und verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
„Was meinst Du damit? Hättest du denen auch geholfen!“, ahmte er seinen Enkel nach und fuchtelte aufgebracht mit den Händen.
„Was soll diese blöde Frage, Bernárd?“, er sah seinen Enkel von unten her an.
Aber Bernárd schwieg zu dieser Antwort seines Großvaters. Der Alte rollte das Traktat wieder zusammen und legte es in die Kommode zurück.
„Höre, Söhnchen!“, sagte er und wurde sehr ernst dabei, „und vergiss es nie wieder! Menschen in Not darf man nicht im Stich lassen! Das ist nicht nur Christenpflicht, das ist eine Frage der Menschenwürde! In dieser unruhigen Zeit wird das leider von den Menschen vergessen! Ein Mensch an sich genießt Freiheit und Würde, ohne Ansehen der Person und des Glaubens. Dazu gehören eben auch uneigennützige Hilfe für Menschen in Not und die Achtung des Lebens. Das ist meine Überzeugung! Mein Vater und mein Großvater haben mich dies gelehrt! Und … ich dachte, es Dir ausreichend beigebracht zu heben. Anscheinend hast Du´s nicht richtig begriffen, Bursche!“ Der Großvater zuckte betroffen zurück, als er die Antwort seines Enkels vernahm.
„Freiheit und Würde … was ist mit den Ketzern Großvater! Sie tun uns doch genau das Gegenteil an!“,fetzte der Junge heraus, bückte sich nach dem Bottich wollte gehen, aber der Alte fügte noch einen Satz so bestimmt hinzu, dass es diesmal dem Jungen die Sprache verschlug.
„Die Unfreiheit der Menschen ist nicht gottgewollt, wie die Mächtigen es dem kleinen Mann immer wieder einreden! Die Unfreiheit ist von Menschen gemacht! Auch die Ketzer wissen das, aber es gibt Menschen unter ihnen, die das nicht respektieren. die die Würde des Menschen mit Füßen treten! Unser Geschlecht musste für diese Erkenntnis über die Jahrhunderte büßen, Bernárd!“
Beschämt schlug der Junge die Augen nieder legte die Rolle auf den Tisch zurück und räumte wortlos die schmutzigen Tücher weg. Den Bottich nahm er auf und trug ihn hinaus.
Der Alte sah ihm lächelnd nach.
»Er ist eben noch jung, ein ungeschliffener Diamant«, dachte er, »aber das gibt sich noch. Hoffentlich erhält mir der Allmächtige noch einige Zeit das Leben, damit ich ihm zur Seite stehen kann!«
Die Tür klapperte. Bernárd kam zurück, stellte den gereinigten Bottich weg und schockte den Alten erneut, indem er das Gespräch wieder auf die Ebersbacher Ereignisse lenkte.
„Aber mit uns hätten die Hussiten nicht solchen Aufwand betrieben, Großvater … uns hätten sie geschlitzt oder erschlagen … wie sie es mit Mutter und Vater getan haben!“, fetzte es böse aus dem jungen Mann heraus und diese Bemerkung riss den alten Mann abrupt aus seinen Gedanken.
Er zuckte zurück.
In den Augen des Jungen funkelte der Hass.
Der Ausdruck in den Augen des Jungen jagte dem alten Mann kalte Schauer über den Rücken. Der Verlust seiner Eltern hing dem jungen Mann gewaltig an und es würde wohl bestimmt noch eine geraume Zeit dauern, bis er diesen schmerzhaften Verlust verarbeitet hat ‐ wenn überhaupt. »Aber dieser Hass, seelisch völlig zusammengebrochen war das Kind, als der Ebersbacher Reiter ihn zu uns auf den Berg brachte«, erinnerte sich der alte Mann traurig und sein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse.
»Der Junge hat viel Furchtbares erlebt, wenn sich das so in seinem Kopfe festgefressen hat! Warum spricht er nach so vielen Jahren nie darüber, er muss es doch einmal loswerden!«
Der Alte raffte sich auf und unterbrach damit die ungewollte Stille zwischen ihnen.
„Ich … das heißt wir“, er zeigte auf die Großmutter, „wir haben noch nie, und das kannst du dir merken, wir haben noch nie einen Menschen, der in Not war, im Stich gelassen!“
Der alte Mann wollte noch etwas sagen und hatte schon den Mund geöffnet, aber er kam nicht mehr dazu. Er wurde plötzlich von seinem Enkel so rasch daran gehindert, dass er sich erschrocken auf den Schemel setzte und den Mund wieder zuklappte. So hatte sich Bernárd ihm gegenüber noch nie verhalten.
„Ich will Dir etwas sagen, Großvater!“ Bernárd hatte die Hände in die Hüften gestemmt. In seinen Augen funkelten Hass und Wut.
„Einer mit diesem Zeichen auf der Brust hat das Massaker in Ebersbach befohlen, Großvater ... und denen hättest du geholfen? fauchte der Junge und starrte den Alten an.
„Das begreife wer will, ich jedenfalls nicht!“
Diese Feststellung Bernárds stand wie ein Berg im Raum und harrte einer Antwort. Der alte Mann erhob sich mühsam vom Schemel und so standen sich beide wie unversöhnlich gegenüber.
Auch Bernárd war verblüfft über den plötzlich veränderten Gesichtsausdruck seines Großvaters. Das Gutmütige war während dieser Widerrede aus seinem Gesicht verschwunden und machte einer Entschlossenheit Platz, die Bernárd erstaunte. Richtiggehend verändert hatte sich der sonst so gutmütige Gesichtsausdruck des Alten, er war hart und unnachgiebig geworden. Der Alte drehte sich um, schlurfte zum Herd und nahm sich einen Becher Tee aus dem kleinen Topf.
„Wenn du damit Probleme hast, Junge, dann rede gefälligst mit uns!“, sagte er, bemüht, seiner Stimme einen ruhigen Klang zu geben. Doch Bernárd drehte sich wütend um und sah seinen Großvater an.
„Reden … reden, immer nur reden! Ja, Großvater! Ich habe damit Probleme und die kannst Du mir nicht ausreden!“, entfuhr es bitter Bernárds Mund, und dann fuhr der nächste Satz wie ein Peitschenhieb auf den Alten nieder: „Du warst nicht dabei, als sie Deinem Sohn, meinem Vater, das Gehirn aus dem Schädel geprügelt haben … mit dem Dreschflegel, viehisch ... mit dem Dreschflegel, Großvater!“ Bernárd japste nach Luft.
Seine Stimme wurde nun etwas ruhiger und er sagte etwas leiser: „Vielleicht würdest Du dann anders reden!“ Bernárd schluckte schwer.
„Und Mutter …“ Bernárd drehte sich weg, er wollte nicht, dass der Großvater die aufsteigenden Tränen sah. Der alte d´Moreau erwartete weitere Worte von seinem Enkel.
Doch Bernárd schwieg verbissen, für ihn hatte sich der Disput erledigt.
„Bernárd, Junge! Wir müssen darüber reden. Du kannst nicht alles in dich hineinfressen! Warum kapierst Du das nicht?“
Bernárd antwortete nicht.
Er sah nur seinen Großvater aus vorwurfsvollen Augen an und verließ das Haus. Der Alte zuckte zusammen, als die Tür ziemlich hart zuschlug. Er stellte den Becher weg, den er noch immer in der Hand hielt und ließ seinen Erinnerungen freien Lauf.
»Der Reiter, Rudolf von Gersdorff, war damals selbst völlig am Ende, als er hier auf dem Heideberg eintraf. Er, seine Tochter und mit ihnen Bernárd, konnten sich nur durch eine abenteuerliche Flucht vor den Hussiten retten. Sie haben sich nach Königshain zu seinem Vetter durchgeschlagen und das, obwohl auch Königshain von den Ketzern heimgesucht wurde und an allen Ecken und Enden brannte. Sie hatten damals einfach Glück im Unglück, weil die Hussiten das Rittergut mit dem wehrhaften Steinstock mieden, aber wie lange wird das noch sein? Irgendwann kehren die Unholde zurück! Die Anzeichen mehrten sich, dass sie wieder unterwegs sind«.
Er sah zu dem Verwundeten hin, der sich stöhnend zu drehen versuchte und wischte ihm den Schweiß von der Stirn. »Vater und Tochter sind dann später weitergezogen, nach Baruth. Das Schloss Baruth gehört Nicolaus Pak von Gersdorff einem Bruder Rudolfs. Das Schloss selbst soll von einem Herrn von Gersdorff bereits vor vierhundert Jahren erbaut worden sein, erzählte mir Rudolf und es ist ebenfalls wehrhaft. Er wähnte sich und die Tochter dort in Sicherheit. Doch bevor sie weiterzogen, brachte Rudolf von Gersdorff den Jungen zu uns, zu seinen Großeltern auf den Berg«.
Der alte Mann wischte sich über die Augen und seufzte. »Ohne Rudolf von Gersdorff wäre wohl das Geschlecht der d´Moreau ausgelöscht«, dachte der Alte d´Moreau und ein Gefühl der unendlichen Dankbarkeit durchflutete ihn.
In kurzen Zügen hatte damals Rudolf von Gersdorff dem Alten über die Geschehnisse in Ebersbach berichtet, aber eben nur in kurzen Zügen. Rudolf von Gersdorff nahm bestimmt an, dass der Enkel alles Weitere erzählen würde.
»Aber Bernárd schweigt, seit Jahren schweigt er verbissen. Bernárd ist hochgradig traumatisiert. Wenn jemand ihn auf die Ereignisse in Ebersbach anspricht, verschließt er sich und sucht irgendwo die Einsamkeit«, schloss der Alte betrübt. »Das geht auf Dauer nicht gut aus«, grübelte er und ging müde zum Herd.
Er und seine Frau wollten den Enkel nicht bei jeder Gelegenheit daran erinnern, was mit seinen Eltern geschah. Sie wollten damit verhindern, dass sich der Hass in ihm entfaltete, er ist doch noch jung.
Aber das Gegenteil schien der Fall zu sein.
Mit jedem Jahr des Älterwerdens steigerte sich der Hass in ihm, der Hass auf die Hussiten. Schuld waren wie immer die abscheulichen Nachrichten über die Gräueltaten der Waisen und der Táboriten, die in Königshain eintrafen und die hin und wieder auch den Berg erreichten und ... die den inneren Hass in Bernárd jedes Mal neu anfachten. Der alte Mann schüttelte sich.
»Bernárd muss sich den Frust von der Seele reden ... er muss, sonst geht es einmal böse für ihn aus!«, dachte er und sah zu seiner Frau hinüber.
Aufmerksam hatte die alte Frau das Gespräch und dem sich anschließenden Disput verfolgt und sie lächelte still in sich hinein. Die Bewunderung ihres Mannes um ihre Heilkunst machte sie stolz.
Doch dann verfinsterte sich ihr Gesicht.
Die letzten Bemerkungen ihres Enkels machten auch sie betroffen.
»War das schon wieder der Hass, der aus ihm sprach?«, dachte auch die alte Frau und machte sich schweigsam daran, die Blessur des Fremden zu versorgen.
»Der Hass treibt alles Menschliche aus dem Körper … aus dem Kopf. Der Hass lässt die Menschen zu wilden Tieren werden … zu Raubtieren!«. Dieser Gedanke kreiste im Hirn der alten Dame und ließ sie wieder nicht los.
»Mein Enkel darf nicht hassen … er darf nicht … Gott will das nicht. Bernárd muss endlich darüber reden. Er muss … so furchtbar es auch für ihn ist, aber er muss reden! Bisher ist nicht ein Ton über seine Lippen gekommen, die ganzen Jahre schweigt er und frisst es in sich hinein«, folgerte die alte Frau besorgt.
»Solange dieser entsetzliche Krieg andauert und die grausamen Nachrichten hier eintreffen, solange wird Bernárd keine Ruhe finden! Ich muss mit Jean darüber reden! Vielleicht war es falsch von uns, sich darüber hinweg zu setzen und einfach zu schweigen!«
Sie sah zu ihrem Mann hinüber, der sich sichtlich beeindruckt von dem heftigen Disput mit dem Enkel am Kamin lehnte und machte sich wieder an die Arbeit. Noch einmal säuberte sie die Wunde, bestrich diese mit einer kühlenden und entkeimenden Arnikapaste und legte dem Verwundeten einen festen Verband an. Von alldem merkte der Verwundete nichts.
Seine Bewusstlosigkeit war so tief, dass er den Schmerz nicht verspürte.
Die Tür klappte und Bernárd kehrte zurück.
Über dem Feuer hing ein größerer Kessel, aus dem es angenehm nach Fenchel und Schlehdorn roch. Die
Großmutter hatte dieses Blutreinigungselexier nach einem nur ihr bekannten Rezept zusammengestellt und kochte es nun für den Verwundeten.
Als sie den fragenden Blick ihres Enkels bemerkte deutete sie auf den Kessel.
„Der Tee wird ihm das schlechte Blut aus dem Körper treiben und es reinigen … das hat diese verfluchte Bleikugel hinterlassen. Blei ist schlecht für den Körper, es vergiftet das Blut. Er hat schon eine beginnende Sepsis. Hauptsache ist, er bekommt kein hohes Fieber dazu!“, flüsterte sie ihrem Enkel zu und füllte den heißen Tee in einen Becher. Das gütige Gesicht der Großmutter wurde von Sorgenfalten durchzogen, als sie auf den Verletzten schaute.
Schweißperlen traten auf dessen Stirn.
„Ich glaube das Fieber hat ihn schon tüchtig erwischt. Ich gebe ihm etwas zu trinken [ sofort!“, sagte sie gebieterisch als sie die sich mehrenden Schweißperlen auf dessen Stirn sah. Sie holte vom Wandbord eine Tonflasche herunter und füllte daraus eine dicke grüne Flüssigkeit auf einen großen Löffel.
„Richte ihn auf!“, befahl sie dem jungen Mann.
„Er muss das hier schlucken!“
„Was ist das?“, fragte Bernárd.
„Ein Decoctum [ eine Mischung aus Honigtau, Lindenblüten, Holunder, Spierblüten und eingedickten Schlafmohnsaft. Das ist ein Konzentrat und hilft ihm, gegen das aufkommende Fieber anzukämpfen und es wird auch den Wundschmerz lindern!“, antwortete die alte Frau.
Der junge Mann schob die Hand unter den Kopf des Verletzten und wollte ihn gerade aufrichten, als dieser die Augen aufschlug.
Unverständnis war in seinem Blick, als er sich umsah. „Wo bin ich … wer seid Ihr?“, krächzte er mit schwacher Stimme.
„Jetzt schluckt das erst einmal und schwatzt nicht!“, schnurrte ihn die alte Frau an.
Der Mann richtete sich mühsam auf und schob ihre Hand mit dem Löffel beiseite.
„Wie lange bin ich schon hier … wo bin ich? Ich muss sofort weiter!“, stöhnte er und sank mit einem leisen Schmerzenslaut auf sein Lager zurück. Erneut bildeten sich Schweißperlen auf seiner Stirn.
Erst jetzt bemerkte er, dass er mit freiem Oberkörper auf einer nicht gerade breiten Bank lag und, dass seine Wunde wohl versorgt und verbunden war.
„Wenn Ihr nicht vernünftig seid, werdet Ihr nirgendwohin reiten!“, schimpfte die Alte und schob ihm den großen Löffel so furios in den Mund, dass dessen Zähne auf dem Löffel klapperten.
Der Verletzte schluckte folgsam.
Sie schob ihm ein Kissen in den Rücken und drückte ihm den heißen Becher in die Hände.
„Jetzt trinkt diesen Tee, den ganzen Becher und nicht absetzen!“, sagte sie. Gehorsam trank er den heißen Absud in kleinen Schlucken, auch weil er plötzlich das Gefühl hatte, dass diese Menschen ihm helfen wollten.
„Ich muss weiter!“, stöhnte er.
„Bitte, ich muss nach Görlitz! In Görlitz warten sie auf mich! Es geht auf Leben oder Tod! Die Hussiten sind wieder im Anmarsch, … und, zwar die Schlimmsten von ihnen … Táboriten!“, keuchte der Verletzte und sah dabei mit bereits fieberglänzenden Augen auf den alten Mann, der neben der Bank stand.
Als das Wort ‚Táboriten‘ fiel, zuckte Bernárd zusammen und sah aufmerksam zu dem Verwundeten hin. Der Großvater beugte sich zu ihm herunter:
„Nun mal langsam junger Mann! Wer seid Ihr und wen haben wir da draußen aufgelesen? Findet Ihr nicht, dass wir ein Recht dazu haben, es zu erfahren?“
Der Verletzte nickte.
„Ich vertraue Euch!“, krächzte er.
„Hi, hi, hi ... er vertraut uns!“, kicherte der Alte und sah seine Frau an. „Er vertraut uns Marie! Wie findest Du das?“ Der Alte drehte sich zu dem Verwundeten hin.
„Ich fürchte, es bleibt Euch auch gar nichts anderes übrig!“, gluckste er ironisch und gab ihm einen neu aufgefüllten Becher zu trinken.
„Übrigens, ich habe Euch gerade eine Kugel aus der Schulter geschnitten! Ihr hattet unwahrscheinliches Glück, dass die Kugel durch Euren Mantel und den Brustpanzer erheblich abgeschwächt wurde! Es sieht, verdammt noch mal, nicht gut aus mit Eurer Wunde. Ein bisschen müsst Ihr schon Geduld haben!“
Die Großmutter wischte ihm den Schweiß von der Stirn und legte ein feuchtes, kaltes Tuch auf.
Der erneut einsetzende, bohrende Schmerz in seiner Schulter setzte ihm jetzt unwahrscheinlich zu. Das schmerzverzogene Gesicht des Verwundeten sprach Bände. Die körperliche Anstrengung des Rittes und die Verwundung hatten ihm die ganze Kraft aus dem Körper gezogen.
„Der Schmerz wird gleich nachlassen, junger Mann!“, erklärte ihm die alte Dame und wischte ihm erneut den Schweiß von der Stirn.
„Ihr müsst nur etwas Geduld haben, bis die Arnikapaste und das Laudanum wirken!“ Dann ging sie zum Herd und füllte den Becher erneut mit dem Absud auf.
Der Mann richtete sich auf, soweit das er straffe Verband zuließ.
„Ich bin Konrad Petermann aus Görlitz“, sagte er und sah auf die Menschen, die um ihn herumstanden.
„Auf dem Weg nach Görlitz haben mich im Reichenbachschen die Ketzer erwischt, die mich seit Jankowice verfolgten. Ich musste von dort flüchten.
Mein Schwert habe ich, gleich in der ersten Auseinandersetzung mit ihnen, zerbrochen und ich hatte dann nur noch meinen Dolch. Sie aber führten Handrohre und kurze Hakenbüchsen mit sich und feuerten mir hinterher. Irgendwo im Wald hat mir einer von ihnen diese Kugel verpasst!“, platzte es mühsam aus dem Verwundeten heraus, als er sich wieder zurücklehnte.
„Ich bin dann wie irre querfeldein geritten, um denen zu entkommen!“, ächzte er und legte den Kopf auf die Seite. Der Alte räusperte sich und sah fragend zu seiner Frau, die am Herd den Sud für einen neuen Becher abfüllte und die abweisend den Kopf schüttelte.
„Hört zu Konrad Petermann oder wie Ihr euch nennt! In dem Zustand könnt Ihr sowieso nicht reiten und schon gar nicht bei diesem Wetter!“, brach es zornig aus dem Alte über so viel Unvernunft heraus und er drehte sich zum Fenster und zeigte nach draußen.
„Wir haben Schneesturm, einen scharfen Nordost! Ihr könnt nicht reiten!“
Zur Bekräftigung seiner Worte heulte draußen der Wolfsziegel.
„Was ist das?“, fragte der Verwundete.
„Das Heulen? Das ist ein hohler Ziegel, der uns vor dem Wetter und den Wölfen warnt!“, antwortete der Alte. „Ich muss weiter… wenn der Sturm nachlässt …!“, stöhnte der Verwundete.
Er wurde abrupt unterbrochen.
„Nichts da!“, brummelte der Alte entschieden. „Ihr seid dazu gar nicht in der Lage. Ihr könntet nicht einmal in den Sattel steigen! Mein Enkel wird ins Dorf reiten und bei denen von Gersdorff Hilfe holen. Die können einen ihrer Reisigen oder einen Knecht nach Görlitz reiten lassen … wenn das Wetter es zulässt!“
Als Petermann den Namen derer von Gersdorff hörte, schloss er für einen Moment entsetzt die Augen.
„Liegen die nicht in Fehde mit der Stadt?“, krächzte er und trank erneut aus dem Becher den heißen Tee, dem ihm die Alte reichte.
„Weiß ich nicht!“, knurrte der Alte.
„Außerdem ist mir das scheißegal! Wenn es um die Hussiten geht, sind wohl auch die von Gersdorff betroffen! Verwandte von ihnen haben in Ebersbach durch die Ketzer alles verloren [ alles! Nur ihr nacktes Leben konnten sie retten! Die Hussiten haben das Dorf dem Erdboden gleichgemacht!“ Konrad Petermann hörte mitwachsendem Erstaunen zu. „Ebersbach? Wo bin ich denn hier?“, fragte er leise und schloss erneut die Augen.
„Ihr seid auf dem Heideberg angelangt, genauer gesagt auf einem Berg zwischen Arnholdisdorf und dem etwa drei Meilen entfernten Dorf Königshain! Hierher verirrt sich zu dieser Jahreszeit kein Mensch!“ Petermann lehnte sich stöhnend zurück.
„Oh Gott! Da bin ich wohl ganz schön vom Wege abgekommen!“, murmelte er und öffnete wieder die Augen.
„Bedankt Euch lieber bei Eurem Pferd, es ist seinem Instinkt gefolgt, mein Lieber! Das Tier wusste, wo es Menschen findet!“, warf der Alte ein.
Der alte Mann deutete auf den Verband an seiner Schulter. „Mit der Schusswunde in der Schulter ist es überhaupt ein Wunder, das Ihr soweit gekommen seid, Petermann! Der Jüngste seid Ihr ja auch nicht gerade! Außerdem, Ihr hättet unterwegs auch vom Pferd fallen und verbluten können! Irgendwo da unten im Wald währet Ihr dann jämmerlich verreckt! Das Blei in Eurer Wunde hätte Euch vollkommen vergiftet!“ Der alte Mann sah ihn grüblerisch an.
„Hier draußen in der Wildnis hätte Euch um diese Jahreszeit keine Menschseele gefunden!“
Man sah dem Verwundeten an, dass er mit sich rang, dem Alten etwas anzuvertrauen, was er ansonsten nie getan hätte. Der Verletzte richtete die Augen auf den alten Mann. „Bitte … beantwortet mir eine Frage“, er schluckte schwer. „Wer seid Ihr? Ich muss das wissen! Ich muss wissen, wem ich vertrauen kann!“, murmelte er und schloss wieder die Augen. Der Alte unterbrach ihn und in seinen Augen glommen irre Fünkchen, als er das Wort ‚Vertrauen‘ hörte und dem Verwundeten die Antwort gab.
„Ich will es Euch gern verraten, wenn es Euch nutzt. Ich weiß es nicht!“ Er räusperte sich.
„Mein Name ist Jean[Baptiste d´Moreau. Meine Frau Marie und meinen Enkel Bernárd habt ihr bereits kennengelernt. Bernárd wird nach Königshain reiten, wenn der Sturm etwas nachgelassen hat. Seine Eltern sind tot! Wir leben hier auf diesem Berg schon eine kleine Ewigkeit!“