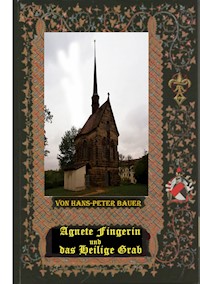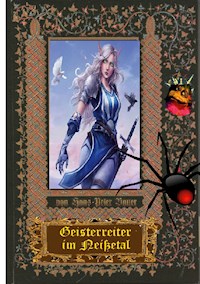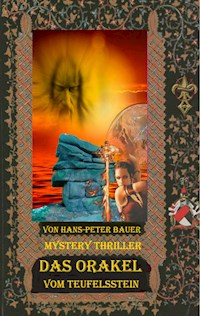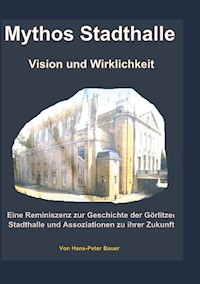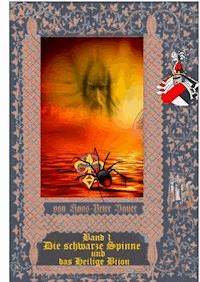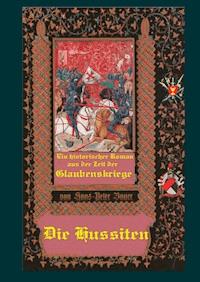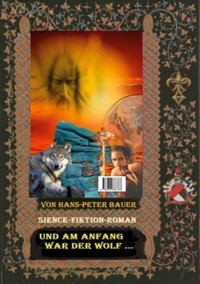
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der vorliegende Science-Fiktion-Roman ist mehr oder
weniger eine Zusammenfassung vergangener
Zeitabschnitte der Stadt Görlitz und ihres Umkreises.
Das E-Book Und am Anfang war der Wolf wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Fantasy, Görlitz, Wolf, Stadtumbau, Heilige Grab
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Wie alles begann
Die Stadt Görlitz
Auf der Mauerbaustelle
Und am Anfang war der Wolf
Auf dem Görlitzer Untermarkt
Sieben Jahre später
Die Burg «Sternenlicht»
Nach dem Studium
Wieder in Görlitz
Im Görlitzer Rathaus
Auf dem Weg nach Gerhardisdorf
Im Schloss derer von Gersdorff
Das orientalische Fieber
Der Medikamentenraum im Schloss Gersdorf
Zurück im Gersdorfer Schloss
Im Gasthof zu den drei Krebsen
In der Jonsdorfer Felsenstadt
Der Herzog der Trolle
Kloster Marienthal
Die Ordensburg Ymir
Kunstinsdorf
Das Ende der Ordensburg
Das Neißespital an der «Via Regia»
Tempelritter in Görlitz
Drei Tage später im Schloss derer von Gersdorff
Viele Jahre danach
Görlitzer Rathaus
Der verhinderte Wächter
Die Heimkehr des Taufkelches
Erfolglos
Nach Hause
Einige Monate später
Der Bau des Heiligen Grabes
Ein trauriger Abschied
Gorlicium Anno 1642
Der Oheim
Das Kreuz auf dem Heideberg
Der Oheim
Erinnerungen und Danksagung
Verwendete Literatur
Prolog
Das nachfolgende ist ein passendes Vorwort zu meinem eigentlichen Prolog
(aber geschrieben hat es Miguel de Cervantes für seinen Don Quichote)
»Müßiger Leser! – Ohne Schwur magst du mir glauben, dass ich wünsche, dieses Buch, das Kind meines Geistes, wäre das schönste, lieblichste und verständigste, dass man sich nur vorstellen kann. Ich habe aber unmöglich dem Naturgesetz zuwiderhandeln können, dass jedes Wesen sein Ähnliches hervorbringt; was konnte also mein unfruchtbarer, ungebildeter Verstand anders erzeugen als die Geschichte…«
Ich empfinde dieses Vorwort Miguel de Cervantes zu seinem Buch so treffend zum Thema meines Buches, das ich es dem eigentlichen Prolog voranstelle.
Friedrich Carl von Gersdorff hatte einen Traum.
«Er war auf dem Weg von seiner Stadtwohnung auf der Webergasse zum Gasthof zu den »Drei Krebsen«. Eigentlich wollte er seinen dort eingestellten Hengst holen, um dann ins Schloss nach Gerhardisdorf zu reiten». Ihm fröstelte, denn es war draußen bitterkalt.
Im noch hellen Mondschein des frühen Morgens kam ihm auf der schmalen Webergasse ein riesiger weißgrauer Wolf entgegen, dem ein alter weißbärtiger Mann folgte. Der Wolf hinkte, ihm fehlte ein Stück des rechten Vorderlaufes.
Gersdorffs Muskeln zwischen den Schulterblättern vibrierten zunehmend stärker.
War das ein Zeichen, dass er von dem Alten erwartet wurde oder drohte ihm irgendeine Gefahr?
Die innere Abwehr machte sich in ihm breit.
Unnötig!
Gersdorff hatte jetzt die Gewissheit, warum sich sein Alter Ego so nachdrücklich meldete. Er spürte, dass der alte Mann ihn gerufen hatte.
Aber warum? Wer ist der Alte?
Mitten auf der Gasse blieb der alte Mann vor Gersdorff stehen. Nicht die geringste Bewegung machte er, sondern er musterte ihn mit einem intensiven, durchdringenden Blick. Scharfe Augen, die im Mondlicht seltsam schimmerten, sahen zu ihm hin. Gersdorff war verunsichert, was sollte er tun, er blieb nun ebenfalls stehen und ließ sich mustern. Es schien keine Gefahr von dem Alten auszugehen, sonst hätte sich sein Alter Ego eindringlicher gemeldet, aber es vibrierte nach wie vor.
Komisch, aus der Nähe sah der Alte merkwürdig aus, irgendwie passte etwas nicht zusammen. Es war nichts Greisenhaftes an ihm, es erinnerte an etwas junggebliebenes in der Gestalt. Die weißen Haare und der weiße Bart passten nicht zu der aufrechten Haltung, sie waren nicht die eines Greises.
Ein seltsames Grinsen erschien auf dem Gesicht des alten Mannes. Der große Wolf hatte sich zu seinen Füßen niedergelassen und beobachtete Gersdorff aufmerksam.
»Guten Morgen!«, sagte der Alte.
»Ich habe dich erwartet Friedrich Carl von Gersdorff!« Bis zu diesem Augenblick, da der alte Mann seine Stimme erhob, hatte Gersdorff das Gefühl, eine Erscheinung anzustarren – und nun musste er wohl sehr erschrocken wirken, denn der Alte versuchte ihn zu beruhigen.
Mit einer sanften Stimme sagte er zu ihm.
»Keine Angst, es wird dir nichts passieren. Ich habe dich gerufen, weil ich mit dir reden muss. Du hast Besuch in Gerhardisdorf. Die Kinder deines Vetters, Graf Zinsendorf sind bei euch zu Gast. Du hast deinem Vetter und Studienfreund Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf für dessen Herrnhuter Brüdergemeine auf seinem Gut Klix eine sorbische Predigerschule eingerichtet. Dafür ist er dir sehr dankbar.
Aber das ist nicht alles.
Jetzt liest du seinen Buben aus der wertvollen alten Chronik vor, sie beschreibt nicht nur die Geschichte des Geschlechts derer von Gersdorff, sondern sie ist auch ein Spiegelbild der Region. Mir ist wichtig, dass du weißt, die Buben werden bald das Erbe ihres Vaters antreten und als Missionare die Welt bereisen. Mit dem Vorlesen der Geschichten aus der Chronik bereitest du die Buben auch darauf vor. Du kennst ja das Bestreben deines Vetters bezüglich der Brüderunität. Das sind Vorhaben, die das Wohlgefallen des Allmächtigen, als auch meine volle Unterstützung genießen.
Die in Böhmen und den angrenzenden Ländern wütenden Kämpfe führten damals zum Untergang der Taboriten. Die Utraquisten konnten sich auf Grundlage, der vom Konzil von Basel bestätigten, Prager Kompaktaten zur Mehrheitskirche und zur Brüderunität etablieren. Du weißt von was ich rede?«.
Gersdorff nickte, er kannte die Geschichte der Hussiten.
Der alte Mann deutete auf den Wolf. »Das ist Lupus! Eigentlich gehört er denen von Gersdorff, aber als seine Herrin Mechthild vor den Thron des Allmächtigen gerufen wurde, habe ich ihn wieder zu mir genommen«. Der alte Mann nestelte einen kleinen goldenen Anhänger vom Hals, in diesem war kunstvoll ein grüner Edelstein eingefasst. Er reichte den Artefakt Gersdorff. »Trag ihn und du wirst immer in der Lage sein, in der Gedankensprache mit uns zu reden!«
Dabei deutete er auf Lupus. »Auch er versteht sie«.
»Ich bin Pater Augostino, der Hüter des Heiligen Grabes von Jerusalem. Eigentlich bin ich der Guardian des Franziskanerklosters auf dem Berg Zion.
Einige deiner Vorfahren kannten mich, weil ich sie zum Ritter des Heiligen Grabes geschlagen habe.
Alle anderen Auslegungen zu den Geschichten findest du in der alten Chronik und wenn es Fragen gibt, dann reden wir in der Gedankensprache miteinander. Du musst dazu nur das Artefakt in die Hand nehmen und mich in Gedanken rufen. Ab und zu schicke ich Lupus zu euch. Dem musst du die Hand auf den Kopf legen, dann kann er dir Botschaften übermitteln. Denn wie lange es der Allmächtige noch zulässt, dass ich mithilfe der Mystik von Land zu Land wandere, ist äußerst ungewiss«.
Schweißgebadet wachte Gersdorff auf und schaute sich um. Was war das? Er war ja gar nicht in Görlitz, sondern im Schloss derer von Gersdorff in seinem eigenen Schlafgemach.
Der Alte und der dreibeinige Wolf waren verschwunden. Was war das? Hatte er das wirklich geträumt?
Immer öfter suchten «sogenannte» Traumsichten Eingang zu seinem Hirn. Die Großmutter litt unter dieser Art von Traumsichten, hatte sie ihm einmal erzählt. Gersdorff hatte damals das Gefühl, sie hatte den Namen «Traumsicht» erfunden. Aber wie es jetzt aussah, hatte er diese Eigenschaften anscheinend von ihr geerbt.
Gersdorff stand auf.
Auf dem Nachtschränkchen fand er das kleine goldene Artefakt mit dem eingelassenen grünen Edelstein. Er nahm es in die Hand und betrachtete es aufmerksam und sehr nachdenklich.
Er wusste, dass dieser Schmuck eigentlich ein uraltes Familienerbstück ist. Friedrich Carl von Gersdorff hatte den Schmuck von seiner Großmutter geerbt, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte und sie hatte ihm gesagt, dass dieser Schmuck weit in die Geschichte der Familie derer von Gersdorff zurück reicht. Er erinnerte sich aber auch daran, was der alte Mann ihm erzählt hatte, demnach ist dieses alte Schmuckstück ein mystisches Artefakt?
Aber woher wusste der alte Mann von dem Schmuckstück?
Gersdorff schüttelte den Kopf und wollte den Traum in den Bereich des Aberglaubens schieben, als er plötzlich deutlich die Stimme des Bruder Augostino in seinem Kopf vernahm.
Gersdorff erschrak und warf das Schmuckstück weit von sich auf das Bett.
Die Stimme in seinem Kopf brach ab.
Vorsichtig tastete Gersdorff wieder nach dem Schmuckstück und die Stimme war plötzlich wieder da. »Friedrich Carl von Gersdorff, du bemerkst, es ist kein Albtraum oder gar Aberglauben!« erklang es laut und deutlich in seinem Kopf.
Das Artefakt befähigt dich, die Gedankensprache der Elfen zu verstehen und sie auch anzuwenden. Sie ist eine uralte Art aus dem Asenreich, untereinander zu kommunizieren! Deine Großmutter hat sie auch beherrscht, auch weil sie begriffen hatte, dass auch die Elfen Kinder des Schöpfers sind. Mich hat die Herrin des Asenreiches befähigt, über diese Art der Kommunikation mit ihr in Verbindung zu bleiben!
Die Weisen von Jerusalem beherrschen die Gedankensprache ebenfalls!
Also, geh nicht leichtsinnig mit dem Artefakt um.
Du wirst es noch brauchen!«
Wie alles begann …
Im Schloss derer von Gersdorff brannte im Kamin ein helles und wärmendes Feuer. Draußen klirrte noch der Frost und so war es angenehm vor dem warmen Kamin zu sitzen. Der Mann vor dem Kamin blätterte in der sehr alten, in Schafsleder gebundenen Chronik. Über dem Kamin war der Kupferstich von Daniel Petzold zu sehen, welcher die Stadtmauer von Görlitz zeigte und die die Stadt, abgesehen von einem kurzen Stück auf der Ostseite entlang der Neiße, wie mit einem zweifachen Ring umfasste. Die äußeren Mauern sind sechs und acht Ellen hoch, waren teilweise auch höher. Immer wieder verglich der junge Mann die Zeichnungen im Buch mit dem Kupferstich an der Wand, den er zur Ansicht aufgehangen hatte. Er konnte keine Abweichungen feststellen, der Künstler hatte sehr genau gearbeitet und die wehrhafte Stadt auch wehrhaft dargestellt. Im Gegensatz zu den Befestigungsanlagen zur Zeit des Hussitenkrieges, vor rund fünfhundertneunzig Jahren, ist die Wehrhaftigkeit der Stadt bemerkenswert gewachsen.
Friedrich Carl von Gersdorff war trotz seiner Jugend, bereits Oberamtsmann der Oberlausitz. Der Oberamtmann hatte für den gesetzmäßigen Gang der Verwaltung zu sorgen und war der vorgesetzten Behörde unmittelbar und persönlich verantwortlich. Der Titel entsprach damit etwa dem eines Landeshauptmannes.
In der Chronik war er auf Eintragungen gestoßen, die er mit Spannung nachverfolgt hatte. Den einen Beitrag hatte einer seiner Vorfahren verfasst. Der Verfasser hieß Leuther von Gersdorff, Stadthauptmann von Görlitz, der sich in diesem Beitrag ausgiebig mit den misslungenen Hussitenüberfällen auf die Stadt auseinandergesetzt hatte. Den Befehl über die Görlitzer Truppen führten kühne und kundige Görlitzer meist aus den führenden Geschlechtern, aber auch besondere Hauptleute aus dem Adel, die man besoldete, wurden dazu angenommen. Bewunderungswürdig in diesen Zeiten ist der Görlitzer Nachrichtendienst und ebenso die rastlose Arbeit der Bürgermeister und Ratmannen bei Tag und Nacht, ihre zielbewusste, folgenschwere Entschlussschnelligkeit, die politische und militärische Bereitschaft, das große Mühsal, das Stadtschreiber und Ratsherren auf ihren weiten Gesandtschaftsreisen auf sich nahmen; es sind straffe, harte, zähe und kluge Leute, die damals in größter Aufopferung die Geschicke der Stadt leiteten. Die Stadt Görlitz allein war es, welche der guten Organisation, dem Wagemut und dem Zielbewusstsein der Feinde einigermaßen gewachsen war, die anderen Sechsstädte kamen ihr nicht gleich. Überhaupt war es ein Unglück, dass die kriegerische Kraft der Oberlausitz, die im Ganzen recht bedeutend war, eines festen Zusammenschlusses und einer einheitlichen Führung entbehrte. Hier versagte der oberste Landesbeamte, dem die Sorge dafür oblag, vollständig, und auch der Sechsstädtebund, der im Verlauf des Krieges wegen des starren Widerstandes der Görlitzer gegen die Hussiten sich überhaupt lockerte und erst 1436 wieder neu gefügt wurde, bewährte sich in dieser Hinsicht nicht. Görlitz war schließlich auf sich selbst allein angewiesen
Lärm war vor der Tür zu hören.
Gersdorff barg schnell das vor ihm liegende Schmuckstück in die Schublade des Schreibsekretärs.
Die beiden Buben, die da hereinstürmten, sind die Söhne seines Vetters Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf. Die beiden Adelsgeschlechter hielten sehr enge Beziehungen zueinander. Zinzendorf war der Sohn von Georg Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf und Charlotte Justine Freiin von Gersdorff Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass sie sich auch familiär austauschten. Für die Buben war und blieb es der Oheim.
Die Jungen bestaunten das Bild an der Wand über dem Kamin. »Oheim, was ist das? Das hing doch vorher nicht da!« fragte der jüngere der beiden Buben.
»Gut beobachtet! Das ist ein Kupferstich des Künstlers Daniel Petzold aus Görlitz, der die Umrisse der Stadtbefestigung seiner Stadt darstellt«.
Gersdorff klappte die Chronik zu.
»Bevor ich euch etwas darüber erzähle, noch einige Hinweise zu denen von Gersdorff, praktisch zu meiner Familie.
Das Geschlecht derer von Gersdorff blickt auf eine mehr als 700-jährige Geschichte zurück. Es gehört dem Oberlausitzer Uradel an. Viele Erzählungen und Geschichten, teils auch Legenden, ranken sich im Verlaufe der Jahrhunderte um das Gersdorffer Geschlecht, das sich im Verlaufe dieser Zeit in ganz Europa verteilte«. Der Oheim drehte die Chronik, so dass die Buben die Abbildung einer Urkunde sehen und lesen konnten.
»Oheim, erzählst du uns auch etwas darüber?«, fragte der ältere der Jungen.
Gersdorff nickte, blätterte einige Seiten um und erzählte.
»Erstmals taucht der Ortsname Gersdorf als „Gerhardisdorf“ im Jahr 1241 in den Akten der Oberlausitz auf. Seit 1301 lässt sich mit Stammvater Jencz, zu Deutsch Johannes, eine durchgehende Namensfolge nachweisen. Jencz ist in einer Urkunde vom 25.4.1301 mit seinem Bruder Christian vermerkt, der benannt wird als «dominus Christianus advocatus provinciae Gorlicensis dictus de Gerhardisdorf, auf Deutsch «Lord Christianus, ein Anwalt in der Provinz Gorlicense, genannt Gerhardisdorf.».
Der mit ihm verwandte Ramfold von Gersdorff war in seiner Folge Grundherr Gersdorfs und des Städtchens Reichenbach, das bis heute das Gersdorff-Wappen als Stadtwappen führt«.
Dann klappte Gersdorff das Buch zu und erzählte weiter.
»Der Familienverband derer von Gersdorff hat eine ganz besondere Beziehung zu dieser Stadt«, erläuterte von Gersdorff den Buben vor dem Kupferstich der Stadt Görlitz stehend. Er verwies im Folgenden auf die Familiengeschichte derer von Gersdorff und zog einen Vergleich zu denen von Zinsendorf.
»Euer Vater hat ja in Niesky und in Herrnhut ähnliche Beziehungen aufgebaut, aber das wisst ihr ja. Das Geschlecht derer von Zinsendorf hat ja eine ähnliche Entwicklung hinter sich gebracht wie das derer von Gersdorff!«, sagte er.
Gersdorff warf noch einige Scheite Holz in den Kamin und zog das dicke Buch wieder an sich heran. »Zunächst konnten sich diese reformatorischen Gruppen, die euer Vater geeint hat, mit der damals üblichen Fremdbezeichnung Böhmische Brüder,
bzw. der Eigenbezeichnung Unitas Fratrum, zu Deutsch, Brüder-Unität, behaupten. Ihr werdet einmal diesen Glauben missionieren und in die Welt hinaustragen! Das sind aber sehr lange Geschichten!«, sagte er zu ihnen. »Die sind nicht in einer Stunde erzählt, aber wenn ihr die Geduld habt zuzuhören, werde ich wohl einige Abende brauchen, um euch jeden Abend eine oder auch zwei Geschichten vorzulesen, oder was meint ihr?«.
Gersdorff blätterte in der dicken Chronik.
»Oheim, wir sind ja noch einige Tage hier bis der Vater uns wieder abholt!«, sagte der ältere von den Buben.
»Wir haben ja schließlich Winterferien! Also machen wir das, du liest uns jeden Abend eine spannende Geschichte aus dem dicken Buch vor!«
Gersdorff lachte herzlich.
»Ihr Schlingel, ihr habt mich aber richtig toll überzeugt, um nicht zu sagen, richtig toll reingelegt!«
Die Jungen grinsten, machten es sich auf dem weichen Bärenfell bequem und warteten gespannt auf die erste Erzählung des Oheims.
Gersdorff blätterte in der Chronik bis zu einem Lesezeichen und sagte zu ihnen.
»Viele Geschichten, die ich vorlesen werde, beginnen vor mehr als vierhundert oder vielleicht auch sechshundert Jahren und sie sind nicht nur geprägt vom Bau der Befestigungsanlagen der Stadt, sondern auch vom Fleiß seiner Erbauer und von schlimmen Erinnerungen an Gräueltaten der Hussiten und an das Leid der Menschen, die damals die junge Stadt heimgesucht haben. Diese Geschichten habe ich willkürlich ausgewählt, sie sind nicht zusammenhängend geordnet. Ich habe sie so ausgewählt, dass ihr die Zusammenhänge besser versteht.
Noch bevor dieses Schloss erbaut wurde, lebten einige von den Gersdorffs in Kralowski haj oder heute Königshain genannt, in Ebersbach und in Gerhardisdorf. Nach ihrer Flucht aus Prag versteckten sich die Gersdorffs und die d´Moreau, das ist eine befreundete französische Familie, um der Rache der Hussiten zu entgehen, auf dem Heideberg bei Arnholdisdorf. Die beiden Männer lehrten einst an der Universität in Prag Philosophie, der Inhalt ihrer philosophischen Lehre war den Hussiten aber ein Dorn im Auge. Es floss damals viel Blut durch die Prager Gassen. Doch es gab in Görlitz einen Verräter, der die Hussiten zu dem Versteck auf den Heideberg führte. Sie nahmen fürchterliche Rache an den Flüchtlingen, vor allem an denen d`Moreau. Doch davon erzähle ich später in einer eigenen Geschichte, sie ist prägend für die weitere Entwicklung und die möchte ich euch nicht vorenthalten! Die anderen Geschichten erzählen euch aber auch von «Lupus», dem Wolf aus dem Asenreich, von Elfen, Kobolden und Trollen. Auch «Ritter des Heiligen Grabes» spielen in den Aufzeichnungen hier in der Chronik eine Rolle.
Aber sie erzählen auch von einem verborgenen Geheimnis, einem Arkanum der Tempelritter in unserer Stadt«. Nach diesem langen Monolog machte der Oheim eine kleine Pause und trank einen Schluck von dem schon erkalteten Tee und fuhr dann fort.
»Irgendwo haben die Erzählungen alle einen berechtigten Platz in der Geschichte der Stadt Görlitz und deren Umgebung. Jeder der die Berichte, niedergeschrieben hat, erzählt die Geschichten auch auf seine Weise«.
Friedrich Carl von Gersdorff strich über die Chronik und wies dabei auf den Kupferstich an der Wand.
»Das waren überaus kluge Menschen, sie haben es niedergeschrieben, um es der Nachwelt, damit auch uns, zu erhalten!
Es ist alles höchst sorgfältig hier in dieser Chronik aufgeschrieben und von den Schreibern auch bezeugt! Beginnen wir mit einer Zeit, wo die Mauern vollendet wurden, weil sie mit ihrer Vollendung die Sicherheit der Stadt gewährleisten konnten. Das war vor dem nicht so! Eigentlich müsste ich bis in die Anfänge zurückgehen, in denen sich Görlitz langsam, aber sicher zur Stadt mauserte.
Und das war schon in grauer Vorzeit als der Kaiser Heinrich IV. die »Villa Goreliz« in einer Urkunde erwähnte. Beispielsweise war dieser Eintrag die Geburtsstunde unserer Stadt. Aber, die Gegend war auch das Siedlungsgebiet der geheimnisvollen Vorfahren der Sorben, der Milzener, eines slawischen Volksstammes, deren Häuptling «Ziscibor» war.
Der Häuptling errichtete auf der Landeskrone einen festen Sitz und die überzähligen Burgbewohner siedelte er in einem Dorf mit Namen «Gerlois» am Neißeübergang bewusst an. Das ist sehr wahrscheinlich, weil der sichere Neißeübergang für den Handelsweg von besonderer Bedeutung war und den die Bewohner von «Gerlois», die ja Krieger des Häuptlings «Ziscibor» waren vor räuberischen Übergriffen auf die Händler schützten, auch sehr zu ihrem eigenen Nutzen.
Es gibt aber auch noch andere Sagen zur Entstehung unserer Stadt, auf die ich vielleicht später zurückkommen werde.
Wir beginnen aber, zum besseren Verständnis, mit der Fertigstellung des Befestigungsbaus der Stadtmauer so wie sie auf dem Kupferstich von Petzold dargestellt ist. Da ist der Übergang von einer fast wehrlosen zu einer wehrhaften Stadt besser zu verstehen. Lasst euch im Weiteren überraschen!«
Die Stadt Görlitz
Zwischen Lunitz und Neiße wuchs die Stadt rasant empor. Handel und aufblühendes Handwerk sorgten für schnelles wachsen der Stadt. Aber immer noch standen das Kloster und seine Kirche zum Teil außerhalb der Stadtmauer. Das würde wohl nicht mehr lange so bleiben, denn die Bestrebungen des Aufnehmens in die Sicherheit der aufstrebenden Stadt waren schon nach der Weihe durch den Bischof von Meißen sichtbar. Es wurde überall mit großem Eifer gebaut. Besonders an diesem Teil der Stadtbefestigung, der noch offen war, werkelte man seit Jahren eifrig, um die Mauerlücke zu schließen. Es ist an der Zeit, jetzt das Kloster und die Kirche endgültig ins Stadtinnere zu holen.
Durch die noch offenen Lücken in der Stadtmauer gelangten immer wieder Strauchdiebe in die Stadt, richteten Schaden an und versetzten die Menschen in Angst und Schrecken. Die Stadtväter ließen gleichzeitig die Mauern aufgrund von neuen Erfahrungen im Festungsbau, um einiges erhöhen.
Die Fuhrwerke der Bauern brachten in ununterbrochener Folge nach wie vor Granitblöcke aus den umliegenden Steinbrüchen. Sand und Lehm aus den Kiesgruben transportierten sie zu den eingerüsteten Mauern. Der Kalk wurde immer noch bei den Dörfern Henndorf und Ludwigsdorf gegraben und aufbereitet und dann mit Fuhrwerken der Bauern zur Stadtmauer transportiert. Hier mischten die Mauerer den Lehm mit Kalk zu einem Lehmkalkmörtel und verarbeiteten ihn auch sofort. Der Lehmkalkmörtel wurde in Bütten gemischt und mithilfe eines Hebebaums und Flaschen – so nannte man damals die Seilzüge - auf die Mauern transportiert. Zwischen den Schenkeln des Hebebaums ist eine Haspel angebracht, die, wenn man sie drehte, die Last anhob und das Zugseil aufwickelte. Die Flaschen waren aus Hartholz, sie nahmen eine Anzahl auswechselbarer Rollen in sich auf, sowie die Zugseile, die über die Rollen gelegt wurden. Es gab auch sogenannte Traversen, auch aus Hartholz, die mehrere Rollen nebeneinander in sich aufnahmen.
Die Maurer und die Zimmerer verringerten damit, je nach Anzahl der Rollen, die Kraft um ein Vielfaches, die sie zum Aufziehen der schweren Steine und der anderen Materialien benötigten. Diese Zugseile aber sind mit besonderen Tierhaaren und Hanf gedrillt und sie sind äußerst haltbar.
Die Hanffaser ist so stark, dass sie sogar zur Herstellung von Segeln, Seilen und Leitern für Schiffe verwendet werden.
In der jungen Stadt gab es inzwischen eine richtig gutgehende Seilerei, die sich ausschließlich mit dem Drillen solcher Zugseile befasste. Der Innungsmeister dieser Seilerei, ein zugewanderter Flame, konnte sich vor Aufträgen kaum retten. Findige Köpfe, wie der Schmied Gregor aus Klingewalde, hatten zudem die neue sogenannte «Teufelskralle» erfunden, eine Vorrichtung, deren Hebel sich beim Anheben der Last fest an den Stein krallten und ihn festhielten.
Stein für Stein wurde mit diesen Flaschen und den dazugehörigen Seilen auf die Mauern hochgezogen und sofort verbaut. Der angemischte Lehmkalkmörtel durfte ja nicht aushärten, bevor die Steine eingefügt wurden. Es ging mit den Seilzügen alles wesentlich leichter und außerdem auch schneller. Trotzdem, es war für die Maurer eine Sisyphusarbeit und sie wird wohl nie gänzlich enden.
Der Parlierer des Baumeisters Aye, ein zugewanderter Flame namens Helge, steht mit in die Hüften gestemmten Händen auf der Mauer und beobachtete aufmerksam den Fortschritt der Bauarbeiten an der Befestigungsanlage. Vor ihm liegt ein aufgerolltes Pergament mit den Rissen des damaligen Baumeisters Ruppert, die jenen Teil der Befestigungsmauern darstellen, an dem jetzt angestrengt gewerkelt wird.
Gersdorf zeigte den Buben mit der Hand den Verlauf der Mauer auf dem Kupferstich. Dieser neue Teil der Stadtmauer soll schließlich die Stadt gänzlich umschließen. Ruppert hat die Stadtmauer vor vielen Jahren mit einer Länge von etwa sechstausend Ellen entworfen und auf dem Pergament festgehalten. Eine gewaltige Länge und eine gewaltige Anstrengung für die Erbauer.
»Oheim, was ist ein Parlierer?«, fragte der jüngere der beiden Brüder.
»Ein Parlierer ist so etwas wie ein Vorarbeiter mit vielen Kenntnissen vom Bau - später nannte man ihn einfach Polier!«, antwortete der Oheim.
»Der Parlierer hier, von dem wir reden, ist ein erfahrener Mann und hat schon an verschiedenen Befestigungsanlagen im Lande sein Zeichen hinterlassen«.
Der Oheim stand auf und ging zu dem Bild an der Wand. »Aber dass hier, das ist ein Meisterstück des Befestigungsbaus, an dem er mitwirkte«.
Der Oheim zeigte am Kupferstich auf die Mauer.
»Abgesehen von dem kurzen Stück auf der Ostseite der Stadt entlang der Neiße, ist es ein doppelter Ring, der die Stadt umschließt. Die äußeren Mauern sind zwischen sechs und acht Ellen hoch, teilweise auch höher eingezeichnet. Die inneren Mauern hingegen sind noch höher und stärker. Auch besitzen die inneren Mauern im Gegensatz zu den Äußeren, Treppen, Umgänge mit hölzernen Geländern und Schießscharten. Immerhin, die Mauern sind mit Ziegeldächern versehen und schützten somit die künftigen Verteidiger nicht nur vor der schlechten Witterung, sondern auch vor Bolzen und Kugeln der Angreifer. Das Areal zwischen den beiden Mauern nannte der Baumeister Ruppert «Parchen». Inzwischen dienten die Parchen den Tuchmachern der Stadt als Trockenplatz für die von ihnen eingefärbten Stoffe, sehr zum Ärger des Baumeisters. Das wurde etwas später durch die Stadt mit einem Ratsbeschluss verboten. Von da an nannte man die Parchen «Zwinger» und sie erhielten Namen nach ihrem Standort«.
Die Jungen reagierten nervös auf die Stimme des Oheims und rutschten auf dem Fell hin und her.
»Warum ärgerte sich der Baumeister?«, fragte der Jüngere. »Ist das so schlimm, wenn sie dort Stoffe trocknen?«
»Er war der Meinung, dass die Rahmen der Tuchmacher die Verteidigungshandlung behindern würden und er hatte nicht unrecht. Lasst mich einfach weiterlesen«, sagte der Oheim.
»Auf dem Pergament ist auch schon die zukunftsweisende Idee zu erkennen, wie das künftige Frauentor beschaffen sein sollte. Es ist auf dem Pergament dreifach ausgelegt. Das innere Tor ist auf beiden Seiten mit der inneren Stadtmauer verbunden und steht stadteinwärts vor einem riesigen Turm, der schon viel früher mit besonders dickem Mauerwerk erbaut wurde. Das mittlere Tor ist mit einem Gebäude überbaut und sollte dann ein starkes Holzfallgatter besitzen, mit Eisenschuhen bewehrt, das mittels Rädern herauf- und hinuntergelassen werden kann. Der Bau dieser Anlage würde wohl noch eine Weile dauern».
Der Oheim trank wieder einen Schluck kalten Tee aus der Karaffe und las weiter vor.
»Inzwischen hatten die Handwerker der Stadt damit begonnen, die Idee des Baumeisters in die Tat umzusetzen.
Die künstlerisch fantastische Zeichnung des Frauentores, auf der auch ein Wolf zu sehen ist, hatte Baumeister Ruppert damals seinem Entwurf beigefügt. Man konnte denken, der Allmächtige hat den Baumeister mit der Vorsehung gesegnet, dass der Wolf einmal eine bedeutende Rolle in Görlitz spielen würde. Auch davon werdet ihr noch hören! Es ist alles in dieser Chronik niedergeschrieben! Auch die folgende Geschichte, die sich während des Baus der Befestigungsanlage abspielte, ist von Bedeutung für unsere Stadt. Also hört gut zu!«
Auf der Mauerbaustelle
Die Finger des Parlierer fuhren die Linien entlang, die der Baumeister mit viel Akribie auf das Pergament gezeichnet hatte.
Das äußere Tor ist auch sehr wehrhaft dargestellt und wirkt basteiähnlich.
Es steht weit außerhalb der Stadtmauer im Wassergraben und wird mit einer starken Mauer auf jeder Seite mit der eigentlichen Stadtmauer verbunden. In Richtung Süden vor dem Tor führt eine kleine Brücke über den Graben. Noch ist das Frauentor keine offene Baustelle, aber bald wird es sich auch in die Befestigung einfügen».
»An diesen Mauern wird sich jeder Feind die Zähne ausbeißen!«, sagte der Parlierer laut vor sich hin und rollte zufrieden das Pergament zusammen.
Die breiten Mauern, die Bastionen mit ihren Türmen und Toren, sie wachsen in Windeseile. Sind sie doch der Garant für die Sicherheit der Handelsleute und der Bürger der aufblühenden Stadt. Und sie würden auch dem Kloster und seiner Kirche gänzlich diesen Schutz gewähren.
Der Parlierer wandte sich wieder der Baustelle zu und drehte sich nochmals um, weil er plötzlich durch einen Tumult an der Neißeseite von seinem Vorhaben abgelenkt wurde.
Er schaute über die Mauer.
Zwei übel aussehende Kerle in schmuddeliger Forstbekleidung zogen eine gefesselte junge Frau gewaltsam in Richtung der Stadt. Ein dritter Mann, anscheinend angetrunken, folgte ihnen und begrapschte laufend die Gefangene.
Der Parlierer verstand nicht, was die junge Frau schrie, aber es schienen nicht gerade anständige Worte zu sein. Als sie näher heran waren, sah er, dass das eine rotbraunhaarige wunderschöne junge Frau war, die sich auffallend mit diesen kruden Beschimpfungen gegen das Begrapschen des nachfolgenden Kerls wehrte. Er überlegte, die junge Frau kam ihm bekannt vor.
Der Parlierer schüttelte den Kopf als er den Mann erkannte. »Das ist doch der Hartwig Haubold aus der Schar der Herren von Wirsynge, bei denen er sich als Forstknecht verdingt hatte«, sagte er laut und dann fiel es ihm wieder ein. Der Hartwig hat seinen ehrbaren Stellmacherberuf aufgegeben und wurde zu einem stadtbekannten Rauf- und Trunkenbold. Warum auch immer, die Leute verabscheuten und mieden ihn.
Er hauste jetzt in einer kleinen unansehnlichen Hütte vor der neuen Stadtmauer. Von hier oben aus konnte der Parlierer diese armselige Hütte sehen. Aber die Kerle schleppten ihre Gefangene nicht in diese Richtung, sie schleppten sie in die Stadt. »Was haben die Kerle mit der jungen Frau vor?«, fragte sich der Parlierer. Die Arbeiten auf der Baustelle Stadtmauer standen auf einmal still.
Die Handwerker schauten gebannt auf die unwürdige Szene, die sich vor ihnen abspielte und einige Handwerker machten ihrem Unmut durch laute Rufe Luft und drohten den Kerlen mit der Faust.
»Hey, ihr Kuhketzer, ihr Mordbrenner lasst die Frau los!«, brüllte ein Maurer. Die anderen Handwerker fielen in die Rufe ein. Tumultartiger Lärm brach bei den Handwerkern auf der Mauer los.
»Verdammter Trunkenslunt, lass die Frau los!« brüllten die Zimmerer. Deren Wut richtete sich gegen die vermeintlichen Forstleute, die die sich wehrende, gefesselte junge Frau hinter sich herzogen. Die Wut der Zimmerer richtete sich vor allem gegen den Hartwig Haubold, den sie als abtrünnigen Handwerker ansahen. Die Empörung schien zu explodieren und es bestand die Gefahr, dass die Handwerker in ihrer Rage die Mauer verließen, um der jungen Frau zu helfen!
»An die Arbeit!«, schrie der Parlierer und drohte seinen Handwerkern ebenfalls mit der Faust.
Die Köpfe verschwanden und urplötzlich setzte der Baulärm wieder ein.
«Sie haben eben Respekt vor mir!», grinste er und begab sich zur Leiter, um die Mauer zu verlassen.
Als er nach unten schaute, sah er den Bürgermeister Berwich des Calen mit dem Stadtschreiber auf die Leiter zustreben. »Oh Gott, sie kommen gewiss, den Fortschritt des Befestigungsbaus zu kontrollieren«, dachte der Parlierer und grinste. Er rollte das Pergament wieder auf und beschwerte die Enden mit Steinen.
Er ahnte, was der Bürgermeister wollte.
Die Begrüßung war kurz, aber herzlich, man kannte sich.
Nach der Einsicht in die Baurisse sagte der Bürgermeister:
»Helge, schaffen wir es bis zum Wintereinbruch, wenigstens die noch vorhandenen großen Mauerlücken zum Kloster zu schließen?«, fragte er und duzte den Parlierer. Er nannte ihn sogar beim Vornamen.
Ein Zeichen, dass sie sich sogar sehr gut kannten.
Berwich wies auf die eingezeichneten vorhandenen Lücken auf dem Pergament.
»Warum fragt ihr das Bürgermeister?
Wenn alles so funktioniert wie bisher und das Wetter hält, gehe ich davon aus, dass der gesamte Mauerabschnitt bis zum Winter vollkommen geschlossen ist, das habe ich euch zugesagt. Ich gedenke meine Zusage einzuhalten!«, antwortete der mit Helge angesprochene Parlierer dem Bürgermeister. »Die Restarbeiten auf der Mauer erledigen wir auch später«, erklärte der Parlierer abschließend.
Bürgermeister Berwich atmete erleichtert auf, er nahm die Antwort des Parlierers wohlwollend zur Kenntnis und deutete seinem Schreiber an, das zu notieren, musste er doch seinen Ratmannen und Schöppen in der nächsten Ratssitzung eine bindende Antwort geben. Es war schon gut, dass die Stadt sich der Mitarbeit von Handwerkern aus Flandern versicherte. Brachten die Flamen doch viele Erfahrungen und Neuerungen aus dem Festungsbau von Brügge mit, die sie hier anwendeten.
»Es gab in den letzten fünf Jahren besonders nachts Raubüberfälle innerhalb der Stadt, die blutig endeten. Unsicherheit verbreitete sich unter den Handelsleuten. «Ist die Stadt nicht mehr sicher?», so stellte sich die Frage im Rat. Der Rat beschloss daraufhin, den Bau der Stadtbefestigungen vordringlich zu betreiben und endlich zu beenden!
»Das wird mit der Schließung dieser Mauerlücken ein Ende haben, so hoffe ich. Dann wird keiner dieser Strauchdiebe mehr unkontrolliert die Stadt betreten können«, sagte der Bürgermeister zum Parlierer. Der nickte bestätigend.
Der Bürgermeister erinnerte sich nur ungern daran, dass der letzte Fall vor einem Jahr für Aufregung und Unmut im Rat gesorgt hatte. Er war da noch nicht Bürgermeister, aber er hatte diese Last mit in dieses Amt übernommen und wollte sie unbedingt loswerden.
«Ein Kaufmann aus Fulda wurde ermordet und seiner gesamten Barschaft beraubt als er die Herberge verließ,» erinnerte sich Berwich.
«Der Zimmerermeister Bernhard von Breitenbach aus Kunstinsdorf, der dem Überfallenen zur Hilfe eilen wollte, wurde brutal niedergeschlagen und getötet, man hatte ihm die Kehle durchgeschnitten. Die tumultartige Reaktion bei den Ratmannen und Schöppen war dementsprechend, man gab die Schuld an dem Verbrechen der seit über zehn Jahren noch nicht fertiggestellten Umfassungsmauer am Kloster …» Die andauernden Verbrechen in der Stadt machten dem Bürgermeister zu schaffen.
Berwich wurde vom Parlierer aus seinen Überlegungen gerissen.
»Bürgermeister, ich habe noch einen Hinweis für euch, den Bau nicht betreffend. Vorhin haben wir beobachtet, dass der Forstknecht der Wirsynger, der Hartwig Haubold, eine junge Frau zum Markt schleppte. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Witwe des Zimmerermeisters von Breitenbach.
Wer weiß, was er mit ihr vorhat! Hat er nicht einmal bei denen als Zimmerer gedient?
Der Saufbruder Hartwig macht doch der Stadt bestimmt wieder Ärger!«
Der Bürgermeister wechselte die Farbe und sah den Stadtschreiber an. Gerade hatte er an diesen Vorfall vor einem Jahr gedacht, an dem dieser Zimmerermeister zu Tode kam. Alle Spuren deuteten darauf hin, dass die Mörder mit ihrer Beute, durch diese hier noch nicht geschlossene Lücke in der Stadtmauer entkommen sind, das war nicht abzustreiten, denn die gesicherten Spuren deuteten daraufhin.
Berwich holte tief Luft.
»Schon wieder dieser Saukerl! Da können die Wirsynger jetzt Ableugnungen erheben, wie sie wollen. Das hat ein Nachspiel. Vor etwa zehn oder elf Jahren hatten die Wirsynger ein ähnliches, fast gleiches Dilemma zu verantworten, da ging es um die Witwe des Schreinermeisters Schubarth. Ich habe das im zutreffenden Jahrbuch der Stadt zufällig gelesen. Zum Glück haben sich die Mönche des Franziskanerklosters eingemischt und schlimmeres verhindert. Die Franziskaner Mönche haben Gott sei Dank eine andere Auffassung vom Aberglauben wie der Stadtpfarrer, ein Dominikaner!«.
Berwich machte eine Pause, bevor er weiter redete und sah den Schreiber und den Parlierer bedeutungsvoll an. »An den Fleisch- und Brotbänken aber sabbern die alten Weiber schon wieder etwas von einem Hexensabbat, vom Hexenflug, vom Teufelspakt, der Teufelsbuhlschaft und so weiter! Einen Anteil an diesen grotesken Geschichten hat dieser Saukerl Haubold, aber auch die nicht verstummende Legende vom Orakel am Teufelsstein in Kralowski haj, das ist der obersorbische Name von Königshain. Was meint ihr wohl, wer wohl der Urheber dieser Gruselgerüchte ist?«
Der Bürgermeister wurde wütend.
»Richtig, es ist dieser Saufbruder, der so etwas verbreitet!
Der arbeitet doch damit dem Stadtpfarrer zu.
Aber dieses Mal blüht dem Lumpen die Acht! Da werde ich wohl oder übel mit dem hochwohlgeborenen Herrn Grundbesitzer reden müssen und ihm die Augen öffnen, wen er da unter seine Fittiche genommen hat!«, sagte der Bürgermeister zum Parlierer.
Der Bürgermeister lief zur Leiter.
»Los vorwärts, wir reiten zum Markt«, befahl er dem Stadtschreiber und kletterte auf die Leiter.
»Es sollte mich wundern, wenn der Stadtpfarrer nicht wieder seine unegalen Pfoten im Spiel hat!«, rief er aufgebracht dem Stadtschreiber zu.
Der Stadtschreiber sah seinen Bürgermeister fragend an.
»Ihr seid wohl nicht gut auf den Pfarrer zu sprechen?«
»Der ist doch Dominikaner und wie es aussieht, braut sich da, mit seiner Duldung, ein sogenanntes «Ketzergericht» zusammen! Das hätten die ja gerne.
Der Pfarrer macht doch dicke Tinte mit der Inquisition wie alle Dominikaner! Aber denen werde ich etwas husten!«, antwortete ihm Berwich des Calen und redete weiter. »Kennt ihr die Geschichte? Der Heilige Vater, Papst Gregor der IX., entband damals die Bischöfe von der Untersuchungspflicht und beauftragte künftig und überwiegend den Dominikanerorden mit der Inquisition, also mit der Häretikerverfolgung. Sie allein haben jetzt das Sagen. Der Unmut der vernünftig denkenden Menschen trifft nun den Dominikanerorden und dazu zähle auch ich mich.
Na, leuchtet das ein?«, fragte er den Stadtschreiber.
Der aber wagte eine Widerrede.
»Aber jetzt ausgerechnet mit der Witwe des angesehenen Zimmerermeisters? Das glaube ich nicht! Das ist ja eine fatale Ähnlichkeit mit dem vergangenen Geschehen, von denen ihr erzählt habt, Bürgermeister!«, sagte er.
»Natürlich! Wir werden das feststellen!«
Er ging zum ungewöhnlich klingenden «Du» über.
»Du wirst das lesen, wenn wir zurück sind! Ich gebe dir die zutreffende Chronik! Los, vorwärts, wir reiten jetzt zum Markt!«, befahl der Bürgermeister.
»Dem renitenten Stadtpfarrer traue ich alles zu! Dem müssen wir das Handwerk legen, anders bekommen wir keine Ruhe in die Stadt! Wir können eigentlich froh sein, dass wir hier die Franziskaner haben! Die denken noch völlig normal über diesen Aberglauben und gehen auch dagegen vor. Dazu hatte ich vor nicht allzu langer Zeit ein gutes Gespräch mit dem Abt des Klosters. Da ging es um die Gerüchteküche an den Fleisch- und Brotbänken, die immer wieder neu angefacht wird, auch die um das sogenannte Orakel von Kralowski haj und der sogenannten Sage vom «Klötzelmönch» in der die Franziskaner Tag für Tag verleumdet werden, weil sie angeblich ein Lotterleben führen. Die übelsten Geschichten machten die Runde. Der Abt wollte das gerne unterbinden und ausmerzen.
Was meinst du, wem das nützt?
Der Stadtpfarrer arbeitete sonntags in seinen Predigten vehement dagegen. Ich werde mich mal, in meiner Eigenschaft als Bürgermeister, an den Ordensmeister der Dominikaner mit einer Beschwerde wenden, aber ob das überhaupt Sinn macht?«
Sie bestiegen ihre Reittiere und ritten eilig zum Markt. Sie wussten aber nicht, was vordem geschah und das einmal dabei ein Wolf eine entscheidende Rolle spielen würde …
… und am Anfang war der Wolf
Der sehr muskulös gebaute, aber doch schon ältere Franziskanermönch, Pater Franziskus, war aus dem Kloster aufgebrochen, um in der Neißeniederung Kräuter zur Heilung eines kranken Bruders zu sammeln. Pater Franziskus war der Heilkundige des Klosters und er kannte die Stellen in der Neißeniederung, wo auch das Arnika an den mageren Hängen der Berge gedieh und wo das Bilsenkraut wuchs. Das Bilsenkraut bevorzugt dagegen frischen Sand- oder Lehmböden. Also musste er ganz schön suchen.
Pater Franziskus brauchte das Bilsenkraut, eigentlich eine Giftpflanze, für die Zubereitung eines Decoctum zur Linderung der Schmerzen seines Bruders. Denn Pater Franziskus wusste, für jedes Leiden ließ der Herrgott ein Kräutlein wachsen, man musste es nur finden und wissen, wie es zuzubereiten und anzuwenden ist. In seiner Klause las er aus diesem Grunde immer wieder die Schriften der Hildegard von Bingen, hauptsächlich aber las er in ihrem Hauptwerk »Causae et curae«, «Ursachen und Behandlung». Ein Born unerschöpflichen Wissens um die Gesundheit ist dieses Werk der Hildegard von Bingen.
Auf seiner Suche nach diesen Kräutern sah er unverhofft am Waldrand ein barfüßiges Mädchen von etwa zehn oder elf Jahren, die schnell versuchte, sich vor ihm im Unterholz zu verbergen. Neugierig ging der Pater auf das Kind zu, sich umblickend, ob er nicht irgendwo deren Eltern oder einen Erwachsenen entdeckte, die sich des Kindes annahmen. Aber da war niemand zu sehen. Als das Mädchen sah, wer vor ihr stand, glomm ein hoffnungsvoller Funke in ihren Augen, die voller Tränen standen. Sie erkannte doch die Mönche aus dem Kloster an ihrem Habit. Oft hatte sie mit der Mutter den Mönchen Kräuter ins Kloster gebracht.
»Wie heißt du denn? Bist du allein hier? Wo sind deine Eltern?«, fragte Pater Franziskus das Kind und beugte sich zu ihm herab.
So viele Fragen auf einmal verkraftete das Mädchen überhaupt nicht.
Es weinte plötzlich herzerweichend.
»Ich heiße Mechthild«, schluchzte es unter Tränen.
»Und ... wo sind deine Eltern?«, fragte der Pater noch einmal.
»Ich habe doch nur noch die Mutter!«, schluchzte die Kleine.
»Und wo ist die Mutter?«, fragte der alte Mönch.
Erneut brach ein Tränenstrom aus den Augen des Kindes.
»Die hat der Forstknecht mitgenommen, weil sie im Wald dort oben Kräuter, Holz und Pilze gesammelt hat und das sei verboten, hat er gesagt und dann hat er sich umgedreht und plötzlich mit seinem Jagdbogen auf meinen Wolf geschossen … und er hat ihn verletzt!«, antwortete das Mädchen schluchzend auf seine Frage. »Dann erst konnte er Mutter mitnehmen.
Mein «Lupus» hätte ihn sonst zerrissen!« »Du hast einen Wolf?«, fragte der Alte verblüfft, »und wo ist der?« Die Kleine stand auf und fasste nun vertrauensvoll nach seiner Hand. »Komm Pater! Ich kenne dich. Du bist doch der Pater Franziskus aus dem Kloster!«, sagte sie vertrauensvoll und führte den Alten einige wenige Schritte in den Wald. Der Alte war erstaunt. Dort, unter einer großen Buche, fand der alte Franziskanermönch tatsächlich einen riesig großen, vor Schmerzen winselnden Wolf.
Als der Wolf das Mädchen sah, stemmte er sich mühsam auf den Vorderläufen hoch und schmiegte sich an das Mädchen, aber in einer Art und Weise, die anzeigte, dass er das Mädchen unter allen Umständen schützen wollte.