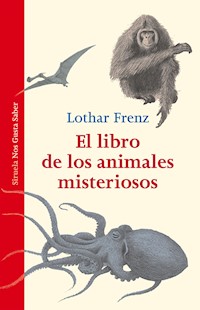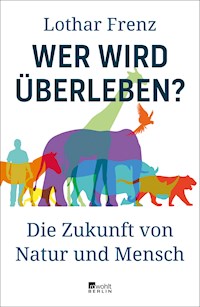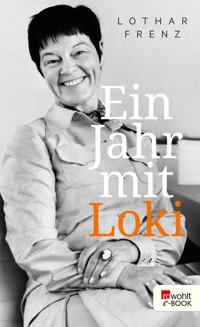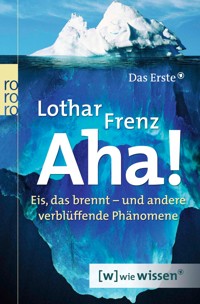
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Weshalb lecken Wissenschaftler an giftigen Fröschen? Warum können wir Menschen nicht älter als hundertzwanzig werden? Was tun eigentlich Seuchenjäger, die nach unbekannten Erregern fahnden? Und was verraten uns Quietscheentchen über unser Klima? Jeden Sonntag nimmt das ARD-Magazin «W wie Wissen» die Zuschauer mit auf Entdeckungsreise und präsentiert Erstaunliches aus der faszinierenden Welt der Wissenschaft. Das Begleitbuch zur beliebten Fernsehsendung entführt uns in die Tiefen der Ozeane, die geheimnisvolle Welt des menschlichen Körpers oder die entlegensten Winkel der Regenwälder. So ist Wissenschaft alles andere als eine trockene Angelegenheit, ein ebenso unterhaltsames wie lehrreiches Lesevergnügen für die ganze Familie. Mit zahlreichen farbigen Abbildungen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Lothar Frenz
Aha!
Eis, das brennt – und andere verblüffende Phänomene
Inhaltsverzeichnis
«Jedes Wissen ist mit anderem Wissen verknüpft»: Einleitung
Erstes Kapitel: Der Mensch
Der Krankheit auf der Spur: Von Mumienhütern und Seuchenjägern
Hydra aus dem Tümpel: Das Geheimnis des ewigen Lebens
Am Anfang waren zwei: Wie der Mensch über die Erde kam
Zweites Kapitel: Das Klima
Das Rügen-Szenario: Eine Reise in die Klimageschichte
Eisbär, Lemurenbeutler & Co: Der Wettlauf gegen die Hitze
Blubber im Boden: Wohin mit dem Sprudelgas?
Drittes Kapitel: Energie
Brennendes Eis aus dem Meer: Segen oder Zeitbombe?
Immer der Sonne nach: Ein heißes Projekt aus der Wüste
Viertes Kapitel Meere und Seen
Das Prinzip Flaschenpost: Auf der Spur der Quietscheentchen
Sushi oder Fischstäbchen: Wir futtern die Ozeane leer
Es war einmal ein See: Verrückte Wasserspiele
Fünftes Kapitel: Regenwald
Zum Fressen gern: Von Schimpansen und Paranüssen
Der Urwald, der gar keiner ist: Kosmos Amazonien
Von Lurchen und Küssen: Die Froschleckerin
Sechstes Kapitel: Tiere
Die Aliens sind da: Die Invasion der anderen Art
Der Baron und die Tigerpferde: Weshalb Zebras keine Haustiere wurden
Spinnenhaar und Ahornflügel: Nie mehr putzen und andere Tricks der Natur
Bildnachweis
Über den Autor
«Jedes Wissen ist mit anderem Wissen verknüpft»: Einleitung
Wieso kann eine Spinne Vorbild für die Badehose der Zukunft sein? Wo gibt es Eis, das brennt? Und weshalb soll das Gas Kohlendioxid möglichst unter die Erde gebracht werden? Am Anfang dieses Buches stehen ungewöhnliche Fragen. Denn jede Wissenschaft beginnt mit Staunen. Und dem folgt der Drang, mehr entdecken, mehr verstehen – mehr wissen zu wollen.
Aber hinter den Fragen stecken auch drängende Zukunftsthemen – und mit denen beschäftigt sich dieses Buch. Wie können wir auf Dauer auf der Erde überleben? Wie können wir nachhaltig wirtschaften, ohne die Meere zu plündern, die Regenwälder abzuholzen? Wie finden wir intelligente Lösungen für die Probleme von heute und morgen? Überall auf der Welt erforschen Wissenschaftler diese Leitfragen der Zukunft – und haben beileibe noch nicht für alle die Antworten gefunden.
Da die Fülle an Wissen, die heutzutage ständig erzeugt wird, wächst und wächst, vertieft dieses Buch nicht nur aktuelle Forschungsprojekte aus sechs großen Themengebieten der Fernsehsendung – und liefert damit mehr Wissen. Es soll auch anregen zu verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt: die ständig wachsende und älter werdende Menschheit, Klima und Energie, große Lebensräume wie Meere und Regenwälder und die Tiere, die mit uns leben.
Es soll zeigen, dass nicht nur Welthandel und Verkehr heutzutage «globalisiert» sind – die Meeresströme, Seuchenzüge, Ernährungs-, Wasser- und Energiefragen sind es auch. Und wenn es so weitergeht, so glauben manche Wissenschaftler, gibt es irgendwann eine vereinheitlichte – eine «mcdonaldisierte» – Tierwelt.
Es soll zeigen, dass nicht nur mit Hilfe moderner Hochtechnologie Zukunftsfragen beantwortet werden und dabei Solarprojekte wie aus Science-Fiction-Visionen entstehen. Noch immer lassen sich durch einfaches Beobachten und dem Benutzen aller menschlichen Sinne wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen: weshalb Forscher etwa an Fröschen lecken.
Es soll zeigen, dass es sich lohnt, auch ungewöhnlichen Herangehensweisen zu trauen und ihnen zu folgen. Etwa indem man sich jahrelang mit Quietscheenten beschäftigt, die eigentlich in die Badewanne gehören; dabei aber wirklich weltumspannenden Strömen und Transportwegen auf die Schliche kommt.
Es soll zeigen, dass eben eines zum anderen führen kann: dass Archäologen, die beim Graben im Regenwald Amazoniens indianische Tonscherben und damit Zeugnisse untergegangener, unbekannter Kulturen entdecken, dabei sogar eine neue Möglichkeit finden, das Klimaproblem anzugehen. Oder dass die Beobachtung wilder Schimpansen zur Entwicklung neuer Medikamente gegen Malaria führen kann.
Es soll zeigen, dass es auf Neugier, Ideen und immer wieder neue Fragen ankommt – und die Lust zu entdecken, wie alles mit allem zusammenhängt. Arthur C.Aufderheide, der «Hüter der Mumien», der fast sein ganzes Leben mit der Präparation menschlicher Leichen verbrachte, liefert so das Motto für dieses Buch: «Jedes Wissen ist mit anderem Wissen verknüpft. Und den größten Spaß macht es, diese Verknüpfung herauszufinden.»
Lothar Frenz
Erstes Kapitel: Der Mensch
«Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan.» So heißt es im Ersten Buch Mose, Vers 28 – und genau so hat es der Homo sapiens, der «verständige Mensch», auf seinem langen Weg zur Eroberung der Welt auch gehalten. Dabei vermehrte er sich nicht nur beharrlich und wurde schließlich zum Herrscher des Planeten – er wurde auch immer älter. Aber diese Erfolgsgeschichte reicht ihm nicht. Der Mensch will ewig bleiben – und sei es konserviert als Mumie. So forschen Wissenschaftler nach den Geheimnissen von Leben und Tod – in jahrtausendealten Leichen, im Urwald oder im Tümpel: Was macht uns krank? Was lässt uns altern? Was lässt uns sterben? Und: Gibt es unsterbliches Leben?
Der Krankheit auf der Spur: Von Mumienhütern und Seuchenjägern
Wie verlassene Puppenkokons, aus denen prächtige Falter geschlüpft sind, liegen die vertrockneten Gebilde in der Schachtel. Der Herr mit der weißen Tolle, den blauen Augen und der dicken Hornbrille, der sie soeben aus schützenden Plastiktüten hervorgeholt hat, ist jedoch weder Schmetterlingssammler noch Insektenforscher, sondern eher die graue Eminenz der Mumienforschung. Aber selbst Arthur C.Aufderheide muss gestehen, dass er die bräunlichen Objekte nicht erkennen würde, wenn er nicht genau wüsste, woher die eingefallenen Teile stammen: Es sind nämlich 19Schrumpelpenisse im Karton.
Ein seltsam strenger Geruch liegt in der Luft, wie nach alten Büchern oder getrocknetem Leder. Oder wie bei den Löwen im Zoo, nur nicht ganz so stechend. Aufderheide macht das jedoch nichts aus, denn mit seiner Nase riecht er von Geburt an nicht besonders gut. Daher, so findet er selbst, sei er geradezu prädestiniert gewesen für seinen Beruf und seine Passion: als Pathologe Leichen aufzuschneiden und zu sammeln.
In seinem Labor in Duluth im amerikanischen Bundesstaat Minnesota hat er die wohl größte Kollektion mumifizierter Körperteile zusammengetragen. In dem ehemaligen Kindergartenraum sind alle Fenster mit Alufolie verhängt, damit weder Sonnenstrahlen noch Zugluft die kostbaren Präparate schädigen. Überall stehen Schränke, Regale oder alte Kühlschränke herum, türmen sich Schachteln und Kartons voller Plastiktüten. Und darin jeweils: ein Stückchen vertrockneter Mensch.
Lebern liegen neben Lungen, Herzen neben Hirnen; fein ordentlich sortiert und katalogisiert, sind dort Muskeln, Haut, Gedärm und Kehlköpfe aufbewahrt oder eine verschrumpelte Zunge, die über und über mit Geschmacksknospen gesprenkelt ist wie mit kleinen Kratern. Die eine Schachtel enthält ein haariges Ohr, die nächste zehn vertrocknete Finger, die sich krümmen wie die Scheren einer Krabbe. Über 7000Körperteile umfasst die Sammlung des Pathologen; darunter echte «Antiquitäten»: etwa Gewebeteile des «Acha-Man» aus der chilenischen Atacama-Wüste, der vor etwa 9000Jahren gestorben ist, eine der ältesten menschlichen Mumien überhaupt.
Nicht nur vertrocknete Leichen werden Mumien genannt. Aufderheide bezeichnet jedes Fragment eines Verstorbenen, das für einen gewissen Zeitraum nach dem Tode nicht verwest und nicht aus Knochen besteht, als Mumie – also auch eingefrorene, ausgetrocknete oder auf andere Weise konservierte Körperteile. «Mir war es nie wichtig, vollständig erhaltene Mumien zu besitzen. Denn es ist verdammt schwer, sie richtig zu konservieren. Auch Museen haben oft Schwierigkeiten damit. Viele Mumien nehmen dort ein trauriges Ende. Nach Jahrtausenden werden sie wegen schlechter Aufbewahrung doch noch von Insekten aufgefressen oder schimmeln vor sich hin.»
Das Geheimnis der Beständigkeit von Mumien besteht darin, möglichst rasch nach dem Tod die Verwesungsprozesse zu stoppen – und das auf Dauer. Wenn ein Lebewesen stirbt, platzen innerhalb von Minuten die Zellen auf und entlassen Enzyme, die das umgebende Gewebe zersetzen. Dann schwärmen Bakterien aus den Eingeweiden ins Gewebe, dringen über die Adern in die Lungen und ins Herz, von dort über die Arterien in den ganzen Körper. Der Leichnam verfärbt sich: zunächst grünlich, dann violett und schließlich ganz dunkel. Gase blähen die Leiche auf. Der Körper beginnt zu verrotten, was mit der völligen Auflösung des Skeletts endet. Dann gehen die Mineralien der Knochen als Ionen aufgelöst ins umgebende Erdreich über. So geschieht es bei einem ungebremsten, vollständigen Verwesungsprozess – es sei denn, der Körper wird mumifiziert.
Das passiert, wenn die Zersetzungsenzyme möglichst vollständig und rasch an ihrer Arbeit gehindert werden – durch Hitze, eisige Kälte oder durch Chemikalien. In Wüsten entstehen daher durch Austrocknung «natürliche» Mumien, denn die Enzyme brauchen Wasser, um zu funktionieren. Die alten Ägypter perfektionierten, was die Natur ihnen vormachte: Um einen Leichnam zu mumifizieren, entfernten sie direkt nach dem Tod eines Menschen die Eingeweide und füllten den Körper mit Salz, um Feuchtigkeit zu entziehen. Auch das Umwickeln der Leiche mit Leinen entzieht dem Körper Wasser. Später balsamierten sie den toten Körper mit Pech, Myrrhe oder anderen harzigen Dichtungsmitteln ein, um die Fäulnis zu stoppen.
So präpariert können einige Menschen als Mumien überdauern. Doch für Aufderheide ist die menschliche «Essenz» schon mit dem Tode verflogen. Seine Sammlung toter Körper ist für ihn kein Monstrositätenkabinett, sondern ein Archiv der Krankheiten. «Jede Mumie birgt ein Stück faszinierender Geschichte – nicht nur ihrer eigenen, sondern meiner und unser aller Geschichte», sagt Aufderheide. «Das ist mein persönlicher Anreiz, mich so intensiv mit ihnen zu befassen. Wissenschaftlich könnte ich es so ausdrücken: Die Mumien bergen einzigartige Informationen.»
Die Tuberkulose etwa ist eine der ausdauerndsten Seuchen überhaupt, die von jeher den Menschen plagt. Sie wurde schon in ägyptischen Mumien nachgewiesen, die fast viereinhalbtausend Jahre alt sind. Lange glaubten Forscher, die Schwindsucht sei erst nach der Entdeckung Amerikas auf die Kontinente der Neuen Welt gelangt. Bis Aufderheide einen mumifizierten chilenischen Frauentorso untersuchte. Grabräuber hatten der LeicheKopf und Hände abgerissen, wahrscheinlich, um leichter an den Schmuck der Verstorbenen zu gelangen. Doch der Rumpf der Frau war weitgehend intakt. «Als ich die Brust öffnete, sah ich sofort die typischen verhärteten Strukturen in der Lunge. Auch die Lymphknoten waren bis auf das Fünffache angeschwollen. Dieses Bild ist ganz typisch für eine ganz bestimmte Krankheit: Ich war mir sicher, dass sie Tuberkulose hatte.»
Kein Goodbye für Lenin: Berühmte Mumien
Der ägyptische Pharao Tutanchamun war etwa 19Jahre alt, als er vor 3300Jahren starb. Seine Mumie ist nur schlecht erhalten, weil sein Entdecker Howard Carter 1922 die prächtige Goldmaske über dem Gesicht des toten Königs mit scharfem Werkzeug abnahm und die Mumie dann in der Sonne liegenließ. Lange dachte man, Tutanchamun sei nach einem Nackenschlag, wahrscheinlich einem heimtückischen Mord, gestorben. Vermutlich erlag er jedoch einer schlimmen Entzündung am linken Bein, vielleicht nach einem Jagdunfall. Als einzige Mumie altägyptischer Könige ruht der junge Pharao wieder in seinem Grab – hinter Plexiglas vor Keimen und der Witterung geschützt.
Die Mumie von Similaun ist besser als «Ötzi» bekannt. Der etwa 40Jahre alte und 1,58Meter große Mann überdauerte 5500Jahre als Eismumie in den Gletschern der Ötztaler Alpen im Grenzgebiet von Österreich und Italien. Bei einer Computertomographie konnte ein großer Bluterguss sichtbar gemacht werden, der von einem Pfeilschuss in die linke Schulter stammt. Wahrscheinlich verblutete Ötzi innerhalb weniger Minuten an der Wunde. Nach einer anderen Theorie starb er nach einer Attacke und einem Schlag auf den Kopf. Klar scheint nur, dass der «Mann vom Hauslabjoch» Opfer eines Steinzeitverbrechens geworden war.
Gefriergetrocknet:
5500Jahre überdauerte der «Mann vom Hauslabjoch» im Eis der Alpen. Besser bekannt ist die Gletschermumie als «Ötzi».
Die Schlinge um den Hals deutet daraufhin, dass auch der Mann von Tollund eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Die guterhaltene Leiche des etwa 40-Jährigen wurde 1950 in einem dänischen Hochmoor entdeckt. Inhaltsstoffe von Torfmoosen konservieren Moorleichen bestens: Gerbsäuren machen die Haut haltbarer. Huminsäuren verhindern die Zersetzung durch Bakterien. Allerdings lösen sich im sauren Wasser eines Moores die kalkhaltigen Knochen meist völlig auf. Der guterhaltene Mageninhalt des um 350 vor Christus gestorbenen Mannes zeigt, dass er als letzte Mahlzeit eine Art Grütze aus Pflanzensamen aß, bevor er erhängt oder erwürgt wurde.
Die wohl berühmteste Mumie der Neuzeit wird noch immer in Moskau auf dem Roten Platz ausgestellt. Direkt nach Lenins Tod gab Stalin die Anweisung, die Leiche des Revolutionärs einzubalsamieren und alle Körperteile mit konservierenden Stoffen zu durchtränken. Seine Oberfläche soll regelmäßig mit einer geheimen Tinktur behandelt worden sein, sodass die Haut eine natürliche Farbe behielt und mehr oder weniger elastisch blieb. Doch existieren Gerüchte, dass zumindest einige Körperteile durch Kunststoffimitate ersetzt worden sind. Die Pflege der Lenin-Mumie in ihrem Mausoleum am Roten Platz soll noch immer 1,5Millionen Dollar im Jahr kosten. Dabei hatte sich der Arbeiterführer zu Lebzeiten einen Totenkult um die eigene Person verbeten.
Die kleine Rosalia Lombardo gilt als schönste Mumie der Welt. Im Jahr 1920 ist das Mädchen, noch nicht einmal drei Jahre alt, eines der letzten Opfer der Spanischen Grippe geworden. Weil ihr Vater, ein sizilianischer General, sie so sehr liebte, bat er Mönche in Palermo, Rosalia in ihre Gruft aufzunehmen, in deren Mikroklima Leichen besonders gut erhalten bleiben. Außerdem nahm er die Dienste eines bekannten Einbalsamierers in Anspruch, um den Körper des Kindes vor dem Verfall zu bewahren. Mit Erfolg: Selbst kleinste Härchen sind auf der pfrsichfarbenen Haut noch zu erkennen. Beinahe makellos liegt Rosalia bis heute in ihrem Glassarg, als sei sie eben erst eingeschlafen.
Wie eine Spielzeugpuppe liegt Rosalia Lombardo im Sarg. Sie war 1920 eines der letzten Opfer der Spanischen Grippe und gilt heute als «schönste Mumie der Welt».
Genetische Untersuchungen bestätigten Aufderheides Diagnose: Im Lungengewebe konnte Erbgut des Tuberkuloseerregers nachgewiesen werden. Die Chilenin aber war schon seit etwa tausend Jahren tot – lange bevor Kolumbus Amerika «entdeckte». Somit hatte der Pathologe nachgewiesen, dass die Schwindsucht schon vor den ersten Europäern in Amerika war. Ein «Freispruch» ersten Ranges für den großen Entdecker: Zumindest die Tuberkulose hat nicht durch ihn den Weg in die Neue Welt gefunden.
Längst sind nicht alle Geheimnisse im Mumien-Magazin des Forschers gelüftet – wer weiß, wie viele Spuren uralter Krankheitserreger sie noch enthalten? «Es gibt so viele Krankheiten zu entdecken. Wir haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt.» Sein Archiv könnte dabei helfen aufzuklären, unter welchen Bedingungen in der Menschheitsgeschichte neue Erreger entstanden und wie sie sich verbreiteten.
Aufderheides Mumienschau in die Vergangenheit behandelt so auf eigene Weise höchst aktuelle Themen und Probleme: Wann ist welche Infektion erstmals wo aufgetreten? Waren es vor Jahrhunderten Cholera und Pest, Pocken, Typhus und Tuberkulose, die den Menschen quälten, die Bevölkerung ganzer Landstriche auslöschten, Völkerwanderungen auslösten und Kriege entschieden, so machen heute neuartige ansteckende Krankheiten horrorhafte Schlagzeilen: Aids und Ebola, Lassa, Hanta, Marburg und SARS, dazu die Vogel- und die Schweinegrippe. Ständig erscheinen neue Erreger und wecken uralte Ängste.
Obwohl so viele Arzneimittel und Impfstoffe wie nie zuvor in der Geschichte des Menschen zur Verfügung stehen, ist die Gefahr einer weltweiten Seuche, einer Pandemie, groß. Vor Jahrhunderten kamen neuartige Krankheitskeime noch über Land oder über See und brauchten dabei lange von einem Kontinent zum anderen. Heute jedoch reist ein Erreger, der in einem der entlegensten Winkel der Erde entsteht, mit dem Flugzeug innerhalb von zwei Tagen um den ganzen Globus – und kann dabei Menschen auf allen Kontinenten infizieren.
Eines der ersten schlimmen Beispiele dieser «neuartigen», «globalisierten» Pandemien war die «Spanische Grippe», die nach 1918 in drei Wellen um die Welt ging. Sie heißt so, weil in Spanien Ende Mai 1918 erstmals ausführlich über die Seuche berichtet wurde; zwar wütete die Krankheit zu diesem Zeitpunkt auch anderswo, doch im Gegensatz zu den Nationen, die in den Ersten Weltkrieg verstrickt waren, hielt das neutrale Spanien die Nachricht vom Ausbruch der hochansteckenden Grippe nicht zurück.
Dabei verlief die Krankheit zunächst noch recht mild. Nach einem halben Jahr aber brach sie erneut aus – und nun endete sie oft tödlich. Im September 1918 erreichte die Spanische Grippe die USA – und bald starben dort 20000Menschen pro Woche nach der Infektion mit dem Virus. Nach einem weiteren Jahr hatte die Grippe auf der ganzen Welt schon mehr als 50Millionen Menschen getötet – fünfmal mehr, als im gesamten Ersten Weltkrieg starben. Nach anderen Schätzungen forderte sie sogar 70Millionen Todesopfer. Bis zu zwei Drittel der damaligen Weltbevölkerung hatten sich in dieser Zeitspanne mit dem Grippevirus infiziert und waren erkrankt.
Zu einem so katastrophalen Seuchenzug kann es kommen, wenn ein völlig neues Virus entsteht, das dem menschlichen Immunsystem unbekannt ist und daher seiner Abwehr entgeht. Immer wieder springen gerade Grippeviren, auch Influenza-Erreger genannt, zwischen verschiedenen Arten hin und her – vor allem zwischen Geflügel, Schweinen und dem Menschen; so wurde auch die Spanische Grippe 1918 vermutlich von Vögeln auf den Menschen übertragen. Erstaunlicherweise fielen damals besonders junge Erwachsene zwischen 20 und 35Jahren der Spanischen Grippe zum Opfer– Menschen in den besten Jahren also, die normalerweise ein gut funktionierendes Immunsystem besitzen. Wahrscheinlich war diese Influenza-Pandemie so viel verheerender als «herkömmliche» Grippen, weil sie nicht nur den normalen Krankheitsverlauf hervorrief. Die Spanische Grippe regte das Immunsystem so stark an, dass es Fieber im Übermaß auslöste; gerade bei jungen Menschen mit besonders intakter Abwehr war die Reaktion oft so heftig, dass sie an den Fieberschüben starben.
Pandemie– Epidemie– Endemie
Ein zeitlich und räumlich begrenzter, aber stark gehäufter Ausbruch einer Infektionskrankheit – etwa bei vielen Tropenkrankheiten wie Denguefieber, aber auch bei Typhus oder Cholera – heißt in der Sprache der Seuchenforscher Epidemie. Bei Seuchen, die andauernd nur in bestimmten Regionen grassieren, wie etwa Lepra oder Malaria, spricht man von einer Endemie. Die Spanische Grippe von 1918 ist dagegen eines der bekanntesten Beispiele für eine Pandemie – einer weltweit verlaufenden Seuche, die sich über viele Länder und Kontinente hinweg verbreitet. Auch Aids zählt zu den Pandemien.
Außerdem hatte der Erste Weltkrieg den Weg für die Spanische Grippe bereitet: Soldaten lebten auf engem Raum in unhygienischen Verhältnissen und wurden zu Zehntausenden um die ganze Welt verschifft. Viele Menschen waren geschwächt und damit besonders anfällig für den aggressiven Erreger, der durch «Tröpfcheninfektion» übertragen wird – also schon durch winzige, keimhaltige Sekretteilchen, wie sie beim Sprechen, Niesen oder Husten aus den Atemwegen in die Luft geraten. Gelangen die auf Schleimhäute eines neuen Wirtes, können sie auch diesen infizieren. So forderte die Spanische Grippe in kurzer Zeit mehr Opfer als jede andere Krankheit vorher oder nachher – auch mehr als HIV, der Erreger von Aids, das zweite Beispiel für eine «neue» weltumspannende Seuche.
Erstmals sorgte Aids zu Beginn der 1980er Jahre für Aufsehen, als in San Francisco und New York immer mehr Menschen an einer seltenen Form von Lungenentzündung und einem seltenen Krebs, dem Kaposisarkom, starben. Heute weiß man, dass beide Krankheitsbilder auf eine bis dahin unbekannte Immunschwäche zurückgehen, das zugehörige Krankheitsbild wurde Aids genannt («acquired immune deficieny syndrome»); sein Erreger wurde schon 1983 identifiziert – das «Humane Immundefizienz-Virus». (HIV). Im Gegensatz zur Spanischen Grippe mit ihrem raschen Krankheitsausbruch verläuft eine Infektion mit HIV viel langsamer. Oft merken die Infizierten erst nach Jahren, dass sie sich angesteckt haben. Weil zur Infektion Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden müssen – etwa beim Sexualverkehr, durch Bluttransfusionen oder den gemeinsamen Gebrauch von Nadeln–, breitet sich HIV auch viel langsamer aus als etwa die Spanische Grippe, bei der ein Hustenhauch genügen konnte, um krank zu werden. Dennoch sind bis heute etwa 25Millionen Menschen an HIV gestorben und etwa weitere 40Millionen Menschen infiziert – und ein Ende ist nicht abzusehen. Denn im Gegensatz zur Grippe ist Aids noch immer nicht heilbar, auch gibt es bislang keinen Impfstoff, der zuverlässig vor dem Erreger schützt.
HIV ist deshalb so erfolgreich, weil es die zentralen Schaltstellen des Immunsystems befällt und schließlich ausschaltet, die sogenannten CD4-T-Helferzellen. Früher oder später bricht daher irgendwann das Immunsystem zusammen, weil die «Helfer», die fast die gesamte Abwehrreaktion koordinieren, mehr und mehr ausfallen. Außerdem ist das HI-Virus extrem wandlungsfähig: Es ändert dauernd sein Erscheinungsbild im befallenen Organismus, sodass es immer wieder aufs Neue einer gerade beginnenden Immunantwort entgeht. Seine hohe Mutationsrate ist auch ein Grund dafür, weshalb sich gegen die Medikamente, die seine Vermehrung einschränken können, regelmäßig neue Resistenzen entwickeln. Selbst bei wirksamer Therapie verschwindet HIV nie völlig aus dem Körper des Patienten, denn die Erbinformation des Virus kann in das Erbgut des Wirts eingebaut werden – und schlummert dort als «Provirus», das irgendwann wieder ausbrechen kann.
Wo aber kam HIV Anfang der 1980er Jahre so plötzlich her? Auch dieses Virus ist irgendwann – wie der Erreger der Spanischen Grippe – von einer anderen Spezies auf den Menschen übergesprungen, in diesem Falle von einem unserer nächsten Verwandten, dem Schimpansen in den tropischen Wäldern Afrikas.
Dort, in den Urwäldern, lauern immer wieder neue, noch unbekannte Killer wie aus einem Horrorfilm. So jedenfalls hörten sich die Nachrichten an, die 1976 aus der Demokratischen Republik Kongo kamen: In einer Missionsstation am Fluss Ebola, die von belgischen Nonnen betrieben wird, rafft eine bislang unbekannte Krankheit Hunderte von Menschen dahin. Nach einer Inkubationszeit von drei bis 21Tagen entwickeln die Infizierten hohes Fieber, dann sickert Blut in die Leibeshöhle und später aus allen Körperöffnungen. Bis nach wenigen Tagen voller Krämpfe alle Organe versagen. 280 der 318Infizierten sterben.
Wie sich später zeigt, hatte ein Einheimischer, der den todbringenden Erreger trug, in der Mission eine Spritze gegen Malaria bekommen. Doch weil die Kanülen in der Station nicht desinfiziert, sondern nur mit Wasser ausgewaschen werden, verteilen die Nonnen den Erreger der neuen Krankheit auf viele Patienten und infizieren sich bei der Pflege der Todkranken selbst. Noch im gleichen Jahr wird aus dem Gewebe einer der verstorbenen Nonnen der Erreger identifiziert: ein Virus, der nach dem Ort «Ebola» genannt wird.
Seither flackerten in mehreren Regionen Afrikas immer wieder solche Epidemien auf. Doch zum Glück konnten sie sich bislang nicht weiter ausbreiten: So tödlich das Ebola-Virus auch ist, es ist genau sein «Killerinstinkt», der verhindert, dass Ebola um die Welt zieht. Denn ein Krankheitserreger, der seinen Wirt allzu schnell umbringt, rottet sich auf Dauer selbst aus. Schließlich braucht er sein «Opfer», um sich zu vermehren. Ebola ist daher – im Gegensatz zu HIV und zum großen Glück für den Homo sapiens – anscheinend ausgesprochen schlecht an den Menschen angepasst.
Dennoch: Auch ein einziger mit Ebola infizierter Mensch könnte einen katastrophalen Seuchenausbruch auslösen. Denn die Krankheit verbreitet sich auch per Tröpfcheninfektion, ein Niesen oder ein Händedruck genügen zur Ansteckung. Ein Ebola-Reisender in einer Großstadt wie Kinshasa oder Nairobi, Frankfurt oder New York könnte zu einer Epidemie mit Zehntausenden von Toten innerhalb weniger Tage führen.
Auch wenn die moderne Welt glaubt, mit unserer westlichen Hygiene sei die Jahrmillionen dauernde Weltherrschaft der Mikroben vorbei – so wiegt uns das gerade im Zeitalter der Globalisierung in falscher Sicherheit. Denn noch niemals lebten so viele Menschen so dicht beieinander wie heute, oft in Slums unter schlimmen hygienischen Verhältnissen, oft eng mit Tieren zusammen, was das Überspringen der Artgrenzen begünstigt. Noch niemals gab es so viele Menschen auf der Erde – und sie dringen immer tiefer in die verbliebenen Urwälder vor, wo noch immer bislang unbekannte Killerviren hausen mögen.
Welt in Zahlen: SARS – der Verlauf einer Epidemie
Im November 2002 erkrankt ein Mann in der chinesischen Provinz Guandong an hohem Fieber und Lungenentzündung; die Ursache ist unbekannt. Er infziert vier Menschen. Im Dezember 2002 zeigt ein Koch in Shenzhen unabhängig davon ähnliche Symptome und steckt acht weitere Menschen an, die alle erkranken. Bis Ende Januar 2003 steigt die Zahl ähnlicher Fälle in China drastisch an; die Weltöffentlichkeit wird aufmerksam. In einer Klinik in Guandong hat zu diesem Zeitpunkt ein Fischer in den drei Wochen nach seiner Einlieferung in eine Klinik schon fast 70Verwandte und medizinisches Personal infziert, darunter einen Arzt, der vorübergehend erkrankt, dann nach Hongkong zu einer Hochzeit fliegt, einen Rückfall erleidet und dort schließlich stirbt. Doch eine Nacht im neunten Stock des Hotels genügen, um mindestens 17 weitere Personen zu infzieren – vielleicht nur, weil sie denselben Knopf im Fahrstuhl drücken. Dort fängt sich wohl auch ein junger Mann den Erreger ein; ins Krankenhaus eingeliefert, infziert er 143Patienten, darunter einen Dialyse-Patienten, der nach der Blutwäsche zurück in seine Siedlung mit 19000Einwohnern fährt. Nach einer Nacht hat er dort 213Anwohner angesteckt – wahrscheinlich erreicht der infektiöse Keim seine Opfer über die Toilettenanlage. Ein Kaufmann aus New York, der in dem Hotel logiert hat, fliegt unterdessen von Hongkong aus nach Hanoi und infziert in Vietnam 63Menschen. Eine Frau bringt den Erreger im Flugzeug nach Singapur und steckt dort die ersten 195Personen an; mit einer Kanadierin wechselt er erstmals auf den amerikanischen Kontinent, wo er in Toronto 136Menschen infziert.
So wird das Viersternehotel in Hongkong zum Ausgangspunkt für die Reise des noch unbekannten Partikels um die Welt. Um es kurz zu machen: Der Erreger der Krankheit, die bald nur noch SARS heißt, wird Ende März 2003 als bislang unbekanntes Corona-Virus identifziert. Am 23.April überschreitet die Zahl der SARS-Kranken weltweit die 4000er-Marke, fünf Tage später sind es schon 5000, am 2.Mai 6000, am 7.Mai 8000Fälle. Täglich kommen rund 200Fälle dazu – dann ebbt die Epidemie plötzlich ab. Vereinzelte Fälle von SARS gibt es noch bis Anfang 2004.
Insgesamt wurden mehr als 8000Menschen angesteckt, von denen 750 das Fieber nicht überlebten. Vorübergehend legte SARS Teile der Weltwirtschaft lahm, nicht zuletzt dank der panikhaften Berichterstattung durch manche Medien. Asien meldete Verluste von 25Milliarden US-Dollar; der internationale Flugverkehr hatte 6Milliarden Dollar Einbußen, allein die deutsche Lufthansa 1,5Milliarden Dollar. Was passiert wäre, wenn es dem SARS-Virus gelungen wäre, sich auf Dauer in der menschlichen Bevölkerung zu etablieren, ist gar nicht abzuschätzen. Doch die Krankheit tauchte auf wie ein Meteor, der glühte und bald darauf wieder verschwand. Für immer?
Beim leisesten Anzeichen einer unbekannten, infektiösen Krankheit schwärmen daher Seuchenjäger aus, um den Erreger zu identifizieren und herauszufinden, wer sein natürlicher Wirt ist. In den Hochsicherheitslabors der Welt versuchen sie, so rasch wie möglich Diagnosemöglichkeiten zu finden – und am besten gleich einen Impfstoff, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Als etwa im April 2009 erstmals ein neuer Typ des Schweinegrippevirus entdeckt wurde, der auch dem Menschen gefährlich wird, waren im Berliner Robert-Koch-Institut rasch 150Spezialisten nur mit dem neuen Influenza-Erreger beschäftigt: Sie erfassen alle Verdachts- und Krankheitsfälle, erarbeiten Notfallpläne und entwickeln Schnelltests, um bei einem Kranken möglichst rasch herauszufinden, ob er mit dem neuen Virus angesteckt ist. Vor allem die Entwicklung eines Impfstoffs steht im Vordergrund der Bemühungen. Die «Seuchenjäger» arbeiten weltweit zusammen. Sie sehen sich selber als Frühwarner, die im besten Fall Gesundheitsrisiken «schon am Horizont erkennen», bevor sie der Bevölkerung gefährlich werden können. Die Spanische Grippe von 1918 bleibt ein warnendes Beispiel. Doch wann immer ein neuer Erreger auftaucht und Schlagzeilen macht – es ist eine Gratwanderung zwischen Warnung und Entwarnung. Wie will man erkennen, wann, ob und wo sich Ebola, Lassa, SARS oder die Schweinegrippe wirklich zu einer Pandemie ausweiten können?
Daher schickte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits 1976Expeditionen aus, um nach dem Ausgangspunkt der Ebola-Seuche zu fahnden: Von welchem Tier stammte das Virus? Doch zunächst kehrten die Seuchenjäger unverrichteter Dinge zurück. Sie hatten die Infektionsquelle, das natürliche Reservoir des Virus, nicht finden können. Zwar erkannte man irgendwann, dass auch Menschenaffen wie Gorillas und Schimpansen an dem heimtückischen Virus verenden. Doch erst im Jahr 2005 identifizierten Wissenschaftler drei Arten von Fledermäusen als natürlichen Wirt von Ebola; das Virus befällt die Flattertiere, ohne sie zu töten.